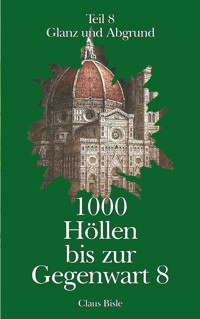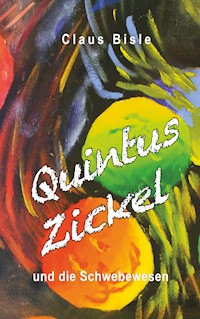Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: 1000 Höllen bis zur Gegenwart
- Sprache: Deutsch
Nach unzähligen Abenteuern steht Manuel Jebich kurz davor, die Gegenwart, aus der er gerissen worden war, zu erreichen. 1,5 Mio. Jahre Menschheitsgeschichte hat er durchwandert. Kurz vor seinem Ziel erwarten ihn weitere energiegeladene Erlebnisse. Würde er in seine Heimat zurückfinden? Wenn ja, wie sollte er nach dem, was er erfahren musste, in der Gegenwart umgehen? Überraschende Momente stellen sich ein. Mit "1000 Höllen bis zur Gegenwart" gelang Claus Bisle nicht nur die Darstellung eines neuen ausgewogenen Geschichtsbildes, sondern ebenso ein umfassender abenteuerlicher und fantasievoller Roman, der mit beinahe 4200 Seiten und knapp 1 Million Wörter der längste im deutschsprachigen Raum ist. Mit seiner raffinierten Erzähltechnik ist ihm die Verknüpfung von historischer Korrektheit und fantastischen Bildern gelungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 503
Veröffentlichungsjahr: 2026
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALTSVERZEICHNIS
Schachbrettblume (1865 n. Chr.)
Hiobsträne (1914 n. Chr.)
Salzmiere (1930 n. Chr.)
Satansröhrling (1940 n. Chr.)
Hauswurz (2014 n. Chr.)
Rosenkranzperlenstrauch (2025 n. Chr.)
SCHACHBRETTBLUME
(1865 N. CHR.)
Wir hätten uns die Lichter sparen können. Mit dem Verlassen der Mauern traten wir in strahlenden Sonnenschein.
„Ein Zeitsprung?“ Ich sprach aus, was mir schwante.
„Wahnsinn!“, rief Silve. „Wir hörten Amnara über tausende Meilen hinweg und durch Jahrzehnte hindurch!“
Mir hatte es die Sprache verschlagen. Amnara stand unmittelbar vor uns. In ihrem Rücken ver-kehrten Segelkähne auf einem mächtigen Strom, der wiederum von Palastanlagen gesäumt war. Türme streckten sich mit umsäumenden Aussichtsplattformen weit in die Höhe, Dächer bogen sich im orientalischen Stil. Palmen, blühender Jasmin, ein Zug von Händlern streifte hoch auf Elefanten sitzend an uns vorbei.
„Es hat funktioniert!“, schrie das Mädchen enthusiastisch auf.
Die Kinder flogen sich in die Arme. Dass zwischen beiden eine Liebe entflammt war, vermutete ich längst, diese Begrüßung stellte es klar. Derar-tige Küsse ließen mich zur Nebenrolle werden. Voll innerer Freude akzeptierte ich mein Los.
Schnell wurde offenbar, dass im Glücksgefühl des Mädchens, eine Bitternis lag, die sie nicht lange zurückhalten konnte.
„Silve, Manuel“, es war ein schmerzgetränkter Hilferuf, der ihr entkam. Sie sah uns eindringlich an. „Ning …“
Als ich seinen Namen hörte, war mir klar, dass mit dem guten alten Freund etwas geschehen sein musste.
„Ning will euch nochmals sehen.“ Amnaras Tränenstrom ertränkte jede weitere Silbe.
„Wo ist er?“, kürzte ich ihre Not ab.
Mit eiligem Schritt folgten wir ihr in einen Palast. Inder in edlen Gewändern, Kolonisten, mit Si-cherheit Engländer - niemand stellte sich uns entgegen.
Auf einem komfortablen Bett lag er. Matt, das Gesicht eingefallen, schaute er uns entgegen. Ein friedliches Nicken verdeutlichte uns den Ernst der Erkrankung.
„Letzte Nacht hat er sehr unruhig geschlafen und rief ständig nach euch“, erklärte Amnara. „Ich wusste mir nicht anders zu helfen, als den Mond anzurufen.“
„Den Mond?“ Silve und ich schauten uns fragend an.
„Ihr Flehen hat auch mich erreicht.“ Semla erhob sich aus einer Nische. „Es muss eine immense Macht geben, die dazu im Stande war.“
Über Nings Gesicht glitt ein friedlicher Zug. Wir drückten ihm die Hände. Worte waren überflüssig.
„Meinst du, er schafft es?“, fragte Silve mich am Abend betrübt.
„Offen gesagt, bin ich glücklich, ihn nochmals zu sehen. Beim letzten Mal hatte ich schon das Gefühl, dass es kein Wiedersehen gebe. Insofern ist es heute ein beseelter Tag. Er machte damals den Eindruck auf mich, dass er gehen wollte, Abschied nehmen, du verstehst? Mit Amnara und Semla hat Ning herausragende Heilkundige an seiner Seite. Sie werden ihm die Stunde leicht machen. Deine Schwester Atid wird es hart treffen. Er war ihr an-fangs mehr Vater als ich. Was hatte ich Freude mit ihm und was verdanke ich ihm alles. Über 2000Jahre stand er mir regelmäßig zur Seite. Ohne ihn – es ist nicht vorstellbar.“
„Meine Kontakte zu ihm waren wenige, Vater, trotzdem kann ich es nachfühlen.“
Amnara erzählte zu später Stunde, wie sie auf Ning aufmerksam gemacht wurde. Sie verdankte die Kunde Akabakar. Das treue Dromedar hatte sie aufgespürt und über hunderte von Meilen ans Ziel gebracht.
„Akabakar? Ist er da?“
Sie lächelte und zeigte nach draußen. Ich eilte durch die Tür.
Einer Schusswunde hatte Ning sein endgültiges Leid zuzuschreiben. Sie schien geheilt. Lange quälte sich der Freund mit Krücken vorwärts, gewann Achtung unter der indischen Bevölkerung, nicht weniger bei den englischen Besatzern – bis eine Entzündung auftrat, die kein Arzt verstand einzudämmen. Der Palast, in dem er sich aufhielt, war zu seiner Heimat geworden. Die Verletzung, so wurde uns bestätigt, trug sich vor sieben Jahren zu.
Sonderbarerweise verunsicherte mich bei der Gegebenheit ein Nebenaspekt. Soweit ich zurück-blicken konnte, verlor ich teure Freunde stets durch eine direkte Einflussnahme der Dämonen. Nun mochte es dem Zufall zuzuschreiben sein, dass unseren Ning ein Geschoss traf. Womöglich war ein solches Vorkommnis längst überfällig. Eine Ahnung, dass es sich doch anders verhalten könne, vermochte ich nicht wegzudrücken.
Dass es Ning besser ginge, beruhigte mich nicht. Amnara und Semla waren geteilter Meinung. An diesem Morgen wachte er mit einem Scherz auf den Lippen auf, der zwar kaum verstanden, doch als solcher gedeutet wurde. Mein Name fiel und so rannte ich eilig an seine Seite.
„Sag ihr nichts.“ Das war es, was ich verstand.
„Wem? Atid?“, frage ich nach.
„Wenn sie alt ist. Rostig. Dann ja.“
„So werde ich es machen.“ Ich drückte ihm die Hand, wobei deutlich wurde, dass er sein Ende sah.
Mit Menschen zu reden, die den Tod vor Augen sehen, tat ich mich stets schwer. Nie wurde es mir zur Selbstverständlichkeit. In mir trafen stets Hoffnung und Nicht-wahrhaben-wollen aufeinander. Dann wiederum saß ich wiederholt neben Betroffenen, die bereits in einem Zustand fern des Irdischen waren und ein übersinnliches Glück ausstrahlten. Ning sah ich noch längst nicht in dieser Phase. Erfreulicherweise stabilisierte sich seine Verfassung bei dem Gespräch, das sich ergab.
„Atid. Sie darf nicht leiden“, bekräftigte er.
„Ning, bitte.“
„Die Sepoys, du kennst die Sepoys?“
„Du wirst es mir erklären.“
„Das wird er nicht.“ Semla bremste die Unterhaltung und das hatte wohl seinen guten Grund.
Als ich sie erstaunt ansah, gab sie mir ein Zeichen. Das, was Ning loswerden wollte, war unerheblich und es hätte ihn über Gebühr angestrengt.
„Ihr habt doch so viel Wundervolles erlebt“, lenkte sie das Gespräch auf Gegebenheiten, die nicht ausformuliert werden mussten: das chinesische Haus, das plötzlich umgebaut war, die Tage, in denen er Atid groß zog und vieles mehr. Wie lächelte er, als ich die verkorkste Papstwahl erwähnte, die wir gemeinsam durchgestanden hatten.
Er schlief während der Worte ein.
Später wandte ich mich an Semla. „Was wollte er mir erzählen?“
„Über Indien und was sich dort gerade abspielt. Er kennt es nicht anders. Immer, wenn ihr euch getroffen habt, wurden zwischen euch aktuelleEreignisse aufgearbeitet. Die Zeit ist abgelaufen, er muss es sich nicht mehr antun. Außerdem hat er mir alles aufgetischt. Nicht nur einmal, zweimal.“
„War was Entscheidendes dabei?“
„Wie man´s nimmt. Manchmal denke ich, alles ist belanglos. Mir liegt allein daran, dass du überlebst. Dann weiß ich, dass es Geschehnisse gibt, die du kennen musst, eben um zu bestehen.“
„Und wie ist es hier?“
„Entscheide selbst. Ning sprach von einer geringen Anzahl von Engländern, die sich in Indien befänden, und dass sie sich Inder zu Soldaten ausbilden müssten, falls sie über das Land zu herrschen beabsichtigten. Sepoys werden solche Rekruten genannt.“
„Die Briten tun somit genau das, was er anführte?“
„Genau. Und ich darf ergänzen, es sind viele Soldaten, die herangezogen werden. Sie werden von der East India Company befehligt.“
„Ist das nicht eine Handelsgesellschaft, die Waren einkauft und über die Welt vertreibt?“
„Anfangs war sie das. Aber aus dieser Gesellschaft rekrutierten sich die Herren, die über Indien verfügen und die Moguls wie ein Puppentheater tanzen lassen. Um das unüberschaubare Indien zu bezwingen, braucht man ein Heer. Die East India hatte ein eigenes, aber, wie gesagt, es war ein erbärmlicher Haufen im Vergleich zu der Bevölkerungszahl. So wurde das Volk Indiens in Waffenkostüme gesteckt. Über 200.000. Es dürfte die mächtigste Armee der Welt sein. Ning hatte einen Hintergedanken, als er das Thema aufgriff, und daher will ich alles in seinem Sinn weitergeben.“
„Jetzt hast du mich neugierig gemacht“, sagte ich.
„Es hängt mit seiner Verwundung zusammen. Hör zu, es gibt dazu eine Vorgeschichte. Sie zu erläutern, hätte ihn über die Maßen angestrengt.“
„Ich bin ganz Ohr.“
„Womöglich war es Unfug oder dummes Gerede. Die Munition der Briten wurde angeprangert. Zunächst hieß es, das Papier, das das Pulver schützte, sei mit Bienenwachs eingefettet, bald darauf wurde von einem Fett gesprochen, das Kühen und Schweinen abkommt.“
„Rindertalg?“
„Genau. Befleckt durch diese Unreinheit, fürchteten viele Sepoys um ihre Stellung nach dem Tod. Wie ein Lauffeuer stieß die Nachricht durch die Kasten und wühlte die Herzen der Inder auf.“
„Du willst sagen, es gab Aufstände?“
„Ja, ihre Angst zwang sie dazu. Die East India konterte zunächst mit dramatischen Strafen. Zehn Jahre Zwangsarbeit für jeden Meuterer. Das fachte das Feuer umso mehr an und im Nu entflammte ein Glaubenskrieg. Moslems und Hindus griffen gemeinsam zu den Waffen und sahen nur einen Gegner.“
„Die Engländer.“
„Genau. Eine Rebellion braucht einen Kopf, der fehlte zunächst. Blindlings wurde überfallen und gemordet. Dann aber kam ein alter Mogul ins Gespräch, zudem der mächtigste unter ihnen. Bahadur Shah Zafar II. zählte achtzig Jahre und residierte in Delphi. Die Aufständischen drangen in seinen Palast und gewannen ihn für sich. Es waren dramatische Tage. Die East India Company bot alles auf, und beorderte ein ganzes Regiment in die Stadt, um die Rebellion zu ersticken. Das Gegenteil passierte, die Unruhestifter verschanzten sich und zielten allein auf Europäer, nicht auf die Sepoys, die den Briten treu geblieben waren. Das entging den Sepoys im Regiment nicht. Als sie das Feuer erwidern sollten, blieb es still. Sie schossen nicht auf ihre Brüder. Von dem Augenblick an war alles außer Rand und Band. Kein Gesetz zählte mehr. Du kennst das Morden und Plündern. Angeblich wurden gar Menschen gekocht und Kinder gekreuzigt.“
„Und England?“
„Darf ich zu Nings Worten greifen? ,Früher hätte man das sehen können, aber seitdem die Erde eine Kugel ist, tut man sich schwer, wenn man auf der Rückseite seinen Tee trinkt‵. “
„Sehr plastisch gedacht.“ Ich musste schmunzeln. „Aber ewig konnte der Sturm im Heimatland nicht verborgen bleiben.“
„Ewig nicht, aber lange genug. Nur allmählich erreichten die Botschaften Königin Victoria. Die East India zog in der Not alles an Hilfen zusammen, was man aufbringen konnte, Gurkhas aus dem Süden, aus Nepal und Sikhs aus Punjab. Mit brutalster Gewalt wurde man Stück für Stück Herr über die Stadt Delhi, soweit der Begriff Stadt real ist. Es war ein Trümmerfeld. Nachdem die Engländer übermächtig wurden, fanden die Exzesse durch sie statt. Ning berichtete davon voller Entsetzen und angewidert. Hast du schon einen Körper gesehen, der vor ein Kanonenrohr gebunden wurde und dann…“
„Erspare mir das Bild. Komm auf Ning zu sprechen, bitte.“
„Er erzählte von einer verirrten Kugel. Er wollte das Haus wechseln, da das seinige brannte. Da er äußerst schwach war, bot er ein leichtes Ziel. Freunde haben ihn von der Straße gezogen und gepflegt. Wacker kämpfte er um seine Gesundheit und bald trat eine Besserung ein. Aber warte, die Erzählung ist noch nicht zu Ende. Queen Victoria war außer sich, als das alles zu ihren Ohren kam. Nachdem die East India ohnehin in Trümmern lag, entzog sie ihr die Gewalt. Sie selbst ist jetzt die Regentin Indiens, wobei das so nicht stimmt, Indien ist ein Teil Britanniens.“
„Was ist aus dem Mogul geworden?“
„Der wurde bezwungen, verhaftet und aus der Stadt gebracht. Er starb bald darauf, wie gesagt, er war ohnehin betagt. Ob sich viel zum Guten wenden wird, ist offen. Charles Cunning, der letzteGeneralgouverneur aus der Zeit der East India, führt das Zepter über das Land.“
„So walten die gleichen Gesichter mit anderen Minen.“
„Das hast du treffend gesagt.“
Erfreulich war der Gesundheitsverlauf unseres Freundes. Mir war, als zöge er sich mithilfe seines unsterblichen Humors an den eigenen Haaren aus dem Verderben. Die folgenden Tage führten zu einer weiteren Genesung.
Ein anderer Umstand spielte sich in den Vordergrund. Silve und Amnara hatten untrennbar zueinandergefunden und entschieden, das ewige Band zu schnüren. Bedenken ließ ich fallen. Die zwei waren sich nur wenige Male begegnet und sich im Grunde fremd. Doch, lebten wir nicht alle in einer Ausnahmesituation? Glückliche Augenblicke waren rar. Nie und nimmer führten die Kinder ein normales Leben und daher standen ihnen Freiheiten und mutige Entschlüsse zu.
Die beiden organisierten ein zauberhaftes Fest. Hoch auf einem geschmückten Elefanten ritten sie zu einem See, an dessen Ufer ein Festmahl vorbereitet worden war. Ladies und Gentlemen der ehrenwerten englischen Gesellschaft, die in diesem Kontinent weit mehr glänzte als in Old England, ließen es uns an nichts ermangeln.
Dunkle Wolken, die zur ungünstigsten Stunde aufzogen, konnte Semla-Seraphin abwehren. Sie erkannte hinter dem Unwetter die Wut ihres Bru-ders, des Dämons.
Die böse Nachricht blieb am Ende doch nicht aus. Nings Seelengerüst brach in einer düsteren Nacht zusammen.
Amnara fand den Entschlafenen am Morgen, als sie ihm frisches Wasser bringen wollte.
„Wie können wir es Atid beibringen?“, grübelte Silve.
„Er wollte, dass wir es verschweigen“, merkte Amnara an.
„Wir haben ohnehin keine Möglichkeit, sie zu informieren“, gab ich zu bedenken.
Zu viert saßen wir am Fluss und warfen Steine in die sanften Wellen.
„Wie ist es mit euch?“ Silve schaute zu Semla und mir auf.
„Was meinst du?“
„Liebt ihr euch nicht?“
Semla gluckste. „Unsere Liebe ist so alt wie der Urknall. Die hält alles aus.“
„Stimmt“, pflichtete ich ihr bei, „manchmal frage ich mich, wie es kommen wird. Ich habe die Angst, dass ich die Ausgangsgeschichte, diesen Fluch, der mich Jahrtausende in die Vergangenheit warf, nochmals erleben muss. Das Geschehen liegt in der Zukunft und der stehen wir unausweichlich gegenüber.“
Semla nickte. „Daran habe ich auch schon gedacht.“
„Als wir uns damals auf dem Reiterhof ansahen, warst du mir eine Fremde. Sollte der Augenblick nochmals kommen, würde ich dich wieder nicht kennen?“
„Du warst mit einem Mädchen dort.“
„Magda.“
„Hast du sie geliebt?“
„Ich kann es mir nicht mehr vorstellen. Alles ist so verschwommen und verwaschen.“
„Sollten wir uns dort ein zweites Mal gegenüberstehen, werden wir eins sein“, merkte Semla mit fester Überzeugung an, „und wenn es nur für eine Sekunde wäre. Sie würde die schönste meines Lebens sein.“
Silve und Amnara lächelten sich an.
Es war ein Erlebnis, in das ich alle paar Tage von neuem eintauchte: das Durchstöbern des Mond-scheinplatzes, dem ich den besseren Begriff,Mondscheinbasar, gab. Auf dem Platz, angelegt in einem gewaltigen Halbmond, der sich bis zum Roten Palast erstreckte, fanden sich die Händler. In den kleinen Flüsschen, die das Forum durchschnitten, spiegelte sich das Leben, Enten schnatterten nicht weniger laut als mancher Geschäftsmann.
Der Reiz bestand in einer Besonderheit: Die Geschäftswelt endete nicht an einer klaren Grenze, sondern setzte sich in den engen Gassen fort, die sich anschlossen. Dort arbeiteten vorwiegend die Handwerker, die ihre Kunstgegenstände feilboten. Die Farbenpracht der zurechtgemachten Menschen ist allein mit der Vielfältigkeit eines Regenbogens vergleichbar. Dazu die Gerüche, die betäubten: Curry, Kurkuma, Vadouvan, in Rosenwasser getauchte Jalebis, frittierte Kringel aus Mehl, liebte ich vor allem. Es gab Gaukler mit Äffchen, Veden-Erzähler unterhielten ihr Publikum, Musik verströmte ihre betörende Wirkung.
Manches beschädigte Haus war seit dem Aufstand gewichen und hatte neuen Gebäuden im Kolonialstil Platz gemacht. Selbst die feine englische Gesellschaft ließ sich das Bad in der Menge nicht nehmen. Die in langen geschmackvollen Kleidern bekleideten Frauen fand man vorwiegend bei den Stoffen und Schmuckgegenständen. Um sie herum strömten die Diener. Das Wort Sklaven durfte ich nicht in den Mund nehmen, da Sklavenhaltung anrüchig und verpönt war.
Ein älterer Inder lud mich auf seinen Kahn ein. Ich lehnte ab und bog in einen schmalen Durchgang, der von Marktständen gesäumt war, ab. Noch einmal blickte ich zu dem Fährmann zurück, übersah dabei einige Töpfe, die aufgetürmt waren, stolperte und …
… kam irrigerweise auf einem Stuhl zu sitzen. Um mich thronten festlich gekleidete Personen. Ein Theater? Steckte ich in einem Theaterhaus?
Ich schloss die Augen. Die Sorge, Silve, Amnara und Semla würden pausenlos nach mir suchen, plagte mich. Erst nach quälenden Minuten verschaffte ich mir Luft. Alles half nichts, ich musste mich mit der veränderten Tatsache anfreunden.
Auf der Bühne wurde manches geredet. Menschen lachten. Ich hatte mich in eine Komödie verloren. Mein Interesse galt mehr den Zuschauern als dem Werk. Hochgeschlossene dunkle Anzüge, die Frauen weniger galant wie jene in Indien, doch ebenfalls gestylt. Viele Blicke bewegten sich regel-mäßig zu einer Loge, die sich rechts an die Bühne erhöht anschloss. Ich vermutete dort einen vornehmen Gast. Als erneuter Beifall aufbrandete, fragte ich meinen Nebenmann, wer anwesend sei.
„Jaja“, erwiderte er flüchtig, „er ist hier.“
Mein „wer?“ überhörte er, da ein anschließender Dialog auf der Bühne seine ganze Aufmerksamkeit einforderte.
Bleib ich eben dumm, entschied ich und lehnte mich zurück.
Mir lag wenig an dem Stück, zu sehr bewegten mich die vergangenen Wochen.
Man spürt es, wenn Künstler einen ausgefallenen Augenblick vorbereiten, wenn sie gezielt die Konzentration des Publikums zu bündeln verstehen, um dann zu einem Paukenschlag zu finden, der den Gemütern die Bahn freigibt. So holten mich die folgenden Worte aus meinem Abschweifen.
„Don’t know the manners of good society, eh? Well I guess I know enough to turn you inside out, old gal — you sockdologizing old man-trap! – Sie wissen wohl nicht, wie man sich in Gesellschaft zu betragen hat, hä? Ich schätze mal, ich weiß genug, um Ihnen das Fell über die Ohren zu ziehen, alte Jungfer – Sie durchtriebene Männerfalle!“
Applaus brandete auf, der auf das Wort „sock- dologizing“ zurückzuführen war. Gleichzeitig durchschnitt ein Schuss die wogende Menge.
Verwirrung, Unsicherheit, Angst!
Gehörte der Knall zum Stück?
Verrückterweise sprang ein Mann von der zuvor beschriebenen Seitenloge aus einer Höhe von circa drei Metern auf die Bühne, stürzte und rief die Worte „Sic semper“ oder etwas Ähnliches. Beim Aufprall auf der Erde hatten sich seine Stiefelsporen mit einer Requisite, einer US-Flagge, verheddert. Es gelang ihm, sich frei zu reißen und davonzueilen. Zweifellos hatte er sich verletzt.
Gar schnell offenbarte sich der wahre Sachverhalt. Der Präsident der Vereinigten Staaten, Abraham Lincoln, war aus nächster Nähe hinterrücks mit einer Kugel in den Kopf getroffen worden. Der Attentäter war es, dem die Flucht von der Loge über die Bühne gelang.
Man kann sich den Wirbel, die Unsicherheit, die Betroffenheit vorstellen, die folgte. Die Einen eilten davon, Anderen, die diskrete Einzelheiten begehrten, wuchsen die Ohren, Weitere waren längst vorinformiert und warfen sich in selbstdarstellerische Pose.
Ich war in Washington, im Ford‘s Theatre, das hatte ich zwischenzeitlich verstanden. Nach der scheußlichen Tat stand ich wie belämmert im Foyer des Theaterhauses, bis mir bewusst wurde, dass ich mir Gedanken darüber machen sollte, wo ich bleiben könnte.
Die riesige Avenue vor dem Gebäude überraschte mich. Mein Standort lag etwa auf der halben Strecke zwischen dem Weißen Haus und dem Sitz des Präsidenten, dem Kapitol, dessen Erweiterung stand kurz vor der Fertigstellung.
Die Unruhe aus dem Inneren des Theaters wurde ins Freie getragen. Kutschen wurden herbeigerufen. Kaum eine war verfügbar, da niemand mit dem frühen Schluss der Vorführung gerechnet hatte und die Fuhrmänner daher abseits weilten. Das wiederum führte dazu, dass die überraschteMenge nahe Gasthäuser aufsuchte, um die Zeit zu überbrücken. Mit Alkohol konnte man zudem die bittere Pille besser schlucken.
Diese Beobachtung generierte in mir ein Stichwort: Tellerwäscher oder um es zur Stunde passend zu präzisieren, Gläserspüler. Konnte es nicht der Beginn meiner Karriere sein?
Sofort steuerte ich eines der übervollen Lokale an.
Der Inhaber hatte weder die Zeit noch die Muse, sich mit mir zu beschäftigen. Die Eindrücke, die auf ihn einströmten – Schilderungen von Entnervten, pöbelnde Herren und weinende Damen – erschlugen ihn förmlich.
Ich organisierte mich selbst, suchte mir ein Spültuch, stellte mich neben einen schwarzen Hü-nen, der Gläser aus einer Brühe fischte und trock-nete dieselben ab. Er grinste vergnüglich.
„Was ist da draußen los?“, fragte er mich nebenbei.
„Der Präsident wurde erschossen.“
„Massa Abraham?“
„Massa Abraham.“
„Oh, Scheiße.“
Ich verstand aus der Wortwahl, die Strecke bis zu meiner Gegenwart war nicht mehr allzu weit.
Als nach wenigen Stunden die letzten Gäste davongezogen waren, lehnten wir uns erschöpft zurück.
„Gott sei Dank, Chef, dass du mir den zur Hand gegeben hast.“
Der Angesprochene sah mich unschlüssig an.
„Wie? Was soll ich getan haben?“
„Hier, diesen Manuel. So ist doch der Name, nicht wahr?“
„Weitblick muss man haben. Das ist die Kunst des Lebens.“ Der Chef schwang sich auf, nur ahnend, wovon gesprochen wurde.
„Wo wird er schlafen?“
„Das ist deine Sache.“
Joe nahm mich ins Schlepptau. Er bewohnte zusammen mit seiner Frau, einigen Kindern und anderen Freunden einen Kellerraum. Was sie verband, sollte mir ein Rätsel bleiben, da nur ein Thema regierte und jeden anderen Gedanken erstickte: Abraham Lincoln.
Dass die ersten Worte der Ehefrau, „Du hast gehört …?“, einen Reigen von Empfindungen auslösten, war verständlich. „Es wird sich allerlei ändern“, schloss sie den primären Sturm ab.
Jo, dem die Arbeitsstunden in den Knochen saßen, wollte von all dem nichts wissen und entgegnete gleichgültig, „Was schon? Es ändert sich nie etwas.“
Die zwei beschworen darauf ein Bild, das – unzählige Male durchgekaut – einen verwaschenen Eindruck von Gewesenem und Erlebtem preisgab.
„Wir dienten im Süden unserem Herrn und ebenso verhalten wir uns im Norden. Im Süden hatten wir ein Dach und bekamen zu essen. Mit den Münzen, die wir hier in Washington zugesteckt bekommen, sind wir damit eben. Hier schiebe ich mir während der Arbeit ein Stück Brot in den Mund, auf dem Feld war es eine Erdnuss. Legte ich mich zwischendurch übermüdet in den Schatten, war es so und es kümmerte niemanden, im Restaurant wirft mir der Chef bei Gleichem eine Pfanne an den Kopf.“
Sie konterte hart, zeigte ein Kind nach dem anderen auf und endete mit der Frage, wer der Vater der zwei Ältesten sei.
Eindeutig saß ich im Strudel von Nord-SüdStaaten Kontroversen, die unverdaut weiterlebten.
Die Ausgangssituation war klar. In den südlichen Staaten hatte vor wenigen Jahren ein reicher und gebildeter Landadel, vergleichbar mit europäischen Herzögen, regiert. Ihre Existenz war durch die Landwirtschaft, maßgeblich durch die Baumwollfelder und die Sklaven, die zur Arbeit unerlässlich waren, gesichert. Ein Verbot der Sklaven bedeutete für manchen den Ruin. Nachdem die Einfuhr von Schwarzen gesetzlich untersagt worden war, explodierten die Preise auf dem Sklavenmarkt. Einige Gutsherren sicherten sich die Schwarzen durch Pflege, andere versuchten sie mit der Peitsche zu halten.
Das Denken und die Lebensweise in den Nordstaaten unterschied sich dazu erheblich. Ge-schäftsleute, die sich dem Handel verschrieben, Einwanderer, die den Westen erschlossen, fromme Herren, die sich ihr Eigen mit bloßen Händen schufen – ihnen allen war der Gedanke, Menschen als Eigentum zu führen, zuwider. Auswanderer aus Europa hatten sich das Joch abgeschüttelt und lehnten ein selbstherrisches Gebaren in der neuen Heimat entschieden ab. Mit Pamphleten und Schriften griffen sie die Menschenhaltung an, in Diskussionen spottete man über den Süden.
Ein brandneues Buch, „Onkel Toms Hütte“, wurde zum wirksamsten Propagandabuch aller Zeiten. Die Südstaatler fühlten sich in die Enge gedrängt, sie, die wahren Herren, die den Löwenan-teil der Präsidenten aus ihrer gebildeten Mitte stellten.
Erläutert hatte ich bereits, dass man bemüht war, den Frieden in einem Gleichgewichtszustand zu gewährleisten. Für jeden neuen Staat ohne Sklavenhaltung musste ein anderer mit Sklavenhaltung dagegenhalten. Aufgrund der realen Gegebenheiten und dem Hass, der keimte, geriet das beschriebene System in eine Schieflage. Anlass gaben zwei neue Territorien: Nebraska und Kansas. Beide Staaten wurden vehement umkämpft und so kam es zum Beschluss eines Kompromisses, dem Kansas-Nebraska-Akt.
Dieser verwarf eine Festlegung, die im Jahre 1820 getroffen worden war, nämlich dass nördlich des 36.30 Breitengrads Sklaverei verboten wäre. Man gestattete in diesem Fall ein Wahlrecht derSiedler. Die Entscheidung führte zu keiner Beruhigung, sondern zu einem schmerzvollen kleinen Bürgerkrieg.
Der Konflikt war unionsweit kaum mehr unter der Decke zu halten, insofern konnten Folgen nicht ausbleiben. Zwei neuen Parteien fanden sich, eine Nationalistische, die schnell wieder verschwand sowie die Republikaner. Bei den Wahlen im Jahre 1856 behielten die Südstaatler zwar die Zügel in der Hand, doch waren schmerzhafte Verluste zu verzeichnen. Der Demokrat Präsident James Buchanan aus Pennsylvania zog geschwächt in das Weiße Haus.
Ein Urteil des obersten Richters Taney schüttete Öl ins Feuer. Es besagte, dass Sklaven das Eigentum der Besitzer seien und kein Recht zu einer Enteignung bestehe. Der Spruch gab den an die Wand gedrückten Plantagenbesitzern Aufwind. Übermütig forderten sie, die Einfuhr von Sklaven zu legalisieren. Es kursierte gar der Gedanke einer Sklavenzüchtung. Das war der Stand der Dinge zu einem Zeitpunkt, als neuerliche Wahlen anstanden. Die Demokratische Partei war auseinandergebrochen. Der bisherige Kitt, Geschichte und Tradition, vermochte es nicht mehr, die nördlichen Handwerker und die südlichen Aristokraten in einem gemeinsamen System zu einen. Zur Wahl ergab sich daher ein neues Bild. Der Norden wurde von den Republikanern, der Unionspartei und den abgespaltenen Demokraten unter Stephen Douglas umworben, den Süden hatte die Stammpartei der Demokraten sicher.
Die Konstellation der entzweiten Demokraten und dem geltenden Wahlmännerverfahren führte dazu, dass die Republikaner mit ihrem Kandidaten Abraham Lincoln die Wahl mit 1.866.352 gegen 2.815.617 Stimmen gewannen, da sie die meisten Wahlmänner hatten vereinen können. Durch die Zersplitterung verstreuten sich die anderen Stimmengeber auf drei Parteien.
Nach dem abendlichen Disput, dem ich ohnmächtig gefolgt war, begab ich mich zur Ruhe. Am nächsten Morgen entschied ich, meine Unverfrorenheit fortzusetzen.
Der Boss - jeder nannte ihn so - hatte mir bei der ersten Begegnung des Tages ein Gespräch an-gedroht. Es kam nicht dazu.
Die Ereignisse überstürzten sich. Der Präsident war seiner Schusswunde erlegen. Jede Mühe der Ärzte hatte versagt.
Ein Schauspieler, ein Verfechter der Südstaateninteressen, war der Attentäter gewesen. Er hatte die entsprechende Stelle in dem Theaterstück wohlbedacht abgewartet. Er hoffte, der Schuss würde im Gelächter untergehen. John Wilkes Booth, so sein Name, war die Flucht gelungen. Das stand ebenfalls fest. Es wurde von einer Verletzung gesprochen, was mich wenig wunderte. Zu ungestüm war er auf der Bühne aufgeschlagen.
Lincoln hatte einen Leibwächter an seiner Seite gehabt. Nachdem der Präsident seine Plätze verspätet aufgesucht hatte, sonderte der Leibwächter sich ab und amüsierte sich in einer anderen Loge über die leichtfüßige Story. Angeblich hatte Lincoln ihm dies zugestanden.
Jede neue Wendung des Berichts, jedes kleinste Gerede erhielt Bibelformat.
„Wer wird sein Nachfolger?“, erkundigte ich mich.
„Der Vize. Andrew Johnson. Er kommt aus Tennessee.“
„Gehört dieser Staat nicht zu den südlichen?“, fragte ich nach.
„Jepp. Ist von der Union abgefallen, das Land! Nicht aber Johnson. Lincoln hat ihn an seine Seite geholt, den Demokraten. Er wollte damit dem Süden die Hand reichen.“
Es hatte nur der Tritt gefehlt, um das Bild eines donnernden Rauswurfs zu komplettieren. Mein aufdringliches Verhalten passte nicht in die klar strukturierte Gesinnungswelt des Chefs. Ohne Arbeitsvertrag hatte man kein Recht etwas zu tun, diese Verknüpfung war ihm Religion. Mir bescherte diese Haltung grenzenlose Freizeit.
Wieder wäre ich durch die Gassen und Fluchten getigert, wenn mich Joe nicht nach einigen hundert Metern eingeholt hätte.
Ich schaute ihn erstaunt an. „Was willst du?“
„Hast du nicht vor reich zu werden?“
„Reichtum ist so eine Sache“; wich ich aus.
„Was für ein jugendlicher Tor!“, rief er aus.„Komm mit mir!“
„Wohin? Nach Bremen, um zu musizieren?“
„Nach … wohin? Nein, wir suchen Booth!“
„Einen Verkaufsstand?“ Ich übersetzte das Wort ins Deutsche
„John Wilkes Booth, den Attentäter! Du Narr! Auf ihn wurde eine Belohnung von 50.000 Dollar ausgesetzt. Damit können wir beide ein Luxusleben führen.“
„Mag sein, aber da werden tausende Verfolger losstürmen.“
„Das dürfen sie gerne. Aber ich weiß, dass er mit einem Boot über den Potomac entkam und hofft, drüben in Virginia gefeiert zu werden.“
„Als Freiheitskämpfer der Südstaaten.“
„Weiterhin ist mir zu Ohren gekommen, dass man den Mordanschlag dort ebenfalls verurteilt. Booth wird somit auf keine Freunde treffen, sondern wird sich verstecken müssen.“
„Das macht eine Suche nicht bequemer.“
„Hoffentlich nicht! Ihn darf ja auch nicht jeder finden - bloß wir!“
Die Überfahrt nach Virginia gelang anstandslos. Joe baute auf ein Netzwerk von Schwarzen. Netz-werk mag nicht der korrekte Begriff sein, da sichlediglich ein paar Einzelkämpfer zusammengefunden hatten, passte aber trotzdem am ehesten auf die Gruppierung, der ich meine Mahlzeiten für die nächsten drei Wochen verdankte.
Don lebte in einer Scheune nahe einer Farm. Sie war unser erstes Ziel. Er selbst arbeitete auf den Feldern, kam abends erschöpft aber singend ins Quartier und wusste allerhand Neuigkeiten, Dinge, die man sich so erzählte und auf die sicher kein Verlass war.
„Das man plötzlich diesen Lincoln preist, das verstehe, wer wolle. Vor wenigen Monaten haben wir gegen ihn gekämpft, damals wäre sein Untergang im Jubel gefeiert worden. Jetzt wird seine Leiche durch die Lande geschippert, damit auch der Letzte sehen kann, dass er nicht mehr ist und der Umstand wird betrauert. Wer soll das verstehen?“
„So entstehen Heilige“, erwiderte ich. Eine Bemerkung irritierte mich. „Du hast gegen den Norden gekämpft, du als Schwarzer? Das habe ich sicher falsch verstanden.“
„Hast du nicht. Manche Sachen ergeben sich und dann ist es so.“
„Also nicht von Anfang an?“
„Kaum. Der Anfang war rein politisch.“
„Politisch?“, fragte ich nach.
„Wie würdest du es ausdrücken? Als Lincoln die Wahl gewonnen hatte, verließen South Carolina, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Texas und Louisiana die Union und riefen sich als Konföderation von Amerika aus. Dabei blieb es nicht. Arkansas, North Carolina, Tennessee und ein sich abspaltender Teil von Virginia schlossen sich an. Der Norden mobilisierte alle Kräfte, um wenigstens Kentucky und Missouri zu halten.“
„Einverstanden, das ist wirklich politisch. Das war ein schweres Los. Man gewinnt eine Wahl, freut sich und das Land zersplittert in der Hand. Ich weiß nicht, was ich getan hätte.“
Idrissa ist zu erwähnen. Obwohl ebenfalls dunkelhäutig, hatte er das Vertrauen seines Herrn gewonnen und fungierte als Verwalter. Seine Entscheidungen und sein Verhalten waren weise. Niemals sich in den Vordergrund spielend, plante er im Stillen, entschied in der Ruhe und lenkte seinen Herrn mit feinfühliger Überlegenheit. Er war sich nie zu schade, in unsere Scheune zu kommen und mit offenen Herzen Bedrängnisse anzuhören. In solchen Situationen lernten wir uns schätzen.
Bei einer Gelegenheit sprach er mich an. „Du bist ernstlich auf der Suche nach dem Täter?“
„Ich will es umschreiben“, versuchte ich mich zu rechtfertigen. „An der Seite von Joe trage ich Sorge, dass er unbeschadet zu seiner Frau zurück-kommt. Sollte er dabei zu Reichtum kommen, mag es mir recht sein.“
„Und du? Du hast wenig Interesse an dem Geld?“
„Für mich ist es bedeutungslos. Ich würde es irgendwelchen Notleidenden schenken. Selbst habe ich keinen Bedarf.“
Selbstverständlich beäugte Idrissa die Weichen, die die Politik stellte, akribisch. Das Land stand vor einem unabsehbaren Umbruch, der sich bis in die letzte Farm auswirken musste. Gegenüber Lincoln behielt er eine neutrale Haltung. Dessen Regierungszeit, die allein durch den Krieg geprägt gewesen war, betrachtete er abseits der SchwarzWeiß-Diskussionen.
„Für Lincoln stand die Wahrung der Einheit Amerikas im Vordergrund. Die Eigenwilligkeit der Föderierten Staaten empfand er als Anarchie. Es kann nicht sein, dass jeder das tut, was ihm passt.“
„Gab das den Anlass für den nachfolgenden Krieg?“ Das interessierte mich.
„Lincoln war kein Mensch, der Kampfhandlungen herbeisehnte. Er vertraute dem, was für ihnrichtig war, nämlich der Einheit. Das bedeutete in der letzten Konsequenz, dass die Fremdgänger weiterhin Abgaben und Steuern an die Union zu erbringen hatten.“
„Somit hatte der Krieg durch die Südstaaten erklärt werden müssen? Täusche ich mich?“
„Keinesfalls. So geschah es. Im April vor vier Jahren besetzten die Föderalisten den Hafen von Charleston und belagerte Ford Sumter mit 100.000 Mann. Es kam zum Kanonenbeschuss. Die Verteidiger durften, nachdem sie die Sinnlosigkeit der Konfrontation erkannten und aufgaben, abziehen, aber der Krieg war damit eröffnet. Lincoln dachte, ein Heer von 75.000 würde genügen, um der Chose Herr zu werden. Das unterstellte ich damals, da er diese Anzahl an Freiwilligen zusammenrief. Heute wissen wir, dass er von Anfang an meisterhaft pokerte. Auf diese Art verschleppte er die Einberufung des Kongresses.“
„Mit welchem Ziel?“
„Um Freiheiten für die militärische Operation zu nutzen. Wird keiner gefragt, kann niemand widersprechen. Er verhängte eine Blockade über die Küste der Südstaaten und schnürte dadurch den Handel ab.“
„War das den Schwarzen nicht angenehm? Sicher sehnten sie sich nach Freiheit?“
„Glaubst du! Lincoln war Jurist und das Gesetz der Staaten ihm heilig. Eine Teilung durfte nicht sein, den Anspruch des Südens auf Sklavenhaltung, den gestand er den Herren zu. Das war nicht sein Thema.“
„Und daher war es den Sklaven gleich, ob sie für den Norden oder den Süden kämpften?“
„Vielen. Den meisten war das alles zu fremd, sie verstanden es nicht. Natürlich blühten Träume von Freiheit auf. Wunschträume sind legitim. Zurück in die Heimat, nach Afrika zu ziehen, diesen Wunsch gibt es ebenso. Von philanthropischen Gesellschaften wurden von Häuptlingen Länderaufgekauft und Schwarze zurückgeführt. Jüngst hörte ich, sie haben sich einen eigenen Staat gegründet, Liberia. Die Hauptstadt ist nach unserem damaligen Präsidenten benannt, Monrovia, also Monroe.“
„Der Norden hat den Sieg davongetragen. War das absehbar?“
„Sicherlich. Es standen 23 Staaten gegen 11. In Personen ausgedrückt, eine Bevölkerung von 22 Millionen gegen 9 Millionen. Die Südstaaten hofften auf die Hilfe Europas. Der Adel würde zum Adel halten, so wurde unterstellt. Was weiß ich, was dort hinter dem Ozean passiert. Man sagt, die alten Länder wären mit sich selbst beschäftigt. Das Hauptproblem der Südstaatler war letztendlich, dass alle Kampfhandlungen auf ihrem Gebiet stattfanden. Vier Jahre zogen sich die Kämpfe in die Länge. Im Süden verfügte man die allgemeine Wehrpflicht, im Norden wählte Lincoln Zwangsrekrutierungen. 980.000 Menschen standen bald unter Waffen. Es war ein Schrecken ohne Ende, 600.000 fielen. Ausgebrannte Städte, verwüstete Felder, Sklaven und Obdachlose irrten ziel- und zukunftslos durch die Lande. Die entscheidende Schlacht trug sich in Gettysburg zu. Von dort an war es für den Süden gelaufen. Ihm blieb nur die Verteidigung. General Lee stand gegen den Nord- staatler General Grant. Der Erstere musste sich ergeben.“
„Der Krieg ist zu Ende. Alles wird seine Ordnung finden“, behauptete ich.
„Jeder blickte auf Lincoln. Die Wahl im vergangenen Jahr hat er mit großer Mehrheit gewonnen. Sie gab ihm den nötigen Rückenwind für Entscheidungen. Die abschließende Kriegsmaßnahme gab er in die Hände von General Grant und so schuf er sich den Freiraum für den Entwurf von Friedenskonzepten. Ich hoffe, die schwirrten ihm nicht nur durch den Kopf, sondern wurden auch dokumentiert. Eines ist durchgedrungen, er strebte keineBestrafung des Südens an. Er erwog, Gelder für dessen Aufbau freizugeben. Seine Minister zeigen für derartige Nächstenliebe wenig Verständnis.“
„Die Freiheit der Sklaven ist entschieden. Das dürfen wir festhalten.“
„Wundere dich nicht, Lincoln wehrte sich dagegen. Er wollte mit dem Adel im Süden nicht brechen. Es ist die Zeit, die diese fällige Entscheidung abverlangt. Längst ist sie nicht durch alle Instanzen. Im Kongress wird ein Zusatzartikel verhandelt, der uns alle auslöst.“
Was Indrissa nicht wissen konnte: Mit der Befreiung der Sklaven brach in Europa jeder Gedanke an eine Intervention zusammen. Liberalisierung war zwischenzeitlich weltweit ein Sprengstoff.
Mittlerweile wusste ich, in welchem Theaterstück ich mich befunden hatte, in Tom Taylors „Our American Cousin.“ Die Inszenierung sparte nicht mit Spott gegenüber englischen Eigenwilligkeiten und hielt einen naiven, aber ehrlichen Amerikaner dagegen. Angeblich war Lincoln ein humorvoller Mensch, der die Farce vertrug.
„Wie würdest du entscheiden?“ Indrissa riss mich aus meinen Gedanken. „Wir wissen, wo sich Booth versteckt. Mit einem Komplizen haust er in einer Hütte. Freiwillig wird er sich nicht ergeben. Sie führen Waffen mit sich.“
„Das bedeutet, Joe käme in Lebensgefahr, wenn er ihn fassen wollte?“
„Genau das will ich damit sagen.“
„Die Neuigkeit kann einen Tag auf sich warten lassen.“
Indrissa nickte lächelnd.
Wie ich gehofft hatte, löste sich das Problem von selbst. Der Komplize von Booth wurde zum wunden Punkt. Bei der Besorgung von Lebensmitteln erlag er dem Reiz von Freudenmädchen. Wohl sprudelte aus seinem Mund manches heraus, wasschädlich war. Zumindest wurde eine Lady bei der Polizei vorstellig und verriet das Versteck. Der Zugriff erfolgte zügig, zeigte aber, dass die Befürch-tungen Indrissas berechtigt waren. Booth wehrte sich bis zur letzten Minute. Die Hütte wurde in Brand gesteckt. Das brachte den Mörder in Not und zwang ihn zu einem Schusswechsel, bei dem ihn eine Kugel niederstreckte. Er erlag seinen Verletzungen.
„Dann bekommt das Weib das Geld?“ Joe kochte, als es bekannt wurde.
„Es stünde ihr zu“, meinte Indrissa.
Nach und nach traten Probleme ans Tageslicht, die den Verlust Abraham Lincolns verdeutlichten. Die Probleme hätten sich auch vor Lincoln ausgebreitet, meinte Indrissa, doch war er sich sicher, dass sein Format ein anderes gewesen wäre als das von Andrew Johnson.
Die Nordstaaten hatten unter dem Krieg kaum gelitten. Die wirtschaftliche Entwicklung gedieh beneidenswert gut, Geschickte verdienten an der Katastrophe und schwammen im Luxus. Eine Abspaltung der Südstaaten hätte der Norden verschmerzt, es gab durchaus Bürger, die sich einen solchen Schritt herbeiwünschten.
Durch den Kriegsgewinn blieben sie verbindlich anwesend, nicht als Freunde, sondern als unsicherer kaum einschätzbarer Faktor. Erhielten diese Staaten alle Rechte im Parlament, würde die Gefahr auftauchen, dass sie die Union kippten. Ein Blick auf die Aufstellung der Abgeordneten führte zu Entsetzen. Lincoln hatte zwar die Wahl gewonnen, deutlicher als die Wahl zuvor, doch die absolute Mehrheit hatten die Republikaner keinesfalls. Formierten sich die Demokraten zu einer Einheit wäre das Desaster perfekt. Zu befürchten war stets alles.
Indrissa ängstigte sich. „Es gibt die Gerüchte über die ,Black Codes‘.“
„Du wirst es mir erklären.“
„Die Rechte der Schwarzen werden in den Südstaaten untergraben. Sondergesetze sollen ihre Freiheiten einschränken. Teils finden solche in den Gesetzen der Länder schriftlichen Niederschlag, teils werden sie unter der Hand gelebt und von unheimlichen Richtern, wie die des Ku-Klux-Klans geahndet.“
„Gerichte, die neben dem Gesetz im Geheimen operieren?“
„Genauso wird es erzählt und ich zweifle nicht daran.
Meine Sorgen um Joes Zukunft fanden Gehör. In- drissa verschaffte ihm und seiner Frau eine Stel-lung.
„Dir kann ich ebenfalls eine Aufgabe anbieten, die eines Boten.“
„Gefährlich?“
„Du wirst nicht allein sein.“
„Das ist keine Antwort.“
„Geh zurück nach Washington. Dort erfährst du mehr.“ Indrissa drückte mir ein Stück Papier in die Hand. Eine Adresse stand an oberster Stelle. „Zur Erklärung: Dieses Schreiben ist heute eingetroffen. Unser Herr wird darin um Mithilfe angefragt. Das ist nicht verwunderlich, da er in der Hauptstadt großes Vertrauen genießt und stets zuverlässig ist.“
Ich ließ mich überreden und tauchte in ein neues Abenteuer ein.
Sauber herausgeputzt trat ich in ein vornehmes Haus. Ein Diener führte mich ohne Umschweife in einen Salon, in dem ein Konzertflügel kaum auffiel.
„Manuel Jebich?“
„Ja.“
„Du wurdest verlässlich beschrieben.“
„Wie soll meine Aufgabe aussehen?“ Ich behielt mir durchaus vor, das Amt abzulehnen.
„Du siehst den Brief auf dem Tisch? Es ist die Hand des neuen Präsidenten. Das Schriftstück ist an Benito Juàrez Garcia gerichtet. Du verstehst? Es muss nach Mexiko gebracht werden.“
„Wer begleitet mich?“
„Jeremia Sanchez. Er ist im Süden bewandert. Der Präsident fordert einen zweiten Mann, mit der Aufgabe, die Depesche im Auge zu behalten.“
„Und da gedenken sie sich, auf mich zu verlassen?“
„Ich bin angehalten, soweit mein Eindruck die Erwartungen trägt, dem stattzugeben.“
Die Kutsche stand zwei Tage später bereit. Zugstrecken im Süden waren dem Krieg zum Opfer gefallen. Mit den besten Wünschen vom Präsidenten bestieg ich gemeinsam mit Jeremia das Gespann.
Wortkarg, konzentriert, mit eiserner Miene saß er mir gegenüber und starrte ins Freie. Die Räder sangen ihr eintöniges, nervenzermürbendes Lied. Tennessee, Arkansas, Texas. Die Grenze nach Mexiko bewältigten wir auf dem Rücken der Pferde - auf einer Route, die für Reisende in einer Kutsche ungeeignet war.
Benito Juàrez – war er ein Staatsmann oder ein Rebell? Man konnte es drehen und wenden, wie man wollte. Aus Sicht des Präsidenten würden wir auf einen Politiker treffen, weit ab, verborgen, kaum in einem Palast.
Unsere Reise fand ein jähes Ende. Durch eine Klapperschlange aufgeschreckt, scheute Jeremias Pferd nicht nur, sondern machte einen gewaltigen Sprung zur Seite. Der Reiter, einen Augenblick unbedacht, verlagerte sein Gewicht derart ungünstig, dass er mitsamt dem Pferd auf dem schmalen Pfad in die Tiefe stürzte. Leblos fand ich ihn dort.
Die Mission war gescheitert. Wenig hatte mir Je- remia über die wahren Umstände erklärt, sei es aus Misstrauen oder auf Anweisung. Jetzt standich einsam und hilflos mit der Depesche in der Hand in unwägbarem Gelände.
Juàrez zu finden, schminkte ich mir ab. Mit dem Tod meines Begleiters wurde der Staatsmanns Juàrez für mich ein Aufrührer. Mir lag wenig daran, alles auf Richtigkeit zu hinterfragen, jedenfalls regierte derzeit ein anderer das Land, Kaiser Maximilian I. Das war Fakt und unter dieser Prämisse war jeder, der dies nicht akzeptierte, Rebell, mochten alternative Erwägungen auch noch so herzerwärmend sein. Im Umfeld von Aufwieglern sah ich Strauchdiebe, Rabauken, gesetzlos Wütende und Ähnliche, die ich zu meiden entschied.
Andererseits war mir bewusst, dass Worte jede Menge bewirken konnten, mitunter Menschen retten, Situationen verbessern, zum Glück einer Nation sein. Je nachdem, was in dem Brief stand, wäre es womöglich doch nützlich, wenn er das Ziel erreichte.
Unentschlossen setzte ich mich auf einen Hügel und schaute ins Weite. Ich machte mir klar, dass die Antwort auf meine Fragen in Tinte festgehalten vor mir lag. Also erbrach ich das Siegel und kämpfte mich durch die weihevollen Sätze des Präsidenten.
Glückwünsche. Er, der neue Präsident, wolle Juàrez und seiner Sache alles Gute wünschen.
Ich drehte das Schriftstück um. Fehlte nicht eine Anlage? Die Monroe-Doktrin? Amerika den Amerikanern?
Zugegeben, ich kochte. Der Präsident hetzte uns durch das Land, um billige Grüße zu überbringen, und wir setzten unser Leben aufs Spiel. Ich wurde nicht ausgewählt, da ich vertrauensvoll war, sondern weil ich ein Depp und ein Nichts war, genauso wertlos wie dieses Schreiben.
Kurz und gut, ich faltete das literarisch niederträchtige Werk zu einer Schwalbe und ließ es in die Weite schweben. Da das Siegel erheblich wog, sollte ich besser von einem fulminanten Steinwurf sprechen und der hatte Folgen.
Einige Soldaten lagerten unter mir. Sie waren mit entgangen. Dass sie die Depesche abgefangen hatten, wurde mir bewusst, als ich nach einem abschüssigen Ritt vor ihnen stand und sie das Papierteil schwenkten.
Grob wurde ich von meinem Pferd gerissen und bedroht. Glücklicherweise verstand ich auf der Stelle, dass keiner von ihnen das Geschriebene lesen konnte. Sie trauten allein dem Siegel eine gewisse Bedeutung zu. Meine große Not bestand darin, zu erkennen, auf welcher Seite sie standen - auf der Juàrezs oder der des Kaisers.
Eine Schmährede half mir, es herauszufinden. Einer der Gruppe, deutlich angetrunken, ließ seinem Unmut freien Lauf und beklagte einen Freund, der von den Rebellen erschossen worden war.
„Die Botschaft ist für den Kaiser!“, gab ich vor, um von meinen Fesseln befreit zu werden. Wieder wurde das Siegel besichtigt. Jeder der acht Anwe-senden drehte das Stück hundertfach hin und her.
„Für den Kaiser?“, spottete ein etwas Untersetzter.
„Sieh doch selbst! Deutlich steht alles geschrieben. Ich denke doch, dass du brav deinen Unterricht genossen und deine Freude an den Sätzen hast.“
„Fürwahr.“ Er fuhr sich über den Bart und wand sich hin und her.
„Was machen wir mit ihm?“, grätschte ein anderer Raubauz dazwischen.
„Wir bringen ihn in die Stadt. Das wird nicht verkehrt sein.“
Es geschah, was zu erwarten war, die Botschaft wanderte mit zunehmender Geschwindigkeit von Hierarchie zu Hierarchie und bald stand ich vor einem Adjutanten des Kaisers im Herzen der StadtMexiko. Sein Spanisch war von durchdringendem Wiener Schmäh gefärbt. Nicht verwunderlich. War doch Mexikos Kaiser Maximilian der Bruder des Habsburger Monarchen Franz Josef I.
Er kam scharf zum Punkt. „Die Botschaft war für Juàrez vorgesehen. Wir wollen von dir nicht mehr wissen als dessen Aufenthaltsort. Wenn du mit uns kooperierst, ersparen wir dir ein Standgericht.“
Ich spielte mit offenen Karten und verwickelte den Adjutanten in ein Gespräch über die weltweiten Unabhängigkeitsbewegungen. Meine Gedanken sprachen ihn an. Dass mir das Versteck des Rebellen nicht bekannt sein konnte, akzeptierte er. Ich nahm seinen Vorschlag an, ihn ins Schloss Chapultepec zu begleiten.
Chapultepec, der Heuschreckenhügel, lag außerhalb der Stadt Mexiko auf einem Bergstock.
Die kaiserliche Familie hatte dort ihr Domizil gefunden. Auf der Fahrt in diese Festung berichtete mir der Adjutant vertrauensvoll von Ereignissen, die - zunächst verborgen, dann in aller Offenheit - eine fatale Wahrheit zeigten. María Eugenia Igna- cia Agustina de Palafox Portocarrero de Guzmàn y Kirkpatrick – man sprach von der schönsten Frau der Welt – , kurz die Ehefrau Napoleon III., die, wie ich erfuhr, zwischenzeitlich den inflationären Kai-sertitel trug, langweilte sich in ihrem Ehefrauendasein. Schlimmer, sie fühlte sich zur Sachwalterin der großen Politik berufen.
Das Herrscherpaar wurde aufgeschreckt, als in Mexiko der päpstliche Legat und der spanische Ge-sandte fortgejagt wurden. Maria Eugenia, wohlbemerkt Spanierin, überzeugte ihren Gatten von dem Nutzen einer Intervention. Wenn Frankreich das viermal größere Mexiko beherrschte, dann hätte es Mitspracherecht in der Neuen Welt. Der Kaiser ließ sich gewinnen und sandte Truppen in diese fremde Umgebung. Diese Maßnahme hatte sich vor vierJahren abgespielt. Benito Juàrez war zu jener Zeit rechtmäßiger Präsident gewesen.
Dass ein solches Projekt zum Scheitern verurteilt war, hätte jeder, der die Entwicklungen ver-antwortungsvoll analysiert hätte, erkennen müssen. Aber, so unterstellte ich, die europäischen Monarchen kannten nur gefestigte Reiche, in denen erlernte Gesetzmäßigkeiten galten. Napoleon hatte niemals eine Chance, sich in Mexiko durchzusetzen. Doch, wie war das Gesicht zu wahren? Indem ein anderer die Schlussrechnung bezahlen sollte?
Ein fingierter Volksentscheid, dass ein eigener Kaiser das eigene ferne Land regieren sollte, war schnell verfasst. Den passenden Herrscher dazu sah der Franzose in Maximilian, dem Habsburger Kaiserbruder. Ohne eine ihm angemessene hochadlige Verantwortung hatte sich dieser in seinem Schloss Miramare bei Triest in Schulden gestürzt. Blind begrüßte er das Angebot und griff nach dem Titel. Warnungen seines Bruders schlug er in den Wind.
Aus dem erhofften fürstlichen Empfang in der Neuen Welt wurde nichts. Maximilian war in einer Schlangengrube gelandet und steckte in ihr fest. Alles, was im blieb, war, die Rebellen zu zerschlagen und auf Napoleons Unterstützung zu hoffen.
Manche Nebensächlichkeiten wage ich an der Stelle zu überspringen. Erwähnenswert ist die Begegnung mit Kaiserin Charlotte, der Tochter des belgischen Königs. Auf Grund meiner Europanähe besorgte sie mir eine achtenswerte Anstellung. Bei Besprechungen zur Lage war ich mitunter anwesend. Mein Rat, einen Frieden mit Juàrez zu finden, wurde belächelt.
Das Jahr 1866 war angebrochen. Aus den Staaten schlugen bombengleich Botschaften ein. Der Koloss Amerika war kaum zu händeln. Der Präsident,Andrew Johnson, musste sich häufig gegenüber Zweidrittelmehrheiten im Kongress und dem Repräsentantenhaus geschlagen geben. Sein Vetorecht half ihm nur bedingt. Das Problem Nord- und Südstaaten war nicht vom Tisch zu bekommen.
Zwei Gesetze veränderten das Land nachhaltig, Wahlrecht für alle und gleiches Bürgerrecht für Schwarze. Dasselbe wurde aber den Offizieren und Beamten der Konföderation verweigert, der Südstaatenadel war zudem zerschlagen und verarmt. Die Maßnahme bescherte den Republikanern in den kommenden Jahren Stimmenschwemmen. Sie nutzten die Unsicherheiten der absolut überforderten Schwarzen aus, die keine Vorstellung hatten, wie sie Bürgerrechte sinnbringend für sich verwerten konnten. Die Gegenwehr der Geheimbünde erblühte. Rassenhass und Rassenstolz trieben ihre vergifteten Früchte.
Eine Nachricht ließ das Kaiserpaar in Mexiko erstarren. Napoleon III. hatte die Entscheidung ge-troffen, die letzten stationierten Truppen zurückzurufen. Maximilian war es bislang nicht gelungen, ein eigenes schlagkräftiges Heer aufzubauen. Uns allen war klar, dass er in diesem Land ausbluten würde.
Beratungen bis tief in die Nacht folgten, Schreiben nach Europa, Bitten.
Kaiserin Charlotte entschied sich für den Gang nach Paris. Sie wollte Napoleon Auge in Auge ge-genübertreten, ihn an seine Zusicherungen erinnern, die militärische Unterstützung garantierten und schriftlich vorlagen. Ich wurde zu ihrem Begleiter ausersehen. Wir sollten auf einem Dampfschiff fahren. Die Strecke von Veracruz nach Saint-Nazaire war in sechs Wochen zu schaffen.
Ich fürchtete die Überfahrt. Nicht wegen Wind, Wetter und dem Seegang, ich traute der Technik nur wenig zu. Wie leicht konnte das ständig lo-dernde Feuer an Bord auf das Holz überschlagen. Regelmäßig rannte ich in meiner Manie in den Maschinenraum und vergewisserte mich, dass keine Gefahr bestand.
Schon die Ankunft in Frankreich stand unter einem unglücklichen Stern. Charlotte hatte mit einem würdigen Empfang gerechnet. Der blieb aus. Um es platt zu sagen, die Bahnhöfe wurden verwechselt. Während wir an dem einen ankamen, blickten an andere Stelle die Musiker ungeduldig in die Noten der mexikanischen Nationalhymne.
Bei einem Treffen zwischen den beiden Kaiserfrauen war ich nicht zugegen. Charlotte kam geknickt zurück. Napoleon war angeblich gesundheitlich angeschlagen und für keinen klaren Gedanken zu gewinnen. Es blieb bei allgemeinen Beteuerungen, Vertröstungen, Ausreden.
Charlotte war von einer Angst getrieben, die ihr das Äußerste abverlangte. Bei dem ersten Besuch blieb es nicht, folgende wurden zunehmend anstrengender und bald wurde offenbar, dass Frankreich selbst in eine Schieflage gekommen war, die keine Rücksichten zuließ.
Vermutet hatten wir es längst, aber wir stellten unsere Hoffnungen lange über die Realität. Demütigungen, wie die Aufforderung, sie solle Hilfe bei ihrem Vater, dem König von Belgien suchen, brachten sie berechtigt in Rage. Von der zugesicherten Unterstützung war keine Rede mehr, im Gegenteil – Napoleon III. zog definitiv seine Truppen aus Mexiko zurück. Nur eine Hoffnung blieb Charlotte, der Papst. Sie entschied ihn aufzusuchen, zu beknien.
Ich hielt an Frankreich fest und verabschiedete mich von Mexikos Kaiserin.
Die grausame Nachricht ließ nicht lange auf sich warten, Maximilian, der Kaiser von Mexiko, wurde gefangen, inhaftiert und gemeinsam mit zwei Generälen standrechtlich erschossen. Die Botschaft durchlief Paris, als ich in freundlichem Kontakt mit dem Maler Eduard Manet stand.
Mit seiner neuartigen Farbgestaltung wandte er sich von der traditionellen Malweise ab. Mir war bewusst, dass ich es mit einem wichtigen Vorreiter des Impressionismus zu tun hatte. Eine unfassbare Pracht von hellen Tönen verscheuchte das düstere Dunkel der Romantiknachfolge. Eduard war über den Tod Maximilians nicht minder erschüttert und wagte sich an ein Bild seiner Hinrichtung. Den ersten Entwurf zeigte er mir nach-denklich.
„Wenn wir es genau nehmen“, resümierte ich, „wurde Seine Majestät nicht von einer mexikanischen Einheit erschossen, sondern von den Franzosen.“
Bei seinem letzten Entwurf erinnerte sich der Meister vermutlich an diesen Satz. Wir finden auf dem Gemälde ein Hinrichtungskomitee in französischer Uniform, das auf den Habsburger zielt.
An jener Stelle muss ich eine weitere traurige Entwicklung einflechten. Charlotte fand auch in Rom kein Gehör. Nachdem sie von der Erschießung ihres Gatten erfahren hatte, zog sie sich zurück und verfiel nach und nach in eine geistige Umnachtung.
Ungewöhnlich lange blieb ich in Paris stecken. Vor der Politik verschloss ich die Augen. Ich trieb mich innerhalb der besseren Gesellschaft herum. Zwar fehlte es mir an den finanziellen Mitteln, doch mein Erscheinen an der Seite der Kaiserin genügte, um mir einen Zuschauerplatz zu sichern.
Die Possen des Musikers Jacques Offenbach waren in jenen Tagen große Mode. Der Kaiser liebte diese leichte spöttische Kunst. Wie erzählt wurde, verhielt sich Kaiser Franz Josef in Wien ähnlich und priorisierte die Walser des JohannStrauß´. Anderes Niveau ließ der Bayernkönig Ludwig II. erkennen, der sich Richard Wagner an den Hof holte.
Aus dem winzigen Baby, das ich einst in den Armen hielt, war ein musikalischer Hüne geworden. „Tristan und Isolde“, sein zentrales Werk, war im Vorjahr auf die Bühne gekommen. Wie eine Granate schlug es ein und lähmte die Musikwelt auf lange Zeit. Unendliche Melodien trieb er pausenlos ins Ekstatische. Die Zuhörer ertranken nahezu im Orchesterrausch.
In Paris wurde darüber geredet. Man hatte mit dem Meister eigene Erfahrungen gesammelt und ihn nach einer Aufführung seines „Tannhäusers“ ordentlich ausgebuht. Frankreich feierte Massenet, Gounod, den jungen Bizet und Verdis „Don Carlos“. Ich hatte das Glück, bei der Uraufführung Gast zu sein, stets in der Hoffnung, Atid zu finden.
Es sollte nicht sein.
Anknüpfen will ich an ein Ereignis, das sich nach drei Wintern einstellte. Eine Gesellschaft plante eine Landfahrt und ich durfte Gast sein. Kaum war ein Buffet hergerichtet, zogen schwere Gewitterwolken auf. Die Geschwindigkeit, in der es zur Entladung kam, war unfassbar. Nicht nur, dass der Regenguss die Töpfe vom Tisch spülte, ein Blitz zerschoss den Baum, den wir uns als Schattenspender gewählt hatten.
Gezeter, Schreie, Hilflosigkeit.
Ich schwang mich auf ein Pferd, um einen Bauernhof oder eine Scheune aufzustöbern, in der alle einen Unterschlupf fänden. Mit den besten Wün-schen im Gepäck jagte ich davon.
Wie ich der Gesellschaft entkam, besserte sich das Wetter. Die Sonne brannte höllisch auf mich herab. Stets im Galopp, veränderte sich das Tier zwischen meinen Schenkeln, wurde zum Esel, dann zum Bernhardiner. Hals über Kopf kugelte ich in einen Heuballen.
Kichernd beobachtete mich eine junge Frau, die aus einigen Garben krabbelte.
„Das passiert mir öfter“, sagte ich so lässig ich konnte.
„Was du nicht erzählst.“
Ich erinnerte mich an mein ursprüngliches Begehren. „Ist hier irgendwo ein Unterschlupf für eine Gesellschaft?“
„Ich verstehe dich nicht. Wo willst du eine Gesellschaft hernehmen?“
„Lass das meine Sorge sein“, wehrte mich energisch.
„Nicht so frech, mein Kleiner. Du verkennst die Tatsachen. Diese Suche kannst du dir schenken.“
„Das magst du so sehen. Ich handle in einem Auftrag.“
„Dann darf ich dich trösten“, erwiderte sie, „an dieser Stelle kommt er zur Ruhe, deine Order wurde bedeutungslos.“
„Entscheidest du das?“
„Ich? Von wegen! Das entscheidet der General!“
„Lass mich mit Kriegsmenschen in Ruhe, von denen habe ich die Nase gestrichen voll.“
„Das magst du der Weide erzählen, die vorne am Fluss steht. Sie wird ihre schlanken Ästchen schwingen und in sich hineinlachen.“
„Genau, das ziehe ich vor.“
„Dem General entkommt keiner!“ Ihr Tonfall wurde aggressiv.
„Wir sind allein auf weiter Flur.“
„Du kannst dich drehen und wenden, wie du willst, stets wirst du auf ihn zugehen.“
Im selben Augenblick war sie verschwunden.
Der Bernhardiner war unterdessen zur Maus mutiert und rettete sich in ein unscheinbares Loch.
Stille, kein Windhauch.
Ein leichtes Zittern in der Erde war womöglich der Vorbote eines Erdbebens. Ich entschied, mich niederzusetzen und abzuwarten.
Weitere Erdstöße folgten und wurden immer heftiger. Selbst im Sitzen kam ich aus der Haltung. Die Erde brach an verschiedenen Stellen auf. Aus den Löchern drückten sich, Pilzen gleich, Gebäude und wuchsen zu gläsernen Palästen im Jugendstil. In jener Kunstrichtung, mit der die Welt gerade schwanger ging, schlossen sie die Entfaltung ab. Fünf insgesamt, zählte ich.
Beeindruckt umrundete ich die unterschiedlichen Hallen. Eingangstüren fehlten. An einer der nächstliegenden drückte ich meine Nase breit, um im Inneren etwas zu erkennen.
Dunst, Nebel.
Eine Stimme überraschte mich „Was suchst du?“, fragte sie.
Ich wandte mich um. Ein Mann stand in meinem Rücken, eindeutig der General.
„Was hat es mit all dem auf sich?“, wollte ich von ihm wissen.
Dieses Gesicht hatte ich schon einmal gesehen. Lange Zeit lag es zurück und doch war mir jede Falte, jeder Zug so nahe, dass es keinen Zweifel gab.
„Du hast ins Spieleland gefunden.“
„Spieleland“, wiederholte ich, intensiv grübelnd, wohin ich ihn stecken musste.
„In den Hallen wird gespielt, gepokert, eine Art Olympia oder Ausscheidung. Die Interpretation stelle ich frei.“
Da war es! Er war mir vor diesem höllischen Fluch, der mich in die Vergangenheit geworfen hatte, begegnet. Die Kapelle kam mir in Erinnerung. Der Typ war damals mit einer Frau an der Seite eine Allee entlanggekommen. Beißende Gefühle rief die aktuelle Begegnung in mir hervor.
„So wird es einen Sieger geben, der gefeiert wird. Ich wünsche ihm alles Gute.“ Unbedingt drängte es mich, den ungemütlichen Kontakt abzuwürgen.
Entschlossen wandte ich mich ab und schritt davon.
„Halt ein!“, brüllte er mir nach. „Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du beugst dich dem, was ich vorgesehen habe, oder ich zitiere deinen Sohn, Silve, herbei und er hat alles unter Peitschenschlägen zu ertragen!“
Erstarrt blieb ich stehen.
Ich wandte mich um.
„Was verlangst du?“
„Wir wandern von Halle zu Halle. Solange du von außen die Spiele beobachtest, besteht keine Gefahr. Gelingt es dir, in ein Haus zu kommen, wirst du Teil eines Matchs.“
„Und das ist vorgesehen?“
„Es liegt in meiner Hand.“
„Du hast einen festgelegten Anfangspunkt im Auge? Ist es so?“
„Langsam, du Wilder. Damit wir uns richtig verstehen, du stehst vor fürstlichsten Ausschei-dungsspielen.“
„Sie finden gerade statt?“
„Haben stattgefunden oder werden stattfinden.“
„So wird die erste Begegnung Geschichte sein.“
„Das Ereignis findest du in Halle 1855.“
„Eine Jahreszahl?“
„Sie dient der Orientierung.“
„Muss ich etwas wissen, um alles zu verstehen?“
„Du bist Teil des Gewesenen. Das genügt.“
Mit gemessenem Schritt wagte ich mich an die erste Scheibe.
„Zwei Personen?“
„Sultan Abdülmecid I. und Zar Nikolaus.“
Beide kletterten, sich im Auge behaltend, auf einen Hochsitz. Unter ihnen veränderte sich die Bodenplattform. Kleine Punkte formten sich zu Quadraten und am Ende hatte sich zwischen den Herrschern ein Schachbrett aufgetan. Zwei Heere in verschiedenen Farben, nicht schwarz, nicht weiß, nahmen Aufstellung. Auf Geheiß stürmten sie aufeinander zu, nicht geordnet, wie es die Spielregel vorsah, sondern unbeherrscht und brutal. Die Bauernreihe wälzte sich nach kürzester Zeit im Blut. Die Despoten beorderten auf einen Wink neuen Reihen aufs Feld.
„Das ist kein Sport, das ist Krieg“, fauchte ich den General an.
„Stelle dich nicht so naiv. Das ist das Vergnügen, die Unterhaltung der Könige und Kaiser, - wie immer du es nennen willst.“
„Es sind Menschen, die dabei sterben!“
„Dafür sind sie geschaffen! Welchen Nutzen hätten sie ansonsten? Es gehört zur Verantwortung von Königen, Chancen zur Machtentfaltung auszuloten und zu testen, wie weit man sich vorwagen kann.“
„Langsam“, bremste ich den Redefluss des unliebsamen Typs ab, „das alles ist billiges überholtes Gerede.“
„Du siehst doch selbst, was passiert“, hielt er mir verächtlich entgegen.
„Beim Wiener Kongress“, betonte ich nachdrücklich, „einigten sich die Großmächte über Regeln und Lösungen, allein mit dem Wunsch, Kriege zu vermeiden. Sie lernten, miteinander zu sprechen und …“
„Und?“, unterbrach er mich. „Einen Weltenbrand wünschte sich keiner, doch war das Gefühl für die Rangfolge verlorengegangen. Diese Kenntnis ist für jeden Regenten elementar. Das Bedürfnis entbrannte, den Ist-Stand abzurufen.“
Während er sprach, verfolgt ich das makabre Spiel weiter. Eine Partei waren Türken, somit ein Volk, das am Wiener Kongress außen vor geblieben war. Ich unterstellte daher, dass dieses Abtasten der eigenen Stärke außerhalb der Grenzen derTeilnehmer stattgefunden hatte. Jetzt fiel mir der Himmel über den Streithengsten auf. Nebelschwa-den in unterschiedlicher Dichte gestalteten sich zu Bildern, gar kleinen Filmen, die im Zusammenhang mit dem Blutbad stehen mussten. Der General las meine Gedanken.
„Vergiss, was sich am Himmel tut. Es sind Trugbilder, Kriegsgründe, künstlich herbeigezogen, um den militärischen Abgleich moralisch zu rechtfertigen.“
Ich schwieg. Er, der General, sprach von Moral. Wie Hohn kam es bei mir an.
Mir halfen die Erscheinungsbilder am Firmament, die ich mit dem Spiel abglich, die Sachlage zu verstehen. Es gesellte sich eine Intuition dazu, die alles ausleuchtete.
Die Rechte der Mönche im Heiligen Land waren bedroht. Der Zar fühlte Fürsorge für die Orthodoxen, Napoleon III. für die Katholiken. Allein wegen dieser Tatsache war jede klare Konfrontation zwischen der Türkei und Russland verwischt. Es regierten die Interessen der Westmächte. Habsburg, Frankreich und England erhofften sich die Kastration des übermächtig gewordenen Russlands. Die Uniformenmischung im türkischen Feld brachten mir diese Erkenntnis nahe.
Die Wahrheit äußerte sich augenblicklich. Der Zar forderte die Türkei auf, die orthodoxen Mönche zu schützen. Die Briten, schlitzohrig im Hintergrund, drängten den Sultan, abzulehnen. Nikolaus war somit gezwungen, eine Machtdemonstration vom Stapel zu lassen. Er besetzte kurzerhand die Walachei und die Moldauregion. Die Kriegserklärung durch den Sultan war die logische Konse-quenz. Nie und nimmer war er den Russen gewachsen. Eine Niederlage zur See zeigte die Kraftlosigkeit der Orientalen. Die Westmächte, aufgeschreckt, da eine weitere Machterweiterung der Slawen deutlich wurde, forderten den Rückzug Russlands aus dem Schwarzen Meer. Der Zarschwieg. Frankreich und England kamen dadurch in die Not zu handeln und erklärten Russland ebenfalls den Krieg. Alle achteten darauf, dass der Kriegsherd auf engstem Raum blieb, zentriert auf die Krim.
Eine seltsame Wendung beobachtete ich. Zar Nikolaus I. fiel von seinem Hochsitz und knallte auf die Erde.
„Was ist das?“, rief ich aus.
„Es ist um ihn geschehen.“
„Er ist tot? Ich sah nicht, dass ihn ein Geschoss traf.“
„War nicht notwendig. Schüttelfrost, Lungenentzündung - solch elementares Zeug raffte ihn dahin.“
„Und jetzt? Es wird ja ein Nachfolger bereitstehen.“
„Zar Alexander II. Aber vergeude deine Gedanken nicht an Nebensächlichkeiten. Schau dir das neue Bauernheer der türkischen Seite an.“
„Was heißt türkische Seite? Franzosen und Engländer sind darunter.“
„Und?“
„Grüngefärbte sind mitunter dabei. Bis gerade eben haben sie gefehlt.“
„Aktuell eine Nebensache. Es sind Krieger aus dem Piemont. Der Minister Graf Cavour hat sie entsandt.“
„Warum lenkst du mein Augenmerk darauf?“
„Es ist gesagt, das genügt.“
„Was geschieht jetzt? Ist es ein Kaiser, der zu Zar Alexander hochklettert?“
„Gut erkannt. Kaiser Franz Josef I.“
„Er will an die Seite des Zaren in den Krieg treten?“
„Du bist ein Narr. Bedenke, der Balkan brennt und wer ist der Herr des Balkans?“
„Der Habsburger.“
„Kaiser Franz Josef ist nur an einem interessiert, am Kriegsende.“
„Kann er den Zaren überzeugen?“
„Mit leichtem Druck, er flüstert ihm seine Kriegserklärung ins Ohr.“
„Was soll dein Gerede? Jetzt haben wir den europäischen Krieg komplettiert.“
„Wäre es so gewesen. Alexander sprach von einem Krieg ohne Feindschaft, schmunzelte zu dem Ganzen und zog sich zurück.“
„Kriegsende? Ich sehe kein Ergebnis.“
„Täusche dich nicht. Die Türkei ward ins Konzert der Mächte aufgenommen und Russland beim Kampf um Platz eins ausgeschieden. Was wollte man mehr?“
Ich schaute auf das Trümmerfeld. 500.000 Tode. Der Löwenanteil fand durch Kälte, fehlende Medizin und Hunger den Untergang. Der Fall einer Festung, Sebastopol, hatte den endgültigen Ausschlag zur Befriedigung gegeben.
„Gehen wir weiter?“, drängte der General. „Die nächste Arena wartet.“
„Du willst damit nicht sagen, es folgt Krieg um Krieg?“
„Hast du es noch nicht begriffen? Ein Ausscheidungswettkampf um Europas Festlandplatz spielt sich ab. Bist du nicht auf den Titelgewinner ge-spannt?“
„Wer wird sich jetzt gegenüberstehen?“
„Napoleon III. und Kaiser Franz Josef. In Halle 1859.“