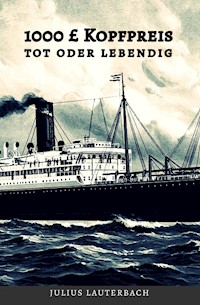
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der aus dem Gefangenenlager von Singapur entflohene Prisenoffizier der "Emden" Julius Lauterbach entgeht mit List und Kühnheit allen englischen Nachstellungen und entkommt unter den unglaublichsten Abenteuern über Sumatra, Java, die Philippinen, China, Japan und Amerika in die Heimat. Das letzte Gefecht der S. M. S. Emden überlebte Lauterbach und so wurde ihm das Recht verliehen, den vererbbaren Zusatznamen "Emden" zu führen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 181
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1000 £ Kopfpreis - tot oder lebendig
Fluchtabenteuer des ehemaligen Prisenoffiziers S. M. S. „Emden“
von
Julius Lauterbach
Kapitänleutnant der Reserve
______
Erstmals erschienen bei:
August Scherl G.m.b.H., Berlin, 1917
__________
Vollständig überarbeitete Ausgabe.
Ungekürzte Fassung.
© 2016 Klarwelt Verlag
ISBN: 978-3-96559-023-6
www.klarweltverlag.de
Inhaltsverzeichnis
Titel
Ein unerwünschtes Kommando
Gefangen
Der Inderaufstand von Singapore
In Ruderbooten über die Malakkastraße
Durch Urwald und Steppe quer durch Sumatra
In Hangen und Bangen
An Bord des „Pynacker Hordycke“
Im offenen Eingeborenenboot über die Celebessee
Längs der Küste von Mindanao
Eine tolle Nacht im Gebiet der Kopfabschneider
Auf der „Ataka Maru“ als Holländer unter Japanern
Den Mordgesellen entwischt
Ein wunderbarer Zufall
Zwischen Japan und Amerika
Nach berühmtem Muster
Letzte Abenteuer und Heimkehr
Die Heimfahrt Kapitänleutnant Lauterbachs
Ein unerwünschtes Kommando
Am Abend des 7. November 1914 befand sich unsere „Emden“ auf dem mit Kohlendampfer „Exford“ verabredeten Treffpunkt in der Nähe der Kokosinseln. Wir blickten nach allen Seiten scharf aus, doch von dem Erwarteten ließ sich keine Spur entdecken. Dafür hörten wir englische Kreuzer von Stunde zu Stunde stärker funken. Die Sorge, „Exford“ könne ihnen zur Beute gefallen sein, ließ sich nicht mehr abweisen.
In der Frühe des folgenden Morgens sollte der Erste Offizier, Kapitänleutnant von Mücke, mit einem Landungskorps die Funkenstation zerstören. Dieses Unternehmen wurde nun um einen Tag verschoben. Zunächst wollte der Kommandant über das Schicksal der „Exford“ Gewissheit haben. Die ganze Nacht fuhren wir suchend umher, und aus immer bedrohlicherer Nähe gaben die Feinde von ihrem Dasein Kunde. Eine höchst ungemütliche Geschichte.
Nach Tagesanbruch kam unsere schon verloren geglaubte „Exford“ endlich in Sicht. Wie ihr Kommandant meldete, hatte er nur für die Nacht sicheres Wasser aufgesucht.
Fregattenkapitän von Müller, der eine Zeitlang nachdenklich auf und ab geschritten war, blieb vor mir stehen. „Trauen Sie sich zu, ohne Offiziere ein Schiff zu führen?“
Da ich zehn Jahre lang als Kapitän der Hamburg-Amerika-Linie in Ostasien Passagierdampfer gefahren hatte, brauchte ich zu der Antwort keine Bedenkzeit; aber ich ahnte schon nichts Gutes, als ich bejahte. „Dann können Sie ja ‚Exford‘ in Sicherheit bringen. Ich habe das Gefühl, dass wir bald ins Gefecht kommen. Der langsame Kohlendampfer wäre dann verloren.“ Meinen Gefühlen entsprechend wird sich bei diesen Worten mein Gesicht stark in die Länge gezogen haben, denn unser allverehrter Kommandant fuhr fort: „Gucken Sie mich nicht so traurig an, Lauterbach. Sie haben bis jetzt alles mitgemacht, als Prisenoffizier und bei Penang sogar besondere Dienste leisten können. Gropius hat mich dringend um Ablösung gebeten, und wenn es zum Gefecht kommt, brauche ich hier möglichst viele Offiziere. In spätestens zwei bis drei Tagen gedenke ich Sie eingeholt zu haben, und dann nehme ich Sie gleich wieder an Bord.“
Ich merkte die gute Absicht, durch diese freundlichen Worte den bitteren Trank zu versüßen, aber es fiel mir doch recht schwer, ihn zu schlucken. Natürlich gab es da keine Einwendungen zu machen. Ich sagte „Zu Befehl“, schlug die Hacken zusammen und machte mich daran, meine Sachen zusammenzupacken. Nicht gerade in rosigster Stimmung, wie man mir wohl nachfühlen wird. Wir alle an Bord fühlten uns mit unserer „Emden“ verwachsen. Und gerade jetzt, wahrscheinlich in der kritischsten Lage, sollte ich das Schiff verlassen und den großen Kohlenkasten in Sicherheit bringen, während die Kameraden heißen Kämpfen und neuen Ehren, wie wir hofften, entgegenfuhren. Wie ausgestoßen kam ich mir vor. Dass der Kommandant recht hatte und ich unter den besonderen Umständen auf „Exford“ der gemeinsamen Sache am besten dienen konnte, war mir durchaus kein Trost.
Das Packen war schnell erledigt. In der Hoffnung, in wenigen Tagen wieder an Bord zu sein, nahm ich nur das Notwendigste mit. Auf dem andern Fahrzeug sollte ich ja nur eine kurze Gastrolle spielen. Ich klammerte mich förmlich an diesen Gedanken. Jede andere Vorstellung war mir unerträglich. Kapitänleutnant Gropius empfing mich freudestrahlend. Seine gute Stimmung war leicht erklärlich. Schon Ende September war er von „Emden“ entlassen worden, und drei lange Wochen hatte er hier gelegen und auf uns gewartet. Auch aus den Gesichtern der beiden andern Offiziere leuchtete das Glück, endlich von diesem stumpfsinnigen Kommando erlöst zu sein. Dazu stand ihnen in Aussicht, mit Kapitänleutnant v. Mücke an Land zu kommen. Ihr Gepäck lag schon zum Einschiffen bereit. Mit fröhlichen Abschiedsrufen fuhren sie wenige Minuten später im Kutter davon.
Tagsüber hielten sich „Exford“ und „Buresk“, der zweite Kohlendampfer, noch in der Nähe des schmucken, grauweißen Kreuzers. Um sechs Uhr wurde „Exford“ entlassen. Kapitän von Müller wünschte uns gute Reise, was ich mit Signal: „Wünsche guten Erfolg!“ erwiderte. Dann gab man uns noch die Warnung: „Englische Kreuzer in der Nähe!“ mit auf den Weg — das Letzte, was ich von unserer „Emden“ hörte.
Blutrot ging die Sonne unter. Als ich in diesem wunderbaren, tropischen Farbenspiel das schmucke Schiff verschwinden sah, übermannte mich plötzlich das Gefühl: „Du siehst es niemals wieder.“
Neben mir blickte Bootsmann Müller, ein ehemaliger Bootssteuerer des Kutters S. M. S. „Hohenzollern“ der „Emden“ nach. Er nickte schweigend mit dem Kopf, als ich ihm gegenüber meine Ahnung aussprach. Offenbar hatte er das gleiche gedacht.
Dieser Bootsmann, ein Maschinist, dreizehn „Emden“- Matrosen und siebzehn Chinesen von dem aufgebrachten englischen Dampfer „Troilus“, die gegen Bezahlung Heizerdienste taten, das war meine ganze Besatzung. Ich hatte schriftlichen Befehl, auf einem ungefähr tausend Seemeilen entfernt liegenden Punkt die „Emden“ zu erwarten, bis der Proviant ausging, fuhr also mit dem bestimmten Kurs gemächlich in die Nacht hinein.
Unsere erste Arbeit war die Einrichtung einer von dem versenkten Dampfer „Chilkana“ stammenden Funkenstation. Zwar konnten wir nie selber Nachricht geben, doch fingen wir in den nächsten Tagen viele Funkenmeldungen auf. Sie waren chiffriert, für uns also nicht zu entziffern: immerhin ließen sie darauf schließen, dass etwas Besonderes sich ereignet haben musste. Tag auf Tag verging, ohne dass wir trotz eifrigsten Ausschauens etwas von der „Emden“ sahen. War es da ein Wunder, dass wir diese lebhafte Funkerei mit ihrem Schicksal in Verbindung brachten?
Ja, man mochte innerlich noch so sehr gegen trübe Gedanken ankämpfen und die Leute auf ein baldiges frohes Wiedersehen vertrösten: mit den Tagen und Wochen tatenlosen Wartens verblasste allmählich der letzte Hoffnungsschimmer. Selbstverständlich kam das in unserem Tun und Treiben nicht zum Ausdruck. Ebenso wenig in unseren Worten. Schwarzseherische Redensarten waren verpönt. Mit jedem Wachewechsel nahmen wir Besteck, um uns ja auf dem richtigen Platz zu halten, und von früh bis spät wurde vom Ausguck der Horizont abgesucht. Doch kein Schiff kam in Sicht, denn mit Absicht war uns ja eine Gegend angewiesen worden, die abseits jeder Fahrstraße lag.
Die Leute zu beschäftigen, war wirklich keine Kleinigkeit. Im beständigen Kampfe gegen die Langeweile war jeder Zeitvertreib willkommen. Die Leute überholten ihr Zeug, und wie in alten Segelschiffszeiten habe auch ich kunstgerecht meine Unterhosen geflickt. Wäre nur das Wetter nicht so abscheulich gewesen! Wir befanden uns im Gebiet der Kalmen, litten unter wahnsinniger Hitze, und dabei goss es tagtäglich wie aus Kübeln vom Himmel herunter, ohne auch nur im geringsten Abkühlung zu bringen. Als Dusche war uns der Regen immerhin willkommen, und jedes Mal entwickelte sich an Deck ein höchst ungezwungener Badebetrieb.
Das Arbeiten des Schiffes im schweren Seegang war natürlich weit davon entfernt, das Leben an Bord gemütlicher zu machen. Nachts auf der Brücke meinte einmal der wachhabende Unteroffizier in allem Ernst: „Herr Oberleutnant, ich glaube, der Kasten fällt um.“ Für jemand, der zur Seekrankheit neigt, war „Exford“ jedenfalls nicht ein empfehlenswerter Aufenthalt.
Auch nicht für Freunde einer guten Küche. Dem erhaltenen Befehle gemäß hielt ich es für meine Pflicht, den Proviant möglichst in die Länge zu ziehen. Als alter Ostasienfahrer wusste ich, wie ungern Chinesen ihre heimatlichen Gerichte, vor allem Reis, entbehren: doch hier halfen ihnen keine Klagen: an Bord der „Exford“ lernten sie Kartoffeln essen. Auch für uns Europäer schrumpfte die Auswahl der Gerichte immer mehr zusammen. Erst als am Ende der vierten Woche von „Emden“ immer noch nichts zu sehen war, Kartoffelpuffer unsere einzige Nahrung bildeten, und auch diese nur noch wenige Tage geboten werden konnten, hielt ich den von Kapitän Müller vorgesehenen Zeitpunkt für gekommen. In dem an der Westküste Sumatras gelegenen holländischen Hafen Padang hofften wir Näheres über das Schicksal unseres Mutterschiffes zu erfahren.
Gefangen
Bei regnerischem, stürmischem Wetter bekamen wir am Morgen des 11. Dezember die der Küste vorgelagerten Inseln in Sicht. Auf gut Glück mussten wir uns durchtasten. Eine Seekarte besaßen wir nicht, und auf der an Bord befindlichen Karte des Indischen Ozeans waren nur die größten der vor uns liegenden Inseln als kleine Pünktchen verzeichnet.
Bis auf ungefähr fünf Meilen hatten wir uns neutralem Grund und Boden genähert, als wir gerade vor Padang eine Rauchwolke auftauchen sahen. Die erste seit unserer Trennung von der „Emden“. Volle vier Wochen hindurch war uns kein Fahrzeug begegnet.
Während wir gespannt der neuen Erscheinung entgegenblickten, meldete unser Funkentelegraphist: „In der Nähe funkt ein holländischer Postdampfer.“ Das klang ja recht beruhigend, aber ich traute dem Frieden nicht. Um ganz sicher zu gehen, änderte ich den Kurs und hielt auf die nächste Insel zu. Innerhalb der neutralen Dreimeilenzone wollte ich abwarten, als was sich der andere entpuppte.
Auch wir hatten offenbar sein Interesse geweckt. Mit äußerster Kraft lief er geradeswegs auf uns zu. Und nun dauerte es nicht mehr lange, da konnte ich mit Gewissheit feststellen, dass ich einen alten Bekannten vor mir hatte: „Empreß of Japan“, einen großen englischen Passagierdampfer der Linie Vancouver—Japan—China, in dessen Nähe ich oft friedlich geankert hatte, und der nun als Hilfskreuzer diente. Über seine Absichten war ich keinen Augenblick im Zweifel, und wenn ich es gewesen wäre, hätte mir das Signal „M N“, mit dem wir auf der „Emden“ unsere Unterhaltung mit fremden Schiffen einzuleiten pflegten, Gewissheit verschafft. „Stoppen Sie sofort!“ bedeutete es, und zwei Schüsse vor den Bug bekräftigten den Befehl. Aber wir befanden uns doch jetzt längst innerhalb des neutralen Gebietes! Ach, wann wäre es dem edlen Briten auf einen Völkerrechtsbruch mehr oder weniger angekommen?! Ich sah klar vor Augen, was uns bevorstand, und ehe „Exford“ stilllag, hatte ich schon den Befehl gegeben, geheimzuhaltende Schriftstücke sowie die Flagge zu verbrennen, wichtige Teile unserer F. T. Station über Bord zu werfen, den Kompass aus seinem Gehäuse zu nehmen, ihn zu vernichten und durch den Kompass des Handruders zu ersetzen, der die Richtung um volle vier Strich verkehrt anzeigte.
Während dies ausgeführt wurde, kam von drüben ein Boot herangerudert. Ein junger Leutnant stieg an Bord und bat um die Papiere.
Mit der nötigen Entschiedenheit verlangte ich, dass die holländische Neutralität geachtet werde.
Der Engländer zuckte lächelnd die Schultern. „Sagen Sie das meinem Kommandanten. Ich habe den Befehl, Ihr Schiff aufzubringen.“
Jedes weitere Wort wäre Kraftverschwendung gewesen und hätte in dem andern nur das Gefühl der Überlegenheit gestärkt. Ohne ihn noch eines Blickes zu würdigen, befahl ich meinen Leuten, ihr Hab und Gut zusammenzupacken. Schon näherte sich ein zweites Boot mit der Prisenbesatzung. Wir Europäer sollten auf den Hilfskreuzer gebracht werden, die Chinesen dagegen an Bord bleiben.
Auf der „Empreß of Japan“ empfing mich der Erste Offizier. Während wir schweigend zur Brücke emporstiegen, stellte ich mir im Geist zusammen, was ich dem Kommandanten über sein Verfahren sagen wollte, und ich kann versichern, dass der kleine, rotbärtige Mann recht kräftige Worte von mir zu hören bekommen hat. Es half natürlich nichts, erleichterte aber wenigstens mein erbittertes Gemüt. „Das können Sie den Leuten in Berlin erzählen“, war alles, was er auf meine Rede erwiderte.
Nun fragte er nach der Zahl meiner Besatzung und schien sehr verwundert, dass sie nicht größer war. Schon der Leutnant hatte offenbar etwas anderes erwartet und das Schiff durchsuchen lassen, als ob ein Teil versteckt sei.
Nun erfuhr ich den Grund. „Empreß of Japan“ war von Singapore hierher geschickt worden, um einen „Emden“-Offizier und fünfzig Mann aufzubringen, die sich von den Kokosinseln auf einem Segler nach Padang durchgeschlagen und von dort ihre abenteuerliche Reise fortgesetzt hatten. Tags zuvor sei ein deutscher Dampfer ausgefahren, offenbar, um sie zu unterstützen, und für diesen habe man „Exford“ gehalten.
So erfuhr ich von v. Mückes kühner Tat und dem traurigen Schicksal unserer „Emden“. Ich muss es den Engländern lassen, dass, sie die für sie erfreuliche Zerstörung des erfolgreichen deutschen Kreuzers in durchaus taktvoller Weise berichteten.
Auch sonst kam die Achtung vor seinen Leistungen zum Ausdruck. Als ich unten als Gefangener den Dolch abbinden wollte, sagte der Erste Offizier: „Auf Befehl des Königs von England bleibt den Offizieren der ‚Emden‘ die Waffe.“
Die ganze folgende Nacht hindurch wurden die verschiedenen Inseln mit Scheinwerfern nach „Ayesha“ und „Choising“ abgesucht.
Im Übrigen führte die aus Engländern und Franzosen gemischte Besatzung des Hilfskreuzers ein beneidenswert gemütliches Dasein. Wenn man Offiziere und Mannschaften sich mit Eifer ihren Bordspielen hingeben sah, glaubte man, sich eher auf einem Vergnügungsdampfer als auf einem Kriegsschiff zu befinden. Dienst unterbrach nur in sehr bescheidenem Maße die allgemeine Fröhlichkeit. Aber auch wir Gefangenen hatten keine Ursache, uns zu beklagen.
Meine Leute blieben auf das Vorderdeck beschränkt, mir jedoch stand das ganze Schiff frei. Zwar begleitete mich auf allen Gängen ein Mann mit aufgeplanztem Bajonett, aber wenn ich sagte: „Hole mir eine Flasche Bier!“ dann stellte er sein Gewehr in die Ecke und beeilte sich, meinen Wunsch zu erfüllen. Uniformknöpfe und Mützenbänder der „Emden“ waren stark begehrt, aber selbstverständlich nicht zu haben.
Als wir nachts die Bankastraße durchfuhren, kam der Navigationsoffizier, ein sehr netter, wohlwollender Herr, zu mir in die Kabine und sagte: „Ich weiß in diesen Gewässern nicht recht Bescheid. Wollen Sie nicht auf die Brücke kommen und bei der Navigation helfen?“
Das war doch wirklich der Gipfel der Gemütlichkeit! Konnte es überhaupt ernst gemeint sein? In meiner ersten Verblüffung war ich versucht, daran zu zweifeln, doch der Engländer sah nicht aus, als ob er scherze.
Ich fühlte mich natürlich hochgeehrt über diesen Vertrauensbeweis und habe sicher sehr vergnügt drein geschaut. Umso erstaunter wird der freundliche Herr über meine Antwort gewesen sein.
„Gut, ich komme, aber dann wird Ihr Schiff binnen einer Minute festsitzen.“
„Dann möchte ich doch lieber unten bleiben“, meinte er darauf mit sauersüßem Lächeln.
Bei der Nähe des Landes lag der Gedanke nahe, über Bord zu springen und schwimmend holländischen Boden zu erreichen. Glücklicherweise war mir bekannt, wie zahlreich Menschenhaie diese Gewässer bevölkern. Als hier der französische Passagierdampfer „La Seine“ unterging, sind die meisten Menschen diesen unheimlichen Meeresbewohnern zum Opfer gefallen.
Es gibt rühmlichere Todesarten. Die Vorstellung, auf diese Weise ums Leben zu kommen, bewirkte jedenfalls, dass ich die Ausführung meiner Fluchtpläne auf eine günstigere Gelegenheit verschob. Sobald wie irgend möglich auszukneifen, war ich von Anfang an fest entschlossen.
Der Inderaufstand von Singapore
Gleich nach der Ankunft wurden wir Deutschen in Automobilen nach dem in der Mitte der Singapore-Insel gelegenen Gefangenenlager „Tanglin Barracks“ befördert. Freudig erregte Stimmen schallten uns aus dem Innern der Einfriedigung entgegen, und als wir unser künftiges Gefängnis betraten, begrüßten uns ein kräftiges Hurra und der Gesang: „Deutschland, Deutschland über alles“. Nun folgte ein großes Händeschütteln, Fragen und Erzählen, denn unter den dreihundert Internierten besaß ich viele Bekannte: Großkaufleute, Kapitäne, Schiffsoffiziere, die Besatzung unseres Kohlendampfers „Markomannia“, das Prisenkommando des von uns zuerst gekaperten Griechen — sie und viele andere umdrängten uns und wollten von unseren Erlebnissen hören. Gleich am Abend gab es ein großes Fest, wobei allerdings die gute Stimmung der Teilnehmer die leiblichen Genüsse und was sonst zu einer Festlichkeit zu gehören pflegt, ersetzen mussten. Mit der Verpflegung und mehr noch mit den Wohnverhältnissen war es nämlich übel bestellt. Je hundert Mann schliefen in einer Baracke, Großkaufleute und Schiffsheizer im schönsten Durcheinander. Fieber und Dysenterie waren an der Tagesordnung. Auf alle Beschwerden hatte Lord Kitchener aus London kurz geantwortet, dass die Einrichtungen für die Deutschen genügten. Den Engländern blieb diese Entscheidung natürlich maßgebend.
In vielen Stücken hatten sich unsere Landsleute schon selbst zu helfen gewusst. Aus Bierkisten waren Möbel entstanden, und die Wohlhabenden sorgten dafür, dass die Mittellosen nicht allein auf die britische Gastfreundschaft angewiesen blieben. Turnverein, Gesangverein, Lesezirkel, Billard- und Kegelklub boten Unterhaltung. Auch der zwei Minuten vom Lager entfernte Sportplatz durfte benutzt werden, wobei Soldaten mit aufgepflanztem Bajonett die Spieler beobachteten.
Der Lagerkommandant stellte mir Vergünstigungen in Aussicht, wenn ich mein Ehrenwort geben wolle, nicht zu fliehen. Meine Antwort, dass ich nach dem Völkerrechtsbruch, der mich zum Gefangenen gemacht habe, keinem Engländer mein Ehrenwort geben wolle, schien ihm nicht zu gefallen. Immerhin besann er sich auf den allgemein anerkannten Grundsatz, dass gefangene Offiziere nur mit ihresgleichen untergebracht werden dürfen, und da ich hier der einzige war, auf den diese Regel Anwendung finden konnte, erhielt ich ein kleines Haus für mich allein angewiesen. Reserveoffiziere, die nicht im Krieg die Uniform getragen hatten, wurden nicht anerkannt und ganz wie andere Zivilgefangene behandelt.
Ich lebte mich schnell ein, aber schon vom ersten Tage an beschäftigte mich der Gedanke, wie ich diesem unerfreulichen Aufenthaltsort heimlich den Rücken kehren könnte. Bald fand ich einige beherzte Männer, die auf das gleiche Ziel hinstrebten. In meinem Hause konnte ich nach Belieben Gäste empfangen, und so hatten wir die schönste Gelegenheit, in stundenlangen Zusammenkünften unauffällig Pläne zu schmieden, über Mangel an Geselligkeit konnte ich mich überhaupt nicht beklagen. Allein bei mir durfte die ganze Nacht Licht brennen. Dass ich zweitausend Dollar besaß, band ich den Engländern natürlich nicht auf die Nase. Bei der flüchtigen Untersuchung waren die gut versteckten Scheine unbemerkt geblieben.
Ein zwei Meter hoher Wellblechzaun, Stacheldrahtverhaue und elektrische Drähte umschlossen das Lager, und draußen stand alle hundert Meter ein Posten auf einer kleinen Tribüne, von der aus er das ganze Lager überblicken konnte. Innerhalb dieser Einfriedigung wurden wir dreihundert Internierten von einigen zwanzig Engländern und achthundertfünfzig Indern bewacht, die ehemals in unsern Baracken gehaust hatten und nun in einer ganz in der Nähe stehenden Kaserne wohnten. Ein Kinderspiel war es also gerade nicht, unbemerkt zu verduften.
Eins war uns bald klar: nur durch einen unterirdischen Gang, der außerhalb der Drahtverhaue mündete, konnte die Flucht gelingen.
Eine geeignete Stelle hatten wir bald gefunden, und ehe zwei Wochen nach meiner Einlieferung verstrichen waren, leitete der erste Spatenstich das verheißungsvolle Werk ein. So pflegt man ja in solchem Falle zu sagen. In Wirklichkeit begannen wir damit, die vom Sonnenbrand verhärtete Oberschicht mit Messern zu lockern. Richtiger Spaten konnten wir uns erst später bedienen.
Aus triftigen Gründen hielten wir unser Tun auch vor unsern Landsleuten ganz geheim. Spione befanden sich im Lager. Gefährlicher als die beiden japanischen Barbiere waren einige Elsässer, die alles, was sie aufschnappten, den Engländern verrieten. Durch aufgefangene Briefe, in denen sie den Wunsch aussprachen, gegen die Boches zu kämpfen, war der Verdacht zur Gewissheit geworden. Bei dem Mangel an Gesprächsstoff hätten sie gar zu leicht durch ein unvorsichtiges Wort Wind von der Sache bekommen können, und dadurch wollten wir unsere Hoffnung, die unser ganzes Sein erfüllte, nicht zuschanden werden lassen.
Es war ein mühseliges Werk, das da allnächtlich im geheimen vor sich ging, und die Schwierigkeit wurde noch größer, als bald die Regenzeit einsetzte und das Erdreich ausweichte. Bierkisten, die glücklicherweise in nicht geringen Mengen zur Verfügung standen, lieferten die Stützen. Nach jeder Schicht wurde die Öffnung mit einem Deckel verschlossen, und wenn dann die sorgfältig ausgehobenen Rasenstücke darüberlagen, hob sich die Stelle kaum von ihrer Umgebung ab.
Um keinen der deutschen Mitverschworenen zu schädigen — Gott weiß, wo sie jetzt stecken mögen — muss ich es mir leider versagen, ihre Namen zu nennen: aber es drängt mich doch, auch an dieser Stelle den Männern zu danken, die freiwillig die Hauptarbeit leisteten, indem sie zwei Monate lang einen großen Teil ihrer Nachtruhe opferten und im Schweiße nicht allein ihres Angesichtes zwei Meter unter der Erde schanzten, und zwar nackend, wie sie Gott geschaffen hatte. Einer lag ganz vorn im Tunnel auf dem Bauch, lockerte die Erde und schob sie hinter sich: der zweite füllte sie in der gleichen unbequemen Stellung in einen Kopfkissenüberzug: der draußenstehende dritte förderte sie mit Hilfe eines starken Bindfadens ins Freie und verteilte sie auf Blumenbeets und andere gärtnerische Anlagen, mit denen sich die Gefangenen in den Morgenstunden beschäftigten. Wenn dann noch der Sicherheit halber in die frisch aufgeworfenen Erdhügel ein paar Blumen gesteckt wurden, konnte niemand auf den Gedanken kommen, welcher geheimen Maulwurfsarbeit sie ihre Entstehung verdankten.
Aber die Posten? wird man fragen. Nun, wir hatten uns natürlich einen möglichst günstigen Platz ausgesucht, keine drei Schritte hinter dem hohen Wellblechzaun, so dass der dahinter auf seiner Erhöhung stehende Inder nichts bemerken konnte und auch kein Strahl der Bogenlampen uns verriet.
Langsam, aber sicher wuchs der Weg in die Freiheit. Von Zeit zu Zeit wurde ein dünner Bambusstock durch die Decke gebohrt, und wenn wir dann am folgenden Tage von der nächsten Baracke aus über den Zaun blickten, stellten wir jedes Mal mit Freuds fest, dass schon vor dem zur Flucht in Aussicht genommenen 23. Februar der Gang über das letzte Hindernis hinaus gediehen sein werde. Diesen Tag hatten wir gewählt, weil dann Neumond war und wir nur in einer dunklen Nacht entwischen konnten. Ein Chinese war für unsern Plan gewonnen worden. Dadurch konnten wir Vorbereitungen treffen, die für das Gelingen unseres Planes unbedingt erforderlich waren: ein Boot und vertrauenswürdige Leute sollten uns in der Nacht des 23. Februar an einem bestimmten Punkt der Küste erwarten und nach der nächsten holländischen Insel befördern.





























