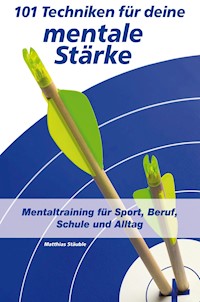
17,95 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Die 101 Sportmentaltrainingstechniken dieses Buches bieten dem Sportler, aber auch Alltagsmenschen die Möglichkeit, die mentale Stärke praxisnah zu trainieren, wodurch bereits vorhandene Fertigkeiten besser abgerufen werden können. Das Buch enthält unter anderem Mentaltechniken aus den Bereichen "klassisches Sportmentaltraining" (Bewegungsvorstellungstraining, Selbstgesprächsregulation, Anspannungsregulation, Motivation, Konzentration, Körpersprache, Zielsetzungen, Wettkampfvorbereitung, mentale Regeneration), "lösungsorientiertes Coaching" (Fragetechniken, Selbstcoaching-Methoden) und "imaginative Methoden" (Meditationen/innere Bildreisen zur Entspannung und Erfolgssteuerung). Ob im Sport oder Alltag: Das Buch liefert für alle jene Personen eine wertvolle Hilfestellung, die auf der Suche nach praxisorientierten Lösungsansätzen sind, welche die Leistungsfähigkeit, aber auch Lebensqualität positiv beeinflussen. Dank des einfachen und übersichtlichen Aufbaus - jede Mentaltechnik ist einem bestimmten Thema zugeordnet und in sich abgeschlossen - ist das Buch auch als Nachschlagewerk und stetiger Begleiter für die (Sport-)Tasche einsetzbar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 401
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Matthias Stäuble
101 Techniken für deinementaleStärke
Mentaltraining für Sport, Beruf, Schule und Alltag
© 2019 Matthias Stäuble
Layout und Umschlaggestaltung: Bernd Gottwald
Lektorat und Korrektorat: Edgar Haberthür
Fotos: Mike Gottwald, Bernd Gottwald, Fotolia, Shutterstock
Grafiken: Bernd Gottwald, Werner Kilchhofer
Druck und Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN Paperback: 978-3-7439-1726-2
ISBN Hardcover: 978-3-7439-1727-9
ISBN e-Book: 978-3-7439-1728-6
Das Werk, einschliesslich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Die Inhalte dieses Werks basieren auf der Meinung und Erfahrung des Autors und sind nach bestem Wissen und Gewissen geprüft. Die vorgestellten Techniken sind als Unterstützung zu sehen und können deshalb keine therapeutische Beratung oder allgemeine Trainingsberatung ersetzen.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Vorwort: Verlängerung wider Erwarten
Übungsauswahl für Schnellstarter
1
Warm-up: Was du über Mentaltraining wissen solltest
1.1
Wenn die Vorstellung zur Realität wird
1.2
Einsatzgebiete und Nutzen des Mentaltrainings
1.3
Leistungseinflussfaktoren für den sportlichen Erfolg
1.4
Umgang mit Emotionen
1.4.1
Die «drei Wellen»
1.4.2
Entstehung und Abbau von Emotionen
1.4.3
Häufige Fragen im Zusammenhang mit Emotionen und Gefühlen
1.5
Eine Übung zum Start – der Biss in die Zitrone
1.6
Zum Aufbau der einzelnen Kapitel
2
Visualisierung: Innere Bilder als Trainingswerkzeug nutzen
2.1
Einsatzmöglichkeiten
2.2
Noch gut zu wissen
2.3
Den perfekten Film gestalten – das Visualisierungs-Drehbuch
Technik 1:
Bewegungsabläufe und Verhaltensmuster trainieren
Technik 2:
Visualisierung und «echtes» Training kombinieren
Technik 3:
Wettkampfnachbereitung mithilfe der Visualisierung
Technik 4:
Mentale Trainings- und Wellnessinsel
Technik 5:
Gelungene und misslungene Aktionen vergleichen
Technik 6:
Den Alltag erfolgreich bewältigen
3
Bereit sein, wenn’s losgeht – die Wettkampfvorbereitung
3.1
Wenn einer eine (Wettkampf-)Reise tut…
3.2
Die Bedeutung von Störfaktoren
Technik 7:
Gute Vorbereitung ist die halbe Miete
Technik 8:
Drucksituationen trainieren
Technik 9:
Handlungsdrehbuch für meine Schlüsselmomente
Technik 10:
Der optimale Wettkampferregungsgrad
Technik 11:
Der Wettkampfzeitraffer
Technik 12:
Emotionale Zustände steuern
Technik 13:
Die imaginäre Garderobe – mein Rückzugsort
Technik 14:
Negative Gedanken verändern
Technik 15:
Imaginäre Schatztruhe (Belastungen ablegen)
Technik 16:
Der Gedankenmoderator (inneren Dialog regulieren)
Technik 17:
Das Fingermodell – auf Herausforderungen vorbereitet sein
Technik 18:
«KADI» – innere Balance vor Wettkampfbeginn
Technik 19:
In den Wettkampf «einsummen» (einstimmen)
Technik 20:
Gedankenkontrolle (Selbstgesprächsregulation)
4
Optimaler Anspannungsgrad rund um den Wettkampf
4.1
Zum Auftakt: Stress – doch besser als sein Ruf?
4.2
Die Verkehrsampel
4.3
Noch einige Bemerkungen
Technik 21:
Anspannungsregulierung mit dem «BADIS»-Konzept
Technik 22:
Kälter oder wärmer – die optimale «Betriebstemperatur»
Technik 23:
Atemtechniken zur Aktivierung oder Stressreduktion
Technik 24:
Das Fadenkreuz im Kopf
Technik 25:
Eintauchen in eine andere Welt
Technik 26:
Gedanken aus Distanz wahrnehmen
Technik 27:
Vorwärts- und Rückwärtszählen
Technik 28:
Balancieren auf dem mentalen Surfbrett
Technik 29:
Schüttelentspannung
Technik 30:
«Über diesen Lavateppich musst du gehn»
Technik 31:
Selbstregulation mit dem Gedanken-Tonband
5
Konzentrations- und Aufmerksamkeitssteuerung
5.1
Die vier Konzentrationszustände
5.2
Innehalten oder Action?
5.3
Wechseln zwischen den verschiedenen Konzentrationszuständen
Technik 32:
Konzentrationsübung für den Alltag
Technik 33:
Der Gedankentunnel
Technik 34:
Der Gedankensauger
Technik 35:
Konzentrationssteigerung «mit den Fingern»
Technik 36:
Vogelperspektive: Den richtigen Fokus wählen
Technik 37:
Den Fokus aufs Positive richten
Technik 38:
Zählen und beschreiben
Technik 39:
Einprägen – was weisst du noch alles?
Technik 40:
Umgang mit Störfaktoren
6
Motivation: Die treibende Kraft in dir
6.1
Motivationsarten
6.2
Noch gut zu wissen
Technik 41:
Meine fünfzig Motivationsgründe
Technik 42:
Dialog mit dem «inneren Schweinehund»
Technik 43:
«Nur fünf Minuten, dann schauen wir weiter…»
Technik 44:
Tage abstreichen
Technik 45:
Raus aus den Federn!
Technik 46:
Von der Motivation anderer anstecken lassen
Technik 47:
Persönlichen Motivationsfilm drehen
7
Umgang mit Zielsetzungen
7.1
Ziele sind nicht gleich Ziele – die verschiedenen Zielkategorien
7.2
Das «SPORT»-Modell
Technik 48:
Monats-, Wochen- und Tagesziele
Technik 49:
Mein Tagesmotto
Technik 50:
«ZINA» – Lösungsansätze in vier Schritten
Technik 51:
Der Weg zu meinem Ziel
Technik 52:
Entwicklungspotenziale erkennen und fördern
Technik 53:
«Little Mountain» – die Kraft eines Songs nutzen
Technik 54:
Sinnhaftigkeit von Zielen und Entscheidungen prüfen
Technik 55:
Herausforderungen und Zielsetzungen relativieren
8
In der Entspannung liegt die Kraft
8.1
Alles besteht aus zwei Polen
8.2
Entspannung im Alltag und während des Wettkampfs
Technik 56:
Streck dich!
Technik 57:
Ich gönne mir kurz ein Nickerchen (Powernap)
Technik 58:
Einnasenloch-Atmung
Technik 59:
Atmung mit offener Körperhaltung
Technik 60:
Kraftpunkt-Atmung
Technik 61:
«Entspannung an der Wand»
Technik 62:
Körperbalance (Hook-up)
Technik 63:
Mentaler Naturpfad
Technik 64:
Imaginärer Kneipp-Pfad
Technik 65:
ALI (Atmung, Lächeln, innere Wahrnehmung)
Technik 66:
Alltagssituationen in Zeitlupe erleben (Entschleunigung)
Technik 67:
Kopflüften mit der Gesichtsmassage
Technik 68:
Regenbogenfarben-Entspannung
Technik 69:
Lockere dein Gesicht
Technik 70:
Entspannte Muskeln (Tiefenmuskelentspannung)
Technik 71:
Innere Ruhe mit der Kerzenflammen-Atmung
Technik 72:
Duftgarten – Balance für Körper, Geist und Seele
9
Selbstbewusstsein und innere Stärke entwickeln
Technik 73:
Wer fragt, der führt (Selbstcoaching-Fragen)
Technik 74:
Die Kraft der Symbole
Technik 75:
Die Zehn-Finger-Methode – Dinge konsequent durchziehen
Technik 76:
Mein verborgenes Entwicklungspotenzial erkennen
Technik 77:
Meine hundert Energielieferanten
Technik 78:
Mein persönliches Kraftritual
Technik 79:
Fähigkeiten aus der Vergangenheit reaktivieren
Technik 80:
Neue Wege gehen (Verhaltensmuster ändern)
Technik 81:
Verändern von Glaubenssätzen (Überzeugungen)
Technik 82:
Ausschau halten nach Glücksmomenten
Technik 83:
Mein «Mission Statement» (Lebensgrundsatz)
Technik 84:
Der Gefühlsbrief – mentale und emotionale Verarbeitung
Technik 85:
Bist du sicher, dass «es» wahr, gut und notwendig ist?
10
Umgang mit Herausforderungen
10.1
«Die Wettkampfangst konnte mir noch niemand nehmen»
10.2
Trainieren der Widerstandsfähigkeit (Resilienz)
Technik 86:
Umgang mit Zukunftsängsten
Technik 87:
Sorgen lindern mit dem «Worst-Case»-Szenario
Technik 88:
Emotionale Stabilität im Sport und Alltag
Technik 89:
«Reframing» – einen anderen Blickwinkel einnehmen
Technik 90:
Perspektivenwechsel: «Jetzt sehe ich das anders…»
Technik 91:
Die Kraft von Yin und Yang
Technik 92:
Erlebnisse mit der Flaschenpost verarbeiten
Technik 93:
Emotionale Balance dank Musik
Technik 94:
Ruhe und Kreativität mit der «liegenden Acht»
Technik 95:
Entscheidungsfindung: Welchen Weg will ich gehen?
Technik 96:
A oder B – für was entscheide ich mich am besten?
Technik 97:
Vertrauen aufbauen mit dem mentalen Hochseilgarten
Technik 98:
Prioritäten setzen
Technik 99:
AAA – Ändern, Akzeptieren oder Aussteigen
Technik 100:
Potenzialentfaltung mit dem ABC-Modell
11
Bonustechniken 101
Bonus A:
Das Selbstcoaching-Modell
Bonus B:
Kommunikationsstrategien für Sport und Alltag
Bonus C:
Da war ich wirklich gut!
Bonus D:
Selbstcoaching-Fragen für jede Thematik
Bonus E:
Konzentration und Energie in den Fingerkuppen
Bonus F:
Fokus- und Augenbewegungstraining
Bonus G:
Autogenes Training
Nachwort:
Wenn alle Stricke reissen…
Danksagung:
Altbewährtes Team
Literatur- und Quellenverzeichnis
Früheres Werk
Verlängerung wider Erwarten
Als ich vor einigen Jahren mit dem Schreiben meines ersten Buches «Dein Weg zur mentalen Stärke: Mentaltraining und Lebensschule für Sportler, Trainer und Betreuer» beschäftigt war, stand für mich fest, dass dies gleichzeitig mein letztes sein würde. Ich war damals der Meinung, alles niedergeschrieben zu haben, was einen Menschen dabei unterstützt, sich mental weiterzuentwickeln.
Im Zuge meiner eigenen Entwicklung stellte ich jedoch fest, dass noch genügend Stoff für ein zweites Buch vorhanden war – mein «Spiel» als Autor hat also wider Erwarten eine Verlängerung erfahren. Selbstverständlich bin auch ich nicht in der Lage, das Rad neu zu erfinden; ich bin aber fest davon überzeugt, dass selbst jene Leser, welche mein erstes Werk bereits kennen, zahlreiche weitere Impulse erhalten werden. Dies ist auch der Hauptgrund, warum ich bereit war, den immensen Aufwand, der einem solchen Werk zugrunde liegt, noch einmal zu betreiben. Mit der Veröffentlichung meines zweiten Buches endet übrigens auch mein Dasein als «aktiver» Autor, da in Zukunft andere Aufgaben auf mich warten.
Das Buch kann wie üblich von «A bis Z» beziehungsweise kapitelweise gelesen werden. Für jene Leser, welche sich aber lieber häppchenweise mit dem Thema «mentale Stärke» befassen wollen, habe ich mir etwas Besonderes einfallen lassen: Das Buch ist zwar wie gewohnt in einzelne Kapitel/Themenbereiche aufgeteilt, beinhaltet jedoch vor allem einzelne, in sich abgeschlossene Mentaltechniken. Somit ist das Buch auch hervorragend als Nachschlagewerk einsetzbar und nicht nur für Leseratten geeignet. Übrigens: Obwohl sich das Buch häufig auf sportliche Herausforderungen bezieht, sind die Inhalte selbstverständlich auch in den Bereichen Beruf, Schule und Alltag anwendbar. Denn unser Gehirn funktioniert schlussendlich in sämtlichen Lebensbereichen gleich.
Die vorgestellten Techniken sind das Ergebnis aus rund fünfzehn Jahren Erfahrung im Mental- und Coachingbereich. Ich war all die Jahre über privilegiert, während meiner Aus- und Weiterbildungen von ganz unterschiedlichen Mentoren beziehungsweise Denkansätzen zu profitieren, und hatte auch immer wieder die Möglichkeit, mich mit Berufskollegen professionell auszutauschen. Besonders wertvoll waren aber vor allem jene Erfahrungen, welche ich in der Praxis mit meinen Athleten und Studenten erleben durfte. Dabei ist mir unter anderem immer wieder besonders aufgefallen, dass es nichts bringt, jemandem ein Patentrezept überzustülpen, sondern dass es massgeschneiderter Lösungen bedarf. Dies deshalb, weil die Gegebenheiten (Rahmenbedingungen, Biografie, Persönlichkeitsmerkmale) eines jeden Menschen unzählige Eigenheiten aufweisen, welche ein 08.15-Vorgehen häufig schwierig machen. Und da diese Gegebenheiten niemand so gut kennt wie die betroffene Person selbst, obliegt ihr auch die Hauptverantwortung, die Lösungsansätze zu erarbeiten und konsequent in die Praxis umzusetzen. Das bedeutet zwar etwas mehr Arbeit, als wenn einem etwas fixfertig serviert wird, ist dafür aber um ein Vielfaches nachhaltiger. Selbstverständlich spricht nichts dagegen, wenn während einer Lösungssuche andere Menschen eine unterstützende Rolle einnehmen (nahestehende Personen, Trainer, Mentalcoach). Solche Begleiter erweisen sich in der Praxis gerade in stürmischen Phasen oft als hilfreich.
«Nimm an, was nützlich ist. Lass weg, was unnütz ist. Und füge das hinzu, was dein Eigenes ist.» (Bruce Lee)
Was bedeutet dies nun für dich als Leser? Betrachte die Inhalte dieses Buches als Inspirationsquelle. Probiere aus, was für dich momentan am besten passt, was du lieber weglassen möchtest, und kombiniere deine neugewonnenen Erkenntnisse mit Dingen, welche du in der Vergangenheit bereits erfolgreich angewandt hast. Viel wichtiger als irgendeine Technik detailliert nach einem Lehrbuch anzuwenden, ist sowieso, mit welcher Haltung du durchs Leben gehst.
Ich habe beim Schreiben des vorliegenden Werks wirklich nochmals all meine Karten auf den Tisch gelegt und hoffe, dass du in irgendeiner Form davon zu profitieren weisst. Nun bist du an der Reihe: Ich wünsche dir viel Spass beim Eintauchen in die Welt des mentalen Trainings!
Olten, im Januar 2019
Matthias Stäuble
PS: Da ich mit den meisten Personen in der Sportwelt eine sehr persönliche Beziehung pflege, habe ich mich bei der Schreibweise für die Du-Form entschieden. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwende ich zudem lediglich die männliche Form; es sind jedoch immer beide Geschlechter gemeint.
Übungsauswahl für Schnellstarter
Obwohl vieles dafür spricht, dass du die Techniken nach deinem eigenen Gutdünken aussuchst, habe ich als Starthilfe zehn Techniken ausgewählt, welche ich als guten Einstieg erachte. Falls du also bei der Auswahl unschlüssig bist oder es kaum erwarten magst, loszulegen, probiere zuerst die eine oder andere der unten aufgeführten Techniken aus (die Reihenfolge spielt dabei keine Rolle). Um die Materie in der Tiefe zu verstehen, empfehle ich dir allerdings, zu einem späteren Zeitpunkt auch die Einführungen der einzelnen Kapitel zu lesen.
Technik 1:
Bewegungsabläufe und Verhaltensmuster trainieren
Technik 9:
Handlungsdrehbuch für meine Schlüsselmomente
Technik 13:
Die imaginäre Garderobe – mein Rückzugsort
Technik 15:
Imaginäre Schatztruhe (Belastungen ablegen)
Technik 20:
Gedankenkontrolle (Selbstgesprächsregulation)
Technik 21:
Anspannungsregulierung mit dem «BADIS»-Konzept
Technik 23:
Atemtechniken zur Aktivierung oder Stressreduktion
Technik 35:
Konzentrationssteigerung «mit den Fingern»
Technik 52:
Entwicklungspotenziale erkennen und fördern
Technik 89:
«Reframing» – einen anderen Blickwinkel einnehmen
1
Warm-up: Was du über Mentaltraining wissen solltest
Auf den nächsten Seiten zeige ich dir einige Hintergründe und grundlegende Themen des Mentaltrainings auf. Es ist sozusagen das Aufwärmen, damit du für die später vorgestellten Techniken bereits etwas vorbereitet bist.
Dass unsere Vorstellungen realer sind, als wir oft glauben, widerspiegelt sich auch im täglichen Sprachgebrauch: Sätze wie «wenn ich nur schon daran denke, wird mir ganz schlecht» oder «Vorfreude ist bekanntlich die grösste Freude» bestätigen dies schon seit eh und je.
1.1 Wenn die Vorstellung zur Realität wird
Bestimmt hast du schon das eine oder andere Mal an etwas gedacht, das dir äusserst real vorkam, obwohl es sich dabei nur um eine Vorstellung in deinem Kopf handelte (zum Beispiel bevorstehender oder vergangener Wettkampf, Ferien, geplantes Treffen mit Freunden). Dass sich solche Vorstellungen manchmal sehr echt anfühlen, hat damit zu tun, dass dein Gehirn grundsätzlich nicht unterscheidet, ob etwas wirklich gerade passiert oder ob es sich dabei nur um eine innere Vorstellung handelt. Dies gilt übrigens auch für Ereignisse, die gar noch nicht stattgefunden haben und von denen du nicht einmal sicher bist, ob sie je stattfinden werden. Denn gewisse Teile des Gehirns kennen keine Zeit- und Raumempfindungen im eigentlichen Sinne; das heisst, jede im Kopf ablaufende Vorstellung wird grundsätzlich als real wahrgenommen und löst dabei die dazugehörigen Gedanken, Emotionen und Körperreaktionen aus. Ein sehr gutes Beispiel dazu ist der nächtliche Traum: Die in einem Traum vorkommenden Ereignisse fühlen sich wie im richtigen Leben an, obwohl der Körper die ganze Zeit über im Bett liegt. Auch wenn Vorstellungen im Alltag (Wachbewusstsein) in der Regel nicht ganz so intensiv wahrgenommen werden wie im Traum, ist deren Effekt für deine Leistungsfähigkeit und Lebensqualität dennoch sehr entscheidend.
Einen ähnlichen Mechanismus erlebst du, wenn du zum Beispiel beobachtest, wie sich jemand bei einem (Sport-)Unfall verletzt, oder wenn du eine schöne Filmszene im Fernsehen anschaust. Dabei werden die Empfindungen – die Intensität fällt je nach Situation sehr unterschiedlich aus – auf dich als Beobachter übertragen. Dank diesem Mechanismus ist es uns Menschen auch möglich, die Gefühle einer anderen Person wahrzunehmen (Mitgefühl, Empathie). Manche Forscher ordnen dieses Phänomen den sogenannten Spiegelneuronen in unserem Gehirn zu.
Beim Mentaltraining im engeren Sinne – oft als Visualisierung, Vorstellungstraining oder Imagination bezeichnet – geht es in der Praxis darum, den gerade beschriebenen Mechanismus des Gehirns bewusst einzusetzen, um eine von dir gewünschte Veränderung herbeizuführen. Mit Mentaltraining ist es zum Beispiel möglich, Bewegungsabläufe, Standardsituationen, optimale Verhaltensweisen oder ähnliche Dinge im Kopf zu trainieren. Grundsätzlich funktioniert das Vorstellungstraining wie das «echte» Training: Wird ein bestimmtes Muster immer wieder auf die gleiche Art und Weise ausgeführt, tritt mit der Zeit ein Automatismus ein, welcher tendenziell auch unter erschwerten Bedingungen standhält. Welche Möglichkeiten im Detail existieren, erfährst du in Kapitel 2.
Das Gehirn hält Vorstellungen grundsätzlich für sehr real. Das heisst, wenn beispielsweise ein Eiskunstläufer bestimmte Stellen seiner Choreographie innerlich durchgeht, werden dieselben Nervenzellen in Gehirn und Körper aktiviert wie beim physischen Training.
1.2 Einsatzgebiete und Nutzen des Mentaltrainings
In der Praxis wird der Begriff Mentaltraining nicht nur für das im letzten Abschnitt beschriebene Visualisierungstraining verwendet, sondern bezieht sich häufig auch auf weitere Einsatzgebiete. Eine Übersicht findest du in der nachfolgenden Grafik:
Einsatzgebiete des Mentaltrainings: Mentale Werkzeuge («Fundament») sind als Unterstützung gedacht, um sportliche, private und berufliche Situationen bestmöglich zu meistern. Je besser die Werkzeuge beherrscht werden, desto einfacher können die Themen der Lebenssäulen «Sport» und «Privat und Beruf» gemeistert werden. Wichtig: Es geht dabei nicht nur um den sichtbaren Erfolg (messbares Resultat), sondern auch um den Umgang mit Herausforderungen jeglicher Art sowie um eine langfristige und nachhaltige Entwicklung der Persönlichkeit.
Über den Nutzen des Mentaltrainings wird in der Sportwelt – wie über andere Angelegenheiten natürlich ebenfalls – oft diskutiert. Obwohl es immer noch Stimmen gibt, die Mentaltraining für unnötig halten, sind heute viele Personen aus der Sportszene der Ansicht, dass Mentaltraining einen festen Platz im Leben eines (Leistungs-)Sportlers einnehmen sollte. In Studien beziehungsweise Fachdiskussionen tauchen manchmal sogar Prozentzahlen auf, wie hoch der Nutzen denn wirklich genau sei. Die Ergebnisse oder Meinungen fallen jedoch von Situation zu Situation sehr verschieden aus, weshalb es in der Praxis kaum Sinn macht, pauschal eine Zahl zu nennen. Zudem ist der Begriff Mentaltraining sehr unterschiedlich interpretierbar, was eine genaue Bezifferung zusätzlich erschwert.
1.3 Leistungseinflussfaktoren für den sportlichen Erfolg
Mentaltraining sollte regelmässig durchgeführt werden und einen festen Platz im Alltag einnehmen. Einfach schnell zum Mentaltrainer zu gehen oder dreimal tief durchzuatmen, bringt nicht den optimalen Nutzen. Es ist ähnlich wie bei einem Muskel, welcher über längere Zeit hinweg trainiert werden muss, um sich optimal zu entwickeln.
Wie gross der Nutzen des Mentaltrainings auch immer sein mag: Es gibt zahlreiche Faktoren, die den (sportlichen) Erfolg beeinflussen, wobei diese nicht immer klar ersichtlich sind. Deshalb fällt es Sportlern besonders unmittelbar nach dem Wettkampf schwer, auf auftauchende «Journalistenfragen» – welche übrigens nicht nur von Journalisten gestellt werden – eine passende Antwort zu finden. Denn bis das Gehirn in der Lage ist, die Eindrücke zu analysieren und verarbeiten, braucht es zuerst einmal eine emotionale Abkühlung sowie etwas Bedenkzeit. Aber selbst dann bleibt häufig eine kleinere oder grössere «Lücke» (eine Art Blackbox) zurück, welche verhindert, eine ganz klare Erkenntnis über den erreichten Erfolg oder Misserfolg zu erlangen. Dies hat wohl damit zu tun, dass viele Dinge auf unbewusster sowie emotionaler Ebene ablaufen und somit nicht logisch nachvollziehbar sind. Zudem gibt es zahlreiche Faktoren, welche oft nicht in vollem Ausmass der eigenen Kontrolle unterliegen.
Aus meiner Sicht existieren vordergründig folgende Puzzleteile, welche die Leistungsfähigkeit beziehungsweise den Wettkampfausgang beeinflussen:
Beeinflussungsfaktoren für Leistungsfähigkeit und Wettkampfausgang: Achte darauf, dass du deine Energie vor allem für jene Bereiche einsetzt, welche du in einer bestimmten Situation auch wirklich selbst beeinflussen kannst. Es gilt zu beachten, dass das Puzzleteil «mentale Fertigkeiten» manchmal eine «übergeordnete» Rolle innehat. Das heisst, du bist mit dessen Unterstützung in der Lage, die anderen Bereiche positiv zu beeinflussen.
Noch ein wichtiger Hinweis: Willst du sportlich oder persönlich wachsen, ist es oft notwendig, neue Verhaltensmuster zu schaffen. Um ein altes Muster zu lösen beziehungsweise ein neues stabil zu installieren, braucht es in der Regel etwa vier Wochen Zeit. Während dieses Prozesses solltest du dich möglichst täglich in irgendeiner Form mit dem neuen Muster (Verhalten, Taktik, Technik, mentale Übungen) beschäftigen und nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, falls sich der Erfolg nicht auf Anhieb einstellt und sich etwas in dir gegen die geplante Veränderung wehrt (Motivationsprobleme, Skepsis, temporäre Blockaden, Jammern). Denn Veränderungen bedeuten für das Gehirn immer sehr viel Arbeit, weshalb es gute Argumente (Motive) für das neue Muster braucht. In einzelnen Fällen – wenn du zum Beispiel merkst, dass der angestrebte neue Weg voraussichtlich in einer Sackgasse endet – ist die Gegenwehr natürlich berechtigt, und es gilt einen neuen Weg einzuschlagen oder beim Ursprungszustand (altes Muster) zu bleiben.
1.4 Umgang mit Emotionen
Über den optimalen Umgang mit den rund um einen Wettkampf aufkommenden Emotionen und Gedanken (Selbstregulation, Selbstkontrolle oder Psychoregulation genannt) wird in Fach- und Athletenkreisen immer wieder diskutiert. Meine Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass es in der Regel verschiedener Strategien bedarf beziehungsweise es «mehrere Wege gibt, die nach Rom führen». Du wirst deshalb in den nachfolgenden Kapiteln Techniken aus ganz unterschiedlichen Bereichen kennenlernen. Um die verschiedenen Ansätze besser zu verstehen, vermittle ich dir vorab noch einige psychologische Grundlagen:
1.4.1 Die «drei Wellen»
In der Entwicklungsgeschichte der Psychologie (Verhaltenstherapie) existieren drei verschiedene «Wellen», wobei jede der einzelnen Wellen bei auftretenden «Problemen» ihre eigene Erfolgsstrategie bereithält:
Erste Welle («Behaviorismus», etwa 50er Jahre): Ein problematisches Verhalten wird durch ein «besseres», konstruktives Verhalten ersetzt (zum Beispiel einer Angst oder übermässigem Stress mit Entspannung begegnen, welche durch eine entsprechende Übung erreicht wird).
Zweite Welle («kognitive Wende», etwa 60er/70er Jahre): Einem problematischen Verhalten wird durch die Veränderung von Kognitionen entgegengewirkt (zum Beispiel wird ein irrationaler, negativer Gedanke durch einen «besseren», positiven Gedanken ersetzt). Kommt bei einem Athleten beispielsweise der Gedanke auf, «ich habe Angst, dass ich verschiesse», könnte er diesen ersetzen durch «ich versenke den Ball sicher».
Dritte Welle («emotionale Wende», etwa 80er/90er Jahre): Diese Theorie geht davon aus, dass Emotionen, Gefühle und Gedanken funktionelle (sinnvolle) psychologische Phänomene darstellen und somit nicht einfach als «schlecht» oder «gut» zu werten sind. Bei diesem Ansatz werden also «problematische» Verhaltensweisen, Gedanken, Emotionen und Gefühle nicht etwa ersetzt, sondern in erster Linie akzeptierend (nicht wertend und nicht hinterfragend) wahrgenommen. Beispiel: Ein Speerwerfer zittert kurz vor seinem nächsten Versuch und denkt dabei, «in diesem Zustand wird das heute nichts». Nun versucht er NICHT, das Zittern und den negativen Gedanken um jeden Preis zu ändern (das wäre der Ansatz der ersten beziehungsweise zweiten Welle), sondern akzeptiert die momentanen Empfindungen und konzentriert sich anschliessend so gut wie möglich auf seinen Versuch. Das Ziel besteht somit vor allem darin, aus einer «schlechten» (unangenehmen) Situation das Beste zu machen und zu verhindern, dass sich die Dinge nicht noch weiter hochschaukeln. Es geht also bei dieser «Technik» nicht primär darum, sich dank dem Annehmen umgehend besser zu fühlen.
Nebenbei: Die Ansätze der dritten Welle kennt man in anderen Kulturen und Konzepten (beispielsweise Buddhismus, Yoga) schon seit Menschengedenken.
1.4.2 Entstehung und Abbau von Emotionen
Wie schon angedeutet, haben meiner Ansicht nach sämtliche drei Wellen ihre Daseinsberechtigung (sehr gute Ergebnisse sind häufig zu beobachten, wenn die drei Wellen miteinander kombiniert werden). Obwohl die richtige Strategiewahl sehr individuell ist und von mehreren Faktoren abhängt, kann allgemein festgehalten werden, dass die ersten beiden Wellen eher geeignet sind, um mit «kleinen» negativen Emotionen und Gedanken umzugehen. Wurde das Emotionsfeuerwerk einmal richtig gezündet, ist diesem mithilfe der ersten beiden Wellen (zum Beispiel Durchführung einer Entspannungsatmung oder eines positiven Selbstdialogs) zumindest auf die Schnelle kaum beizukommen. Häufig passiert sogar genau das Gegenteil: Unangenehme Emotionen unbedingt weghaben zu wollen verstärkt den gegenwärtigen Zustand meist zusätzlich.
Zeitverlauf bei Entstehung und Abbau von Emotionen: Emotionen – unangenehme wie angenehme – entwickeln beim Eintreffen eines bestimmten Ereignisses (Auslöser) häufig innert kürzester Zeit einen Grossteil ihres Potenzials, brauchen jedoch relativ lange, um sich danach wenigstens einigermassen «abzukühlen». Ab einer gewissen Stärke können Emotionen zudem nicht mehr im Keime erstickt werden. Dieser Mechanismus ist zu vergleichen mit einer bereits ausgelösten Lawine: Eine Lawine, die bereits eine gewisse Kraft entfaltet hat, ist nicht mehr aufzuhalten. In der Praxis gibt es ganz viele «Lawinengrössen». Manchmal kommt es auch vor, dass sich viele kleine Lawinen zu einer grossen Lawine zusammenballen und das Fass erst zu einem späteren Zeitpunkt zum Überlaufen bringen. In solchen Fällen heisst es dann: «Die Emotionen sind mit mir durchgegangen.»
Stellst du fest, dass es dir nicht gelingt, ein unangenehmes Gefühl anzunehmen, nimmst du auch diese Tatsache an; also dass du im Moment nicht in der Lage bist, das unangenehme Gefühl anzunehmen.
1.4.3 Häufige Fragen im Zusammenhang mit Emotionen und Gefühlen
Sind Emotionen und Gefühle eigentlich das Gleiche?
Im gängigen Sprachgebrauch werden die beiden Begriffe häufig synonym verwendet, was für den Alltag aus meiner Sicht auch völlig in Ordnung ist. Nichtsdestotrotz gibt es einige Unterschiede, die interessant und hilfreich sein können. Allerdings findet sich in der Fachwelt keine einheitliche Abgrenzung, weshalb ich an dieser Stelle meine eigene Auffassung dazu ausführe: Gefühle werden grundsätzlich bewusst wahrgenommen oder eben gefühlt – im Vordergrund steht die Beobachtung/Empfindung und nicht die Bewertung mit den damit verbundenen Reaktionen. Bei Emotionen hingegen erfolgt – wenn häufig auch unbewusst – eine Bewertung, und es kommt «Bewegung» ins Spiel (Handlungen und Reaktionen, welche oft auch nach aussen sicht- oder hörbar werden). Nicht umsonst wird Emotion manchmal mit «Energie in Bewegung» übersetzt. Kommt bei einem Athleten in einer Wettkampfsituation, aus welchen Gründen auch immer, beispielsweise Angst auf, entstehen vielleicht Dinge wie Herzklopfen, Schweisshände, trockener Mund, negative Gedanken oder allgemeines Unwohlsein (= Gefühle). Bliebe der Athlet lediglich beim Fühlen/Wahrnehmen, würde ansonsten nichts weiter passieren. Häufig entstehen in solchen Situationen jedoch emotionale Reaktionen wie Weglaufen (vielleicht auch nur im übertragenen Sinne), überhasteter oder verzögerter Start, Schreien, Ausraster, Materialbeschädigung usw.
Zum Vergleich der beiden Begriffe noch ein Sinnbild: Ist der Wellengang des Meeres eher ruhig, handelt es sich um ein Gefühl; ist ein heftiger Sturm am Toben, geht es um Emotionen. Man könnte deshalb auch sagen, dass eine Emotion ein sehr intensiv ausgelebtes Gefühl ist.
An dieser Stelle sei noch ausdrücklich angemerkt, dass Emotionen und Gefühle, welcher Art auch immer, grundsätzlich eine völlig natürliche und notwendige Erscheinung darstellen. Wichtig ist jedoch, dass du lernst, diese richtig zu verstehen und situationsgerecht mit ihnen umzugehen.
Welche Emotionen/Gefühle gibt es?
In der Literatur wird oft von sogenannten Grundemotionen (auch Grundgefühle, Primäraffekte oder Basisemotionen genannt) gesprochen, welche als wesentlicher Bestandteil jeder menschlichen Existenz angesehen werden und somit auch in allen Kulturen gleichermassen anzutreffen sind. Fasst man die verschiedenen Theorien zusammen, kommen in erster Linie folgende Grundemotionen zur Sprache: Freude, Liebe, Neugierde, Interesse, Überraschung, Wut, Hass, Ekel, Ärger, Furcht, Angst, Verachtung, Traurigkeit, Scham, Schuld (Quelle: Wikipedia). Im täglichen Sprachgebrauch beziehungsweise in der Coachingarbeit werden den Emotionen jedoch häufig noch weitere Begriffe zugeschrieben. Übrigens: Der Grund, warum die Mehrzahl der Grundemotionen eher «negativ» besetzt ist, hat vermutlich – wie könnte es anders sein? – evolutionsgeschichtliche Hintergründe.
Ist Achtsamkeit/Akzeptanz (dritte Welle) ein Trick, um unangenehme Gefühle oder Emotionen schnell loszuwerden?
Nein. Wenn du beispielsweise deinen Frust nur mit dem Hintergedanken akzeptierst, weil du ihn wieder loswerden willst, handelt es sich dabei nicht um eine echte Akzeptanz. Gefühle und Emotionen haben ihren eigenen Zeitplan – manchmal tritt die Wandlung/Auflösung schnell ein, manchmal dauert es eben länger, wobei die mögliche Zeitspanne ziemlich gross ist. Wenn du bereit bist, deine aktuellen Empfindungen einfach wahrzunehmen und zu akzeptieren, vermeidest du es, zusätzlich Öl ins Feuer zu giessen.
Das heisst also, ich soll sämtliche unangenehme Gefühle und Emotionen immer annehmen und akzeptieren?
Nein. Dieser Ansatz ist – zumindest langfristig betrachtet – zu einseitig und würde früher oder später wohl in einer allgemeinen Resignation enden, was definitiv nicht das Ziel ist. Es geht eher darum, eine gesunde Balance zwischen verändern/kontrollieren (erste und zweite Welle) und akzeptieren/annehmen (dritte Welle) herzustellen. Je häufiger du diese Konzepte bewusst anwendest, desto einfacher wird es dir in Zukunft fallen, in einer bestimmten Situation – sei es im Wettkampf oder Alltag – die für dich beste Lösung zu finden.
Wenn sich ein unangenehmes Gefühl aufgelöst hat, ist es dann für immer weg?
Nein. Gefühle und Emotionen – unangenehme und angenehme – sind ein fester und sinnvoller Bestandteil der Natur. Sie kommen und gehen bis ans Lebensende und sind für die körperliche sowie psychische Regulation unabdingbar. Zudem verleihen sie deinem Dasein eine gesunde «Würze». Das Naturphänomen des «Kommens und Gehens» lässt sich beispielsweise sehr gut am Wetter beziehungsweise an den Jahreszeiten beobachten.
Wie kann ich positive Gefühle und Emotionen erzeugen?
Das ist eine sehr individuelle Angelegenheit. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass alles, was du gerne tust und zu deinem «wahren Wesen» gehört, gute Gefühle und Emotionen auslöst. Beachte aber, dass es niemals darum geht, ausschliesslich gute Empfindungen anzustreben. Dies ist weder sinnvoll noch erreichbar und führt eher ins Verderben als ins Glück.
Welche Auswirkungen hat Angst auf die Leistungsfähigkeit?
Zuerst muss festgehalten werden, dass es verschiedene «Qualitäten» von Ängsten gibt. Sehr unangenehme beziehungsweise starke Ängste wirken sich tendenziell negativ auf die Leistungsfähigkeit aus und führen häufig zu folgenden Reaktionen: Blockierung, sich zu wenig zutrauen, Zaghaftigkeit, übers Ziel hinausschiessen. Leistungssteigernd wirken sich hingegen in der Regel positive Emotionen aus. So konnte beispielsweise der Diplom-Psychologe Marco Rathschlag anhand von Forschungsarbeiten an der Deutschen Sporthochschule Köln aufzeigen, dass Freude zu signifikant besseren Leistungen führt als Angst, Trauer oder emotionsneutrale Zustände. Gemessen wurden dabei Fingerkraft, Sprungkraft, 40-Meter-Sprint und Wurfkraft (Quelle: Buch «Mit Freude läuft’s besser», Junfermann-Verlag 2013).
«Ich bin immer recht nervös vor den Wettkämpfen», sagte der Freeskier Fabian Bösch in einem Fernsehinterview. Auf die Frage des Moderators, was er dagegen tun könne, meinte Bösch kopfschüttelnd: «Nichts. Das gehört zu mir. Das war schon immer so – und ich will es auch gar nicht ändern.»
Quellen Ziffer 1.4.1 bis 1.4.3: Teilweise aus der Präsentation «Achtsamkeit und ACT-basierte Interventionen im Spitzensport» (Bundesamt für Sport BASPO, November 2015, und www.researchgate.net 2016).
1.5 Eine Übung zum Start – der Biss in die Zitrone
Nun darfst du gleich einmal selbst erleben, wie sich deine Vorstellung auf deine Realität auswirkt:
Lege oder setze dich bequem hin und schliesse deine Augen. Zähle innerlich von zehn auf null zurück, wobei du mit jedem Atemzug eine Zahl zurückzählst…
Du befindest dich auf einer Wiese mit ganz vielen Zitronenbäumen. Gehe auf einen der Bäume zu und pflücke eine reife Zitrone… Schneide dir einen Schnitz heraus. Nimm den Geruch wahr und stecke den Schnitz anschliessend in deinen Mund. Beisse fest in den Schnitz und nimm wahr, wie sich der Saft in deinem ganzen Mund ausbreitet. Wie fühlen sich Geschmack und Geruch an? Was passiert mit deinem Gesicht und deinem Speichel…?
Zähle zum Abschluss in dem von dir gewünschten Tempo von null auf zehn… Öffne langsam deine Augen und beende die Übung.
1.6 Zum Aufbau der einzelnen Kapitel
Neben einer kurzen Einleitung (Grundlagen) enthält jedes der nachfolgenden Kapitel mehrere themenbezogene Techniken, welche jeweils wie folgt gegliedert sind:
Übungsziele
Mögliche Ziele, welche mit der Technik angestrebt werden.
Kurzbeschrieb
Die wichtigsten Inhalte der Technik werden grob zusammengefasst. Dies ermöglicht dir, in kurzer Zeit einen Überblick über die Übung zu erlangen.
Einsatzbeispiele
Konkrete Beispiele, für welche Situationen die beschriebene Technik verwendet werden kann.
Komplexität
Es wird zwischen geringer, mittlerer und hoher Komplexität unterschieden. Techniken mit geringer Komplexität sind in der Regel schneller und einfacher anwendbar, Techniken mit hoher Komplexität gehen mehr in die Tiefe, fordern dich stärker und brauchen etwas mehr Zeit.
Zeitbedarf
Ungefähr benötigte Zeit. Teilweise wird unterschieden zwischen Basisübung (diese ist in der Regel nur einmal durchzuführen) und Praxisanwendung (nach Anwendung der Basisübung wird zur Praxisanwendung übergegangen, welche deutlich weniger Zeit benötigt).
Vorbereitung
Bei gewissen Techniken ist vor dem eigentlichen Übungsbeginn eine organisatorische Vorbereitung nötig (geeigneter Durchführungsort suchen, Schreibgeräte, Papier und anderes Material beschaffen). Manchmal sind ebenfalls gewisse Vorüberlegungen anzustellen.
Übungsdurchführung
Detaillierte Anleitung zur Durchführung der jeweiligen Technik.
Variationen
Alternative Ideen oder Kombinationsmöglichkeiten im Zusammenhang mit der vorgestellten Technik.
Übrigens
Themenbezogene Hintergründe oder zusätzliche Anregungen.
2
Visualisierung: Innere Bilder als Trainingswerkzeug nutzen
2.1 Einsatzmöglichkeiten
Das Visualisierungstraining ist die wohl bekannteste Methode des Mentaltrainings. Mit Visualisierung ist gemeint, dass du dir den optimalen Ablauf einer bestimmten Schlüsselsituation immer wieder vor deinem geistigen Auge vorstellst, bis das Muster von deinem Unterbewusstsein übernommen wird und du in einer Ernstfallsituation, ohne zu überlegen, entsprechend reagierst. Grundsätzlich ist die Visualisierung in folgenden Bereichen anwendbar:
– Erlernen einer neuen Technik: Technische Grundelemente bei Nachwuchsathleten, starke Veränderung einer bestehenden Technik (beispielsweise andere Landung beim Skispringen).
– Verfeinern einer bestehenden Technik: Feinanpassungen (mehr Explosivität aus den Hüften, tiefere Hockeposition, Ball früher treffen).
– Bereits vorhandene (technische) Fertigkeiten «konservieren»: Gute Form während einer Trainings-, Wettkampf- oder Verletzungspause beibehalten.
– Optimale Verhaltensweisen automatisch abrufen: In diesem Fall geht es weniger darum, ein bestimmtes Muster neu zu erlernen oder zu verbessern (verfeinern). Denn im Normalfall stellen grundlegende Muster wie zum Beispiel das ruhige Atmen oder eine lockere Körperhaltung einzunehmen niemanden vor eine grosse Herausforderung. Unter Stress fallen vielen Athleten aber verständlicherweise selbst solch einfache Dinge schwer. Das Ziel besteht deshalb darin, gewünschte Verhaltensweisen so lange zu visualisieren, bis du auch im Wettkampf in der Lage bist, diese problemlos abzurufen. Natürlich besteht ebenfalls die Möglichkeit, mehrere (bereits stabile Muster) zu einem grossen Gesamtmuster aneinanderzureihen, wie dies häufig bei Ritualen der Fall ist; zum Beispiel aussteigen aus dem Bus, umziehen, gut aufwärmen, kurz vor Stadioneinlauf Konzentration hochfahren, Schuhe gut schnüren, letzter Schluck aus der Flasche, und los geht‘s.
– Reaktivierung verlorengegangener Muster: Das Gehirn arbeitet nach dem Prinzip «use it or lose it», was ungefähr so viel heisst wie «gebrauche etwas oder du verlierst es wieder». Das bedeutet, dass jedes Muster (Linksschwung im Skisport, Dialog in einer Fremdsprache, Bedienung eines Computerprogramms, Ausführung von Schreinerarbeiten usw.), welches über längere Zeit hinweg nicht mehr ausgeführt wird, sich tendenziell zurückbildet. Allerdings gilt auch das Gegenteil, nämlich dass etwas, was früher einmal erlernt wurde, mit etwas Training wieder reaktiviert werden kann (die «Verdrahtung» der entsprechenden Nervenzellen im Gehirn wird wieder stärker).
Was heisst das für die Praxis? Wenn ein Athlet beispielsweise aufgrund einer langwierigen Verletzung nicht oder kaum in der Lage ist, zu trainieren, ist das Visualisierungstraining eine sehr gute Methode, da die Vorstellungskraft unabhängig von den körperlichen Voraussetzungen funktioniert. Diese Tatsache macht sich übrigens manchmal auch die Medizin zunutze: Ist ein Patient zum Beispiel von einer sogenannten Parese betroffen (unvollständige Lähmung, Teilausfall der motorischen Funktion eines Muskels), so wird dieser vom Physiotherapeuten gebeten, die Behandlung mittels Vorstellung zu begleiten (beispielsweise das Heben des Armes oder das Beugen des Knies bildlich vorstellen).
Beim Sportunterricht liegen alle auf dem Rücken und fahren Rad. «He Florian! Warum machst du nicht mit? Du liegst ja ganz ruhig da!», schimpft der Lehrer. «Sehen Sie nicht. Ich fahre gerade bergab!»
Nachfolgend ein paar konkrete Einsatzbeispiele für das Visualisierungstraining:
Technisch
Annahme beim Volleyball, Topspin beim Tischtennis, Sprungtechnik beim Hürdenlauf, Ballkontrolle, Passgenauigkeit
Taktisch
Optimale Raumaufteilung und Stellungsspiel bei Mannschaftssportarten, rechtzeitiges Umschalten von Angriff auf Verteidigung, taktisches Verhalten bei Rennbeginn, Spielübersicht, Oberkörper «grösser» machen (Eishockeytorhüter)
Verhalten
Bei Hektik oder Lärm ruhig bleiben, Hände bei Zweikampf unten lassen (Fussball), nach Strafe wieder voll konzentriert aufs Eis gehen, bestimmtes Ritual zwischen einzelnen Punkten
Standard-situationen
Freiwurf, Paßspiel, Landung, Absprung, sämtliche Übungen aus dem Training
Koordination
Gleichgewichtsfähigkeit, Rhythmisierungsfähigkeit, Orientierungsfähigkeit, Reaktionsfähigkeit
Athletik
Mentales Kraft- und Konditionstraining, Explosivität, Sprungkraft
Mental
Idealen Leistungszustand regulieren (Stress und Anspannungsgrad beeinflussen), Umgang mit Druck, Konzentrationsfähigkeit, Fehler abhaken, vergebene Chance innerlich in verbesserter Form nochmals durchgehen («Filmkorrektur»)
Alltag
Positiver Verlauf eines Gesprächs, souveränes Auftreten bei einem Vortrag, Gelassenheit im Strassenverkehr
Anmerkungen
Alles, was du im «echten» (physischen) Training übst, kannst du grundsätzlich auch mit der Visualisierungstechnik (bildliche Vorstellung) unterstützen. Denn dein Gehirn aktiviert in deiner Vorstellung die gleichen Nervenzellen und Muskeln wie beim physischen Training. Selbstverständlich ersetzt – zumindest langfristig – das mentale Training niemals das physische Training, sondern ist als Ergänzung zu verstehen. Der grosse Vorteil des mentalen Trainings besteht jedoch darin, dass dieses praktisch immer anwendbar ist, da es keiner zeitlichen, örtlichen oder körperlichen Einschränkung unterliegt.
Ähnlich wie beim «echten» Training wird auch beim Visualisieren zwischen Teil- und Vollabläufen unterschieden. Wann genau welche Variante zu bevorzugen ist, hängt von zahlreichen Faktoren ab (Trainingsziel, Entwicklungsstand des Sportlers, Sportart, Intuition). Sieh dir die Beispiele in der folgenden Grafik an:
Es gilt anzumerken, dass die Grenzen in der Praxis fliessend verlaufen; das heisst, es gibt auch Zwischenvarianten. Dasselbe gilt für die in der nachfolgenden Grafik dargestellte Unterscheidung zwischen standardisierten Abläufen (Bewegungsmuster, welche mehr oder weniger immer genau gleich ausgeführt werden) und situationsabhängigen Abläufen (Bewegungsmuster, welche auf die jeweilige Situation – oft spielen dabei die eigene Position sowie das Verhalten der Gegner und Mitspieler eine Rolle – angepasst werden müssen).
Nun stellt sich dir vielleicht die Frage, welcher Nutzen dem Visualisierungstraining bei situationsabhängigen Abläufen zugrunde liegt, wenn doch im Vornherein sowieso nicht klar ist, wie der optimale Ablauf in einem Wettkampf im Detail genau aussehen soll. Die Antwort liegt darin begründet, dass es bei situationsabhängigen Abläufen nicht um das Einüben eines einzigen, starren Bewegungsablaufs geht, sondern um das Ausweiten des Handlungsspektrums, welches in den entsprechenden Situationen zu einem schnellen, intuitiven und optimalen Verhalten führt (Reaktionsvermögen und Improvisationsfähigkeit).
«Erfolg ist, wenn das erfolgt, was ICH mir vorgestellt habe.»
2.2 Noch gut zu wissen
Das Visualisierungstraining ist im Liegen, Sitzen oder Stehen möglich und kann mit geschlossenen oder offenen Augen durchgeführt werden. Welche Variante sich am besten eignet, hängt von deiner Routine – also wie gut du das Training schon verinnerlicht hast –, deinen Präferenzen sowie dem genauen Einsatzzweck ab. Denn wie du später sehen wirst, gib es längere Trainingseinheiten, welche eher im stillen Kämmerlein zu Hause durchgeführt werden, sowie kurze Trainingseinheiten, welche während des Wettkampfs beziehungsweise kurz vor dem Wettkampfstart zur Anwendung kommen.
Eine Visualisierung beginnt meistens mit einer Entspannungs- beziehungsweise Konzentrationsphase, wobei die Dauer je nach Situation sehr unterschiedlich ausfällt (wenige Sekunden bis fünf Minuten). Ich stelle dir in diesem Buch bewusst ganz unterschiedliche Varianten vor, damit du die für dich beste auswählen oder selbst zusammenstellen kannst. Welche Variante du also verwendest, ist weniger entscheidend. Viel wichtiger ist, bei welcher du die beste Wirkung verspürst.
Manchen Athleten fällt es leichter, wenn sie – zumindest anfänglich – bei der Visualisierung begleitet werden. Wenn dies auf dich zutrifft, suche dir eine Person, welche dich durch die Übung führt (also den Text vorliest) oder nimm den Text vorab auf dein Smartphone auf. Falls es dir hilft, ergänze die Übung mit einer für dich passenden Hintergrundmusik.
Es gibt zwei Visualisierungsperspektiven: In der «Zuschauerperspektive» betrachtest du dich von aussen auf einer imaginären Leinwand, wie du beispielsweise einen bestimmten Bewegungsablauf ausführst. In der «Schauspielerperspektive» erfolgt der Bewegungsablauf von innen; das heisst, du tauchst in die Leinwand ein und wirst selbst zum Akteur (Schauspieler). Nach ein paar Versuchen merkst du, welche der beiden Varianten in welcher Situation am besten geeignet ist. Manchmal werden die beiden Varianten auch miteinander kombiniert.
In der Praxis begegne ich hin und wieder Athleten, welche beim Visualisierungstraining keine oder kaum Bilder im eigentlichen Sinne sehen. Die «Visualisierung» läuft bei diesen Menschen vordergründig auf gedanklicher (beschreibender) Ebene ab, was wohlgemerkt völlig in Ordnung ist.
Bestimmt hast du bei Sportübertragungen im Fernsehen schon gesehen, wie ein Experte am Ende eines Wettkampfs eine bestimmte Schlüsselszene für die Zuschauer zu Hause analysiert: Die Szene wird oft in Zeitlupe oder Superzeitlupe angeschaut und stellenweise das eine oder andere Mal zurückgespult. Mit einem ähnlichen Prinzip arbeiten auch Trainer, indem sie mit ihren Athleten Videostudium betreiben. Wenn du dich beim Visualisieren in der Zuschauerperspektive befindest, kannst du das gleiche Prinzip – eine Art Videostudium im Kopf – selbst anwenden, um dadurch neue Erkenntnisse zu gewinnen. Obwohl ich in meiner Tätigkeit noch kein Negativbeispiel erlebt habe, sollte diese Art der Visualisierung sicherheitshalber jedoch eher sparsam eingesetzt werden, da sich die langsame Vorstellung (Zeitlupe) oder das Anhalten des «Kopfvideos» im Extremfall nachteilig auf die «echte Bewegung» (Timing) übertragen könnte.
Eine Visualisierung ist keine «Zaubertechnik» im Sinne von «alles, was ich mir vorstelle, tritt sofort und immer ein». Damit Visualisierungen – also innere Bilder – ihr volles Potenzial entfalten, braucht es etliche Wiederholungen, und selbst dann gestaltet sich nicht immer genau das, was du erwartest. Wieso? Einerseits können innere Bilder von emotionalen oder körperlichen Faktoren überlagert werden, andererseits gibt es äussere (nicht kontrollierbare) Faktoren, die das Ergebnis mit beeinflussen. Stellt sich ein Sportler zum Beispiel vor, wie er den Gegner – wohlgemerkt mit fairen Mitteln – in einem Zweikampf konsequent attackiert, gleichzeitig aber Angst verspürt, wird die Angst eventuell stärker sein. Das ist etwa das Gleiche wie ein «schöner Film», der nicht abspielbar ist, weil die DVD Kratzer aufweist.
2.3 Den perfekten Film gestalten – das Visualisierungs-Drehbuch
Vor allem wenn es sich um ein neu zu erlernendes beziehungsweise komplexes Element handelt (beispielsweise neuer Bewegungsablauf), fällt es dir unter Umständen leichter, vor der eigentlichen Visualisierung zuerst ein Visualisierungs-Drehbuch zu erarbeiten. Stelle dir dabei folgende Frage: «Welche Punkte wären in einer Betriebsanleitung enthalten, damit ich in der Lage bin, mich beim Thema X weiter zu verbessern?»
Nachfolgend findest du auszugsweise ein «Betriebsanleitungs»-Beispiel eines «Flatteraufschlags» beim Volleyball (Quelle: teilweise aus www.volleyball-trainieren.de).
Vorbemerkung: Die Klammerbemerkungen stellen Abkürzungen dar und sind nach eigenemGutdünken wählbar. Sie dienen dazu, die einzelnen Punkte des Drehbuchs nach einer gewissen Einübungszeit schneller abzurufen (eine Art Code-Wort). Du brauchst diese aber nicht unbedingt einzusetzen.
a) Auf Arm-, Hand- und Körperhaltung achten (Körper)
Mein linker Fuss ist vorne mit der Schulterachse in Schlagrichtung. Ich achte besonders auf die optimale Körperspannung in den Füssen, Beinen und im Schulter-/Nackenbereich. Mein Schlagarm ist gebeugt und das Handgelenk fixiert. Der Ellbogen befindet sich oberhalb der Schulter.
Meine linke Hand hält den Ball vor der rechten Schulter in Brusthöhe.
Falls ich feststelle, dass ich in dieser Phase zu unruhig bin, konzentriere ich mich kurz auf meine Atmung und blende dadurch alles um mich herum aus.
b) Ball senkrecht nach oben werfen (senkrecht)
…
c) Kurzer und schneller Schlag mit «fester» Hand (Schlag)
…
d) Nach dem Treffen des Balls (danach)
…
Anmerkungen
Bei einem Visualisierungs-Drehbuch geht es weniger um einen perfekten Ablaufbeschrieb nach Lehrbuch, sondern vielmehr um deine subjektive Wahrnehmung. Dies gilt besonders, wenn du ein Drehbuch für ein bestimmtes Verhalten erarbeiten willst (zum Beispiel Ritual zwischen den einzelnen Punkten beim Badminton). Bei technischen Elementen ist es selbstverständlich sinnvoll, Punkte aus dem Lehrbuch beziehungsweise Anweisungen des Trainers zu integrieren. Aber selbst in solchen Fällen sollten deine persönlichen Empfindungen und Formulierungen den Hauptbestandteil des Drehbuchbeschriebs bilden.
Manchen Athleten fällt es leichter, wenn sie zuerst alles aufschreiben, was ihnen in den Sinn kommt, und erst danach eine Ordnung beziehungsweise Reihenfolge erstellen. In diesem Fall ist die Verwendung einzelner Schreibkarten oder Post-it-Zettel sinnvoll. Eine weitere Variante besteht darin, den perfekten Ablauf im Stile eines Aufsatzes ohne Titel aufzuschreiben und die wichtigsten drei bis acht Punkte mit einem Leuchtstift zu markieren. Diese Punkte ersetzen die eigentlichen Titel und stellen somit wichtige Erinnerungsanker zur Einübung des Ablaufs dar.
Bei einem neu zu erlernenden Element macht es vielleicht Sinn, das Drehbuch – eventuell in Kombination mit dem «echten» Training – über einige Tage hinweg immer wieder durchzulesen und erst dann mit dem eigentlichen Visualisieren zu starten, wenn die Inhalte des Drehbuchs genügend verankert sind. Eventuell hilft es dir, die Visualisierung zu Beginn teilweise langsamer (Zeitlupe) durchzuführen oder den «Film» kurz anzuhalten beziehungsweise zurückzuspulen. Das Ziel ist aber in jedem Fall, schlussendlich das Originaltempo zu erreichen. Solltest du das Bedürfnis verspüren, technische Hilfe in Anspruch zu nehmen, eignen sich zum Beispiel die Bildprogramme www.dartfish.com oder www.coachseye.com.
Grundsätzlich ist die Verwendung mehrerer Elemente in derselben Visualisierungsübung möglich. So könnte ein Handballtorhüter zum Beispiel folgende Elemente visualisieren:
Element 1: Genaue und schnelle Pässe auf lange Distanzen spielen.
Element 2: Bei Würfen der Flügelspieler nahe genug am Pfosten stehen.
Element 3: Stellungsspiel bei Tempogegenstössen optimieren.
Jedes einzelne Element wird grundsätzlich als «Zuschauer» (von aussen auf den «Monitor» schauen) sowie als «Schauspieler» (in den «Monitor» eintauchen) etwa fünf bis fünfzehn Mal wiederholt. Wie unter Ziffer 2.2. bereits angetönt, ist es aber auch möglich, mit nur einer Perspektive zu arbeiten. Die genaue Wiederholungszahl hängt von deinem Gefühl und der Länge eines entsprechenden Elements ab.
Technik 1: Bewegungsabläufe und Verhaltensmuster trainieren
Vorbemerkungen
Um die Technik optimal anzuwenden, ist es von Vorteil, wenn du die Einführung dieses Kapitels (Ziffer 2.1 bis 2.3) gelesen hast. Bei technisch anspruchsvollen Bewegungsabläufen ist es normalerweise hilfreich, diese bereits im «echten» Training geübt zu haben und somit bis zu einem gewissen Grad zu beherrschen.
Übungsziele
Allgemeine Wettkampf- und Trainingselemente verbessern, stabilisieren oder neu lernen (Bewegungsablauf, Taktik, Verhaltensweise).
Kurzbeschrieb
Nach einer kurzen Entspannungsphase stellst du dir bildlich jenen Bewegungs-/Verhaltensablauf vor, den du verbessern willst (eine Art neuer, «perfekter» Film). Jeder Ablauf ist mehrere Male zu wiederholen; das heisst, die Übung wird mehrmals wöchentlich durchgeführt, bis schlussendlich auch im «echten» Training/Wettkampf eine deutliche Verbesserung auszumachen ist.
Einsatzbeispiele
• Technische Elemente verbessern (Sprung, Landung, Ballannahme, Passqualität, Balltreffpunkt, Salto, Kurventechnik, Schusstechnik).• Standardsituationen (Freistoss, Penalty, Weitschuss, fliegender Wechsel im Mannschaftssport, Anspannungsgrad beim Start regulieren, optimale Konzentration während der ersten Wettkampfminuten).
Komplexität
Mittel.
Zeitbedarf
Fünf bis fünfzehn Minuten mehrmals wöchentlich.
Vorbereitung
Überlege dir, welche Elemente du genau visualisieren willst (als Inspiration siehe obige Einsatzbeispiele). Wähle jene ein bis maximal drei Elemente aus, in welchen du zurzeit am meisten Potenzial siehst. Werde dir jeweils bewusst, um was es genau geht. Also zum Beispiel nicht nur «Beinarbeit verbessern», sondern was genau du an der Beinarbeit verbessern willst (wie sieht der Soll-Zustand genau aus?).
Übungsdurchführung
Entspannungsphase (etwa zwei bis fünf Minuten)
Mache es dir auf einem Stuhl oder auf einer Liege bequem und schliesse die Augen. Nimm für eine Weile lediglich deinen Atem wahr… Erinnere dich nun an irgendeine Vergangenheitssituation, in welcher du in Balance warst (zum Beispiel schöner Platz in der Natur, Aufenthalt am Strand, spielen mit Kindern oder Tieren, Hobby ausüben, Zusammensein mit Freunden). Nimm die Situation für eine oder zwei Minuten mit möglichst vielen Sinnen wahr…
Schliesse nun die Situation bewusst ab und wende dich der eigentlichen Visualisierungsübung zu.
Hauptphase (etwa vier bis zehn Minuten)
Du startest deine Visualisierung in deinem mentalen Trainingsraum. Es spielt keine Rolle, ob es sich dabei um einen dir bekannten Raum handelt oder um einen Raum, den du noch nie gesehen hast. Setze oder lege dich in deinem Trainingsraum an einen Ort, an welchem du dich wohlfühlst. An der Wand entdeckst du einen grossen Monitor. Eventuell kannst du bereits etwas darauf erkennen, oder er ist noch ausgeschaltet…
Du erkennst auf dem Monitor dein erstes Element. Führe etwa fünf bis fünfzehn Wiederholungen aus der «Zuschauerperspektive» (Aussenperspektive) aus. Stelle dir das Element als den «perfekten» Film vor (Soll-Zustand). Du bist der Regisseur und entscheidest, wie sich der Film gestaltet…
Halte den Film allmählich an. Als Nächstes steigst du in den Monitor hinein und führst etwa fünf bis fünfzehn Wiederholungen aus der «Schauspielerperspektive» (Innenperspektive) aus. Vielleicht bist du hierbei sogar in der Lage, weitere Sinneseindrücke wahrzunehmen (zum Beispiel Körperempfindungen, Emotionen, Geräusche, Selbstgespräche, Gedanken oder Gerüche)… Wenn du fertig bist, steige aus dem Monitor heraus und setze oder lege dich wieder bequem hin.
Falls du noch weitere Elemente visualisieren willst, tue dies auf die gleiche Weise (Anwendung der Hauptphase) wie beim ersten Element. Wenn du nur ein Element visualisierst, fahre mit der «Rückkehr» fort…
Rückkehr (etwa eine Minute)
Frage dich zum Schluss, was für dich besonders wichtig ist, damit du dein/e Element/e im Trainings- und Wettkampfalltag verbessern kannst. Was willst du konkret umsetzen (Handlungen, Erkenntnisse)?
Falls du nach der Visualisierungsübung einschlafen willst, lasse den folgenden Abschnitt einfach weg.
Spüre deinen Körper wieder bewusst und fange an, dich leicht zu bewegen und zu strecken… Komme in deinem Tempo ins Hier und Jetzt zurück. Blinzle zuerst ein wenig und öffne dann deine Augen.
Variationen
Nach einigen Visualisierungseinheiten bist du wahrscheinlich in der Lage, die hier vorgestellte Übung abzukürzen und gegebenenfalls direkt in Wettkampf- sowie Trainingssituationen einzusetzen (siehe auch Technik 2).
Übrigens
Ein besonderer Vorteil des Visualisierungstrainings liegt darin, dass du dieses – im Gegensatz zum «echten» Training – praktisch ohne Einschränkungen anwenden kannst. Dies ist besonders in Fällen wertvoll, in welchen ein «echtes» Training nicht oder nur in beschränktem Masse möglich ist: schlechtes Wetter, keine Trainingsinfrastruktur oder kein Trainingspartner verfügbar, Rehabilitation.
Technik 2: Visualisierung und «echtes» Training kombinieren
Vorbemerkung
Wahrscheinlich fällt dir diese Übung leichter, wenn du bereits Erfahrungen im Visualisieren gesammelt hast. Mache dich deshalb allenfalls zuerst mit Technik 1 vertraut. Falls du jedoch zu jenen Sportlern gehörst, welche sehr visuell veranlagt sind, darfst du selbstverständlich sofort mit der hier vorgestellten Technik starten.
Übungsziele
Die Visualisierung wird ergänzend in die Durchführung des «echten» (physischen) Trainings integriert. Einerseits werden dadurch gelungene Trainingsaktionen zusätzlich verankert, andererseits können misslungene Aktionen mental «nachbearbeitet» werden.
Kurzbeschrieb
Die Schwerpunkte einer bevorstehenden Trainingseinheit werden vor Trainingsbeginn zuerst visualisiert. Daraufhin folgt die eigentliche, «echte» Trainingseinheit, wobei es auch während dieser Phase möglich ist, Kurzvisualisierungen einzustreuen. Nach der Trainingseinheit folgt zum Abschluss nochmals eine kurze Visualisierung.
Einsatzbeispiele
Grundsätzlich ist die Technik für sämtliche Elemente (Bewegungsablauf, Taktik, Verhaltensweise) möglich, welche auch im Training geübt werden. Konkrete Beispiele findest du zu Beginn dieses Kapitels unter Ziffer 2.1.
Komplexität
Gering bis mittel.
Zeitbedarf
Zwei bis acht Minuten Visualisierungstraining (plus Zeit für das «echte» Training).
Vorbereitung
Die geplanten Inhalte der «echten» Trainingseinheit – zumindest was die Schwerpunkte anbelangt – müssen bekannt sein.
Übungsdurchführung
Vorbemerkung: Als Übungsbeispiel stellen wir uns einen Schwimmtrainer vor, der mit seinen Athleten die «Rollwende» verbessern will. Da die Rollwende sehr komplex ist, könnte der Trainer das Hauptaugenmerk eventuell nur auf einen oder zwei einzelne Punkte legen. Auf was genau beziehungsweise auf wie viele Dinge geachtet wird, hängt unter anderem von der Entwicklung des Athleten und dem Trainingsziel ab. In der Praxis hat es sich bewährt, das Hauptaugenmerk bei der Visualisierung auf einen bis maximal drei Punkte (Schlüsselfaktoren) zu legen. Es ist jedoch trotzdem möglich, den ganzen Ablauf zu visualisieren (die restlichen Punkte werden dabei einfach nicht bewusst beachtet).
Schritt 1: Schwerpunkte definieren
Die Schwerpunkte des «echten» Trainings – welche ebenfalls für das Visualisieren relevant sind – werden definiert, und der Trainer erklärt, auf was bei der Ausführung besonders geachtet werden sollte (bei diesem Beispiel «Drehung auf kleinem Raum» und «Abstossen auf dem Rücken»).
Schritt 2: Visualisierung A
Der Trainer leitet die Visualisierung an: «Setze dich bequem hin und schliesse deine Augen. Atme einige Male tief durch… Nimm für eine Weile deinen Körper wahr und erlaube diesem, locker und entspannt zu sein…





























