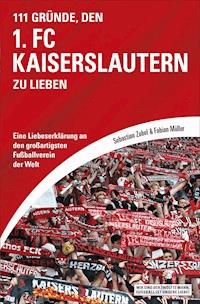
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schwarzkopf & Schwarzkopf
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Gänsehaut, Tränen, Freud und Leid: Nirgendwo sonst im deutschen Fußball liegt all das so nahe beieinander wie auf dem Betzenberg in Kaiserslautern. Schon vor der Gründung der Bundesliga waren die Roten Teufel weit über die Grenzen der Pfalz hinaus für ihren Spielstil bekannt. Angeführt von Fritz Walter, prägten der 1. FC Kaiserslautern und die deutsche Nationalmannschaft die Nachkriegsgeschichte. Und noch immer sorgt der FCK für Schlagzeilen: Als Absteiger Pokalsieger, als erster Aufsteiger Deutscher Meister, dann die Beinahe-Insolvenz und der Fast-Absturz in Liga drei - In Kaiserslautern scheint wirklich nichts unmöglich. Die Autoren liefern 111 Gründe, diesen verrückten Fußballverein mit all seinen Facetten zu lieben - auch wenn es zugegebenermaßen nicht immer ganz leichtfällt. Wer den Verein dennoch oder gerade deswegen liebt, findet in diesem Buch garantiert mehr als einen weiteren Grund für seine Leidenschaft. Und wer weiß, vielleicht kommt nach der Lektüre ja noch der eine oder andere Fan dazu.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Sebastian Zobel & Fabian Müller
111 GRÜNDE, DEN 1. FC KAISERSLAUTERN ZU LIEBEN
Eine Liebeserklärung an den großartigsten Fußballverein der Welt
WIR SIND DER ZWÖLFTE MANN,FUSSBALL IST UNSERE LIEBE!
Vorwort
EINE GROSSE FAMILIE: VON DER WAHL DER QUAL
Mit der freien Wahl ist es so eine Sache: Wir leben in einer Demokratie und können uns glücklich schätzen, über unsere politische Zukunft selbst entscheiden zu dürfen. Wir haben das Recht, fast überall in Europa zu leben und zu arbeiten. Und wir können in der Regel unsere Meinung kundtun, wann immer wir das wollen. Eigentlich geht es uns da doch ziemlich gut.
Eigentlich. Denn es gibt ein paar Dinge, die man sich nicht aussuchen kann. Die Familie zum Beispiel, weiß der Volksmund, die hat man einfach. Und ganz ähnlich verhält es sich mit dem Fußball – frei nach Chuck Norris: Du wählst nicht den Verein, der Verein wählt dich. Natürlich kann man sein Herzensteam auch wieder wechseln, aber sind wir doch mal ehrlich: Alles andere, als seinem Club auch in schwierigen Zeiten die Treue zu halten, ist doch irgendwie »Hoffenheim«. Nun kann man trefflich darüber streiten, ob der 1. FC Kaiserslautern die beste Wahl ist, um fußballerisch sozialisiert zu werden. Als Bayern-Fan hat man es sicher leichter: Nur alle paar Jahre muss man sich über eine Vizemeisterschaft schwarz-gelb ärgern. Und die Anhänger von St. Pauli oder Eisern Union erst: Ja, deren so alternativen Verein findet doch irgendwie jeder Fußballinteressierte wenigstens ein kleines bisschen sympathisch. Kaiserslautern, so ist stets zu hören, ist da anders. Die Stadt: nicht besonders pittoresk und alles andere als ein touristisches Must-see. Die Region: strukturschwach und provinziell. Die Fans: aggressiv und ungehobelt. Und der Verein: ein Ex-Champion mit großer Tradition, auf dem besten Weg, sich als graue Fahrstuhlmaus zu etablieren?
Mitnichten, denn die Pfalz ist stolz auf ihren Club, ihre Menschen und ihre Fußballhauptstadt. Gegenwart und Zukunft der Roten Teufel wurden schon mehrfach für beendet erklärt, doch eines hat den Verein immer am Leben gehalten – seine Anhänger. Sie gehen mit ihrem Team durch alle Höhen und Tiefen, und vor allem von Letzteren hat es in der jüngeren Vergangenheit einige gegeben. Dieses Buch ist eine Ode an die Fans des 1. FC Kaiserslautern, die es schaffen, ihren Verein trotz oder gerade wegen alldem zu lieben. Ob niederschmetternde Rückschläge, chaotische Auftritte, peinliche Kuriositäten oder sensationelle Comebacks: Der FCK ist wie eine Seifenoper, die nie langweilig wird. Nicht so ausgelutscht wie Gute Zeiten, schlechte Zeiten (VfL Wolfsburg), nicht so abgehalftert wie Reich undSchön (1. FC Köln), nicht so bieder wie die Lindenstraße (viele, viele) und nicht so peinlich wie Berlin – Tag & Nacht (Hamburger SV).
Der FCK ist all das und noch viel mehr. Er ist eine Institution, ohne die die Geschichte des deutschen Fußballs sicher anders verlaufen wäre. Er gibt den Menschen in der Pfalz und weit darüber hinaus Halt, auch wenn es nicht immer einfach mit ihm ist. Aber so ist es nun mal bei einer Familie und auch bei der Liebe zu einem Fußballverein – man kann sie sich nicht aussuchen, aber man kann immer auf sie zählen.
In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen, Wiedererkennen, Neuentdecken und Rückbesinnen wünschen die mit ihren Familien übrigens sehr zufriedenen
Fabian Müller und Sebastian Zobel
1. KAPITEL
WELTMEISTERLICHER FCK
EGAL OB WUNDER VON BERN ODER SOMMERMÄRCHEN – OHNE DEN FCK? UNDENKBAR!
GRUND 1
Weil Fritz Walter in der Pfalz einfach jedes Kind in seinen Bann zieht.
Als in Kaiserslautern aufgewachsener und halbwegs fußballbegeisterter Junge ist es eigentlich unmöglich, sich nicht in den 1. FCK zu verlieben. Ein persönliches Beispiel: In unserer Grundschulzeit hatte die Dortmunder Borussia ihre ganz großen Jahre, gewann zweimal die Meisterschaft und 1997 sogar die Champions League – was zur Folge hatte, dass einige verwirrte Seelen in der großen Pause tatsächlich in den Dortmunder Continental Trikots herumliefen. Die Mehrheit aber betete einen Verein an, der gerade zum ersten Mal in die zweite Bundesliga abgestiegen war. Warum ich damals FCK-Fan geworden bin und mich nicht von schwarz-gelben Mächten habe beeinflussen lassen, das liegt im Grunde genommen an zwei Situationen – und einer Person.
Rückblende, Ende Oktober 1995: Fritz Walter wird 75 Jahre alt. Ein großer Tag für mich, denn meine Oma hat mich mit in die Innenstadt genommen. Unser Ziel ist der alte FCK-Fanshop am Stiftsplatz. Drei Wochen zuvor feierte ich meinen achten Geburtstag, geschenkt gab es unter anderem einen 15-D-Mark-Gutschein, der nun in Fandevotionalien investiert werden soll. Als ich mich mal wieder nicht zwischen den vielen Schals entscheiden kann, betritt ein Reporterteam den Laden – in meiner Erinnerung eines vom Südwestfunk. Prompt hält mir eine Frau ein Aufnahmegerät vor die Nase, ich solle doch bitte etwas zu Fritz Walter sagen. Vermutlich hat sie, wenn überhaupt, erwartet, dass ich den Namen schon einmal gehört habe – und ihn im besten Fall mit den Roten Teufeln in Verbindung bringe.
Als ich dann wie ein Wasserfall anfange, vom Wunder von Bern, den zwei Kaiserslauterer Meisterschaften Anfang der 1950er und vom »Fritz-Walter-Wetter« zu erzählen, werden nicht nur die Augen meiner Großmutter ganz groß. Ohne Fritz Walter jemals persönlich getroffen zu haben, ohne jemals auch nur ein Spiel von ihm gesehen zu haben, war dieser Mann für mich kleinen Steppke schon damals der Allergrößte. Er stand wie kein Zweiter für das, was Fußballnostalgiker heute mit Tränen in den Augen am Kommerzgeschäft Bundesliga vermissen: Vereinstreue, absolute Identifikation, Heimatverbundenheit. Fritz Walter war für den achtjährigen Fabian aus Kaiserslautern ein absoluter Held.
Das hat sich in den Jahren darauf natürlich nicht geändert, ganz im Gegenteil. Zeitsprung ins Millenniumsjahr 2000: Inzwischen bin ich in der siebten Klasse angekommen. Wie jedes Jahr veranstaltet mein Gymnasium ein Mittelstufenturnier zwischen allen Klassen von der siebten bis zur zehnten Jahrgangsstufe. Es geht um den begehrten Fritz-Walter-Pokal. Als jüngstes Team im Teilnehmerfeld kommt meine Mannschaft sensationell bis ins Finale, wo dann aber beim 0:3 gegen eine körperlich klar überlegene zehnte Klasse Endstation ist. Zunächst untröstlich, gibt es für uns dann doch noch ein Happy End: Fritz Walter ist persönlich vor Ort und überreicht allen Teilnehmern signierte Autogrammkarten. Natürlich habe ich derer schon zur Genüge im heimischen Sammelalbum, aber diese eine, die ist eine ganz besondere.
Ich kann mich heute privilegiert fühlen, den großen Fritz Walter einmal persönlich getroffen zu haben. Auch, wenn es nur für wenige Sekunden war. Spätestens seit damals verstehe ich nun, warum Männer im Rentenalter mit Leuchten in den Augen davon erzählen, vor einem halben Jahrhundert mal »gegen den Fritz« gespielt haben zu dürfen. Und warum rivalisierende Fans zwar Vater und Mutter eines FCK-Anhängers, niemals aber die Lauterer Lichtgestalt beleidigen dürfen. Fritz Walter verstarb im Sommer 2002, doch sein Andenken lebt ewig weiter. Schade ist nur, dass die Kinder von heute niemals die Chance haben werden, ihm einmal persönlich gegenüberzustehen. Bleibt nur zu hoffen, dass deswegen keine Welle schwarz-gelber Trikots über die pfälzischen Schulhöfe rollt.
GRUND 2
Weil man in Kaiserslautern weltmeisterlich sein Auto tanken konnte.
E10, 95, 98 oder 100 Oktan – der Besuch an der Tankstelle ist heute beinahe eine Wissenschaft für sich. Wie schön waren da noch die Zeiten, als man in Kaiserslautern weltmeisterlich einfach sein Kraftfahrzeug volltanken konnte, an der Tankstelle von FCK-Legende Ottmar Walter. »Willst du unserem Ottmar danken, musst du fleißig bei ihm tanken« lautete damals der Slogan. Doch viel Glück hatte der Weltmeister von 1954 mit der gepachteten Tankstelle nicht: Er häufte Schulden an und musste sie 1970 nach einem verlorenen Prozess gegen einen Ölkonzern wieder aufgeben.
Ohnehin war das Leben von Stehaufmännchen Ottmar Walter gezeichnet von Rückschlägen wie kaum ein zweites. Schon vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges prophezeiten ihm die Ärzte das vorzeitige Karriereende. Undenkbar schien die Rückkehr in den Fußball angesichts dreier Granatsplitter im Knie. Doch der jüngste der drei Walter-Brüder schaffte ein eindrucksvolles Comeback, erzielte für seinen 1. FC Kaiserslautern weit über 300 Treffer und damit so viele wie bis heute kein anderer. Seine beiden wichtigsten schoss »Ottes« wohl im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft 1951, als er beinahe im Alleingang den 0:1-Rückstand gegen Preußen Münster noch in einen Sieg drehte und den Roten Teufeln den ersten großen Titel der Vereinshistorie bescherte.
Der Lohn war die Berufung in die Nationalmannschaft, mit der Ottmar Walter 1954 Weltmeister wurde – vier Treffer steuerte er zum Titelgewinn bei. Im Endspiel ging er allerdings leer aus. Auch, weil der Siegtorschütze Helmut Rahn ihn in der berühmten 84. Minute frei stehend übersah und lieber selbst von der Strafraumgrenze abzog – und mit einem Schlag zum Helden wurde. Ottmar Walter hingegen war ein Weltmeister im Stillen, der nach dem Karriereende einen Autounfall baute, Geldsorgen hatte, sein Heil im Alkohol suchte und schließlich 1968 einen Selbstmordversuch unternahm (O-Ton: »Das war eine Kurzschlusshandlung, die mir im Nachhinein unverständlich ist.«). Schließlich musste Walter seine weltmeisterliche Tanke übergeben – dieser Beruf war damals übrigens neben der Eröffnung einer Lotto-Annahmestelle der Klassiker für ausgediente Fußballer.
Ottmar Walter hatte viel Pech im Leben, teilweise auch selbst verschuldet. Die Stadt Kaiserslautern vergaß ihren Helden jedoch nicht. »Ottes« bekam einen Job in der Stadtverwaltung, den er bis zu seiner Frühpensionierung im Alter von 58 Jahren innehatte. Erst spät kam er auch zu zeremoniellen Ehren: Im Millenniumsjahr 2000 erhielt der gelernte Automechaniker das Bundesverdienstkreuz, und auch vier Jahre später, zum 50-jährigen Jubiläum des Wunders von Bern, richteten sich noch einmal alle Augen auf den damals ältesten noch lebenden Weltmeister von 1954.
Im Juni 2013 verstarb Ottmar Walter, 89-jährig und gezeichnet von Alzheimer, in einem Pflegeheim in seiner Heimat Kaiserslautern. Die Erinnerung an den bescheidenen Weltmeister wird jedoch lebendig bleiben: Seit 2004 betreten alle FCK-Fans das Stadiongelände auf dem Betzenberg durch das »Ottmar-Walter-Tor«. Nur ihr Auto volltanken, ja, das müssen sie heute woanders erledigen.
GRUND 3
Weil Werner Liebrich mehr oder weniger die Grätsche erfunden hat.
Die Grätsche gehört zum Fußball wie die Stadionwurst in der Halbzeitpause oder das Meckern über den Schiedsrichter – und ein gelungenes Tackling erfreut sich vor allem in den Niederungen des Amateurfußballs meist immer noch größerer Beliebtheit als der Hackentrick im gegnerischen Strafraum. Den Ruf als Erfinder der Grätsche proklamieren natürlich viele fußballerische Raubeine für sich. Doch der einzig wahre (Mit-)Urvater der Grätsche war, ganz klar, ein Kaiserslauterer, nämlich der 1954er Weltmeister Werner Liebrich.
Eigentlich sollte man meinen, eine bessere »Nummer zehn« als Fritz Walter hätte es im deutschen Weltmeisterteam überhaupt nicht geben können. Doch der Spielführer trug lieber die Nummern acht oder 16. Und so wurde eben dem beinharten Mittelläufer Werner Liebrich die Ehre zuteil, das Trikot mit der berühmtesten aller Nummern zu tragen – was angesichts von späteren »Zehnern« wie Maradona, Zico, Netzer oder Platini beinahe ironisch wirkt.
Schon im ersten Aufeinandertreffen mit den als unschlagbar geltenden Ungarn (3:8) bewies Liebrich in der Schweiz das, was man gerne als »internationale Härte« bezeichnet. Das »gleitende Grätschen«, englisch »sliding tackling«, entwickelte er fast zur Perfektion. Prominenter Leidtragender: Ungarns Ferenc Puskás, der von Liebrich ordentlich auf die Socken – oder besser: auf das Sprunggelenk – bekam. Nach dem Turnier wurde der gebürtige Kaiserslauterer von der Fachpresse als weltweit bester Spieler auf seiner Position gefeiert. Neben seinem kompromisslosen Einschreiten in der Abwehr glänzte er während der WM 1954 auch als verkappter Libero mit öffnenden Pässen in die Spitze. Profiteur war nicht nur einmal Angreifer Ottmar Walter, mit dem sich Liebrich im berühmten WM-Quartier in Spiez das Zimmer teilte.
Auch später als Jugend- und Amateurtrainer beim 1. FC Kaiserslautern blieb Liebrich seiner Linie treu – defense first. So erinnert sich der ehemalige Lauterer Nachwuchsspieler und heutige Kommentator Marcel Reif im Tagesspiegel an eine kuriose Situation: »Und einmal, ich fand, dass ich begeisternd gespielt hatte, sozusagen weltmeisterlich, überragend und dabei auch ästhetisch und leicht, als ich also nach Abpfiff vom Platz ging, erwartete ich eigentlich, dass Liebrich auf mich zukommen und in etwa sagen würde: ›Das ist er! Du, Marcel, du bist mein würdiger Nachfolger!‹ Aber Liebrich sagte so etwas nicht, er schaute mich von oben bis unten an und wieder zurück und sagte: ›Bei uns in Lautern tun mir kei’ Walzer tanze!‹ So ein Satz könnte einem schon die Liebe vergällen, das Dumme war nur, dass Liebrich, der Weltmeister, wusste, wovon er sprach.«1
Vielleicht mag das auch ein Grund sein, warum Liebrich seinem Club stets treu geblieben ist, unter anderem ein Angebot vom AC Mailand ausschlug und später sogar kurzzeitig die erste FCK-Mannschaft in der frisch gegründeten Bundesliga als Coach vor dem Abstieg bewahrte. Er blieb sein Leben lang Lauterer, erst als Spieler, dann als Trainer und schließlich als Unternehmer: Die Lotto-Toto-Annahmestelle »Werner Liebrich« ziert noch heute in der Richard-Wagner-Straße das Kaiserslauterer Stadtbild.
GRUND 4
Weil der vergessene Weltmeister ein echter Kaiserslauterer ist.
Elf wackere deutsche Helden standen am 4. Juli 1954 im Schweizer Wankdorfstadion im WM-Finale und siegten gegen scheinbar übermächtige Ungarn sensationell mit 3:2 – die Geschichte vom Wunder von Bern kennt nicht erst seit Sönke Wortmanns Verfilmung aus dem Jahr 2003 beinahe jedes Kind. Dass der Kern der Mannschaft um Fritz Walter damals aus Kaiserslauterer Spielern bestand, wissen in Fußballdeutschland auch noch viele. Oft vergessen wird bei den häufig verklärten Rückblicken aber der Name Werner Kohlmeyers – und damit auch das traurige Schicksal, das den gebürtigen Lauterer später ereilte.
Kohlmeyer bestritt als linker Verteidiger herausragende 332 Spiele für seine Roten Teufel, stand fünfmal im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft und holte mit dem FCK insgesamt zehnmal den Titel in der Oberliga Südwest. Karrierehöhepunkt jedoch war das Finale von Bern, wo der Abwehrmann gleich zweimal für den geschlagenen Keeper Toni »Teufelskerl« Turek auf der Linie klärte. Am Ende wurde die DFB-Elf Weltmeister – und der damals 29-Jährige Pfälzer war mittendrin.
Doch Kohlmeyers Glück hielt nicht lange an: Nach dem Karriereende 1963 verfiel der dreimalige Familienvater dem Alkohol, verlor erst seinen Job als Lohnbuchhalter bei der Kaiserslauterer Spinnerei Kammgarn und später dann auch Haus, Frau und Kinder. Kohlmeyer eröffnete ein Sportgeschäft und scheiterte auch damit. Sepp Herberger bot dem gefallenen Weltmeister seine Hilfe an, knüpfte daran aber die Bedingung, er müsse eine Entziehungskur machen – ohne Erfolg. Die Krankheit wollte »Kohli« sich selbst nicht eingestehen. Schließlich landete Kohlmeyer in Mainz, fand dort erst einen Job als Hilfsarbeiter auf dem Bau und später dank der Vermittlung des Sportreporters Werner Höllein eine Stelle als Pförtner bei der Mainzer Allgemeinen Zeitung – allerdings nur am Hintereingang. Getrennt von Frau und Kindern, wohnte er mit seiner Mutter in einer Sozialbauwohnung im Stadtteil Mombach, wo er im März 1974 an den Folgen eines Herzanfalls den Tod fand – als Erster aus der Weltmeisterelf von 1954.
Heute erinnert an den »vergessenen Weltmeister« das Werner-Kohlmeyer-Tor auf dem Betzenberg, außerdem findet regelmäßig an Pfingsten ein Gedächtnisturnier im Kaiserslauterer Stadtteil Morlautern statt. Einen großen Auftritt hatte Kohlmeyer dann noch, posthum: als rettender Verteidiger in Sönke Wortmanns Verfilmung des Wunders von Bern. Beinahe hätte sich dabei der Kreis sogar geschlossen: Für die Rolle war ein Enkel Kohlmeyers im Gespräch.2 Den Part als Double bekam der ehemalige Wuppertaler Profi Christian Broos. Es wäre auch zu schön gewesen.
GRUND 5
Weil Horst Eckel die lebende Chronik des Wunders von Bern ist.
Horst Eckels erfolgreiche Karriere auf nur ein Spiel zu reduzieren, das wäre äußerst ungerecht – aber im Prinzip ist es genau diese eine Partie am 4. Juli 1954, die den gebürtigen Vogelbacher seit nunmehr fast 60 Jahren verfolgt. Natürlich nur im positiven Sinne. Horst Eckel ist der jüngste der Weltmeister von 1954 und, gemeinsam mit seinem damaligen Zimmergenossen Hans Schäfer, der letzte noch lebende deutsche Endspielteilnehmer. Das macht ihn, der als Youngster alle sechs Endrundenspiele bestritt, heute zum logischen Wortführer der legendären Truppe um Trainer Sepp Herberger.
Eckels großes Vorbild war Fritz Walter, und seit dessen Tod im Jahr 2002 hat er eben die Rolle des Ehrenspielführers übernommen: Er ist so etwas wie die lebende Chronik des Wunders von Bern. Eckel berichtet über die WM in der Schweiz, schreibt Bücher, gibt Interviews und ist immer noch regelmäßig Gast (und Teilnehmer) bei Prominentenspielen. Außerdem war er Sönke Wortmanns wichtigster Berater beim Dreh von Das Wunder von Bern. Seinen Status weiß der rechte Läufer durchaus zu genießen: »Ich kann hinkommen, wo ich will – in ganz Deutschland oder sogar im Ausland – ich werde immer wieder darauf angesprochen. Und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf«, sagte er im Februar 2012 dem Sportinformationsdienst.
Eckel, wegen seiner Statur und Agilität »Windhund« genannt, wurde als 17-Jähriger beim Freundschafts-Derby zwischen Vogelbach und Kindsbach vom FCK entdeckt, als er in der zweiten Halbzeit sechs (!) Tore erzielte. Dann ging es steil bergauf: Deutscher Meister mit 19 Jahren, dann noch einmal zwei Jahre später und schließlich Weltmeister mit 22 Jahren. Im Finale bewachte er den ungarischen Top-Stürmer Nándor Hidegkuti – mit Erfolg! Mehr als ein Pfostenschuss gelang dem kongenialen Partner von Ferenc Puskás gegen die deutsche Elf nicht. Eckel nahm vier Jahre später in Schweden noch ein zweites Mal an einer Weltmeisterschaft teil. Seine Karriere beendete er erst 1969 mit einem Abschiedsspiel in Braunschweig.
Ganz besonders beliebt ist Horst Eckel, der später in Trier studierte und in Kusel als Realschullehrer unterrichtete, auch wegen seiner Heimatverbundenheit. Trotz eines sehr lukrativen Angebots des englischen Clubs Preston North End verließ er Kaiserslautern wie seine damaligen Teamkameraden nicht und wohnt auch heute noch in seiner Heimatregion. Klar, dass er dem FCK auf ewig verbunden ist und wenn möglich jedes Spiel der Roten Teufel im Stadion verfolgt. Schließlich sagt er, und das wird jeder FCK-Fan gerne hören: »Das ist mein Verein. Ich bin hier groß geworden und durch den 1. FC Kaiserslautern groß geworden. Da steckt mein Herzblut drin. Das ist so und wird immer so bleiben.«3
GRUND 6
Weil Youri Djorkaeff noch lange Zeit die Arbeitsplätze am Lauterer Gericht sicherte.
Der Jubel bei Fans und Medien war groß im Sommer 1999, als der 1. FC Kaiserslautern die Verpflichtung des französischen Weltmeisters Youri Djorkaeff bekannt gab. Der Spielmacher kam vom italienischen Weltclub Inter Mailand für angeblich nur vier Millionen Mark in die Provinz. Ganz klar: Der Transfer ist bis heute der spektakulärste in der Lauterer Vereinsgeschichte. Rückblickend muss man jedoch festhalten: Die Verpflichtung Djorkaeffs war ein klassischer Bock – auf und vor allem neben dem Feld.
Eigentlich hatte alles so gut angefangen: Glanz und Glamour sollte Djorkaeff nach Kaiserslautern bringen, er, der kreative Exzentriker mit dem genialen rechten Fuß. Und unter Coach Otto Rehhagel lief das zunächst auch ganz gut – 14 Tore und sechs Vorlagen standen nach der Premierensaison für den damals 31-Jährigen zu Buche. Doch mit Rehhagels Nachfolger, dem mangels Trainerlizenz »Team-Manager« genannten Andreas Brehme, kam Djorkaeff dann überhaupt nicht zurecht. Die Privatfehde der beiden Weltmeister füllte die Gazetten und wurde auf dem Rücken des Teams ausgetragen – entsprechend bescheiden fielen dann auch die Leistungen aus. In der Hinserie der Saison 2001/02 stand Djorkaeff lediglich 149 Minuten auf dem Feld.
Anfang 2002 war das Tischtuch dann so sehr zerschnitten, dass der Franzose wegen zweifachen Vertragsbruchs (erst hatte er einen Termin mit FCK-Boss Jürgen Friedrich geschwänzt, dann in einem Interview Andreas Brehme beleidigt) zur bis dato höchsten Geldstrafe der Vereinsgeschichte verurteilt wurde: 15.000 Euro musste er blechen. Mehr als nur der Anfang vom Ende: Obwohl sein Vertrag noch bis Saisonende gültig gewesen wäre, ließ der FCK seinen Star ablösefrei nach England zu den Bolton Wanderers ziehen.
»Das Kapitel ist mit dem heutigen Tag beendet«, sagte Djorkaeff nach seinem Weggang, doch im Nachhinein steckt in diesem Zitat nur ganz viel bittere Ironie, denn nichts war beendet. Der Spieler Djorkaeff sollte in der Pfalz noch diverse Personen beschäftigen – allen voran eine Vielzahl an Juristen. Erst nutzte der DFB den Transfer als Präzedenzfall, um den Verein zu einer Geldstrafe samt Punktabzug zu verdonnern. Dann meldete sich Djorkaeff selbst zu Wort und forderte die Nachzahlung von angeblich noch ausstehenden 405.198,82 Euro an Prämien – vergeblich.
Und schließlich war da noch ein Unfall mit Sachschaden im vierstelligen Bereich inklusive Fahrerflucht, der dem Franzosen zur Last gelegt wurde. Das Arbeitsgericht Kaiserslautern verurteilte ihn zu 75.000 Euro Geldstrafe, die er nie beglich – und deswegen zeitweise sogar per Haftbefehl gesucht wurde. Nur war Djorkaeff da schon in England und sah auch nicht die Notwendigkeit, den regelmäßig anberaumten Vorladungen vor Gericht nachzukommen. Für die dortigen Sachbearbeiter erwies er sich dabei immerhin als ausgezeichnete Arbeitsbeschaffungsmaßnahme – viel mehr bleibt in Kaiserslautern aber von der Ära Djorkaeff nicht zurück.
GRUND 7
Weil niemand so bitter um den ersten Abstieg getrauert hat wie Andreas Brehme.
Wir schreiben den 18. Mai 1996. Nach einem 1:1 im Abstiegsduell bei Bayer Leverkusen am letzten Spieltag muss der 1. FC Kaiserslautern, Gründungsmitglied der Bundesliga, erstmals den bitteren Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Die ganze Pfalz versinkt damals in einem Meer aus Tränen. Hätte das Spiel auf dem Betzenberg stattgefunden – Kaiserslautern wäre überflutet worden.
Eine Szene ist vielen Zuschauern bis heute im Gedächtnis geblieben: Nach Spielende werden der Leverkusener Rudi Völler und der Lauterer Andreas Brehme zum Interview gebeten. Beide verbindet eine lange Freundschaft. 1990 gehörten sie zur Deutschen Nationalmannschaft, die in Italien den Weltmeistertitel holte. Brehme traf im Finale gegen Argentinien per Elfmeter zum entscheidenden 1:0.
Unterschiedlicher können zwei Momente nicht sein. 1990 vereint in Glückseligkeit, 1996 haben Rudi Völler und Leverkusen den Abstieg in letzter Sekunde verhindert – Andy Brehme und der FCK steigen ab. Man mag über Brehme sagen, was man will. Zum Beispiel, dass er die Trainingswissenschaft nicht neu erfunden hat. Doch eines kann man über diesen Mann ganz sicher nicht behaupten: dass er keine Emotionen zeigen kann! In dem besagten Interview nach Spielschluss ließ Brehme seinen Gefühlen freien Lauf und weinte – an der Schulter seines Freundes Rudi Völler.
Jahre später sagte er über den bittersten Moment seiner Karriere: »Als Rudi und ich nach dem Spiel zum Interview gebeten wurden, hatte ich einen solchen Kloß im Hals, dass ich kaum sprechen konnte. Ich war nie zuvor abgestiegen, das war ein neues Gefühl für mich – und kein schönes! Plötzlich kamen mir die Tränen, da habe ich mich bei meinem Freund angelehnt. Ich weiß nicht, ob ich mich auch jemand anderem so anvertraut hätte. Da standen zwei Weltmeister Arm in Arm am Abgrund.«4
Dieser Moment war der Beweis dafür, dass auch echte Männer weinen dürfen. Andreas Brehme war mehr als nur der Spieler irgendeines Vereins. Er war Spieler beim FCK. Bei seinem FCK. Heutzutage würden sich die meisten Spieler seines Kalibers nach einem Abstieg den Mund abwischen und ohne mit der Wimper zu zucken bei einem anderen Verein aus der Bundesliga unterschreiben. Doch nicht so Andy Brehme. Er tat das, was die meisten seiner Mannschaftskameraden damals taten. Er blieb in Kaiserslautern und half mit, den Karren aus dem Dreck zu ziehen – und wie! Nur eine Woche später wurden mit dem Sieg im DFB-Pokal-Finale gegen den Karlsruher SC die ersten Tränen getrocknet. Es folgte nur ein kurzer Abstecher in die zweite Bundesliga. Und der Rest, ja der Rest ist Geschichte.
GRUND 8
Weil selbst der Krieg Fritz Walter nicht vom Fußballspielen abhalten konnte.
Bereits mit 19 Jahren bestritt der begnadete Fritz Walter sein erstes Länderspiel. Beim 9:3-Sieg über Rumänien am 14. Juli 1940 erzielte er gleich drei Treffer. Schon damals wurde dem Lauterer Idol eine große Karriere vorhergesagt. Doch der Zweite Weltkrieg raubte Fritz Walter und vielen anderen Fußballern die besten Jahre. Er wurde von der Wehrmacht eingezogen und als Infanterist nach Frankreich versetzt. Zwischen 1942 und 1950 bestritt er kein einziges Länderspiel.
Auch wenn der Krieg den Ligabetrieb und die Länderspiele verhinderte, Fritz Walter spielte weiter Fußball. Zu seinem Glück gab es damals den begeisterten Fußballfan Hermann Graf. Dieser war Luftwaffenoffizier und selbst Torwart. Mit Hilfe des damaligen Reichs- und späteren Bundestrainers Sepp Herberger ließ er aus allen Einheiten der Wehrmacht die besten Fußballspieler zusammenkommen. Herberger versuchte dadurch, seine Nationalspieler vor den Gefahren des Krieges zu schützen, denn die Spieler dieser Militärmannschaft verfügten über Privilegien, wurden größtenteils vom Kampfeinsatz an der Front verschont. Hermann Graf taufte die Soldaten-Mannschaft auf den Namen »Rote Jäger«. Das sollte sich später als der Ursprung der »Roten Teufel« erweisen.
Die Roten Jäger waren im Dritten Reich sehr bekannt und beliebt. In ihren Reihen spielten außer Fritz Walter noch weitere Nationalspieler und Deutsche Meister wie Hermann Eppenhoff und Alfons Moog. Die regelmäßigen Spiele der Mannschaft fanden teilweise vor mehr als 10.000 Zuschauern statt. Neben zahlreichen Auswahlmannschaften spielten Fritz Walter und Co. zum Beispiel auch gegen Bayern München und die ungarische Nationalmannschaft.
Nach Kriegsende geriet Fritz Walter an der rumänisch-ukrainischen Grenze in sowjetische Gefangenschaft. Da sowohl die Gefangenen als auch die Soldaten in dem Lager Fußball spielten, blieben Fritz Walter und sein Talent nicht lange unentdeckt. Der zuständige Lagerkommandant entpuppte sich ebenfalls als fußballverrückt. Angeblich bewahrte er Fritz deshalb vor dem Abtransport in ein sibirisches Lager. Walter kam frei und kehrte schon 1945 in seine Heimatstadt Kaiserslautern und zu seinem FCK zurück. Er entschied, dass die Lauterer fortan in komplett roten Trikots spielen sollten. Das war die Geburtsstunde der Roten Teufel vom Betzenberg.
GRUND 9
Weil der FCK Fußball-Deutschland den Capitano geschenkt hat.
Zugegeben: Ein Weltmeistertitel war Michael Ballack ja leider nie vergönnt – auch wenn er 2002 und 2006 ganz nahe dran war und vielleicht auch 2010 entscheidend hätte mitwirken können. Trotzdem passt er hervorragend in diese Kategorie, hat doch kaum ein größerer Fußballer seine ersten Schritte im FCK-Trikot gemacht. Oft wird vergessen, dass der lange Zeit als »Titel scheu« geltende Capitano schon in seiner ersten Saison als Profi den wohl sensationellsten Erfolg aller Zeiten feiern konnte: Mit dem 1. FC Kaiserslautern gelang Ballack 1997/98 das Kunststück, als Aufsteiger Deutscher Meister zu werden.
Dass der Sachse mal ein ganz Großer werden würde, war Insidern schon früh klar. Schon 1996 wurde Ballack erstmals in der deutschen U21-Nationalmannschaft eingesetzt. Damals spielte er noch in der dritten Liga bei seinem Heimatverein Chemnitzer FC. In einer Saure-Gurken-Zeit, in der vielversprechende deutsche Talente rar gesät waren, standen natürlich schnell viele Proficlubs Schlange. Als Chemnitz knapp den Aufstieg in die zweite Bundesliga verpasste, entschloss sich Ballack zu einem Wechsel – und zwar nach Kaiserslautern, wo Otto Rehhagel die Roten Teufel gerade erst wieder in die Beletage geführt hatte. Die sportliche Perspektive stimmte, und auch das Angebot von Präsident Hubert Kessler sagte Ballack und den klammen Chemnitzern offenbar zu.
Doch unter König Otto, bekannt für seine Affinität für ältere Spieler, hatte es Ballack richtig schwer. Der Star der U21-Nationalmannschaft saß zunächst nur auf der Bank, kam in der Hinrunde zu lediglich drei Kurzeinsätzen. In der Winterpause zog er sogar die Rückkehr nach Chemnitz in Erwägung, biss sich aber dann doch in Kaiserslautern durch. Eine gute Entscheidung, denn in der nächsten Spielzeit ging es steil bergauf: 30 Bundesligaspiele mit vier Toren, sechs Champions-League-Einsätze, die erstmalige Nominierung für die Nationalmannschaft (gemeinsam übrigens mit Teamkollege Marco Reich) und im April 1999 das Länderspieldebüt beim 0:1 gegen Schottland. 1997 weitere Einsätze im DFB-Trikot sollten folgen.
Dann beging Otto Rehhagel allerdings die wohl gröbste Fehleinschätzung seiner Trainerkarriere: In den letzten Saisonspielen setzte er Ballack immer seltener ein, und als dieser dann seine Zelte in der Pfalz abbrechen wollte, sagte der Coach: »Ballack ist ein Ersatzspieler, der in jeder Beziehung zu unreif ist.«5 Heute muss man feststellen: Ein kapitaler Bock des alten Herrn. Ballack war das egal. Er holte 2002 mit Leverkusen und Deutschland gleich vier Vize-Titel, reifte bei Bayern zum Weltklassespieler und drückte anschließend auch dem FC Chelsea seinen Stempel auf.
Sein größter Triumph war aber vielleicht die späte Genugtuung gegenüber dem Nachwuchs-Verweigerer Otto Rehhagel. Das Fußballmagazin 11 Freunde zitiert den Capitano wie folgt: »Ich muss Herrn Rehhagel ja fast dankbar sein, immerhin hat er mir indirekt den Weg nach Leverkusen geebnet, als er mich in Lautern auf die Bank setzte.«6 Schönen Dank auch. Mit großer Sicherheit König Ottos schlechteste Entscheidung in vielen Jahren Bundesliga.7
GRUND 10
Weil ein Weltmeister und ein Vizeweltmeister von 1954 den FCK trainierten.
Walter, Walter, Kohlmeyer, Liebrich, Eckel: Natürlich erfuhren in der Pfalz vor allem die deutschen WM-Helden von 1954 ihre Huldigung – aber nicht nur sie. Auch ein ungarischer Finalteilnehmer kam beim FCK zu großen Ehren, nämlich als erster ausländischer Übungsleiter der Roten Teufel in der Bundesliga überhaupt. Im Sommer 1965 übernahm der ehemalige Abwehrspieler Gyula Lóránt das Traineramt beim 1. FC Kaiserslautern und beerbte damit keinen Geringeren als Weltmeister Werner Liebrich. Ihre Wege kreuzten sich 1954 in der Schweiz also nicht zum letzten Mal.
Gyula Lóránt und Werner Liebrich, auf dem Feld hatten sie als beinharte, zentrale Defensivspieler die gleiche arbeitsintensive Position inne – und auch als Trainer legten beide vor allem Wert auf körperliches Spiel. Ihr gemeinsames Vorbild: Sepp Herberger. Ihr Anspruch: vollkommen unterschiedlich. FCK-Nachwuchstrainer Werner Liebrich wurde im Februar 1965 kurzfristig zum Chefcoach berufen und hatte nur eine Aufgabe: den Klassenerhalt sichern. Es gelang ihm, und nach getaner Arbeit kehrte der gebürtige Lauterer wieder auf den ruhigeren Posten als Trainer der zweiten Mannschaft zurück.
Sein Nachfolger wurde Gyula Lóránt, dem Herberger einige Jahre zuvor auf kurzem Dienstweg einen Platz an der Sporthochschule in Köln verschafft hatte. Bei der Abschlussprüfung für den Trainerschein fiel Lóránt allerdings im Fach Psychologie durch und musste das Examen wiederholen. Fertig ausgebildet trainierte der Ungar, der später die deutsche Staatsbürgerschaft annahm, dann gleich zweimal den FCK. In seiner ersten Spielzeit hielt er als 15. nur knapp die Klasse, im zweiten Jahr stand allerdings ein hervorragender fünfter Tabellenplatz. Nach einem einjährigen Intermezzo beim Meidericher SV kehrte Lóránt noch einmal nach Kaiserslautern zurück, im März 1970 musste er abermals abstiegsgefährdet jedoch seinen Hut nehmen.
Während sein Vorgänger Werner Liebrich es vorzog, nach der großen Bühne Bundesliga wieder in der zweiten Reihe zu arbeiten, tingelte Lóránt später durch die Republik. Er trainierte den FC Bayern München, Eintracht Frankfurt, den 1. FC Köln, Kickers Offenbach, den Freiburger FC und Schalke 04. Schon in Kaiserslautern galt er als »Schinder«, der kaum Rücksicht auf seine Schützlinge nahm – DER SPIELGEL zitierte ihn am 8. Juni 1981 mit dem Credo: »Kein Spieler darf klüger sein als ich.« Allerdings erwies sich Lóránt auch durchaus als Innovator und führte gemeinsam mit Ernst Happel als Erster die Raumdeckung ein, zu einer Zeit, in der die klassische Mann-gegen-Mann-Verteidigung noch als Nonplusultra galt.
Nach seiner Bundesliga-Karriere ging der Coach nach Thessaloniki, wo er schon einmal unter Vertrag stand. Im Mai 1981 erlag er einem Herzinfarkt, den er während eines Spieles erlitten hatte – ein tragischer Abschied vom Leben. Als »Trainer-Wandervogel« der 1960er- und 1970er-Jahre ist Loránt aber noch heute fester Bestandteil aller Geschichtsbücher – und vor allem ein Zitat wird auf ewig mit ihm verbunden bleiben: »Der Ball ist rund. Wäre er eckig, wäre er ein Würfel.« In diesem Sinne: Alea iacta est – die Würfel sind gefallen.
GRUND 11
Weil ohne den FCK der Weltmeistertitel 1954 undenkbar gewesen wäre.
4. Juli 1954, etwa 18:48 Uhr im Wankdorfstadion in Bern: Schiedsrichter William Ling pfeift das Spiel ab, Deutschland ist Fußballweltmeister, schlägt den großen Favoriten aus Ungarn mit 3:2 durch einen Treffer von Max Morlock und einen Doppelpack von Helmut Rahn. Doch auch wenn die Tore an diesem Abend nicht von Spielern des 1. FC Kaiserslautern geschossen wurden: Ohne den FCK wäre der Weltmeistertitel 1954 undenkbar gewesen!
Fünf Lauterer nahm Bundestrainer Sepp Herberger mit zur WM. Alle fünf standen im Finale in der Startelf: Die Brüder Fritz und Ottmar Walter, Werner Kohlmeyer, Werner Liebrich und Horst Eckel. Der berühmteste Sohn des FCK, Fritz Walter, führte die Mannschaft bei allen sechs Spielen der Weltmeisterschaft als Kapitän aufs Feld. Dabei schoss der Kopf der Mannschaft als offensiver Spielmacher drei Tore. Im Finale gegen Ungarn bereitete er das erste Tor Helmut Rahns durch eine Ecke vor. Sein Bruder Ottmar, seines Zeichens Stürmer, traf in fünf Spielen insgesamt viermal ins Schwarze. Beide Walter-Brüder schnürten beim 6:2-Sieg über Österreich im Halbfinale jeweils einen Doppelpack. Werner Liebrich und Werner Kohlmeyer bildeten einen sicheren Rückhalt in der Abwehr. Kohlmeyer klärte kurz vor Abpfiff des Finales einen Schuss der Ungarn auf der Torlinie. Horst Eckel, der Windhund, rannte sich im Mittelfeld die Seele aus dem Leib. Er spielte in allen sechs Spielen jeweils 90 Minuten.





























