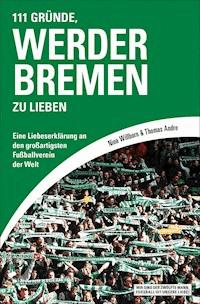
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schwarzkopf & Schwarzkopf
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Dies ist der Fußballverein, der selbst dann der tollste und alleraufregendste ist, wenn er die meisten Gegentore bekommt - denn meistens schießt er einfach vier, wenn es hinten drei Mal geklingelt hat. Werder Bremen: Fußballmacht aus dem hohen Norden, Bayernherausforderer und Angriffsfanatiker: Die können alles außer Abwehr. Früher war das mal anders, da predigte Otto Rehhagel die 'kontrollierte Offensive' und gewann Titel um Titel. Es war dies das Goldene Zeitalter des SV Werder, der eine Renaissance als Bundesliga-Spitzenkraft unter dem anderen Ewigtrainer Thomas Schaaf feierte. Unter dem pflegte Werder vor allem die Lust am schönen Spiel und gewann trotzdem Pokale. Denn Fußball ist nicht immer zynisch und belohnt nicht immer nur die Strategen. So oder so ist es bei uns nie langweilig. Sieht man mal vom Leitprinzip ab, der Kontinuität auf der Trainerbank. Werder ist der coolste Verein von allen: Wenn andere mal wieder hyperventilieren, atmen wir ganz tief ein. Und dann wieder aus. Lebenslang Grün-Weiß!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 319
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Nina Willborn & Thomas Andre
111 GRÜNDE, WERDER BREMEN ZU LIEBEN
Eine Liebeserklärung an den großartigsten Fußballverein der Welt
VORWORT
WERDER-LIEBE
Keine Ahnung, wie viele Fußballfans es auf unserem Planeten gibt. Wahrscheinlich jedoch mehr als drei Milliarden (so viele Männer leben Pi mal Daumen auf der Erde), weil seit einiger Zeit ja auch Frauen ganz verrückt nach Fußball sind. Und wie viele Werder-Fans sind es, die Wochenende für Wochenende ihre Leidenschaft leben? Vier Millionen, gar fünf? Etliche Millionen jedenfalls, der Verein aus Bremen ist der drittbeliebteste in der Bundesliga. Die Leute sind narrisch nach dem SVW!
»Narrisch«? Wer sagt denn so etwas? Die Bremer sicher nicht. Aber es sind eben nicht nur sie, die Fußball und Werder lieben. Werder ist ein Exportschlager, der im Weserbergland genauso gut ankommt wie auf einer Skihütte in Japan. Nach allem, was man so hört. Die Sympathien, die Werder Bremen in Japan genießt, könnten von einem Herrn namens Yasuhiko Okudera herrühren, der in der ersten Hälfte der Achtzigerjahre an der Weser kickte und aus der Mittelfeldreihe der Wie-Phoenix-aus-der-Asche-Bremer nicht wegzudenken war: Mit Trainer Otto Rehhagel und Okudera kehrte Werder Bremen nach langen Jahren des Darbens an die nationale Spitze zurück. Werder-Nerds und Statistik-Freaks können jetzt ganz leicht mit einer grün-weißen Zahlenkolonne aufwarten und die 177 anführen (so viel Zentimeter misst der bei Drucklegung dieses Buchs 61 Jahre alte Okudera), die 159 (so viele Spiele machte er im Werdertrikot) oder die 11 (so oft traf der Japaner für Werder Bremen).
Fußballfans sind zahlengeil, aber noch wichtiger als die numerische Fußballabstraktion ist doch ganz klar die gute Geschichte, oder? Der Fußball ist eine einzige große Erzählung, und eines seiner schönsten Kapitel schreibt selbstverständlich der ruhmreiche SV Werder. Werder Bremen ist eine richtig tolle Geschichte, eine mit Höhen und Tiefen, mit legendären Spielern, legendären Spielen und legendären Erfolgen, mit großartigen Anekdoten und frechen Sprüchen, überraschenden Wendepunkten und glanzvollen Epochen. Von alldem will dieses Büchlein erzählen: in 111 kleinen Stücken, die am Ende ein großes Ganzes ergeben.
Es gibt natürlich noch viel mehr Gründe, Werder Bremen zu lieben, als nur diese 111 – allein schon deswegen, weil jeder einzelne Werder-Fan seinen einen, ganz speziellen Grund hat, diesem Verein so über alle Maßen zugetan zu sein. Florian schätzt ihn, weil er sein ästhetisch anspruchsvolles Spiel mag, und Beatrice verliebte sich in Werder, weil sie Andreas »Herzerl« Herzog so schnuckelig fand. Oma Anni liebt Werder, weil sie zum Neunzigsten ein kleines Video geschenkt bekam, auf dem ihre Helden zum Geburtstag gratulieren – der Enkel hatte die Kicker nach dem Training in der Pauliner Marsch abgefangen. Süß, nicht wahr?
Die Erinnerung ist genau das: süß wie eine Madeleine, bitter wie eine Grapefruit. Unsere Fan-Existenz ist ein Stapel von Vergangenheitsbildern, die sich vor uns anordnen wie in einem Kaleidoskop: Aílton heulend im Münchner Olympiastadion nach dem 3:1-Meistercoup gegen die Bayern. Borowski, Klasnić, Owomoyela und Co. singend und tanzend in Stellingen nach dem Sieg am letzten Spieltag im Derby gegen den HSV im Jahr 2005/2006. Das 2:3 gegen den 1. FC Kaiserslautern im Pokalfinale im Mai 1990 – das zweite verlorene Endspiel in Folge. Natürlich der verschossene Kutzop-Elfmeter am 22. April 1986, der Werder zum Meister gemacht hätte. Kutzop musste nach dem Fehlschuss seine Telefonnummer ändern lassen. Es riefen einfach zu viele Bayern-Fans an, die sich hämisch für seine freundliche Unterstützung beim Gewinn des soundsovielten Meistertitels bedankten. Auch wir Fans mussten damals und auch danach immer wieder mal den Spott der anderen ertragen.
Aber meistens waren die doch sowieso nur neidisch. Werder ist aufregender als viele andere Vereine, und man stand, klammert man mal die biederen Siebzigerjahre aus, als Anhänger dieses mittelgroßen Vereins, der für uns der größte ist, aus dieser mittelgroßen Stadt, die für uns die größte ist, doch ganz gut da im Vergleich.
Man kann gar nicht genug Bücher schreiben, um den SV Werder zu preisen, und deswegen ist die Regalreihe mit den Werder-Bremensien auch schon ordentlich gefüllt. Dieses schmale Büchlein passt da noch rein, es ist eine gleichzeitig subjektive und trotzdem auch umfassende Sammlung der besten Werder-Geschichten und eine Beschreibungen dessen, was es bedeutet, Werder-Fan zu sein. Man kann sie am Stück lesen oder einzeln, chronologisch oder querbeet, ganz egal – nur bierernst wird die Lektüre nie sein. Unsere Methodik ist natürlich ein Trick: Wir wollen in erster Linie Werder-Geschichten erzählen. Jede von ihnen ist, gerade auch wenn sie vielleicht gar nicht so spektakulär oder erst mal kritisch klingt, eine Liebeserklärung – weil der SV Werder einzigartig ist. Auch wenn er im Pokal auf St. Pauli 1:3 verliert oder sich in der Champions League blamiert.
Möge 111 Gründe, Werder Bremen zu lieben jedem Werderaner ein Vademecum sein, das ihn an seine schönsten Erlebnisse als Werder-Fan erinnert und an Titel und Triumphe, an Siege und Sensationen. Leute, wir sind etwas Besonderes, in guten und in schlechten Zeiten. Nie vergessen!
Dank schulden die Autoren der Stadion-Bande, Martin Brinkmann, Gerhard Zebrowski, Petra Zebrowski, Jens Meyer-Odewald und Markus Balczuweit.
Viel Spaß & grün-weiße Grüße!
Thomas Andre und Nina Willborn
1. KAPITEL
GRÜN WIE GRAS UND WEISS WIE SCHNEE
GRUNDSÄTZLICHES I
1. GRUND
Weil man sich den Verein nicht aussucht
Der hervorragende britische Autor Nick Hornby hat zu diesem Thema in seinem Buch Fever Pitch (Pflichtlektüre für jeden Fußballfan!) folgenden Satz geschrieben: »Ich verliebte mich in den Fußball, wie ich mich später in Frauen verlieben sollte: plötzlich, unerklärlich, unkritisch und ohne einen Gedanken an den Schmerz und die Zerrissenheit zu verschwenden, die damit verbunden sein würden.«1 Drei Ausrufezeichen. Mehr muss man eigentlich gar nicht sagen.
Außer, dass die Liebe zu einem Verein ausdauernder ist als die meisten zwischenmenschlichen Beziehungen. Bei Werder singen wir »lebenslang grün-weiß« – und das ist wirklich ernst gemeint.
Fußball-Anhänger sind die Schwäne im Fan-Reich: Sie leben monogam, bleiben ihrem Klub treu, ein ganzes Fan-Leben lang. Die Autoren kennen keinen einzigen Ex-Fan welchen Klubs auch immer. Der fabelhafte Hornby (er verfiel Ende der Sechzigerjahre Arsenal London) schreibt in Fever Pitch auch folgenden Satz: »Die natürliche Grundhaltung eines Fußballfans ist tiefste Enttäuschung, egal, wie es gerade steht.«2 Das stimmt auch.
Aber in jedem Fußballfan wohnt ebenso die tiefe Überzeugung, dass all das Leid für etwas gut sein muss. Dass er irgendwann für seine Qualen belohnt werden wird. Wie könnte man sonst, siehe FC St. Pauli, siehe Fortuna Düsseldorf oder Eintracht Braunschweig, wie könnte man sonst jahrelang und ohne persönlich schweren Schaden zu nehmen durch dunkle Täler namens Regionalliga wandeln oder Zwangsabstiege, gar Insolvenzen ertragen? Doch nur, weil man als Fan der festen Überzeugung ist, dass alles irgendwann gut werden muss.
Nicht-Fußballfans verstehen das nicht. Und sie haben ja auch recht. Es istschon komisch mit uns. Würde man seine Lieblingsband immer noch als solche bezeichnen, hätten sich Besetzung und Musikstil völlig verändert? Würde man immer noch Kleidungsstücke seines favorisierten Modelabels tragen, wenn dort plötzlich ein anderer Chefdesigner einen anderen Stil produzieren ließe? Trüge man sein Lieblingsparfüm ein Leben lang, wenn es plötzlich in einem anderen Flakon daherkäme und völlig anders röche? Wohl kaum. Auf den Fußball übertragen, macht der Fan all das mit. Und er findet es völlig selbstverständlich. Es ist absolut schizophren, aber es ist so. Hat einen erst mal ein Verein erwischt, bleibt es dabei. Wie in jeder langen Beziehung hat auch die zwischen Klub und Anhänger gute und schlechte Phasen. Ein Fan geht vielleicht kurze, manchmal heiße Affären mit anderen Vereinen, manchmal sogar anderen Sportarten, ein. Aber es bleiben Affären. Unsere erste große Liebe verlassen wir nie.
In unserem Fall, hier werden wir jetzt mal ganz persönlich, war das mit Werder so: Im Grunde würden hier jetzt ein Kaiserslautern- und ein Schalke-Fan schreiben. Das sind zumindest die favorisierten Vereine der meisten Menschen in unseren Heimatorten. Der männliche Autor dieses Büchleins, von Kindesbeinen an den schönen Künsten zugetan, und außerdem immer auf der Suche nach einer Möglichkeit der Opposition, entschloss sich aus Prinzip schon früh gegen den Traditionsklub aus der Pfalz. Die Kumpel und der Bruder waren beinah allesamt Bayern- oder FCK-Fans – also musste es für den Autor unbedingt ein anderer Klub sein. Sein Glück, dass Mitte der Achtziger Rudi Völler in Grün-Weiß in der Sportschau auftauchte und für Werder ganz formidable Tore schoss. Ein Blitz, rosarote Herzchen, peng!, da war sie, die Fußball-Liebe auf den ersten Blick. Als Bremen die Meisterschaft 1988 feierte, war es um den Autor längst geschehen. Keine Frage, dass er sich später für den Studienort Bremen entschied, fest davon ausgehend, eines Tages vorm Rathausbalkon Titel und Pokale zu feiern.
Die Autorin hatte es nach einer abgesehen von Welt- und Europameisterschaften fußballfreien Jugend ebenfalls zum fleißigen Studieren an die Weser verschlagen. Und als eines schönen Herbsttages im Jahr 2002 der Co-Autor anfragte, ob man nicht gemeinsam das Weserstadion besuchen wolle, sagte sie zu – für Kulturwissenschaftler gehört teilnehmende Beobachtung schließlich zum Pflichtprogramm. Und da war er dann, der Blitz. Spielminute, Spielstand egal, rosarote Herzchen, peng! Völlig nebensächlich, dass Werder Leverkusen am Ende mit 3:2 (vier von fünf waren Bremer Treffer …) aus dem Stadion schoss. Wenige Wochen nach der geplant einmaligen teilnehmenden Beobachtung stand die Autorin im Ticketcenter und bekam wundersamerweise ohne monatelange Wartezeit eine Dauerkarte ausgehändigt. Als in der neu anbrechenden Saison mit Johan Micoud der George Clooney des Fußballs aufdrehte und ganz Bremen verzauberte, war es um sie, vom Auslandssemester in Paris eh noch frankophilisiert, vollends geschehen.
Man kann sich in Werder oder jeden anderen Klub auf dieser Welt auf viele Arten verlieben. Mal ist es Prägung durch Eltern oder Freunde, mal sind es Bilder von einem irgendetwas feierndem Team, mal ist es eine einzige Spielszene, die einen für immer fasziniert. Bei uns waren es im Grunde genommen zwei Spieler, die uns mit Werder zusammenführten. Beide sind schon längst keine Bremer mehr, aber Fans sind wir immer noch. Wir wohnen nicht mehr in Bremen, haben aber noch unsere Dauerkarten und verbringen fast jedes zweite Wochenende mehr Zeit im Zug als im Stadion. Wir haben mit Werder gewonnen, aber genauso oft schon bitter verloren. Wir schimpfen in der Woche zwischen zwei Spielen und währenddessen 90 Minuten lang auf die eigene Mannschaft. Aber wehe, ein Gladbach-, HSV-, Bayern- oder Sonstwas-Fan maßt sich an, zum Thema Werder etwas zu sagen: Dann verteidigen wir unseren Verein bis zum Letzten. Komplett schizophren. Fans halt.
2. GRUND
Weil Werder die schönste Raute hat
Ein ebenes Viereck mit gleich langen Seiten nennt man Raute. Oder, wenn es mehrere sind, Rauten. Man kann zu einer Raute auch Rhombus sagen – das klingt aber nicht so schön. Wichtig ist bei der echten Raute, dass ihre gegenüberliegenden Seiten parallel sind und die gegenüberliegenden Winkel gleich groß. Aus sechs Rauten kann man ein Gebilde mit dem tollen Namen Parallelepiped basteln. Aus zwölf sogar ein Rhombendodekaeder. Ein auf der Spitze stehendes Quadrat, mit dem sich ein anderer norddeutscher Verein schmückt, geht so grade noch als Sonderfall der Raute durch. Und hier hört die Mathematik-Nachhilfe mangels weiterführender Kenntnisse auch schon wieder auf.
Wir stellen trotzdem nun folgende These für die folgende Beweisführung auf: Werder hat die schönste Raute der Welt. Von der Schönheit der grün-weißen Farbgestaltung ist im nächsten Grund die Rede. Hier soll es zunächst um die Form gehen. Werders heutiges Logo – das W mit den unvergleichlich sich einander zuneigenden Enden in einer grünen Raute mit schmalem weißem Rand – gibt es seit 1929. Es ist die weitaus gelungenste Version, sieht man sich die vier Vorgänger an. Werders Gründungswappen von 1899 würde man heute wohl als, nun ja, unleserliches Gekrakel bezeichnen. 1902 folgte ein neuer Versuch, nun wurde die Abkürzung »FVW« (Fußball-Verein Werder Bremen) diagonal in ein Wappen geschrieben. Neun Jahre später, 1911, sah die modifizierte Version ungefähr so aus wie Hoffenheims Logo heute. 1924 dann, der Verein hieß inzwischen SV Werder Bremen, besann man sich aufs Wesentliche, nämlich das W. Das kam erst mal umrahmt von einem Ei daher, bevor die frühen Werder-Designer 1929 erneut die Zeichenstifte schwangen, dem W eine geschmackvollere Form verpassten und aus dem Ei die Raute werden ließen. Das war’s! Geradlinig, schnörkellos, elegant und gleichzeitig dynamisch: Wie der Klub, so das Wappen. Eine ähnliche Formsprache hat übrigens auch die Gladbacher Borussia.
Das besonders Schöne an der Werder-Raute ist nun, dass man sie als Fan nicht nur auf Devotionalien aller Art bewundern kann. Thomas Schaaf, ein ausgemachter Fan des gleichseitigen Vierecks, dachte sich nämlich Mitte der 2000er-Jahre, dass Werders Logo auch Werders Spiel geradlinig, schnörkellos, elegant und sehr dynamisch aussehen lassen könnte. Wie gedacht, so gemacht: In der Meistersaison 2003/2004 (und auch noch in den Jahren danach) verzückten die Bremer ganz Deutschland mit Schaafs Version des 4-4-2 mit Mittelfeld-Raute. Schon klar, Werder war und ist inzwischen nicht mehr der einzige Verein, der diese Variante des Spielsystems (defensiver Mittelfeld-Spieler als untere Spitze der Raute, zwei Außenbahnspieler als rechte und linke Spitze plus ein offensiver Mittelfeldspieler als obere Spitze) im Repertoire hat. Aber damals mit Frank Baumann, Fabian Ernst, Krisztián Lisztes und Johan Micoud hatte Thomas Schaaf eine außerordentlich schöne Raute gebastelt – und dieses System überhaupt erst in Deutschland zum systemtechnischen Must-have der folgenden Spielzeiten gemacht. Die Werder-Raute auf dem Trikot und auf dem Rasen. Ach, es war eine tolle Zeit mit tollem Fußball!
Nach einem Umbruch zu Beginn der Saison 2012/2013 spielt Werder aus vielen Gründen erst mal wieder ohne Raute. Aber die Spieler tragen sie so oder so immer auf dem Trikot und wir Fans sie und das W (mindestens) in unseren Herzen. Unser Logo, unser Verein. Das sagen uns auch die Sterne: Am abendlichen Firmament, gleich neben der Milchstraße, prangt Kassiopeia als funkelndes, ewiges Werder-W. Und in ganz besonderen Nächten sieht es so aus, als ob rund um das Himmels-W ein elegantes, schnörkelloses gleichseitiges Viereck flimmert. Werder – die schönste Raute des Universums. Was zu beweisen war.
3. GRUND
Weil Grün und Weiß die schönsten Farben sind
»Olé, olé, grün wie Gras und weiß wie Schnee, das ist unser SVW, das ist unser SVW, olé …« Diesen Song hätten die ersten Werderaner so nicht gesungen. Laut der ersten Vereinssatzung 1899 waren die Vereinsfarben Grün und Rot. Aber schon zwei Jahre später ging das Rot (die Farbe der Bremer Landesflagge) irgendwie verschütt. Vielleicht war das farbpsychologisch gar nicht so schlecht, denn Grün und Rot sind komplementäre Farben, also einander entgegengesetzt. Wie Werder und Bayern zu besten Lemke-Hoeneß-Zeiten. Aus dem unseligen Rot wurde dann Weiß. Es hätte farbtechnisch auch wesentlich schlimmer kommen können, siehe Osnabrück (lila und weiß), FC St. Pauli (braun und weiß) oder US Palermo (schwarz und rosa).
Alles im grün-weißen Bereich? Klar doch, wenn Werder gewinnt. Die Farbzusammenstellung ist dafür jedenfalls keine schlechte Grundlage. Grün gilt als Farbe des Wachsens und Gedeihens, der Zuversicht. Im Mittelalter stand es für eine beginnende Liebe. Von Grün heißt es auch, es könne beruhigend wirken – vielleicht ja auch auf Schiedsrichter, bei denen man immer damit rechnen muss, dass sie eine Rote Karte aus ihrer Arbeitskleidung (normalerweise in Dortmund-Farben!) hervorzaubern.
Dazu unschuldiges Weiß, das ja immer ein bisschen die (bekanntlich grüne) Hoffnung auf elegantes Spiel symbolisiert. Man denke nur an Real Madrid, die Mutter des »weißen Balletts«. Auch Werder kann ballettartig spielen, in guten Phasen. Und wenn das mal wieder nicht so gut gelingt, sieht man immerhin auf weißen Trikot-Teilen besonders gut die grün-braunen Spuren, die leidenschaftlicher Einsatz nun mal verursacht.
Offiziell trägt Werders Hauptfarbe mit der Nummer 6024 im RAL-Farbsystem den Namen »Verkehrsgrün«. Und auf den »Verkehr« auf dem Rasen kommt es ja auch an in diesem schönen Sport. Grün und Weiß sind sowieso die Fußballfarben schlechthin. Der Ball? Überwiegend weiß. Gespielt wird auf grünem Untergrund, alle Linien sind weiß. Von daher ist Werder-Spielern ihr Arbeitsplatz sozusagen auf den Leib geschneidert – umso besser, wenn das auch im übertragenen Sinn hinkommt.
Zum ersten Mal trug eine Werder-Elf den grün-weißen Look 1907. Und dabei blieb es dann auch erst mal, abgesehen von der »Speckflaggen«-Ausnahme in den Jahren 1971–1973, bedingt durch eine werderwirtschaftliche Notlage. Da sprang die Stadt als Trikotsponsor ein, und die Spieler trugen rot-weiße Trikots, auf denen statt des Werder-Ws als Emblem der Bremer Schlüssel prangte. Aber sonst: Grün und Weiß, meist im Verhältnis von etwa 70:30. Bis zum Jahr 2003, als – aus welchen marketingtechnisch bestimmt supertollen Gründen auch immer – plötzlich Orange in Werders Farbwelt auftauchte. Immerhin: Mit dem modischen Unfall namens »Papageientrikot« in Grün-Orange wurde Werder Double-Sieger. Inzwischen ist die Signalfarbe (Gott sei Dank) wieder auf dem Rückzug – was den Klub allerdings nicht von vereinzelten Farbexperimenten abhält. Tim Wieses rosa Torwarttrikot 2006/2007, zum Beispiel. Für die einen Kult, für die anderen ein Augengraus. Auf jeden Fall ein Hingucker. Aber auch das ändert nichts an der Tatsache: Werder ist und bleibt grün-weiß.
Übrigens: Grün heißt auf Esperanto, der internationalen Kunst-Sprache, »Verda«. Klingt ausgesprochen wie? Genau.
4. GRUND
Weil wir die Coolen sind. Und die Guten.
Der durchschnittliche Mitte-Styler trägt gerne Hosen, die auf halb acht hängen, und ’ne Basecap andersrum. Er trinkt Club Mate, hat Riesenkopfhörer auf den Lauschern, im Rucksack gerne mal ein MacBook und auf dem die neuen Pladden von Grizzly Bear und den Shins. Und wenn er am Rosenthaler entlangschlurft mit dem Handy am Ohr, dann will er auch gar nichts anderes sein als ein Hipster, und die wachsen und gedeihen nirgends so gut wie in Berlin, weil man sich dort vor lauter Nichtstun vor allem auch um Stil-, Mode- und sonstige ästhetische Fragen kümmern kann. Der typische Mitte-Styler, ätzte mal ein uns namentlich bekannter Fan des SC Freiburg, sei auf jeden Fall Werder-Fan. Dazu ist zunächst zu sagen, dass der SC Freiburg, genauso wie zum Beispiel auch der FC St. Pauli, selbst über einen extremen Hipness-Faktor verfügt. Hip sein, das heißt ja auch, zum richtigen Zeitpunkt dem richtigen Verein anzuhängen. Am besten schon vor allen anderen. Allerdings sind Vereine wie die genannten ja eben gerade nicht hip, sondern zeitlos in ihrer Beliebtheit. Weshalb wir die Behauptung des alemannischen Heißsporns und Hipsterhassers brüsk zurückweisen: Nicht jeder Hipster ist Werder-Fan und nicht jeder Werder-Fan ist Hipster.
Klar sind wir Werderaner die Coolen. Klar sind wir besonders in den geilen Nullerjahren eine gute Wahl gewesen für Fußballfans. Klar sind wir für viele, die Geschmacksfragen für die entscheidenden halten, eine attraktive Wahl. Weil Werder, trotz einer empfindlichen Delle seit 2009, für ästhetisch anspruchsvollen und grundsätzlichen Hurra-Fußball steht. Martin Walser hat angeblich mal gesagt, dass nur eine Sache unsinniger als Fußball sei: das Reflektieren über Fußball. Was für eine blödsinnige Einlassung (übrigens wieder von einem Alemannen) – was macht mehr Spaß, als über Fußball zu philosophieren? Werder zum Beispiel gehört für viele Fans seit vielen Jahren in bestimmte Zusammenhänge, wo es um eine Idee vom offensiven Spiel geht, die etwa ein Fußballintellektueller wie Menotti sehr mag. Damit können sich viele identifizieren, das macht Werder en vogue.
Und trotzdem sind wir, und das macht unsere Beliebtheit aus, vor allem auch: die Guten. Weil unser Image, das für viele so enorm anschlussfähig ist, ja den Tatsachen entspricht. Werder gilt als sympathisch, weil es als David gegen Goliathe kämpft und dabei oft gewinnt. Werder ist sympathisch, weil es ein Verein ist, der seinen Prinzipien treu bleibt und sich von den Zeitläuften nicht kirre machen lässt. Und wenn das der Hipster in Berlin-Mitte cool findet, dann sagen wir: Willkommen im Klub der Werderphilen. Klebt euch ’nen »100 Prozent Werder«-Aufkleber auf den Apfel am Rechner, zieht euch die Werder-Mütze auf und rasiert euch ein »W« in den Hipsterbart.
Und dann stellt euch mal beim Bremen-Trip an den Werder-Imbiss im Steintorviertel, esst ’ne Currywurst und trinkt ein Haake-Beck. Muss ja nicht immer veganes Essen sein und auch nicht immer Bionade. Ihr wollt eine neue Gattung gründen und Proll-Hipster sein? Das geht besonders gut in der Stehplatzkurve im Fußballstadion. Probiert’s einfach aus. Und wenn ihr demnächst einen Freiburg-Fan seht, der eine grimmige Schnute zieht: Seid nett zu ihm. Er weiß, dass er nicht allein Everybody’s Darling sein kann.
Er ist ja nur so sauer, weil der SC immer, wirklich immer gegen Werder auf den Sack bekommt.
5. GRUND
Weil Werder die Nummer eins im Norden ist
Ohne die Derbys würde dem Fußball einiges fehlen. Um nicht zu sagen: beinah alles. Na ja, zumindest aber die Hochgefühle, die sich nur einstellen, wenn ein Gegner aus einer Stadt besiegt wurde, in der man mit dem Zug in einer guten Stunde einfahren könnte, wenn man denn wollte. Noch besser ist es, wenn man tatsächlich eine Tour an diesen Ort unternommen hat, mit vielen Gleichgesinnten, um den depperten Rivalen aus der Vorstadt in dessen eigenem Revier zu demütigen. That’s fun! Gotta love it! Großartig! Unvergleichlich! Auswärtssieg, Auswärtssieg!
Wenn Bremer in Hannover oder Wolfsburg gewinnen und erst recht in Hamburg, dann steppt der Bär. Es gibt nichts Schöneres unter der Sonne. Dass die Glückshormone bei bestimmten Siegen mehr und schneller Karussell fahren als bei anderen, ist letztlich natürlich irrational – das gilt allerdings für ziemlich viele Erscheinungen der Fan-Kultur. Andererseits will man ja auch den schöneren Garten als der liebe Nachbar haben. Oder? Und wenn man, rein hypothetisch, die Möglichkeit hätte, ins Wohnzimmer des Spießers von nebenan zu schleichen und dort die Ordnung der Dinge ein wenig durcheinanderzubringen – würde man das nicht tun? Der ein oder andere bestimmt. Weil es so schön ist, wenn der von nebenan sich ärgert. Weil der uns in vielen Dingen so ähnlich ist, mentalitätsmäßig und so. Im Großen und Ganzen jedenfalls. Die Wolfsburger werden sogar mit Vorliebe im Ausland mit uns verwechselt. Muss man sich mal vorstellen. Nur weil sie unser Wappen nachgemacht haben. Und weil sie Diego und Naldo geholt haben. Und Allofs.
Apropos: Genau deswegen mögen wir den VfL Wolfsburg nicht. Ein Großkonzern hat diesen Verein gekapert, und wenn der keine Tore schießt, dann schießt VW ihm Geld zu und das nicht zu knapp. Wie unsympathisch. In Wolfsburg soll der Erfolg gekauft werden. Hannover 96 und der Hamburger SV, bekanntlich in inniger Fan-Freundschaft verbunden, haben wenigstens eine Tradition, sind aber halt nicht die Nummer eins im Norden, denn das sind wir.
Beliebter sind wir sowieso. Vor allem aber sind wir erfolgreicher: Die Ära der stets sehr selbstbewussten Hamburger ist mindestens 100 Jahre her – die haben seit 1987 keinen Titel mehr gewonnen, da braucht es keine große Rechenkunst, um festzustellen: Geil geht anders. Wird schon auch an den langen Jahren der Entbehrung liegen, dass gerade die Hamburger Fans so sagenhaft unangenehm sind; zumindest, wenn sie sich in großer Zahl zusammenrotten. Von uns behaupten natürlich wiederum sie, hochgradig nervig zu sein, aber das ist Blödsinn. Bremer sind die nettesten Menschen auf dem Erdenrund, nie triumphalisch, selten siegesbesoffen, im Vergleich zu anderen Fangruppen ganz sicher zurückhaltend, kurz: die Krone der Schöpfung.
Aber ein bisschen seltsam ist es manchmal trotzdem: Selbst zu Champions-League-Zeiten, als der HSV doch mit dem Fernglas nach uns suchen musste, hallte der Gesang, der von der Nummer eins im Norden kündete, durchs Stadion – mit einer Inbrunst vorgetragen, als gelte es, die identitätsstiftenden Sätze bis nach Hamburg zu singen. Dort leben selbstverständlich wesentlich mehr Werderaner, als Hamburger in Bremen leben – und für ihr Tor zur Welt brauchen die sowieso erst mal unseren Schlüssel, wer wüsste das nicht.
Bevor die Bundesliga 1963 ihren Betrieb aufnahm, gab es übrigens quasi nur Nordderbys. Dem HSV muss man eine gewisse Dominanz in den Jahren der Oberliga Nord zugestehen: In den 16 Spielzeiten zwischen 1948 und 1963 wurde er 15 Mal Meister. Glückwunsch dazu, liebe Hamburger.
Für Werder standen damals auch Spiele gegen Bremerhaven 93, Holstein Kiel und Altona 93 auf dem Spielplan. Die Älteren unter uns werden sich erinnern. Ein gewonnenes Schlagerspiel, um einen leider etwas aus der Mode gekommenen Begriff zu verwenden, gegen Hannover oder Hamburg, sogar gegen den meistens netten FC St. Pauli kann heute noch über andere Enttäuschungen hinwegtrösten. Is’ ’ne ganz gute Erfindung, so ein Derby.
6. GRUND
Weil Werder nicht Bayern München ist
Tja, die Bayern. Der Stern des Südens. Die Großkopfeten. Der Rekordmeister. Die Seriensieger. Der FC Hollywood. Die Startruppe. Der Klub, in dem Franz Beckenbauer, Gerd Müller und Sepp Maier spielten. Karl-Heinz Rummenigge, Lothar Matthäus und Stefan Effenberg. Spieler also, die Geschichte schrieben und Ehrenplätze in der Bundesliga-Historie besetzen. Sie beanspruchten diesen Platz auch, würde man ihn ihnen nicht freiwillig zugestehen. Sie haben nämlich das Bayern-Gen. Von dem reden sie auch gerne. Wer das Bayern-Gen hat, und wer von ihm spricht, der ist ja vor allem selbstbewusst. Sehr selbstbewusst.
Aber was das Bayern-Gen ist, das ist trotzdem nicht so klar. Meistens erwähnen die Bayern-Spieler, wenn sie über das Bayern-Gen fabulieren, wie sehr die Beschaffenheit ihres Charakters doch darauf ausgerichtet ist, unbedingt und immer gewinnen zu wollen. »Weiter, immer weiter«, rief der blonde Bayern-Recke Oliver Kahn einst, als er über das Movens seines Vereins philosophierte. Wir wiederum spinnen den Mythos vom Bayern-Gen, das, wie der polyglotte Bayern-Vorstand Karl-Heinz Rummenigge sagen würde, grundsätzlich absolut »bayernlike« ist, wir spinnen diesen Mythos jetzt mal geschwind weiter. Oder besser: Wir dechiffrieren dieses ominöse Gen und finden Chromosomen mit eindeutigem Text. Der Bayern-München-Mensch, egal ob Trainer, Manager, Spieler, Präsident, Fan oder Uli Hoeneß, ist selbstsicher bis an die Schwelle zur Arroganz. Er hält es für ein Naturrecht, immer den Sieg davonzutragen und sich die Vitrine mit allerlei Schalen und Pokalen vollzustellen. Er glaubt, dass er den Platz an der Sonne gepachtet hat. Der Bayern-München-Mensch ist vom Grundgedanken her immer das, was der Werder-Bremen-Mensch nicht ist.
Wir in Bremen sind froh über unser Image, das praktischerweise deckungsgleich mit unserer Wesensart ist. Wir gelten als und sind tatsächlich bodenständig, seriös, verlässlich, bescheiden, dabei aber nicht ohne Ehrgeiz. Wir haben nicht so viele Titel wie Bayern München gewonnen, stinken aber eben auch nicht vor Geld. Wir erreichen mit viel weniger Mitteln sportliche Erfolge, können aber auch gönnen: Denn die Bayern haben sich ihren herausragenden Status ja auch erarbeitet, anders als die Betriebssportgruppen von VW, der VfL Wolfsburg, von Bayer, Bayer 04 Leverkusen, und von SAP, die TSG Hoffenheim. Wir kämen aber nie auf die Idee, aus Machtkalkül und Kraftmeierei bei anderen Vereinen die besten Spieler abzuwerben, so wie es die Krake Bayern München traditionell tut. Viele Bremer wurden von den Bayern weggekauft, immer wurde dabei ihr Talent erkannt, oft sollte es aber lieber auf Münchner Auswechselbänken versauern, als das Bremer Spiel weiter so zu versüßen, dass es bajuwarischen Ambitionen in die Quere kommen könnte.
Nach München wechselten unter anderem Andreas Herzog, von dem aus seinem Bayern-Jahr eigentlich nur die präpotente Herumschubserei durch seinen eigenen Torwart Olli Kahn in Erinnerung ist, Mario Basler, Tim Borowski, Torsten Frings (über Borussia Dortmund), Valérien Ismaël und gleich zwei Mal Claudio Pizarro. So gut gespielt wie in Bremen haben sie alle in München nie, und trotzdem steht ihr Zug gen Süden, der in den Neunzigern begann, für einen Verfall der Sitten: In den Achtzigern wäre man als Bremer nie zu den Bayern gewechselt. Die gute, alte Zeit. Irrational, klar. Aber was wäre der Fußball ohne Folklore? Werderaner, bleibt bei Werder! Vergesst Bayern!
7. GRUND
Weil Werder immer da ist, in guten und in schlechten Zeiten, und weil nach jedem Spiel das nächste folgt
Es gibt verschiedene Fußball-Sozialisationen. Glücklich sind die, die Bremer sind und von Vaddern mit ins Stadion genommen wurden, als sie noch ganz Kind waren und gar nicht verstanden, dass es ziemlich ungemütlich war in dieser kalten Betonschüssel, über die graue Wolken zogen, angetrieben von einem fiesen Wind. Die nicht sahen, dass mit dem langen Herrn in der Abwehr, der Per Røntved hieß, genau ein guter Fußballer in einem Bremer Trikot herumlief.
Egal, das ist Fußball, das ist aufregend – so beginnen Liebesbeziehungen, die ein ganzes Leben halten, auch wenn sie in den schmerzhaften Siebzigern beginnen. In den Achtzigern war es einfacher, Werder-Fan zu werden; da war es kein bärenstarker Däne, sondern ein Norweger, der elegant in Werders Defensive seinen Dienst verrichtete. Er hieß Rune Bratseth und war der Libero des erfolgreichsten Werder-Teams aller Zeiten. Wer damals Fan wurde, der schmeckte den süßen Geschmack des Erfolgs und freute sich immer auf – das nächste Spiel. Denn das kommt immer, der Fußball ist der große Rhythmusgeber im Leben eines Fans. Er strukturiert unsere frei flottierenden Existenzen; und das Wichtigste: Auch auf ein schlechtes Spiel folgt immer das nächste. Das ist gut, und das lernten auch wir Werder-Fans, die wir nicht in Bremen in den Siebzigern lebten und irgendwann im Jahr 1986 oder 1987 anfingen, Fußball im Radio zu hören, wo die Moderatoren so wundervoll beruhigende und die Kommentatoren in den Stadien so aufgeregt aufputschende Stimmen hatten. Wir lernten, dass Werder Bremen nicht jedes Spiel gewinnt und das nächste Spiel noch nicht einmal notwendigerweise Besserung bringen muss – eine der wichtigsten Lehren überhaupt für den Werder-Freund. Es war in der Saison 1989/1990, als der erfolgsverwöhnte Fan plötzlich vier Mal in Folge miterleben musste, dass Werder ein Spiel verlor: ein Schockerlebnis. Und am Ende der Saison wurde Werder Bremen nur Siebter; vorher, in diesem ganzen glorreichen Jahrzehnt, das doch mit einem Abstieg begonnen hatte, war der Verein nie schlechter als Fünfter gewesen. Was war da denn los? War Werder nicht der Erfolgsgarant, der Glückshormonbeschleuniger?
Eben nicht immer, und trotzdem drehte sich die Fußballerde weiter um die Sonne, die doch immer auch wieder über Bremen lachte. Auch in den Jahren zwischen 1995, als Werder leider Borussia Dortmund den Vortritt im Kampf um die Meisterschaft lassen musste, und 2003; in diesen Jahren spielten wir keine besondere Rolle in der Bundesliga. Erst mit Thomas Schaaf ging es ja bergauf, steil bergauf und dann ab 2009 fürs Erste beinah ebenso steil bergab. Werder ist in guten Zeiten da und in schlechten, und das gilt in doppelter Hinsicht. Wenn Werder gut ist oder schlecht; wenn wir gut sind oder schlecht. Mal gewinnt Werder, wie es will, national und international, 8:1 gegen Arminia Bielefeld oder 3:2 gegen Real Madrid, mal verliert Werder böse und gemein, 1:7 gegen Borussia Mönchengladbach und 2:7 gegen Olympique Lyon. Mal wird Werder ständig Elfter, mal im steten Wechsel Zweiter, Dritter oder gar Erster.
Und mal reißen wir den geilsten Typen auf, schreiben die besten Klausuren oder Hausarbeiten unseres Lebens, werden im Büro befördert, bekommen die tollste Praktikumsstelle oder den begehrtesten Ausbildungsplatz, feiern die besten Partys, heiraten die schönsten Frauen und zeugen die süßesten Babys. Dann wieder werden wir von der Liebe unseres Lebens verlassen, verlieren unseren Job und brechen uns beim Skifahren beide Beine. Wir werden auf kein Fest eingeladen und trauern um unsere Katze oder unseren Opa. Wer immer da ist, ist Werder. Der Fußball ist die beste Party überhaupt und außerdem die wichtigste Trostreichung. Danke.
8. GRUND
Weil Werder für Lieblingsspiele zuständig ist
Lieblingsspiele können nie welche der Nationalelf sein, nie welche aus der weiten Welt des Fußballs, in der es Champions-League-Perlen gibt und andere große Europapokalabende mit dem FC Barcelona, dem FC Liverpool, Juventus Turin und Borussia Dortmund. Arsenal London vs. Manchester United kann auch ganz nett sein, aber das Größte sind doch, es versteht sich von selbst, Werder-Spiele.
Aber welches ist das ultimative, das beste, das tollste? Eines, das man im Weserstadion gesehen hat oder nur live im Fernsehen? Muss es zwangsläufig eines sein, nach dessen Ende die Bremer einen Pokal in den Händen halten? Ist es ein glanzloses 1:0 in Frankfurt im Frühjahr 1988, nach dem zufälligerweise der zweite Meistertitel eingetütet ist? Oder ein berauschendes 3:0 in Stuttgart fünf Jahre später, gleichbedeutend mit der nächsten Meisterschaft? Das 2:0 gegen den AS Monaco im Europapokalfinale? Ein 4:0 in Stellingen beim HSV, in dessen schicker, neuer Arena?
Sicher, ein Sieg sollte es schon sein. Vielleicht sogar einer in einem eigentlich ganz unwichtigen Spiel, sagen wir: eines gegen den 1. FC Nürnberg. An einem tristen Septemberabend im Jahr 2002, englische Woche, vierter Spieltag. Man ging gerne zu Werder, klar, aber man erwartete kein Feuerwerk der Fußballkunst. Der beste Spieler, in diesem Fall Torsten Frings, war mal wieder gegangen, weggekauft von der solventeren Konkurrenz, in diesem Fall aus Dortmund. Werder war dürftig in die neue Saison gekommen, wenigstens wurde Hamburg zu Hause geschlagen, aber auswärts in Bielefeld und bei 1860 München gab es derbe Klatschen. Eine spielerische Linie hatte das Werder-Spiel nicht, Aílton gerierte sich mehr und mehr als launische Diva, saß oft auf der Bank und war unzufrieden. So weit, so normal alles – Werder Bremen war kein Spitzenklub, schon lange nicht mehr. Aber mit einer gewissen Neugier war man doch an diesem Dienstag an den Osterdeich gekommen. Es sollte ja ein neuer Spieler auflaufen, ein Franzose, der zuletzt in Parma gespielt hatte.
Johan Micoud war sein Name. Man hatte zu Hause schon mal geübt, wie man seinen Namen ausspricht. Grundsätzlich ließ es sich gut an mit ihm, er hatte, so erinnert man sich jedenfalls, erzählt, wie sehr er sich auf Bremen freue. Auf eine neue Kultur und so; wir hofften ja auf etwas mehr Kultur im Werder-Spiel. Die Haltung Micoud gegenüber lässt sich am besten mit den Begriffen »wohlwollend« und »skeptisch« beschreiben, aber was wir dann an diesem doch eigentlich so gewöhnlichen Abend in einer doch eigentlich so gewöhnlichen Zeit zu sehen bekamen, machte uns sehr, sehr zu schaffen: So viel Euphorie war nämlich lange nicht dagewesen. Damit konnte man erst mal gar nicht umgehen. Es entzieht sich genauer Kenntnis, wen man damals ungläubig anstarrte, wem man den Ellbogen in die Seite hieb; wir wissen aber noch ganz genau, wie glücklich wir waren, weil das Werder-Spiel plötzlich so anders aussah.
Aílton erzielte drei Tore und stand nie (na ja, fast nie) im Abseits, er stürmte immer wieder auf das Tor der Gäste zu, in Szene gesetzt von Johan Micoud, diesem einen Spieler, der alles veränderte. Das 2:1 markierte er selbst, wir meinen uns an seinen Torjubel genau zu erinnern, eine erhabene Pose, ein Lächeln, mit dem er fröhlich und staunend selbst den Treffer und das ganze Spiel einordnete – das ist es also, Bundesliga, Deutschland, Werder?
Selten sind wir so optimistisch nach Hause gegangen, einfach rundum zufrieden. Das Leben war schön, Werder Bremen auf dem richtigen Weg, morgen würde es nicht regnen. Deswegen ist dieses Kräftemessen mit dem 1. FC Nürnberg das Lieblingsspiel: Es war der Beginn einer Ära. Wir konnten das damals nicht wissen, aber es lag etwas in der Luft. Und das wiederum wussten wir.
9. GRUND
Weil man Werder auch trotz eines total besch… Spiels lieben kann
Dass etwas in der Luft lag, wussten wir auch beim nun folgenden Beispiel eines absolut enttäuschenden, eines, ja, seien wir ehrlich, sehr schlimmen Spiels. Man konnte das »etwas« sogar sehen, damals, nachmittags, auf der Autobahn in Höhe Sittensen: Schnee. Und nicht nur ein bisschen, sondern sehr, sehr viel Schnee fiel an diesem 25. Januar 2006. Um 20.30 Uhr sollte am Millerntor, beim damaligen Drittligisten FC St. Pauli, das Viertelfinale im DFB-Pokal angepfiffen werden. Die Meinungen im Reporter-Mietauto kurz vor dem Elbtunnel waren einhellig: »Das wird hundertprozentig abgesagt!« Wusste man doch, dass das Millerntor, anders als heute, noch kein schickes neues Zweitligastadion war, sondern eben die charmante, aber vor allem im Winter eisige Bruchbude. Der Rasen: trotz aller Versuche eine Landschaft aus Schnee und Eis.
Entsprechend vehement redeten Thomas Schaaf und Klaus Allofs lange vor dem Anpfiff auf Schiedsrichter Dr. Felix Brych (aus München!) ein – ohne Erfolg. Die Bild-Zeitung dokumentierte ihre Wutausbrüche. Allofs: »Wenn sich einer unserer Nationalspieler verletzt, wir deshalb die WM verlieren, dann ist der Schiedsrichter dieses Spiels schuld!« Schaaf: »Wenn sich hier irgendjemand verletzt, werden wir richtig laut. Der Platz ist indiskutabel!«3
90 Minuten bevor es losgehen sollte, wurde es auch noch zappenduster: totaler Stromausfall. Ein Spaß, sich in der Finsternis zu den Reporterplätzen durchzutasten, zum Teil abbruchreife Mini-Holzkabinchen auf der alten Gegengeraden, zum Teil auch Tribünensitzplätze, die längst von normalen Fans eingenommen worden waren. Dann halt stehen, in halbgebückter Haltung, weil den Raum in Kopfhöhe schon eine TV-Kamera beanspruchte. Es wäre halb so schlimm gewesen. Aber dann kam dieser Werder-Auftritt. Schon nach zehn Minuten war klar: Das hier wird ein ganz, ganz bitterer Abend.
Die Pauli-Spieler kämpften, schlitterten, grätschten um die Wette. Keiner von ihnen hatte Handschuhe an – zumindest in der Erinnerung – im Gegensatz zu Borowski, Micoud, Klose und Co., die in den ersten Minuten so spielten, als würden sie das Spiel am liebsten ganz dick eingemummelt von der Bank aus verfolgen. Werders technisch hochbegabte Nationalspieler und der Schnee-Rasen: offensichtlich keine gute Kombination, und eine solche gelang folglich keinem Bremer. Dann glich plötzlich doch noch Micoud nach Klose-Vorlage St. Paulis frühe Führung durch Dinzey aus. Es sah zwar nach Abseits aus (und war es auch), was soll’s, das Tor zählte, die TV-Kamera geriet kurz ein bisschen ins Wanken in dieser 27. Minute. Und erneut, als kurz vor der Pause Miro Klose auf den Eis-Boden knallte und sich schwer an der Schulter verletzte. Vielleicht nahm das Richtmikrofon der Kamera auch die Flüche dieser Minuten auf, sendefähig im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wären sie auf keinen Fall gewesen.
Um es kurz zu machen: Werder verlor nicht nur Miro Klose, der anschließend vier Wochen lang mit einem Sehnenanriss fehlte. Werder verlor auch das Pokalspiel völlig verdient mit 1:3, weil sich keiner der Spieler an die zugegebenermaßen wirklich unglaublichen Bedingungen anpassen konnte. Eleganz war nicht gefragt an diesem Abend, die Bremer scheiterten kläglich. Selbst beim Elfmeter in der 80. Minute, den Borowski verschoss. Keine Spur von Willen war zu sehen. Gegen einen zwei Klassen schlechteren Gegner ergab sich Werder in sein Schicksal. Es war – einfach nur grausam. Und verdammt kalt.
Immerhin einen halbwegs komischen Moment hatte dieser Abend doch noch: als Thomas Schaaf lange nach Abpfiff erfolglos versuchte, aus einem Kippfenster des St.-Pauli-Klubheims und damit dem Party-Trubel zu entkommen, weil ein Sanitäter-Einsatz die Tür versperrte. Nicht mal das gelang ihm. Und angesichts seiner Miene in diesem Moment kippte die Stimmungslage. Der Ärger über die bremische Bräsigkeit verwandelte sich in Unmut über den ach so kultigen FC St. Pauli, der an diesem Abend abgesehen von der Leistung der Drittliga-Spieler nichts, aber auch gar nichts zustande brachte. Dieses Spiel war eine dieser Niederlagen, die den Fan hin- und hergerissen zurückließ. Natürlich hatte Werder grottenschlecht gespielt und deshalb zu Recht verloren. Und doch auch wieder nicht, weil die Rahmenbedingungen das Spiel lange vor dem Anpfiff entschieden hatten.
Manchmal verhält es sich mit dem Fan und einem schlechten Spiel seiner Mannschaft ein





























