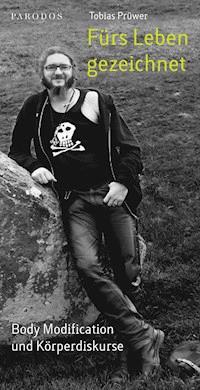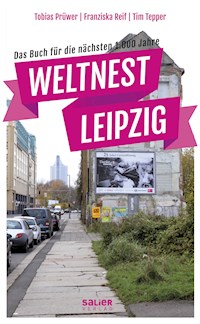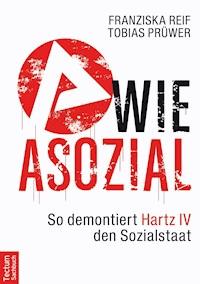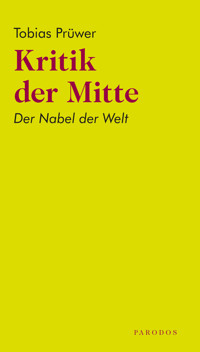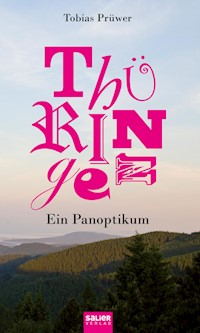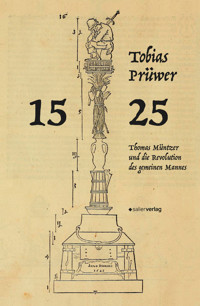
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Salier Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Fanatiker oder Freiheitskämpfer: Über keine andere Person der Reformationszeit wurde derart heftig diskutiert wie über Thomas Müntzer. Die einen erklärten ihn zum mystischen Schwärmer, andere zum Theologen auf Abwegen, zum Utopisten oder Revolutionär mit Regenbogenfahne. Müntzers Leben war eng verbunden mit dem Deutschen Bauernkrieg. Seine Hinrichtung nach verlorener Schlacht von Frankenhausen 1525 bildete den Zenit wie das Fanal der Aufstandsbewegung. Müntzer wurde zum Streitpunkt der Historiker in Ost und West und zum Symbol, auf das sich selbst lateinamerikanische Befreiungstheologen beziehen. Müntzer steht für ein uneingelöstes Versprechen. Denn die Revolution des gemeinen Mannes stellte nichts Geringeres dar als ein frühes Ringen ums demokratische Gemeinwesen. Damals gestellte Sinn- und Gerechtigkeitsfragen bleiben 500 Jahre später aktuell. All das behandelt das Buch. Nach knapper Skizze der Ereignisse und Müntzers Wirken räumt es mit einigen Missverständnissen auf und geht den Folgen nach. 1525 wird zur Folie, Krisenzeiten und Gesellschaft in Bewegung zu betrachten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1525
THOMAS MÜNTZER UND DIE REVOLUTION DES GEMEINEN MANNES
TOBIAS PRÜWER
eBook
ISBN 978-3-96285-186-6
1. Auflage 2025
Copyright © 2025 by Salier Verlag
SalierGroup GmbH, Eichberg 21, 98673 Eisfeld
Alle Rechte vorbehalten.
Printausgabe: ISBN 978-3-96285-073-9
1. Auflage 2025
Umschlaggestaltung: Bastian Salier
Satz & Layout: InDesign im Verlag / Vellum im Verlag
www.salierverlag.de
Inhalt
Über den Autor
Der vom Fünf-Mark-Schein
Vorspiel
Bundschuh und kokelnde Ketzerknochen
Deutscher Bauernkrieg
oder besser: Die Revolution des gemeinen Mannes
Bauernbeben: Aus dem Süden zum Flächenbrand
»Zwölf Artikel«: Freiheit, die sie meinen
Ein Ende mit Schrecken
»Die Veränderung der Welt sitzt vor der Tür«:
Auftritt Thomas Müntzer
Wann und wo: Jahre im Dunkeln
Zwickau: Erste Risse im Reformatorenlager
Prag: Enttäuschung und Manifestation
Wanderzeit: Botenläufer und Seelenwärter
Widerstehen: Allstedter Bund und Fürstenpredigt
Mühlhausen und Wege zu den Bauern
Fanal Frankenhausen: ein Schlachten
Der Funke erlischt
Müntzer und die Folgen
Ernte: Was brachte der Aufruhr?
Zum Begriff: Die Revolution des gemeinen Mannes
Nachbeben:
Müntzer-Deutungen im Lauf der Geschichte
Gesichtslos: (K)ein Bild sich machen
Wittenbergs Wirken: Rufmordkampagne
Es wird politisch: Entdeckung eines Revolutionärs
Deutsche-deutsche Diskussion: Zwischen Theologie und Marxismus
Objekt der Nationalkultur: DDR-Erinnerungspolitik
Populärkultur
Legendäres: Der kugelsichere Müntzer und sein Sensenschwert
Müntzer und wir
Unter der Regenbogenflagge
Wider die Kreaturenfurcht: Menschsein in Gelassenheit
Wasser und Internet: Zur Frage der Allmende
Das Versprechen der Freiheit: Selbst- und Mitbestimmung
Geschichte wird gemacht: Der Mensch in der Revolte
Spurensuche:
Wege zu Müntzer
Literatur
Bildnachweis
Anmerkungen
Mag die Geschichte – kurzfristig – von Siegern gemacht werden, die historischen Erkenntnisgewinne stammen – langfristig – von den Besiegten.1
In der einen Hälfte des Landes wurde Müntzer gezielt als Volksheld inthronisiert, in der anderen weitgehend ignoriert.2
Müntzer erinnert daran, dass die Hoffnung auf einen neuen Himmel und eine neue Erde stärker ist als Verzweiflung, als Leiden und Gewalt.3
Über den Autor
Tobias Prüwer studierte Philosophie und Geschichte in Leipzig und Aberdeen, arbeitet als freischaffender Autor und seit 2009 als Theaterredakteur sowie zeitweiliger Chefredakteur beim Leipziger Stadtmagazin Kreuzer. Er schreibt für Der Freitag, Jungle World, Freie Presse und die Jüdische Allgemeine.
Buchveröffentlichungen (Auswahl): Thüringen. Ein Panoptikum (Salier), Das Wörterbuch des besorgten Bürgers (Ventil), Weltnest Leipzig (Salier), Welt aus Mauern (Wagenbach), Kritik der Mitte (Parodos).
Der vom Fünf-Mark-Schein
EINLEITUNG
… und setz einen trauernden Bauern darauf, der mit einem Schwert durchstochen ist.1
Albrecht Dürers Skizze eines Bauernkriegdenkmals von 1525 enthält genaue Anweisungen. Ein hinterrücks erstochener Bauer sollte auf den Gerätschaften seiner Lebenswelt hocken: Butterfass, Haferkasten, Garben mit Feldwerkzeug und Hühnerkorb bilden seine Stütze. Die Botschaft scheint offensichtlich: Der Bauer starb ungerechtfertigt unter schierer Gewalt. Und doch ist das Cover dieses Buches irreführend. Denn so wie das Urteil der Geschichte über den Bauernkrieg vielfältig ausfällt, wurde auch Dürers Denkmal verschieden gedeutet. Im Begleittext wird es als Siegeszeichen tituliert. Bildsprachlich jedoch greift der hockende Bauer eine bekannte Klagegeste Christus’ auf – sympathisierte Dürer mit den Aufständischen? Dritte erblicken im Objekt die Zerrissenheit des Zeitgenossen, der sich nicht eindeutig positioniert. Perspektiven auf den Bauernkrieg bilden den roten Faden dieses Buchs. Ihre Unterschiedlichkeit erstaunt nicht, war es doch unerhört, dass 200000 Bauern und Städter den Aufstand nicht nur probten. Erst Jahrhunderte später erfolgte ein erneuter Revolutionsversuch zwischen Rhein und Elbe. Selbst nach 500 Jahren fasziniert der Bauernkrieg nicht nur als Ereignis, sondern auch in seiner Wirkgeschichte. Und diese ist maßgeblich der Figur Thomas Müntzer geschuldet, den Luther als »Erzteufel« bezeichnete. Davon wird im Folgenden zu lesen sein und Sie, liebe Leserinnen und Leser, werden erfahren, warum Sie mit dem Namen Thomas Müntzer bereits vertraut sind – oder diesen gar nicht kennen. Das hängt nämlich mit Ihrer Herkunft zusammen und der Frage, wer Sie einst vom Fünf-Mark-Schein grüßte (sofern das je der Fall war).
Bemerkenswerterweise krönte Dürer sein »Siegesmal« mit einem Bauern, während die DDR-Oberen ausgerechnet einen Theologen zum Säulenheiligen ihres Arbeiter- und Bauernstaates erhoben: ebenjenen Thomas Müntzer, den ersten Lutheraner. Nach einem biografischen Abriss und seiner Beteiligung am Bauernkrieg rückt die Diskussion um ihn und sein Schaffen ins Zentrum. Diese hält Müntzer als Figur erstaunlich lebendig. Daran trägt die Rufmordkampagne der Wittenberger Anteil, die zur Bildung von Legenden wie dem kugelsicheren Prediger führte. Zwischen Schwärmer, Hitzkopf und Revolutionär schwanken die Urteile über Müntzer, den Heinrich Heine einen der »heldenmütigsten und unglücklichsten Söhne des deutschen Vaterlandes« nannte.2 Er wurde zur Personifikation der deutsch-deutschen Historikerdebatte im Kalten Krieg und war Galionsfigur der DDR-Erinnerungspolitik. Seine theologische Munitionierung zur Änderung der Welt inspirierte sogar die lateinamerikanische Befreiungstheologie. Müntzer wurde zum Helden eines historischen Thrillers. Es bleibt zu fragen, was er uns heute zu sagen hat.
Als der Henker Müntzers Kopf vor Mühlhausens Stadtmauer auf einem Pfahl den Elementen überließ, war die Revolution gescheitert. Trotz kleinerer Nachgefechte hatte die Obrigkeit das Aufbegehren von unten zerschlagen, ihre Stellung gesichert und Martin Luther seinen Platz innerhalb der Reformation auf fürstlicher Seite gefunden. Das Scheitern des Haufens in Frankenhausen im Mai 1525 markiert ein Fanal. Das erklärt die Konzentration auf Müntzer in diesem Buch, das aus regionaler Perspektive aufs Ganze schaut. Dabei wird die mit ihm verbundene Entwicklung in den Thüringer Gebieten in die Gesamtzusammenhänge und ihre Vorgeschichte eingebettet. Der Aufstand begann im deutschsprachigen Süden und erfasste Gebiete zwischen Tirol, dem Harz und dem Elsass. Entgegen der landläufigen Vorstellung vom »Deutschen Bauernkrieg« kommt die Beschreibung als »Revolution des gemeinen Mannes« den Ereignissen 1525 viel näher. Die Korrekturen am dreifach irreführenden Begriff betreffen sowohl die Träger des Aufstandes, seine Geografie und seinen Charakter als Krieg. Er brach aus, weil sich weltliche Forderungen und religiöse Gefühle zum explosiven Gemisch vermengten. Welche Rolle die Ideen der Reformation spielten, zeigt sich an der Person Thomas Müntzer. Dieser überträgt das theologische Argument auf den weltlichen Bereich: Die Gottesgerechtigkeit wollte er auf Erden realisieren. In Thüringen als Kernland der Reformation werden die Antagonismen innerhalb des Reformatorenlagers besonders deutlich – am Gegensatzpaar Luther und Müntzer. Denn die revolutionären und reformatorischen Ereignisse gehören zusammen. Daran wird am 500. Jubiläum zu erinnern sein.
Geschichte wird gemacht, Ordnung ist nicht auf ewig fest verfügt und historisch brach sich in immer neuen Phasen das Begehren nach Gerechtigkeit Bahn. Reform oder Revolution? Das wurde damals diskutiert, stand auch 1989 zur Debatte bei der Friedlichen Revolution, die einige als Übergabe und damit als abgebrochene Revolution bewerten. Das letzte Wort über 1525 ist noch nicht gesprochen worden, wenn jüngst gedruckte Darstellungen die Revolution mal in Junkerworten als »Unruhen« und »wilde Handlung«3 beschreiben oder sie hoch jazzen zu »Deutschlands großem Volksaufstand«4. Darin zeigt sich ein durchaus großer Deutungsspielraum, den es auszuloten gilt.
Der große Autor Umberto Eco meinte einmal, das Mittelalter sei die Kindheit Europas. Von hier aus ließe sich die politische und kulturelle Entwicklung Europas verstehen und bewerten. Müntzers »sperriges Erbe«5 lohnt durchforstet zu werden, ohne eine Heldenverehrung zu beabsichtigen. Geschichte untersucht dem Historiker Reinhart Koselleck zufolge »gegenwärtige Vergangenheit«, »nicht die vergangene Gegenwart«6. Die Geschichtsschreibung thematisiert demnach diejenigen Aspekte der Vergangenheit, die uns vom gegenwärtigen Standpunkt aus relevant scheinen. Der Frage, was den Bauernkrieg über Jubiläumsgründe hinaus noch präsent macht, folgt dieses Buch. Es widmet sich der gegenwärtigen Vergangenheit von 1525 und geht den Spuren möglicher Gemeinsamkeit nach. Dabei wird auch zu sehen sein, wie missbräuchlich dieses Erbe benutzt wurde, nicht zuletzt während der sogenannten Bauernproteste im Winter 2024. Wenn die daran beteiligten rechten Akteure gewusst hätten, dass Thomas Müntzer Erfinder der Regenbogenfahne ist – und gewiss selbst mit der heute damit verbundenen Botschaft nicht einverstanden wäre.
Müntzer ist kein Zeitgenosse. Seine Antworten können nicht die unseren sein. Zumindest sind die Fragen, die Müntzer und seine revolutionären Bundesgenossen an die Welt gestellt haben, auch 500 Jahre später aktuell. Damals befand sich die Gesellschaft in Verschiebung, suchten die Menschen nach Linderung ihrer Situation – und wollten diese notfalls selbst erzwingen. Daher kann in krisenhafter Gegenwart die Beschäftigung mit 1525 erhellend sein. Wohl wissend, dass auch dieses nur ein vorläufiges Urteil sein kann und man aus der Geschichte nichts lernen kann – aber sie hilft beim Verstehen. Ob die Lesenden selbst im Durchgang dieses Buches zu einer abschließenden Position gelangen, bleibt ihnen überlassen.
Vorspiel
BUNDSCHUH UND KOKELNDE KETZERKNOCHEN
Als Adam grub und Eva spann, /
wo war denn da der Edelmann?1
Revolutionen sind ein Kennzeichen der europäischen Geschichte vom Spätmittelalter bis ins 20. Jahrhundert. Als Unterfangen, alternative Gesellschaftsentwürfe umzusetzen, richteten sie sich gegen die Universalmächte Kirche und Monarchie. Dahinter steht ein bestimmtes philosophisches Bild von Mensch und Gesellschaft, das der Wirklichkeit entgegengehalten wird. Bis zur Französischen Revolution war das christlich geprägt, waren die Revolutionen – wie die hussitische – theologisch motiviert und legitimiert. Andere Ursachen spielten stets mit hinein, sind allerdings nicht so sauber analytisch zu trennen, wie das in der Rückschau scheint. Gerade das 15. und 16. Jahrhundert war eine Zeit der Weichenstellung, die Ära der großen Entdeckungen begann, neue geografische Gebiete wurden nicht nur kartografiert, sondern die Europäer griffen darauf zu. Damit begannen auch Eroberung und Kolonialisierung. Globaler wurde der Handel. Mit einschneidenden Veränderungen der Produktionsweisen und dem aufkommenden Bankwesen erhielten erste ökonomische Teilbereiche frühkapitalistische Züge. Erste sanfte Entwicklungen hin zu einem moderneren Staatswesen und der zunehmenden Autonomie der Landesstaaten waren zu verzeichnen. Zugleich prägten zwei Krisen und Abstiegsphänomene diese Zeit deutlich: Sie betrafen die Bereiche Wirtschaft und Religion.
In West- und Mitteleuropa bildete sich eine immer größere Differenz zwischen aufsteigenden Städten und niedergehendem Adel heraus. Das ausnehmende Pfründewesen der Kirche und die Abgabepflichten erregten Widerwillen. Zumal eine anhaltende Agrarkrise zu Landfluchten und Hungersnöten führte. Aufstände flackerten regelmäßig auf: In Flandern (1302) schlugen Bürgermilizen französische Ritter in die Flucht, eine über Steuererhöhung empörte Menge stürmte das Rathaus von Paris (1382). Französische Bauern erhoben sich (1356 ff.), ebenso die Unterklasse in Florenz (1378) und Bauern in England (1381). Diese englische Rebellion jenseits des Ärmelkanals kann als Vorzeichen auf 1525 interpretiert werden. Denn dort drang die Geldwirtschaft früher als in den deutschsprachigen Gebieten ins dörfliche Leben ein und löste die Naturalienwirtschaft ab. Damit erhöhten sich Abgabe- und Lohndruck. Hier kam die Frage auf, die bald zum geflügelten Wort vieler Aufständischer werden sollte: »Als Adam grub und Eva spann, / wo war denn da der Edelmann?«
Der Spruch weist auf eine lange Traditionslinie, politisch-soziale Forderungen aus der Bibel abzuleiten. Was nur folgerichtig ist, weil man sich auf die göttliche Ordnung bezog respektive sich in einer solchen lebend erachtete. Auch deshalb hatte eine Krise der Glaubensinstitutionen direkt weltliche Auswirkungen. Seit dem 14. Jahrhundert wurden innerhalb der Kirche Forderungen nach Erneuerung laut. Verschiedene Frömmigkeitsströmungen, den Glauben anders zu leben, entstanden. So zielte die sogenannte Devotio moderna (»Zeitgemäße Frömmigkeit«) auf eine neue Verinnerlichung des Glaubens. Sie zehrte von der Mystik wie dem Humanismus, zwei Quellen auch für Thomas Müntzers Denken, das aus religiöser Überzeugung den Umsturz der weltlichen Ordnung vorsah. Diese war in jener stürmischen Epoche bereits ins Wanken geraten. Die zwei großen mittelalterlichen Säulen der Macht, Papsttum und Kaisertum, hatten an Einfluss verloren. Sie sollten weiter erodieren unter dem Partikularismus sich entwickelnder regionaler Territorialherrschaften. Wirtschaftlicher Wandel erhöhte den Druck auf die Grundfesten der Gesellschaft, während vorreformatorisches Beben das katholische Glaubensgebäude erschütterte. Natürlich waren sie verquickt mit der sozialen Dimension beziehungsweise nicht davon zu trennen. So wie Thomas Müntzer spirituell und durch weltliche Erfahrung informiert war, um die politische Umgestaltung aus der Theologie abzuleiten.
Die geistliche Dimension
Eine Anekdote verdeutlicht diese Erschütterung und die antiklerikale Stimmung: »Einmal Ritt der Papst übers Feld, da kam eine alte Frau, eine Bettlerin, zu ihm und begehrte um Gottes Willen einen Schilling von ihm. Er sprach: ›Nein, es ist zu viel.‹ Die Frau sprach: ›So gebt mir einen Plapphart.‹ Er sprach: ›Nein.‹ Die Frau sprach: ›Gebt mir einen Kreuzer.‹ Er sprach: ›Nein.‹ Die Frau sprach: ›Macht den Segen über mir.‹ Er machte das Kreuz über sie. Die Frau sprach: ›Wäre mir Euer Segen einen Heller wert, so hättet Ihr ihn mir auch nicht gegeben.‹ Hiermit ging die Frau davon.«2 Mit Prunksucht, Ausschweifungen, dem Geldabfluss nach Rom und narzisstischer Selbstinszenierung zog der Klerus den Groll der anderen auf sich. Schon die Humanisten geißelten den Ablasshandel. Der Klerus, die Domherren, Priester, Klosterbewohner, erfüllten nicht mehr ihre Funktion als Hirten, so wuchs die tiefe Überzeugung in der Bevölkerung – was den rasenden Bildersturm von 1525 verständlich macht.
Drei Päpste beanspruchten neunzig Jahre zuvor auf dem Konstanzer Konzil (1414–18) für sich, das Oberhaupt der Christenheit zu sein. Sie sprachen sich gegenseitig die Autorität ab, drohten jeweils das Gefolge der anderen zu exkommunizieren. Das war für die Gläubigen niederschmetternd und stellte den Gemeinsinn in Frage. Wie konnte der Einzelne ein guter Christ und sicher sein, dem richtigen Papst zu folgen? Das Seelenheil stand auf dem Spiel, die Höllenfahrt drohte. Während des Konzils löste man zwar die Papstfrage, indem ein vierter als neuer Papst gewählt wurde. Dauerhafte Ordnung und Stabilität waren nicht das Ergebnis. Gerade, weil sich die Kirchenmänner mit dem Ketzerprozess gegen Jan Hus keinen Gefallen taten. Dabei war das bisher das probate Mittel gewesen, Kritik auszuschalten. Denn der Idee einer neuen apostolischen Kirche der Armen folgten bereits Laienbewegungen wie die Waldenser. Sie wurden durch die Inquisition verfolgt. Impulse von ihnen lebten im Hussitismus fort und dadurch bei den Zwickauer Tuchknappen, wo Müntzer mit ihnen in Berührung kam. Der theoretische Boden war vor allem durch den Theologen John Wyclif vorbereitet, dessen Lehren den englischen Bauernaufstand von 1381 begleiteten. Er lehnte den päpstlichen Machtanspruch ab, predigte gegen Ämterverkauf, Reliquienverehrung und Zölibat. Die Bibel ließ er ins Englische übersetzen, seine Schriften beeinflussten deutschsprachige Reformatoren und die Hussiten. Das Konstanzer Konzil erklärte Wyclif dreißig Jahre nach seinem Tod zum Ketzer. Seine Knochen wurden ausgegraben und posthum verbrannt. Auf diesem Konzil wurde 1415 der Theologe Jan Hus lebend verbrannt. Das löste Volksaufstände aus, die in die hussitische Revolution mündeten. Die Frage, wie stark Martin Luthers Thesen auf Hus fußten, beschäftigte hundert Jahre darauf den Wormser Reichstag.
Die wirtschaftliche Dimension
Die feudalistische Gesellschaft war hierarchisch ständisch organisiert. Die Ständegesellschaft bestand aus übereinander stehenden, klar voneinander abgegrenzten Gruppen. Illustrieren soll das die sogenannte Lehnspyramide, der die meisten im Geschichtsunterricht begegneten: Der Kaiser an der Spitze verleiht den unter ihm stehenden Kronvasallen – weltlichen und geistlichen Fürsten und Bischöfen – für Dienst und Treue Grundbesitz, genannt Lehen. Diese wiederum geben Lehen ebenfalls für Dienste im Amt und an der Waffe weiter an Untervasallen wie Ritter und Beamte. Am untersten Ende der Pyramide standen die Abhängigen wie hörige und leibeigene Bauern und mit Ausgang des Mittelalters zunehmend auch die Besitzlosen der Stadtgesellschaften. Allerdings erfasst diese verbreitete Darstellung nicht die komplexe Realität. Sie ist bis zur Verzerrung vereinfacht und kann die tausend Jahre überspannende Epoche gar nicht zutreffend abbilden. In Wahrheit war es komplizierter, gab es viele Arten von Lehen, gestalteten sich die Beziehungs- und Abhängigkeitsgeflechte als komplex, überschnitten oder ergänzten sich Gewohnheitsrechte mit schriftlich Vereinbartem. Glücklicherweise können wir für unseren Zweck am sehr vereinfachten, binären »die da oben – die da unten« festhalten.
Ab dem 14. Jahrhundert begann der Abstieg des bis dahin einigermaßen starken Stands der Bauern, sofern sie nicht abhängig waren. Die Pest hatte für einen massiven Arbeitskräftemangel gesorgt. Zeitgleich hob der Adel die Abgaben an, weil der Geldbedarf der Feudalherren durch erhöhte Militärausgaben, aber auch durch Lust am Luxus stieg. Der Adel sah sich in Konkurrenz zu den urbanen Patrizierfamilien, die Stadtprivilegien genossen, über die er nicht verfügte. In den Städten selbst klafften die sozialen Unterschiede immer weiter auseinander. Die plebejische Gruppe der von Besitz und Mitbestimmung Ausgeschlossenen, der Rechtlosen wie Handwerksgesellen, Tagelöhnern und Bediensteten wuchs an. Der Bettel nahm zu, worauf neu ausgearbeitete Bettelordnungen hinweisen, die zum Beispiel nur noch Einwohnern, aber keinen Fremden, das Betteln gestatteten. Neue Elendsquartiere entstanden. Auf dem Land wurde die »Bauernschinderei« wiederbelebt und die Zahl der Frondienste angehoben. Das bedeutete Beschneidung der relativen Autonomie der Dorfgemeinschaften. Das Begehren nach Partizipation wiederum regte sich innerhalb der Stadtmauern, wo Zünfte gegen Ratsherren protestierten. Überall wuchsen Widerwillen und Widerstand. Selbst einige niederadlige Ritter gerieten dermaßen unter ökonomischen Druck, dass sie sich dem Aufstand anschlossen.
Chance und Apokalypse
Kein Wunder, dass in dieser Zeit die Geschichten vom derben Spaßmacher Till Eulenspiegel populär waren, der die Obrigkeit zum Narren hielt. Als Turmbläser warnte er einen Grafen von Anhalt vor imaginären Feinden; nur um sich über dessen Ochsen am Spieß herzumachen, als er streitlustig die Burg verließ. Einem gierigen Pfarrer jubelte Eulenspiegel Kot als materielles Vermächtnis unter. Der Narr war die literarische Verkörperung eines Freiheitsversprechens. Denn den Menschen in den unteren Rängen ging es nicht nur um Einkommen und Vermögen. Freiheit wurde vollumfänglich verstanden, betraf den Leib, die ganze Familie und Zukunft. In diesem Kontext steht die Bundschuh-Bewegung, die um 1500 im Süden des deutschen Sprachraums Unterdrückung bekämpfte. Unter solchen Zeichen ereigneten sich der florentinische Umsturz von 1498, die Rebellion in Ungarn 1514 und der Windische Bauernkrieg in der Krain, Steiermark und in Kärnten 1515. Und das Bündnis Armer Konrad, das 1514 im Herzogtum Württemberg aufbegehrte. Das alles waren Vorboten der Revolution des gemeinen Mannes.
Dazu trug beginnendes Selbst- und Sendungsbewusstsein bei. Allmählich begann man, die Gegenwart als Prozess zu erfahren, in welchen man gestaltend eingreifen konnte. Man war auch durch den Glauben inspiriert zum Handeln, weil der aufreißende nie gekannte Zukunftshorizont überdeckt wurde von der Endzeitstimmung. Die damaligen Krisen verdichten sich für die Menschen zur Überzeugung, das Ende der bekannten Ordnung, ja, eine Zeitenwende stünde bevor. Religion hielt alles zusammen, war der ideologische Kitt, der die Ordnung zusammenhielt. Glauben war existenziell, weshalb soziale, wirtschaftliche oder politische Belange an ihn geknüpft waren. Das erschütterte Gemeinwesen rief Kräfte wach, Gedanken von Genossenschaftlichkeit und Selbstverwaltung griffen um sich. Die Klöster leerten sich schon von selbst, bevor sie kurze Zeit darauf gewaltsam von Aufständischen gestürmt und von Fürsten aufgelöst wurden.
»In diesem Antiklerikalismus, der bereits ritualisierte Gesten der Verweigerung, der Aufsässigkeit und des Widerstands ausgebildet hatte, steigerte sich religiös und sozial motivierte Entrüstung zur revolutionären Brisanz.«3
Die Infragestellung der Ständeordnung und das Wanken des ersten Stands war nicht im Sinne der Fürsten und anderer Territorialherren. Diese witterten aber ihrerseits in der reformatorischen Bewegung eine Chance zum Machtausbau; sofern sie nicht selbst tief religiös an kirchlicher Erneuerung interessiert waren. Wie ausgeführt, ist die Trennung künstlich, Glauben war Lebenselixier. Insbesondere Teile der Reichsstände, das waren weltliche und geistliche Fürsten, Vertreter der Ritterorden und Reichsstädte, nutzten die Auswirkungen des Thesenanschlags zu ihrem Nutzen. Kaiser Karl V. regierte ab 1519 das Heilige Römische Reich deutscher Nation; und zwar von der Ferne in Spanien aus. Er und sein Haus Habsburg befanden sich in kriegerischer Konkurrenz mit Frankreich, die Osmanen bedrängten die europäischen Ostgrenzen. Die Glaubensfrage barg selbstverständlich großes Konfliktpotenzial, das sich im Schmalkaldischen Krieg (1547) und schließlich im Dreißigjährigen Krieg (1618–48) entladen wird. Noch wollten die neugläubigen Landesherren wie der Luther beschützende Friedrich von Sachsen die Loyalität zum Kaiser nicht offiziell aufkündigen. Aber sie sahen in einer Reformation von oben ein Werkzeug, mehr Eigenständigkeit zu erwirken. Ein selbst geführtes Kirchenregiment bedeutete für sie, Stellenbesetzungen mit ihnen genehmen Geistlichen durchzuführen und die Geldflüsse nach Rom abzuschneiden. Daher agierten sie möglichst diplomatisch, auf Aushandlung und Stabilität bedacht. Eine »wilde« Reformation von unten konnten sie keinesfalls gebrauchen.
Deutscher Bauernkrieg
ODER BESSER: DIE REVOLUTION DES GEMEINEN MANNES
Aus Liebe zur Wahrheit und im Verlangen, sie zu erhellen, sollen die folgenden Thesen in Wittenberg disputiert werden …1
In diese ohnehin bewegte Welt krachte ein Ereignis, das gemeinhin als Beginn der Reformation angesetzt wird: Martin Luther schlägt im Oktober 1517 seine 95 Thesen wider den Ablasshandel an die Schlosskirche zu Wittenberg. Mit dem Kauf sogenannter Ablassbriefe konnten die Gläubigen die Strafen für ihre Sünden mindern. Dieses Jenseitsvollkasko diente dem Vatikan zur Finanzierung des Petersdoms und die Bischöfe strichen ihren Anteil ein. Beichtvater Luther bangte um den Bußernst – welch schöne Worte die Theologie doch schöpft. Zwar ist nicht verbürgt, ob er wirklich mit Hammer und Nagel zu Werke ging. Da er zur Disputation aufrufen wollte, darf als wahrscheinlich angenommen werden, dass sein Thesenplakat angeklebt wurde. Immerhin fungierten öffentliche Aushänge an Kirchentüren als wesentliches Kommunikationsmittel. Ob Luther es selbst tat oder wie üblicherweise der Hausmeister die Kleisterbürste schwang, kann nicht mehr geklärt werden. Jedenfalls trat Luthers Diskussionsvorschlag eine Lawine los, die bei einer Kirchenerneuerung nicht Halt machte.
Die Zeit für einen umfassenden gesellschaftlichen Wandel war längst reif. Konnten diverse Versuche des Aufbegehrens und der Veränderung bis dato eingefangen werden, so vermochte das die Obrigkeit nun nicht mehr. Zumal sich ein Teil davon als Akteur am reformatorischen Prozess beteiligte. In diesem Fahrwasser sahen sich die einfachen Menschen bestätigt, ihre Forderungen endlich einzulösen. Konnten sie doch diese mit Luthers theologischer Kritik als biblisch berechtigt ansehen. Sie weiteten dessen Idee von der Freiheit des Christenmenschen, der allein von Gottes Gnade im Glauben frei sei, gegen dessen Verständnis aus. Das war nicht ganz neu, erwähnter John Wyclif nahm die »Gerechtigkeit Gottes« als oberste Richtschnur, die Hussiten ebenfalls. Eine Fahne der Bundschuh-Bewegung zeigte einen gekreuzigten Christus mit dem Spruch »Nichts denn die Gerechtigkeit Gottes«2. Dank Luther, seinen Wegbegleitern und seinem Netzwerk sowie durch den Buchdruck zirkulierten diese Ideen mit zuvor nie gekannter Breitenwirkung.
Wer das Reformationsgeschehen auf Martin Luthers Umfeld beschränkt und es als rein geistige Bewegung versteht, blendet die sozialen und politischen Aspekte aus. Ebenso übersieht das den Vorlauf des revolutionären Moments, das seit der Hinrichtung von Jan Hus in der Luft lag. Die Rebellion der einfachen Leute ist ein Teil der Reformationsgeschichte, Reformation und Bauernkrieg müssen zusammen gedacht werden. Dabei lassen sich grob zwei Hauptphasen unterscheiden.
Luthers Ablasskritik gab die Initialzündung einer um sich greifenden Reformbewegung. Die führte zur Erschütterung geistlicher und weltlicher Institutionen. Den gescheiterten Aufstand kann man als revolutionären Höhepunkt dieser Bewegung auffassen, denn an die Niederlage schloss sich die Phase obrigkeitlicher Konsolidierung an. Nach knapper Schilderung der im Süden beginnenden Ereignisse sollen im Folgenden die Ursachen dafür erörtert werden. Danach rücken Thomas Müntzer und sein Wirken während des Thüringer Aufstands in den Fokus.
BAUERNBEBEN: AUS DEM SÜDEN ZUM FLÄCHENBRAND
Alle Forderungen ergeben sich aus dem Wort Gottes. Sollten sie sich durch das Evangelium als unberechtigt erweisen, wolle man von ihnen Abstand nehmen.3