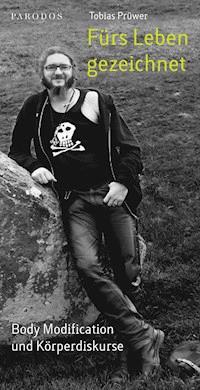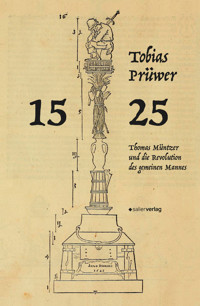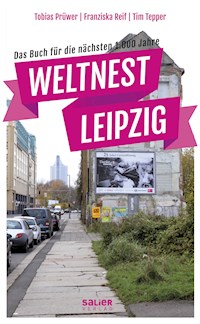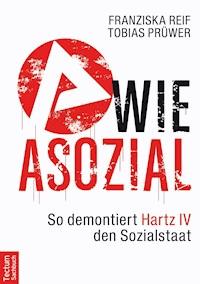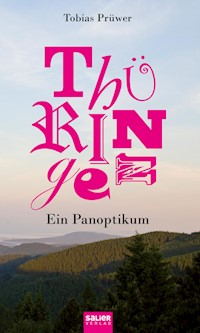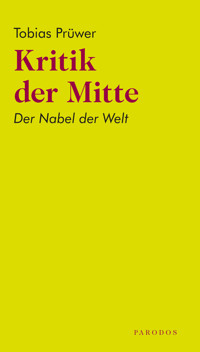
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: heptagon
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
lle reden von Mitte. Man soll die eigene Mitte finden. Positionen wähnen sich als Nabel der Welt. Auch rechte Parteien wollen Mitte sein. Im Gegensatz zur belächelten Peripherie gilt Mitte als Zentrum, als Gutes an sich und neutrale Balance zwischen Extremen: Seien es Laster, Klimabedingungen oder politische Ansichten. Dieser kulturellen und politischen Prägung durch das Mitte-Motiv spürt das Buch nach. Es vermisst das weite Symbolfeld der Mitte und kritisiert die Konsequenzen unreflektierter weltanschaulicher Kategorien: von den Diskussionen um die mittlere Lage Deutschlands in Europa, die geographische Mitte Deutschlands oder den Begriff Mitteldeutschland über die unhaltbare Extremismus-Theorie und die Mobilisierung angeblicher Mittelschichten bis zu einer verschleiernden Identitätspolitik, die sich als Norm setzt, um von „Minderheiten“ nicht behelligt zu werden. Das zeichnet das Buch über eine facettenreiche Kulturgeschichte hinaus als aktuellen Debattenbeitrag aus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tobias Prüwer
Kritik der MitteDer Nabel der Welt
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.© Parodos Verlag Berlin 2022
Alle Rechte vorbehalten
Zwecks Zitiertfähigkeit lassen sich aus dem Inhaltsverzeichnis (Kapitel Seiten) die Seiten der Printausgabe über Links anspringen.
ISBN der Printausgabe: 978-3-96824-008-0ISBN des E-Books: 978-3-96024-060-0
https://parodos.de
Fragt man nach dem spezifischen Ort, den dieser Zuschreibungspunkt in der politischen Geometrie hat, erhält man nicht selten die Antwort: ›Das weiß man doch!‹ In Wirklichkeit jedoch ist das, was ›die Mitte‹ inhaltlich meint, auf der Landkarte des Politischen eine terra incognita, ein nahezu gänzlich weißer Fleck. Kurt Lenk1
Dieses Bild hatte ich vor mir und spähte vergebens umher … Jetzt aber waren wir auch glücklich zwischen dem Strudel der Charybdis und dem Felsen der Skylla hindurch. Gustav Schwab2
Ein Bild hielt uns gefangen. Und heraus konnten wir nicht, denn es lag in unsrer Sprache ... Ludwig Wittgenstein3
Aufriss: Ab durch die Mitte
… ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte,
in der betäubt ein großer Wille steht.4
Alle reden von Mitte. Ratgeber leiten an, die eigene Mitte zu finden. Der Globus ist übersät mit Nabeln der Welt. Politische Parteien reklamieren die Mitte für sich, auch wenn sie rechts sind. Das Zentrum wird gegenüber der Peripherie bevorzugt. Mit Mitte werden Symmetrie, Wohlgestalt und Harmonie assoziiert. Sie verkörpert richtiges Maßhalten, Balance und gleichen Abstand zwischen zwei Extremen: Seien sie nun Laster, Klimabedingungen oder politische Ansichten. Von ihrer über zwei Jahrtausende anhaltenden Anziehungskraft hat die Mittemotivik nichts eingebüßt und soll selbst noch pluralistische Gesellschaften kitten. Wiederkehrend mahnen Politiker, in der Mitte zusammenzurücken, durch Mitte Integration zu produzieren und die Mittelschicht zu schonen. Und wer mag einem warnenden Philosophen widersprechen: »Die Mitte verlassen, heißt die Menschlichkeit verlassen«?5 Ähnlich wie Seefahrerlegende Odysseus die goldene Mitte durchschiffen musste, um der mörderischen Nähe von Skylla wie Charybdis zu entkommen, sucht der Mensch sein Heil in der Mitte, selbst wenn er manchmal das Mittelmaß belächelt. Als Ordnungsmuster wirkt die Mitte vom Alltag bis in die Kosmologie, von der Preisauszeichnung im Supermarkt bis zum Hufeisenmodell der Extremismustheorie.
Bilder und Symbole verdichten Information, doch leiten sie mitunter fehl. Dem irrlichternden Mitteideal und seinem unreflektierten Lob auf die Spur zu kommen, ist das Vorhaben dieses Buchs. Kursorisch in der Form vermisst es ihr weites Symbolfeld und zielt auf die Voraussetzungen ihrer Überzeugungskraft. Leitende Frage ist, in welchen Mittebildern wir verstrickt sind, vom tugendhaften Leben über den Sitz Gottes und grüne Herzregionen bis zu den Risiken politischer Crash-Test-Dummies. Statt wie üblich eine ideengeschichtliche Überlieferungslinie zu ziehen und allerlei Positionen unterm Motto »Maß und Mitte« zum Amalgam der Beliebigkeit zu verschmelzen, betone ich Unterschiede und Brüche. Ich reihe keine Autoritäten als Perlen auf einem Zeitstrahl aneinander, um einen fragwürdigen Humanismusbegriff zu retten, der vom römischen Senat bis zum Grundgesetz reicht: der irgendwie maßhaltende Mensch als allgemeingültiges Vorbild, obwohl er jeweils anders gemeint wird. Wenn Politikwissenschaftler Uwe Backes postuliert, es gebe seit Aristoteles’ Staatslehre eine liberale Idee bürgerlicher Verfasstheit, die in der Gegenwart ihre perfekte, normativ-wissenschaftlich zu verteidigende Form gefunden hat6, so vertritt er damit die exakt entgegengesetzte Position zu der hier unterbreiteten. Dieses epochenüberspannende Traditionsargument leuchtet genauso wenig ein wie die grundlose Erklärung der Mitte zum Guten, Wahren und Schönen.
Dient der Rückgriff auf als nahtlos dargestellte (Erfolgs-)Geschichten zur Legitimation der Gegenwart, so nimmt dieses Buch die Selbstvergewisserung anhand der Mittemotivik skeptisch in den Blick. Ideen sind immer Kinder ihrer Zeit, sie unterliegen der historischen Kontingenz und enthalten daher keine ewige Wahrheit. Aus dieser Einsicht zielt die Kritik der Mitte darauf, sich vor ihrem Sirenengesang zu feien. Die Fesseln ihrer Symbolkraft sollen gelockert werden, um sie durch Analyse und im Verhältnis zu anderen möglichen Bildern als eine Perspektive unter anderen sichtbar zu machen. Auf dieser Suche nach versprengten Motiven der Mitte und ihrer Manifestation als zentralem Denkmuster und Ideal, Gemeinschaft zu arrangieren, zeigen sich ihre semantischen Felder als überlagert und miteinander verquickt. Sie ergänzen und stützen sich, was die vermeintliche Natürlichkeit des Mittebildes als welt-anschauliche Kategorie untermauert.
Hier liegt keine reine Kultur- und Begriffsgeschichte vor. Sich mit dieser Ideenkonstellation auseinanderzusetzen, bedeutet mehr als einen Kampf um Worte. Denn Mitte wirkt. Seit der Französischen Revolution bestimmen »Links«, »Mitte«, »Rechts« politische Parteipositionen. Nach den Katastrophen des »Zeitalters der Extreme«, wie der Historiker Eric Hobsbawm das 20. Jahrhundert bezeichnete, erwuchs Mitte zur fixen Idee der Bundesrepublik: Eine starke Mittelschichtengesellschaft verspricht Harmonie, weshalb nicht nur die »Volksparteien« die Mitte reflexhaft anbellen. Während mehr und mehr sichtbar wird, wie leer sie ist. Mitte suggeriert Ordnung in einer unübersichtlichen Welt. Mit ihr als Schutzschild wehren Überforderte Komplexität ab, instrumentalisieren sie andere politisch, um soziale Sicherheit vorzugaukeln. Wie wurde Mitte zum durchdringenden Symbol? Weshalb können wir uns Städte nicht ohne Zentrum vorstellen und Gesellschaften ebenso wenig? Warum trägt die Mittelschicht die Republik und verkörpert den gesunden Menschenverstand? Wieso werden in ihr Wahlen gewonnen, Kunden akquiriert, kann das Zirkelmaß Kriege verursachen? Wie hängt Mitte mit Bürotemperaturen, Minderheitenrechten und verschleierter Identitätspolitik zusammen? Diese Fragen soll das Buch beantworten. Wir werden sehen, wie Mitte Zeit und Raum strukturiert, bereisen die Nabel der Welt und Zentralgebäude, erkunden deutsche Mittelpunkte und ihre Schatzkisten. Wir schauen, welche Kreise antike Gesellschaften zogen, wo die Kaiser des Mittelalters thronten und wie das moderne politische Koordinatensystem entstand, das Debatten sortiert und als Grundlage der Extremismustheorie die Verharmlosung menschenfeindlicher Ideologien und Gewalt befeuert. Schlussendlich werden wir sehen, wie Mitte das moderne Menschenbild formte, das in der Welt stehende bürgerliche Subjekt, von dem eine normierende Normalität ausgeht.
Zweck des Buches ist nicht, Motive der Mitte per se abzulehnen, sondern genauer hinzuschauen, wo diese als Muster taugen und wo nicht. Im Schlusskapitel wird deshalb gefragt, ob man diesem Bild entkommen kann. Ausgeklammert wird der Komplex Medien und Mediation. Die Sortierung der Welt durch das Mediale, Schnittstellen, Interfaces wie auch durch Geld und andere Medien zu behandeln, würde zu weit weg führen. Die Mittethematik ist auch mit dieser Ausklammerung schillernd genug. »Die Sprachherrschaft in der unmittelbaren aktuellen Politik erwirbt, wer die Wortfelder besetzen kann, in denen die tagesfälligen Konflikte ausgetragen werden«, analysiert der Politikwissenschaftler Stefan Schwarzkopf. »Wer hier den anderen die Worte vorschreiben oder vorreden kann, hat schon gesiegt.«7 Begriffsarbeit bedeutet in diesem Buch nichts anderes als Arbeit am Mythos. Denn genau das ist die Mitte: ein wirkmächtiger Mythos.
Einkreisen: Zur Semantik der Mitte
Nicht rechts ist Schöpfung und nicht links;
sondern in der Mitte8
Obwohl das gesamte Buch als eine Semantik der Mitte zu verstehen ist, unternimmt dieses Kapitel eine vorauseilende Systematisierung. Es soll etwas Übersicht über die verschiedenen Gebräuche des Motivs verschaffen. Wie sehr diese miteinander verflochten sein können, bezeugen die aufschlussreichen Worte eines Verfassungsrechtlers: »dass Deutschland in seiner Verfassung als Bundesrepublik seine Mitte gefunden hat, nachdem die politische Geschichte durch ein Pendeln zwischen Ost und West gekennzeichnet war, das schließlich in die deutsche Teilung mündete. Die Bundesrepublik ist auch insofern ein ›Staat der Mitte‹ geworden, als extreme politische Programme sich nicht haben durchsetzen können bzw. erfolgreich bekämpft worden sind. Die maßgeblichen Kräfte treffen sich in der ›Mitte‹ […] Diese Mitte ist nicht zuletzt durch einen Grundkonsens hinsichtlich fundamentaler Werte und Rechte gekennzeichnet, wie sie im Grundgesetz und im Unionsvertrag niedergelegt sind.«9 Diese Zeilen bringen den Begriff der Mitte zum Schillern, er steht ohne Differenzierung zugleich für Ort, Ausgleich und Ordnung ein. Das geschieht häufig, wenn von der Mitte die Rede ist, wie der holzschnittartige Überblick zeigt. Auf diese Skizze folgen in den weiteren Kapiteln lockerere Tiefenbohrungen, die das jeweilige Thema genauer, aber nicht erschöpfend, sondern beispielhaft erörtern. In meinen Suchbewegungen beschränke ich mich auf das, was man gemeinhin »westliche Kultur« nennt. Das bedeutet nicht, dass Mitte originär oder exklusiv dieser zugeordnet ist. Dafür scheint ihre Symbolkraft zu grundlegend zu sein. So heißt es etwa in der chinesischen Weisheitssammlung »I Ching«: »Kein Makel, wenn du wahrhaftig bist / und in der Mitte wandelst.«10 Konfuzius idealisierte das »In-der-Mitte-Bleiben«11: »Maß und Mitte sind der Höhepunkt menschlicher Naturanlage.«12 Und: »Die Mitte ist die große Wurzel aller menschlichen Dinge in der Welt«.13 Religionswissenschaftler Mircea Eliade nennt zahlreiche Denksysteme, in denen der »Nabel der Welt«, die »axis mundi« oder das »Zentrum der Welt« eine Rolle spielen.14 Dafür spricht zudem das Vorkommen des Kreis-Symbols durch alle Zeiten hinweg, welches oft mit Vollkommenheit gleichgesetzt wird, weil alle Punkte der Kreislinie den gleichen Abstand zum Mittelpunkt haben. Im Buddhismus wird Buddhas Weg der »Mittlere Weg« genannt, weil er sich aller Extreme enthält.15 Das folgende Kapitel ist als Aufzählung gestaltet, die skizzierend den weiteren Buchinhalt vorwegnehmen soll.
Ambivalenzen: Punkt und Zone, Gleichgewicht und Harmonie
As man gehet in mitten, hot man a goldenen Schlitten; as man gehet im Eck, esst man a Schüssel Dreck16
Der Mensch befindet sich inmitten der Welt und muss sich in ihr orientieren. Dass dabei Wahrnehmung und Denken zumeist über Gegensatzpaare funktionieren, ist anders gar nicht vorstellbar, man denke an die Unterschiede zwischen hell und dunkel, oben und unten, kalt und warm oder nass und trocken. Zwischen diesen Polen sind in der Regel abgestufte Positionen bestimmbar, zum Beispiel ist ein Lüftchen lauwarm oder ein Schwamm feucht. Das ist verständlich ohne Angabe, ob sich der betreffende Zustand wirklich in der Mitte befindet. Selbst wenn etwas im Halbdunkeln liegt, nehmen wir – trotz der angedeuteten Hälfte – nicht an, dass seine Lumenzahl exakt die Mitte zwischen hell und dunkel kennzeichnet. Wir verstehen auch so, was dieses halbe Dunkel bedeutet. Bei der Mitte ist es anders. Sie lässt sich erst durch die Nichtmitten, ihre Position zwischen Extremen lokalisieren. Diese Negativdefinition ist ein Merkmal der Mitte.
Weil das Mittemotiv in vielen Kontexten beziehungsweise mit etlichen Bedeutungen erscheint, sind mit ihm starke Überzeugungen verbunden, naturgegeben statt kultureller Natur zu sein. Mal erscheint Mitte als Mittelpunkt oder mittlerer Bereich und hat eine räumliche Bedeutung, sie kann ein zentraler Zeitpunkt oder Zeitraum sein oder ein auf eine Metrik bezogener Mittelwert. Der Begriff Mitte wird als Metapher für Gleichgewicht, einen moderaten Weg oder Zustand verwendet. Ihm werden eine eigene Qualität, ein ausgewogener Charakter und ethische Werte beigemessen. Verstanden als Maßhalten drückt sich mit ihm auch ästhetisch ein Idealstatus aus: Das Ebenmaß im Sinne eines besonderen Ins-Verhältnis-Setzen der Proportionen gilt als Ausdruck vollkommener Schönheit. Auch der Balanceakt und die Ausgewogenheit bilden ein Motiv der Mitte. Man denke nur an die versinnbildlichte Gerechtigkeit als Waage der Justizia oder das Gebot der nuklearen Balance insbesondere zu Zeiten des Kalten Kriegs. In dieser Hinsicht auffällig ist auch Eckhard Jesses Formel vom »Gebot der Äquidistanz gegenüber politischen Extremismen«, welche die »Mitte« zu den Extremisten/extremistischen Positionen halten soll. Wer einen solchen Abstand nicht wahrt, gerät, so der Politikwissenschaftler, in eine »Schieflage«.17
Mitte bezeichnet das Zentrum, das sich in einem symbolischen Feld gegen eine Umgebung, ein Umfeld, einen Rand als Machtzentrum behauptet, und ist als »Nabel« mit Bedeutung aufgeladen. Das drückt sich in der Rede von globalen Machtzentralen in der »ersten« und den abgehängten Ländern der »dritten Welt« aus. Die Gegenüberstellung von Metropole und Provinz ist durch ein unterschwelliges pejoratives Bild geprägt wie die Unterscheidung in Zentrum und Peripherie. Die Mitte besetzt das Herz. Axialsymmetrische Darstellungen sind grundlegende Weisen der Organisation: Sie rücken besondere Menschen, Götter und Sakrales ins Zentrum, auf achsensymmetrischen Prinzipien beruhen die Baupläne von Schlössern, Städten, Grünanlagen. Wappen und Machtarchitekturen von Staats- und Kultstätten sind davon gezeichnet. »Das Strukturmuster der Axialsymmetrie steht in Beziehung zu fast allen semantischen Aspekten von ›Mitte‹«, fasst die Motiv-Forscherin Monika Schmitz-Emans zusammen.18 Mitte wirkt suggestiv, wenn Personen oder Objekte in die Mitte gerückt werden. Man denke an den Kirchenaltar oder das Politikerbad in der Menge. Schlagwörter der politischen Theorie und Praxis sind »Zentralstaat« und »Zentralgewalt«, eine Regierung hat einen Sitz, sie »steuert« schon der Etymologie nach: Das lateinische regere bedeutet »richten« und »lenken«. Das Unterscheiden in Zentrum und Peripherie, Zentrum und Provinz, Mittelmaß und Exzentrik drängt außerdem ein zwangsläufiges Entweder-Oder auf.
Es gibt die Mitte zum einen individuell, das heißt auf persönlichem Level, wie die Ratgeberliteratur vermuten lässt. Regalmeter rufen dazu auf, die eigene Mitte zu finden, zu stärken, auszubauen. Stellvertretend seien genannt: »Heilung aus der Mitte. Werde der, der du bist«, »Der sanfte Weg zur Mitte«, »Beckenboden-Gymnastik. Die eigene Mitte stärken«. Menschen stehen in der Mitte ihres Lebens oder werden aus dieser herausgerissen. Zum anderen wird die Mitte (der Gesellschaft), ob nun als alte, neue oder gar linke Mitte, von den so genannten respektive ehemaligen »Volksparteien« gebetsmühlenartig beschworen und rhetorisch vereinnahmt. Während die spätere Bundeskanzlerin Angela Merkel einmal klarstellte, dass die Mitte »rechts von links« liegt, orakelte ihr Kanzlerkandidaten-Kontrahent Gerhard Schröder: »Wer die Mitte durcheinander wirbelt, erlebt schlimmste Tragödien«.19 Die Proklamation des In-der-neuen-Mitte-Seins bleibt nicht auf Parteienpolitik beschränkt, ein Konsumkomplex namens Neue Mitte wirbt in Jena fürs Shoppen und das Einkaufszentrum Centro wird als Neue Mitte Oberhausen inszeniert. Sich im Zentrum zu wähnen, ist attraktiv, wertet es doch wie selbstverständlich die eigene Position auf. Auch am Körper, die Extremitäten sind als jene weit vom Herz entfernten Teile bestimmt, hat das Mittedenken Hand und Fuß. Und als flüchtige Mitte zwischen gestern und heute wird die Gegenwart gedeutet. In der Mitte, so dichtete Eduard Mörike, »Liegt holdes Bescheiden«.20
Tatsächlich fällt die Verwendung der Mitte-Metaphorik maßlos aus. Es sind die unterschiedlichen Vorstellungen und Ebenen, die im Topos von Mitte mitschwingen und ihn so plausibel machen. Das verdeutlicht folgendes Beispiel, in dem ein Richter des Bundesverfassungsgerichts eine »Verfassung der Mitte« anpreist: »Da die Mitte kein Ort oder Zustand ist, der sich erreichen ließe, geht sie auch nicht einfach verloren, wo einmal der Ausgleich verfehlt wird.« Sie sei eine »Klugheitsmaxime, als eine Art versteckter Kompass, der zwischen technokratischer Alternativlosigkeit und einer übermäßigen Begeisterung für das Faktum der Entscheidung durchsteuert.«21 Die Mitte wird hier als die undefinierbare Leerstelle erkannt, die sie ist. Nur wird das nicht als Problem, sondern Gewinn angesehen. Dem werden folgende Kapitel widersprechen und das Problematische herauskehren.
Dies soll als analytischer Entwurf genügen. Wir werden im Folgenden sehen, dass wir es nicht nur mit einem harmlosen Wort zu tun haben, wie der Essayist Michael Haerdter warnt: »Der Mythos Mitte setzt Zentrum mit Bedeutung oder Wert gleich. Vom Sonnenkönig zu seinen zahlreichen Nachfolgern und Nachahmern, von der Inquisition zum Stalinismus, vom bürgerlichen Milieu und juste milieu zum Tausendjährigen Reich und zum Eurozentrismus: wir zählen unendlich viele Versuche, die einstige Theokratie wiederherzustellen, Versuche, ein verbindliches Maß vorzugeben, eine Wahrheit für alle, und zugleich alles das zu verbannen oder zu vernichten, was sich dieser Weltsicht nicht fügt.«22
Maßhalten: An allem ist Aristoteles schuld
Das Beste ist das Maß.23
Zugeben, die Kapitelüberschrift ist übertrieben – aber nicht bis ins Extrem. Denn es ist vor allem den Schriften des Aristoteles geschuldet, dass das Mitteideal das »westliche« Denken von der griechischen Antike an durch die Jahrhunderte bis heute prägt. Zwar hielten schon Philosophen vor ihm Mitte und Maß für tugendhaft. Aristoteles aber erst systematisierte sie und verschaffte ihnen den Durchbruch in der Philosophie als Kategorien – mit Auswirkungen auf das Alltagsdenken. Mit seiner so genannten Mesotes-Lehre – Griechisch für »Mitte« – führte er sie methodisch in die Ethik ein. Von den Naturbetrachtungen bis zur Logiktheorie zieht sie sich als roter Faden durch sein Denken und Forschen. Er trieb das Prinzip auf die Spitze und verankerte es am nachhaltigsten in den Köpfen. Deshalb werden wir in späteren Kapiteln mehrfach zu Aristoteles zurückkehren müssen, etwa um zu sehen, wie sein Mitteideal das ordnungsstaatliche Denken infizierte.
Für den antiken Mediziner Hippokrates galt das Herz als Zentralorgan – weil es in der Körpermitte sitzt. Aus ihrer Zentralposition leitete auch Aristoteles die besondere Bedeutung der Mitte ab – ein zirkuläres Vorgehen, wie gleich zu sehen sein wird – und erklärte sie in seiner Philosophie zum alles durchwirkenden Prinzip. Er griff auf Vorläufer zurück, denn seinerzeit bildete die Idee des Maßhaltens bereits einen einflussreichen Strang des ethischen Denkens, aber eher als Lebensmotto denn systematische Theorie. Das tugendhafte Leben ruht dieser Vorstellung nach zwischen den Lastern in einer maßvollen Mitte. »Das Beste ist das Maß«, heißt es in der Spruchsammlung der Sieben Weisen von Griechenland, die einen Anfangspunkt der abendländischen Philosophie markieren – wenn man verallgemeinernd ein solches Projekt unterstellen möchte. »Die Mitte ist die Beste«, lautete ein anderer antiker Sinnspruch. Und eine Inschrift am Apollo-Tempel von Delphi mahnte: »Nichts im Übermaß«.24 Schließlich galt Apollo selbst als Gott der maßvollen Ordnung, dem etwa Friedrich Nietzsche den maßlosen, rauschhaften – man könnte sagen: extremen – Dionysos als Kontrapunkt gegenüberstellte.
Als Punkt zwischen zwei äußeren Polen in gleicher Entfernung ist die Mitte nicht nur eine räumliche Vorstellung, sondern steht auch für das Perfekte und Absolute, so Aristoteles. »Die Extreme sind der Gegensatz zur Mitte und zu einander, und die Mitte ist der Gegensatz zu den Extremen« – tautologisch grenzte Aristoteles die Mitte von den Extremen ab.25 Die Ordnungsvorstellungen der Mitte bezog er auf das individuelle Verhalten und Gemüt, die Welt und die Gemeinschaft. Grundlegende Plausibilität erlangte Mesotes zunächst durch ihren bedeutenden Platz in Aristoteles’ Tugendlehre, der Lehre vom willentlichen Maßhalten zwischen konträren Charaktereigenschaften. Mitte bestimmt das richtige Handeln, so ist Mut eine Tat zwischen Feigheit und Tollkühnheit. Abstand von Völlerei und Askese hält, wer die richtige Diät verfolgt. Aristoteles erörterte die Mesotes-Lehre ausführlich und erläuterte an zahlreichen Beispielen, wie sich die Tugend als Mitte zwischen den Extremen – Übermaß und Mangel – geriert: »Die Tugend aber liegt auf dem Felde der Affekte und Handlungen, wo das Übermaß verfehlt ist und der Mangel Tadel erfährt, die Mitte aber Lob erntet und das Rechte trifft«.26 Aristoteles beließ es nicht bei der sittlichen Lebensführung. Er übertrug es auf viele seiner zahlreichen Interessenfelder, bis es überall mittete. Es mag seltsam anmuten, dass eine Kategorie so omnipräsent ist und alles zu durchwalten scheint. Wenigstens in seinen Beispielen des Maßhaltens müsste Aristoteles doch Recht behalten. Doch auch hier trübt sich das klare Bild, wie gleich zu sehen sein wird.
Aristoteles jedenfalls war vom Ideal der Mesotes überzeugt, nicht nur als konkreter Eigenschaft, sondern als einer regulativen Idee. Mesotes verbindet die Argumente und den aus ihnen zu ziehenden Schluss in der logischen Beweisführung. Auch Wissenschaft und Kunst streben ihm zufolge nach Mitte. Maß und Mitte wurde zur naturphilosophischen Quintessenz. Die Mitte des Lebens sei das schönste Lebensalter: Während der junge Mann – er sprach nur von Männern – zur Unbeherrschtheit neigt, ist der ältere lebensmüde, kränklich und schwach. Der mittlere aber, der in Saft und Kraft Stehende habe sich die Hörner abgestoßen und sei tatkräftig. Und schließlich erklärte Aristoteles die Mitte zum quasi-ethnischen Prinzip zwischen den Völkern. Während demnach die Menschen im Norden mutig sind, aber mangels Kunst und Verstand nicht zur verfassten Herrschaft taugen, stellen Asiaten das andere Extrem dar: Mutlos seien sie und gemacht fürs Regiertwerden. »Doch das Volk der Griechen nun, wie es zwischen diesen Bereichen die Mitte hält, hat auch an beiden Charakterqualitäten Anteil«.27 Wie Aristoteles die Mitte als Prinzip von Gesellschaft und Staat auslegte, wird im entsprechenden Kapitel gesondert erörtert, weil die Folgen dieser Bestimmung bis heute anhalten.
Immer wieder ist die Mitte als zweitbeste Lösung interpretiert wurden, als versöhnliche Geste, weil etwas Besseres von unfertigen Wesen wie den Menschen nicht zu erwarten ist. Eine Gesellschaft könne eben nicht auf die Besten hoffen. Also müsse es die Masse machen, weshalb Demokratie in ihrer antiken Schrumpfform nichts weiter als die realpolitische Resignation vorm Bankrott des Idealstaats sei. Aristoteles hätte widersprochen: Die Mittleren waren für ihn die Virtuosen, keine Masse, die über ein Mittelmaß nicht hinauskäme. Sie vollbringen, was vielen nicht gelingt, ein kleines Ziel zwischen dem Zuviel und Zuwenig zu treffen. Denn Aristoteles zufolge muss man sich permanent in der Tugendhaftigkeit üben. Mitte ist bei Aristoteles kein fauler Kompromiss, sondern gelingende Lebenskunst. Sie ist kein Zustand, sondern Prozess und eine fortwährend zu bewältigende Herausforderung. Tatsächlich bemühte Aristoteles das Bild von Pfeil und Bogen, um seine Theorie zu illustrieren, vielleicht saß er dabei der Deutlichkeit seines gewählten Beispiels auf. Die besten Bogenschützen treffen schließlich die Mitte der Zielscheibe, nicht die äußeren Ringe. Sie können zielen, Windbedingungen und Distanz einberechnen und dann das kleinste Element der Scheibe, deren Zentrum, treffen. Der Faule müsse sich dementsprechend nur besonders befleißigen, der Feige besonders tapfer ins Feld ziehen, dann würden sie ihre Mitte schon finden.
Bei Aristoteles wurde die Mitte zur griffigen Weltformel. Geht man ins Detail, verschwimmt die Klarheit. Selbst bei den einfachen ethischen Beispielen stellen sich Fragen. Wo genau liegt denn Sanftmut als Mitte auf der Zornachse? Wo pendelt sich sie sich ein zwischen Zornlosigkeit und Zornmütigkeit? Aristoteles wusste um das Problem: »Wie weit also und wie man von der Mitte abweichen muß, um dem Tadel zu verfallen, läßt sich nicht leicht mit Worten angeben.«28 Die Mitte ist als Position gar nicht selbst bestimmbar, sondern nur über die Extreme als Maß dazwischen. Diese Vagheit der Mitte ist ihr wesentliches Merkmal. Es darf nicht übersehen werden, dass Aristoteles keine rechnerische Mitte empfahl. So schlicht war sein Bild nicht, auch wenn es in einigen seiner Vergleiche anklingt. Es ging ihm, wie er schrieb, um eine jeweils verhältnismäßige Mitte, also eine relative Position, die je nach Kontext verschieden ist. Hilfreich ist auch diese Feststellung nicht und verbleibt im Alltagswissen: Es ist klug und gut, zwischen Hunger und Völlerei etwas Nahrung zu sich zu nehmen. Über die Qualität dieser Mitte ist damit nichts gesagt. Diese Unklarheit ist theoretisch problematisch, auf funktional-praktischer Ebene ist sie auch als Entschuldigung verstehbar, sollte der Mensch einmal fehlen. Denn die Mitte ist nur allzu menschlich, im Menschen ist die Mitte für Aristoteles wesenhaft verankert – sie ist Ziel seines Seins. Lebenskunst besteht nicht wie später bei den stoischen Denkern des antiken Roms darin, eine pragmatische Haltung à la »übe dich in Zurückhaltung« einzunehmen. Sie stellt vielmehr den inhärenten Zweck des Menschen in der Vollendung seines Seins bzw. seiner Entfaltung zum Vollkommenen dar.
Das Mesotes-Ideal erntete natürlich Kritik, weil es die Frage provozierte, wieso das Individuum nicht danach streben sollte, immer besser zu werden. Warum nicht noch tugendhafter agieren und weshalb steht die Tugend als Extrem gegen die Nichttugend, statt die Mitte einzunehmen? Aristoteles sah das Problem, das er durch die Wesensverankerung umgehen wollte: Mesotes ist das menschliche Maß, Punkt, aus. Gerade seine Beispiele sind es schließlich, die seine Idee der Mitte so überzeugend machen – und als Stützen der Tugendlehre bis heute fortdauern. Die Mitte gedeiht in Aristoteles’ Schriften zum Wert an sich. Natürlich ist es unfair, den Philosophen allein dafür verantwortlich zu machen. Er systematisierte die virulente Idee von Maß und Mitte nur bis ins Extrem und wurde besonders breit rezipiert und diskutiert. Aristoteles’ Philosophie ist daher eine wichtige Quelle für die Orientierung in und an der Mitte.
Weltall, Erde, Mensch: Vom Hier und Jetzt
Das All erhält im Haus eine Mitte, von der aus die Erde erschlossen werden kann.29
Das Ausloten der Mitte, so viel kann bisher festgehalten werden, schafft Ordnung und Orientierung. Wie sie als ein Zuordnungsprinzip fungiert, wird später zu sehen sein, wenn die gesellschaftliche Dimension ins Zentrum rückt. Zunächst soll in den Blick genommen werden, wie zwei grundlegende Kategorien unsere Erfahrung, nämlich Zeit und Raum, sich am Mittebild ausrichteten. Raum und Zeit sind Formen unserer Anschauung, sie sind für unsere Wahrnehmung so unerlässlich, dass sie uns naturgegeben und unverformt erscheinen. Dass wiederum die Mitte bei der Gliederung dieser beiden Größen mitwirkt, ist ein wesentlicher Verstärker für die Mittemotivik insgesamt. Da sie hier als selbstverständlich wahrgenommen und nicht hinterfragt wurde, bot sie sich als Muster für andere Gebiete an und wurde arglos auf sie übertragen. Damit gewann das Motiv der Mitte ein ordentliches Pfund Plausibilität und es wurde zur Ordnungsstifterin schlechthin.
Dreisprung: Aufgespannt in der Zeit
Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, / die sich über die Dinge ziehn.30
Das Jetzt bildet die Mitte zwischen gestern und heute und damit auch die Grundlage unserer Zeiterfahrung. Davon war nicht nur Aristoteles überzeugt, der für seine Zeitanalyse wieder das Mitteprinzip anwendete: Zwischen Vergangenheit und Zukunft residiert die Gegenwart. Dort, wo wir anwesend sind, treffen sich Vergangenheit und Zukunft, also das Endende und das Beginnende. Das scheint logisch, stiftet aber nur als analytisch-abstraktes Schema jenseits der Alltagserfahrung Sinn. Dort erfahren wir uns nicht als auf