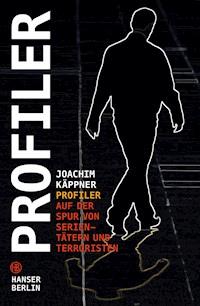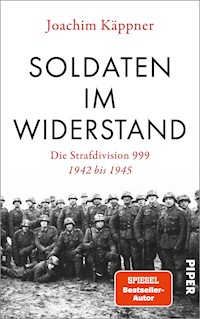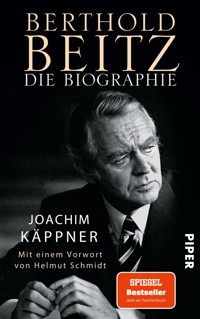13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Revolution der Arbeiter und Soldaten von 1918 war eine historische Chance - dafür, ein demokratisches Deutschland zu schaffen, das stärker gewesen wäre als die Weimarer Republik. In wenigen Tagen erreichen sie, was der Sozialdemokratie in Jahrzehnten nicht gelungen war: die überlebte, autoritäre Ordnung des Kaiserreichs zu stürzen. Es ist die Tragödie der Revolution, dass ihre eigenen Führer sie fürchteten - zu Unrecht. Denn das Ziel der meisten Revolutionäre war nicht, wie es in der Rückschau oft erschien, ein kommunistisches Regime wie in Russland zu errichten. Das Aufbegehren in Deutschland hatte vor allem das Ziel, die alten Eliten der Kaiserzeit zu entmachten, besonders das Militär und die Kriegstreiber von 1914. Für einige wenige Wochen hat die Revolutionsregierung, geführt von der SPD, die Gelegenheit dazu - und nutzt sie nur halbherzig. So bleiben die Todfeinde der deutschen Demokratie mächtig, mit fatalen Folgen für die junge Republik. Joachim Käppner wertet Quellen und neueste Forschungsergebnisse aus und zeichnet ein gerechteres Bild der Arbeiter und Matrosen, die eine Welt aus den Angeln hoben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Dieses Buch ist gewidmet Professor Manfred Messerschmidt, dem Begründer der kritischen Militärwissenschaft in Deutschland – seiner integren Persönlichkeit, seinem Werk und seinen erfolgreichen Bemühungen um eine Rehabilitierung der Opfer der NS-Militärjustiz
ISBN 978-3-492-97791-3
© Piper Verlag GmbH, München 2017
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Covermotiv: Bettmann/Getty Images
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
»Behüt dich Gott, es wär zu schön gewesen«: Einführung
»Dann fahr mal alleine los!«: Oktober 1918 – eine deutsche Revolution
»Geh weg, Schwein, stinkst«: Hochmut und Hybris der Marine
»Der 1. Schuß hat unberechenbare Wirkung«: Der Funke von Wilhelmshaven
»Soldaten, schießt nicht auf Arbeiter!«: Feuer in Kiel
Zwei Revolutionäre: Karl Artelt und Lothar Popp
Tod auf SMS König: Die Revolution und ihre Feinde
Flammen des Aufruhrs: Die Revolution breitet sich aus
Rückblick: Die SPD und das Kaiserreich bis 1918
»Der Dreck des Parlamentsapparats«: Im wilhelminischen Deutschland
Sozialismus, Freiheit, Ohnmacht: Die Welt der Arbeiterbewegung
Götter und Genossen: Das Militär gegen den »inneren Feind«
»Nicht schießen wollen wir auf euch«: Die SPD als Friedenspartei
Burgfrieden, Friedhofsruhe: Im Ersten Weltkrieg
»Das Herz hätte einem springen mögen«: Um die Seele der Partei
»Mich fröstelt, und ich brauche Wärme:« Die Spaltung der Sozialdemokratie
Feindliche Brüder: Friedrich Ebert und Hugo Haase
»Da lehnen sie, die weichen Besen«: Entscheidung in Gotha
»1500 Hände wie zum Schwur«: Die Januarstreiks 1918
Novembersturm: Die Throne wanken
»Männer wie Gespenster«: Die brechende Front
»Bist Du von Gott verlassen?«: Die Bürde der Macht
Fake News 1918: Die Geburt der Dolchstoßlegende
»Die Toten reiten schnell«: Der Sturz des Kaiserreichs
»Die Nacht verlief verhältnismäßig ruhig, abgesehen von kurzen Schießereien«: Die Revolution überrollt das Reich
Freiheit des Andersdenkenden: Die gespaltene Arbeiterbewegung
»Es lebe die deutsche Republik«: Der 9. November 1918
»Ersatzbataillon 48 versagt den Gehorsam«: Generäle ohne Soldaten
»Nicht unter dem Befehl Eurer Majestät«: Die Stunde des Kanzlers
»Scheidemann, komm schnell«: Die Ausrufung der Republik
»Wie eine vom Marder umkreiste Hühnerschar«: Das Dilemma der USPD
Das Gefühl, dass etwas fehlte: Die Regierung der Volksbeauftragten
»Du Hund wirst uns alles verderben«: Machtkampf im Zirkus Busch
»Hierzu hat mich die Revolution autorisiert«: Die sozialistische Einheitsregierung
»Träger des Wehrgedankens«: Das »Bündnis« Ebert-Groener
Unter der roten Fahne: Macht und Ohnmacht der Räte
»Die Magna Charta der Revolution«: Erfolge
»Verfluchte Kontinuität«: Versäumnisse
Und bist du nicht willig: Die Gewalt des Militärs
»Schwarzes Herz auf rotem Grund«: Der erste Putschversuch, 6. Dezember 1918
»Die stehen mit den anderen«: Eine Regierung fürchtet ihre Verteidiger
»15 gut disziplinierte Divisionen«: Zweiter Putschversuch, 10. Dezember
»Dutzende wilde Männer«: Der Reichsrätekongress
»Warum hat man nicht alle Generäle entlassen?«: die »Hamburger Punkte«
»Verhängnisvolle Abstinenz«: Die USPD entleibt sich selbst
Triumph der Generäle: Die MSPD knickt ein
»Ich machte kehrt«: Kontrollversuche
Das Schloss der roten Matrosen: Blutige Weihnachten
»Ein sehr vernünftiger, besonnener Mann«: Die Volksmarinedivision – Porträt einer revolutionären Truppe
»Warum sind wir betrogen?« Die Volksmarinedivision – Schicksal einer revolutionären Truppe
»Wir können hier nicht bleiben«: Die Einheitsregierung zerbricht
»Verliert nicht den Mut, Kinder!«: Frauen in der Revolution
Vom Herd zum Maschinengewehr: Frauenrollen, Rollenbilder
Die Rebellin: Toni Sender
Die Farben der Gewalt: Weißer Terror
Der »Bluthund«: Noske
»Ihr macht euch euren Radikalismus ein bißchen sehr bequem«: Die Gründung der KPD
»Die deutsche Revolution ist tot, der weiße Schnee färbt sich blutrot«: Spartakus
Suppes Kampf: Das letzte Gefecht der Republikaner
»Schlagt alle tot!«: Die Freikorps
»Sie sind tot, gemeuchelt, gemeuchelt«: Der Mord an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht
»Einheit, Freiheit, Vaterland«: Die Nationalversammlung
Scheinriese der Demokratie: Die Weimarer Koalition
Im Frühling blüht der Hass: In den deutschen Bürgerkrieg
»Dann war es ein Traum«: München 1919 – Epitaph einer Revolution
»Es hat nicht sollen sein«: Schluss
Nach 1919: Revolutionäre Lebenswege
Dank
Bildteil
Bibliografie (Auswahl)
Anmerkungen
Abbildungsverzeichnis
Mit welcher Wollust wühlten und schaufelten Soldaten oben in den Kleidern und Gerätekammern. Mit welchem Erlösungsgefühl schütteten sie die Sachen herab. Da flogen die Schaufeln, gedacht für die Schützengräben und ihnen selbst das Grab zu öffnen. Mit diesen Mänteln sollten die neuen Regimenter eingekleidet werden. In ihnen sollten sie zerschossen werden. Tod, Blut, Kanonenkrachen aus allen Stücken. Sie schleuderten sie weit weg, herunter auf die gierigen Zivilisten. Da war es gut aufgehoben. Von da würde es nie wieder kommen.
Alfred Döblin, November 1918 (verfasst 1937 – 1943)
»Behüt dich Gott, es wär zu schön gewesen«: Einführung
Die deutsche Revolution lag kaum ein Jahr zurück, da schrieb ihr Kurt Tucholsky 1919 schon eine Grabrede:
Behüt dich Gott, es wär zu schön gewesen,
behüt dich Gott, es hat nicht sollen sein (…)
Wir dachten schon: Jetzt gilts den Offizieren!
Wir dachten schon: Hier wird nun ernst gemacht.
Wir dachten schon: Man wird sich nicht genieren,
… das Feuer brennt einmal … es ist entfacht …
Wir dachten schon: Nun kommt der Eisenbesen …
Doch weicht der Deutsche sich die Hosen ein.
Behüt dich Gott, es wär zu schön gewesen,
behüt dich Gott, es hat nicht sollen sein![1]
Behüt dich Gott: Tucholskys Text aus der Weltbühne rührt noch heute an, ein Jahrhundert später. Eine tiefe Trauer spricht daraus, Trauer um eine verlorene Möglichkeit, um eine einmalige, verpasste Chance. Dabei hatte die Revolution zu diesem Zeitpunkt eigentlich Gewaltiges erreicht: den Sturz des Kaiserreichs und seiner gestrigen Ordnung, eine Nationalversammlung, welche die erste deutsche Demokratie aus der Taufe hob; ein modernes Wahlrecht, die fortschrittlichste Verfassung und die tiefgreifendsten Sozialgesetze, die es in Deutschland je gab. Und doch. Der Schriftsteller spürte mit wachem Geist, wie labil diese neue Demokratie sein würde, wie mächtig die alten Gewalten noch waren. Wir dachten schon, es galt den Offizieren? Aber sie waren immer noch da, ebenso wie die Juristen und Verwaltungsbeamten des alten Obrigkeitsstaates, die Industrieführer und rechten Zeitungszaren und die vielen anderen, die der jungen Republik von Beginn an nach dem Leben trachteten. Nur wenige Jahre später, 1933, war die deutsche Freiheit tot.
»Was auf Weimar folgte, war so schrecklich, daß wir das Scheitern der ersten Republik zu den großen Katastrophen der Weltgeschichte rechnen müssen«, schrieb der Berliner Historiker Heinrich August Winkler 1991 in seinem glänzenden Buch Weimar 1918 – 1933. Geschichte der ersten deutschen Demokratie, und wer sich mit diesem Scheitern befasse, leiste »damit notwendigerweise immer auch Trauerarbeit«.[2] Die Revolution von 1918, die nach Weimar führte, blieb unvollendet, widersprüchlich, zwiespältig. Sie fegte das wilhelminische Kaiserreich beiseite, ließ seine Institutionen aber bestehen; sie stützte sich in ihren Anfängen auf Hunderttausende bewaffnete Soldaten und fand schon zwei Monate später kaum noch Freiwillige, welche die Regierung bewachen mochten; sie begann mit der Verheißung einer neuen Ära und Ordnung und endete mit den Massakern, verübt von rechtsradikalen Freikorps, in einem jahrelangen, zähen, immer wieder aufflackernden Bürgerkrieg.
Der Anfang der deutschen Republik liegt im Schatten ihres Untergangs. Inkonsequenz, Zögern und Schwäche scheinen für viele das Kennzeichen der Revolution wie der aus ihr hervorgegangenen Demokratie zu sein; und so hat diese Revolution vergleichsweise wenig Spuren im kollektiven Gedächtnis hinterlassen, außer Momentaufnahmen wie der Ausrufung der deutschen Republik durch den Sozialdemokraten Philipp Scheidemann am 9. November 1918 und das grässliche Ende der linken Revolutionäre Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht wenige Wochen später.
In anderen demokratischen Staaten wäre der Sturz der alten Throne der Stoff, aus dem die Mythen der eigenen Gründungsgeschichte gewebt werden: Männer und Frauen, die sich der Ungerechtigkeit entgegenstellen, ihr Leben riskieren, um eine bessere Welt zu schaffen. Der Sturm auf die Bastille und die Französische Revolution 1789 sind ein Beispiel dafür, so wie der Unabhängigkeitskrieg der USA 1775 bis 1783, der Aufstand Simon Bolivars gegen die spanischen Kolonialherren in Südamerika ab 1810; der Sieg der Nordstaaten gegen die Sklavenhalter im amerikanischen Bürgerkrieg 1861 bis 1865. In der Überlieferung leben diese Geschehnisse fort, Denkmäler erinnern an sie; und selbst wer sich für Details der Geschichte wenig interessiert, kann mit den Namen der Helden von damals etwas anfangen und versteht, wofür sie standen und was sie mit der eigenen Gegenwart verbindet.
Aber es gibt keine vergleichbare Erzählung über den erstaunlichen Triumph der ersten Novembertage 1918, als die Freiheit plötzlich zu siegen schien in Deutschland. Bestenfalls erzeugt der Name des linken Sozialdemokraten und Kriegsgegners Hugo Haase, eine der ehrenhaftesten Gestalten des Umsturzes vom November 1918, noch ein fernes Echo. Kaum jemand erinnert sich noch an Richard Müller, der 1918 die Galionsfigur der revolutionären Industriearbeiter war; als 2008 eine erste Biografie, von Ralf Hoffrogge, über Richard Müller erschien, diesen »Sisyphos der Revolution«, schrieb der Extremismusforscher Wolfgang Wippermann voll Grimm im Vorwort: »Was ist das für ein Volk, das seine Revolutionäre nicht kennt!«[3]
Eigentlich ist die deutsche Geschichte an Freiheitsbewegungen nicht arm: Da sind die aufständischen Bauern 1525, die Kämpfe der Städte gegen feudale Mächte, die Erhebungen gegen Napoleon in den Freiheitskriegen, die Göttinger Sieben als Gegner erstickender Repression nach 1815; da ist der Hessische Landbote von 1834 mit seiner berühmten Parole »Friede den Hütten! Krieg den Palästen!« Und da ist natürlich die große Revolution von 1848 mit dem Rufen nach Einheit und Freiheit. Und als ihre letzte Bastion, die Festung Rastatt in Baden, gefallen war und ihre Kämpfer von Preußens Exekutionskommandos füsiliert oder auf der Flucht waren, da dichtete Ludwig Pfau das Badische Wiegenlied:
Schlaf, mein Kind, schlaf leis,
dort draußen geht der Preuß!
Der Preuß hat eine blutige Hand,
die streckt er übers badische Land,
und alle müssen wir stille sein,
so wie dein Vater unterm Stein.
…
Schlaf, mein Kind, schlaf leis,
dort draußen geht der Preuß!
Gott aber weiß, wie lang er geht,
bis dass die Freiheit aufersteht,
und wo dein Vater liegt, mein Schatz,
da hat noch mancher Preuße Platz!
Von da an freilich beginnt eine Entwicklung, die oft als der deutsche Sonderweg bezeichnet wird: Der Vater, der da unterm Stein liegt, Opfer preußischer Kugeln, hat im Zweifel für die nationale Einheit in Freiheit gekämpft. Doch die Freiheit erstand leider nicht mehr auf, und die Einheit der deutschen Lande war von nun an ein obrigkeitsstaatliches Projekt, das sich mit der Reichsgründung von 1871 vollzog. Die Revolution von 1918 war die historische Chance, diesen Webfehler des Deutschen Reiches zu korrigieren. Einmal, aber nur dieses eine Mal und in einem sich schnell schließenden Zeitfenster weniger Wochen, bot sich die Gelegenheit, die Geschichte zu wenden und zu vollenden, was die Barrikadenkämpfer von 1848 nicht vollbracht hatten: den Sturz des Obrigkeitsstaates, des Militarismus, des eifernden Nationalismus, die Errichtung der deutschen Demokratie. Sie wurde nicht stark genug, um nicht auch zu scheitern, so wie alle Versuche zuvor, die deutsche Freiheit zu erkämpfen. Deswegen sind die deutschen Freiheitsbewegungen noch heute ein Stiefkind der Geschichtswissenschaft und Publizistik, auch wenn sich das langsam ändert.
Die Hoffnungen und Möglichkeiten der deutschen Revolution 1918/19 sind Thema dieses Buchs, und damit naturgemäß auch die Gründe, warum die Hoffnungen enttäuscht und die Möglichkeiten verpasst wurden, eine stärkere Republik zu schaffen als jene von Weimar. Im Mittelpunkt stehen die entscheidenden Wochen zwischen dem 9. November 1918 und den Wahlen zur Nationalversammlung am 19. Januar 1919, diesem Scheinsieg der Demokratie, es endet mit dem Untergang der zweiten Münchner Räterepublik im Mai 1919, dem utopischsten Experiment dieser Revolution. Was danach kommt, ist keine Revolution mehr, sondern ein langer, sich noch über Jahre ziehender Bürgerkrieg.
Es ist dies, vor allem, ein Buch über Soldaten – Soldaten, die sich für die Freiheit erheben, ihren Offizieren die Degen wegreißen und Schluss machen wollen mit der Herrschaft der Generäle. Es will daher versuchen, dem Leser diese Männer, ihre Lebenswege, ihre Motive und ihr Handeln, intensiver vor Augen zu führen, als das bisher in einer Gesamtdarstellung der Fall war. Und über ihre Gegenspieler, eben die hohen Offiziere, die Oberste Heeresleitung und mehr und mehr auch die revolutionäre Regierung der Volksbeauftragten selbst. Dominiert von der SPD, die damals MSPD hieß, verbündete sich diese von Friedrich Ebert geführte Regierung ausgerechnet mit dem alten Militär. Die Radikalisierung der Revolution bis zu den »Weihnachtskämpfen« um das Berliner Stadtschloss 1918 ist vor allem eine Folge des Bündnisses der MSPD mit den Generälen, ihren Erzfeinden von gestern, das aus Angst vor den Linksradikalen geschmiedet wurde; doch war diese Angst größer als die tatsächliche Bedrohung.
Das Buch versteht sich in aller Bescheidenheit als Beitrag zur Ehrenrettung der Revolutionäre und will diese daher genauer in Augenschein nehmen, etwa die »Volksmarinedivision«, die zum Schutz der Regierung gegründet wurde und auf die diese Regierung dann am Heiligabend mit schwerer Artillerie schießen ließ. Einer ihrer Unterhändler brachte seine Verwirrung darüber auf den Punkt, als er Regierungschef Friedrich Ebert, den Vorsitzenden des Rates der Volksbeauftragten, schlicht fragte: »Warum sind wir betrogen?«
Diese Revolutionäre waren überwiegend die eigenen Leute der Sozialdemokratie, sie hatten »Einigkeit« gefordert und standen auf dem Boden des Regierungsbündnisses aus MSPD und deren linkerer Abspaltung, den Unabhängigen. Erst als das Bündnis kurz nach Weihnachten 1918 zerbricht an der Gretchenfrage dieser Revolution – wie hältst Du’s mit dem Militär? –, beginnt eine Spirale der Radikalisierung. Und die Gräuel, die sich fortan auf deutschen Straßen abspielen, fügen sich ein in jene Geschichten eines beginnenden Zeitalters überbordender, exzessiver Gewalt in Europa als Mittel der innenpolitischen Auseinandersetzung.[4]
Sehr lange Zeit war die deutsche Revolution ein ungeliebtes Stiefkind der Geschichtsschreibung, teilweise ist sie es bis heute. Fast ein halbes Jahrhundert später schrieb der Hamburger Historiker Fritz Fischer, der in seinem so berühmten, viel diskutierten Buch Griff nach der Weltmacht 1961 die massive Mitschuld der deutschen Führung an der Entfesselung des Ersten Weltkriegs nachwies: »Kein anderes Ereignis deutscher Geschichte wurde bis heute so wenig beachtet wie die November-Revolution von 1918/19 – obgleich der Zusammenbruch der Monarchie und die Entstehung einer bürgerlichen Republik ohne Zweifel zu den entscheidenden und prägenden Ereignissen deutscher Vergangenheit zählen.«[5]
Die Sozialdemokraten unter ihrer einflussreichsten Persönlichkeit, Friedrich Ebert als Vorsitzendem des Rates der Volksbeauftragten, der Revolutionsregierung, und die Generäle sind die wichtigsten Handelnden in dieser Revolution. Am Militär entzündete sich Ende Oktober 1918 der Aufstand der Matrosen und Soldaten, doch als die Revolution vorüberging, da war das Militär immer noch da, in neuer, noch brutalerer Form, und schmiedete bereits die Sargnägel der Republik, der es dienen sollte. Jahrzehnte ist darüber gestritten worden, wie so etwas möglich sein konnte. Viele Jahrgänge von Studenten der Geschichte, auch der Autor dieses Buchs, sind durch den Gebhardt – Handbuch der deutschen Geschichte zur Weimarer Republik zunächst mit einer Deutung konfrontiert worden, die für konservativere Historiker den Rang eines Glaubensbekenntnisses besaß. Ihr zufolge war die Demokratie nach dem Sturz des Kaiserreichs in ihrer »Geburtsstunde von links her, nicht von rechts mit Gewalt in seiner Existenz bedroht«. Angesichts der kommunistischen Bedrohung Deutschlands habe die SPD nach der Revolution vom 9. November 1918 die Qual der Wahl gehabt: »die sozialistische Revolution im Bündnis mit denen auf eine proletarische Diktatur hindrängenden Kräften oder die parlamentarische Republik im Bündnis mit den konservativen Kräften wie dem alten Offizierskorps«.[6] Autor des Gebhardt-Bandes über Weimar war Karl-Dietrich Erdmann, einer der bekanntesten und einflussreichsten Geschichtsprofessoren der frühen Bundesrepublik. Ob, und wenn ja, wie es Erdmann, Jahrgang 1910, mit den Nazis gehalten hatte, ist bis heute umstritten. Nach dem Krieg war er längere Zeit Vorsitzender des Historikerverbandes, CDU-Mitglied und Gegner der Brandt’schen Ostpolitik. Dies ist hier nur erwähnt, weil das von ihm verfasste Handbuch die Konflikte des Kalten Krieges so überdeutlich widerspiegelte. Viele Historiker wie Hagen Schulze folgten dieser Interpretation.
Das Handbuch wurde erst 2001 neu geschrieben – so lange wirkte Erdmanns Interpretation aus der Ära Adenauer noch nach. Widerlegt wurde sie freilich bereits in den sechziger Jahren, etwa von Susanne Miller. Die große Historikerin der deutschen Arbeiterbewegung bemängelte eine »Beschwörung der abschreckenden bolschewistischen Kontrastfigur«, die »von vornherein die Frage nach den realen Chancen eines dritten Weges ausklammert und als gar nicht ernsthaft diskussionswürdig hinstellt«.[7]
In der DDR erfuhr die Novemberrevolution naturgemäß eine andere Bewertung. Hier fand sie durchaus die Aufmerksamkeit der Forschung, es erschienen zahlreiche Werke, die meisten allerdings mit grob verzeichnender Tendenz. Der Staatsratsvorsitzende Walter Ulbricht mahnte die eigenen Historiker früh bereits drohend, sich lieber nicht zu sehr für die Arbeiterräte und meuternden Matrosen von damals zu begeistern: »Wer die Novemberrevolution als eine sozialistische charakterisiert, negiert dabei bewußt oder unbewußt die Rolle der Partei.« Eine schlimmere Sünde war für ostdeutsche Historiker lange Zeit unvorstellbar, aber die Kommunistische Partei oder ihr Vorgänger, der Spartakusbund, waren eben meilenweit davon entfernt gewesen, diese Revolution geführt zu haben. So sind es ausgerechnet die linken Sozialisten, die Gewerkschaftszellen, die Räte der Arbeiter und Soldaten, denen die Geschichtswissenschaft der DDR oftmals mit Misstrauen, Abstand, nachträglichem Rufmord oder plumpen Versuchungen der Vereinnahmung begegnete. In gewisser Weise ergab sich ein trauriges Paradox: Sowohl die bürgerlich-konservative Geschichtsschreibung als auch die orthodox-marxistische betrachteten die Revolution von 1918 als Fremdkörper, als Ereignis ohne Potenzial zu einem dritten Weg.
Diesen hat eine kritische Gegenbewegung in der Bundesrepublik aber schon seit den sechziger Jahren erforscht. Jüngere Historiker wie Eberhard Kolb machten deutlich, »daß der Novemberumsturz nicht das Werk von ›Berufsrevolutionären‹« und schon gar nicht Ergebnis »einer Fernsteuerung aus dem bolschewistischen Rußland« war.[8] Gerade die spontan entstandenen Räte der Arbeiter und Soldaten gerieten ins Spektrum der Forschung – und wurden zeitbedingt gelegentlich verklärt als Beginn einer basisdemokratischen Systemalternative. Die SPD hingegen, welche diese Räte zu zähmen und für ihre Zwecke eines geordneten Übergangs zur Demokratie zu nutzen versucht hatte, wurde immer negativer betrachtet.
Aufs Äußerste zugespitzt hat diese Kritik an der Sozialdemokratie der große deutsche Publizist Sebastian Haffner. Der Verrat (so der ursprüngliche Titel) von 1969 ist das eindrucksvollste der über die Fachwelt hinaus verbreiteten Bücher über die Novemberrevolution und zugleich eine schneidende Abrechnung mit der SPD: »Die deutsche Revolution war eine sozialdemokratische Revolution, die von den sozialdemokratischen Führern niedergeschlagen wurde; ein Vorgang, der in der Weltgeschichte kaum seinesgleichen hat.« Dieses Buch ist ein cri de cœur, eine Totenklage auf alles, was in Deutschland hätte sein können und niemals sein durfte: Hätte die Ebert-SPD die Massenbewegung genutzt, statt sie zu fürchten, das alte Militär zum Teufel gejagt, statt sich mit ihm zu verbünden, wäre die Republik 1933 wahrscheinlich nicht untergegangen oder wenigstens nicht den Nazis in die Hände gefallen – so der Gedankengang Haffners, und seiner Logik kann man sich schwerlich verschließen.
Anders sieht es mit den Motiven derer aus, die Haffner als die Täter erschienen, allen voran von Ebert, an dem er kein gutes Haar ließ: »Ebert hat der Revolution gegenüber nie ein schlechtes Gewissen gehabt, weil er sie verriet.« Verrat eben, Verstellung, Doppelspiel, sogar Mord: So sah Haffner die führenden Mehrheitssozialdemokraten von 1918 und 1919. Zehn Jahre später, 1979, hat er im Nachwort der Neuauflage selbstkritisch bemerkt: »Ich würde es heute anders schreiben: ruhiger, skeptischer, kälter. Es ist mir, für meinen heutigen Geschmack, zu viel Entrüstung darin.«[9] Er hat die handelnden Personen nach den Ergebnissen ihrer Politik beurteilt, und diese Ergebnisse waren eine schwere, zu schwere Bürde für die Weimarer Republik. Er hat aber nicht, wie es Historiker tun, nach den Motiven jenseits der Revolutionsfurcht gefragt, nach den Handlungsspielräumen der »Akteure«, wie man heute sagt, nach ihrem Wissen und ihren Vorstellungen. So spielt der ungeheure äußere Druck, den die Siegermächte auf die deutsche Revolutionsregierung ausübten, in dem Buch kaum eine Rolle; ohne die Last des soeben verlorenen Krieges lassen sich aber viele Entscheidungen der SPD-Führung nicht richtig verstehen.
Inzwischen ist der Blick, auch durch zahlreiche Einzel- und Regionalstudien, sehr viel breiter und unbefangener geworden – und auch gnädiger, was die Rolle der Sozialdemokraten betrifft. Unbestreitbar aber bleibt, dass sie im Bestreben, das Reich 1918/19 nicht in Chaos, Not und Bürgerkrieg entgleiten zu lassen, einen zu hohen Preis zahlten. In der Verwaltung, der Wirtschaftsordnung und vor allem dem Militär führte, so der Freiburger Historiker Ulrich Herbert, »der Primat der Kontinuität dazu, dass selbst scharfe Gegner von Demokratie und Arbeiterschaft in Amt und Würden blieben«. Die Folgen waren die fortgesetzte Spaltung der Arbeiterbewegung und eine schwere Erblast für die junge Republik, deren Erzfeinde weiterhin an Schlüsselpositionen der Macht blieben.
Noch immer ist das Wissen über die deutsche Revolution 1918 – und damit über die einmalige Gelegenheit, der deutschen Geschichte eine völlig andere Wendung zu geben – außerhalb der engeren Fachzunft erstaunlich gering, trotz des neu erwachten Interesses an der Geschichte des Ersten Weltkriegs, das sich am 100. Jahrestag seines Beginns und den kontroversen Debatten um das Werk Die Schlafwandler von Christopher Clark festmachen lässt. In Herfried Münklers Bestseller Der große Krieg spielt die Revolution wie in so vielen älteren Darstellungen nur eine Nebenrolle. Der Hamburger Historiker Axel Schildt spricht von »ihrer nahezu allseitigen posthumen Unbeliebtheit, die sich auf das Ergebnis der Revolution, die Weimarer Republik, umstandslos übertrug und durch deren Ende hinreichend begründet erschien«.[10] Es ist eine Geschichte ohne rechtes Happy End, ohne wirklichen Sieger, aber mit vielen Verlierern, allen voran der deutschen Demokratie.
Nach der Wiedervereinigung 1990 sank das Interesse an der Revolution von 1918 zeitweilig »auf den völligen Nullpunkt«,[11] erst ab 2008 sind zarte Neuansätze zu finden. In den vergangenen Jahren aber hat sich ein gewisses Revival des Interesses an der deutschen Revolution gezeigt. Als jüngere Werke von Gewicht sind unter anderem der kurze Band Die Revolution von 1918/19 zu nennen, verfasst 2009 von dem Hamburger Journalisten und Historiker Volker Ullrich, sowie die großartige, leider an entlegenem Ort erschienene Biografie des linken Sozialdemokraten Hugo Haase von Ernst-Albert Seils von 2016. Mit dem Thema selbst sind aber auch alte politische Kontroversen wieder erwacht. Ein teilweise heftiges Ressentiment gegen die SPD-Führung, besonders gegen Friedrich Ebert, bestimmt erneut nicht wenige, auch durchaus verdienstvolle Werke; umgekehrt sind manche Versuche, Eberts Handeln zu verteidigen, noch immer von längst überwunden geglaubten Vorurteilen gegen seine linken Kontrahenten von damals geprägt. Mitunter verrät all dies noch immer mehr über die Konflikte der Gegenwart als über die Geschichte der Revolution, zumindest aber würde eine weitere Historisierung der Debatte guttun.[12]
Dieses Buch möchte den Versuch dazu wagen. Es will die Geschichte der Revolution vom Anfang her erzählen, unvermeidlich natürlich im Wissen um das Ende des demokratischen Versuchs 1933, aber nicht aus der Perspektive dieses späteren Scheiterns. Es will zeigen, welche Spielräume sich den Handelnden boten und welche Motive sie trieben, und damit auch, ob dieses Scheitern unvermeidlich war. Geschichte ist immer ein offener Prozess, viele Entscheidungen darin sind jedoch niemals mehr umkehrbar. Der Schriftsteller Alfred Döblin hat dies 1931 klarsichtig beschrieben: »Wenn sie 1918 gewußt hätten, was sie unternehmen, würden die Deutschen damals die notwendigen Maßnahmen getroffen haben, ihre Demokratie zu sichern. Alle, die seither Zeit gehabt haben, die Republik zu unterhöhlen, wären gleich damals ein für allemal verhindert worden zu schaden. Stattdessen hat die deutsche Demokratie sich einfach eingerichtet, als gebe es im ganzen Lande niemand mehr, der nicht den Stimmzettel anerkannte. … Die deutsche Demokratie war sogar noch stolz auf ihre Gewaltlosigkeit. Bis heute hat sie die Anwendung von Gewalt ihren Feinden überlassen, die von der gütigen Erlaubnis bestens Gebrauch machen.«[13]
Die Revolution 1918 ist ein Meilenstein in der verkannten und vernachlässigten Geschichte der deutschen Freiheitsbewegungen. Dieses Buch möchte helfen, Verständnis für diese historische Errungenschaft zu wecken. In dem leider wenig besuchten Pantheon dieser Freiheitsbewegungen gehört der Revolution von 1918/19 und jenen, die sie wagten, für immer ein besonderer Platz.
»Dann fahr mal alleine los!«: Oktober 1918 – eine deutsche Revolution
»Geh weg, Schwein, stinkst«: Hochmut und Hybris der Marine
Kapitän zur See Karl Windmüller schaut in mürrische, abweisende Gesichter. In wenigen sieht er Zustimmung, in manchen blanken Hass. Die meisten Zuhörer warten ab. Weit draußen, verborgen im Nebel eines stürmischen Herbsttages, liegt Wilhelmshaven, einer der großen Kriegshäfen des Kaiserreichs. Die Männer an Bord sind wütend, sie haben genug vom Krieg. Der Kapitän jedoch hat die Mannschaften des Schlachtschiffs Thüringen versammelt und hält eine Ansprache, die er selber wohl als heroisch betrachtet. Er will mit seinen Männern und der Hochseeflotte auslaufen, dem Feind entgegen, zu einem letzten großen Gefecht in einem längst verlorenen Krieg, einer Nibelungenschlacht auf See. Es ist der 29. Oktober 1918.
Die Seekriegsleitung des Deutschen Reiches hat beschlossen, den verlorenen Krieg auf eigene Faust fortzusetzen und die Friedensbemühungen der neuen überparteilichen Regierung in Berlin unter Reichskanzler Max von Baden zu ignorieren. Es ist eine Art kollektives Selbstmordattentat. Dies sei, so hat Adolf von Trotha, der Chef des Marinekabinetts, soeben seinem Stabschef geschrieben, ein »Einsatz, um mit Ehren unterzugehen«. Deswegen ruft Windmüller nun auf dem Deck der Besatzung zu: »Wir verfeuern unsere letzten 2000 Schuß und wollen mit wehender Flagge untergehen!«[1]
Der hallende Aufruf zeigt Wirkung. Freilich ist es nicht die, welche sich der Kapitän erhofft hat, kein Jubel, kein dreifaches Hurra. Die Männer murren und fluchen. Und einer, lauter als die Kameraden, ruft seinem Kommandanten zu: »Dann fahr mal alleine los!«
Der Kapitän hat das Schiff nicht mehr unter Kontrolle, die Mannschaften sind außer sich. Ein junger Marinesoldat schreibt in diesen letzten Kriegstagen an seine Familie: »Beunruhigt Euch nun nicht, wenn’s auch etwas drüber und drunter geht. Totschießen lassen wir uns nicht mehr die letzten Tage.« Derselbe Soldat war auf dem Torpedoboot B 97 auf Aufklärungsfahrt in der Nordsee gewesen, und nun, vor der Einfahrt nach Wilhelmshaven, liegt vor dem Hafen ein Großteil der deutschen Hochseeflotte vor Anker; Schlachtschiffe, Panzerkreuzer, Torpedoboote. Es muss etwas Großes im Gange sein: »Plötzlich hieß es, der Flottenchef will in der Deutschen Bucht Flottenmanöver machen. Auf den plumpen Blödsinn fiel natürlich keiner herein. Man bedenke aber auch diesen Unsinn …« Für viele Seeleute ist der Kaiser inzwischen eine Lachnummer und das Offizierskorps ein Haufen von Bürgersöhnen, die sich für den neuen Adel halten, verhasste Leuteschinder, welche die Nase aber sehr hoch am Wind tragen, und warum eigentlich?
Die Royal Navy blockiert seit 1914 den Weg hinaus aus der Deutschen Bucht. Ein einziges Mal nur ist die kaiserliche Hochseeflotte ausgelaufen, 1916 bis zum Skagerrak. Vor Dänemark entbrennt das größte Seegefecht, das die Welt bis dahin gesehen hat. Die Reichsmarine erreicht zwar einen taktischen Sieg – die Verluste der Briten betragen 14 versenkte Schiffe und 6094 Tote, die Deutschen verlieren elf Kriegsschiffe und 2551 Mann. Strategisch sind die Briten dennoch die Sieger: Das große Morden auf dem Meer vor Jütland hat nämlich nichts an der Ausgangslage geändert. Die Deutschen bleiben im nassen Dreieck gefangen, sie können zumindest im Westen nicht ins Kriegsgeschehen eingreifen und die alliierte Seeblockade nicht brechen, Britannia rule the waves. Und die Marineführung wagt keinen zweiten Ausbruchsversuch mehr, sie versucht es mit dem unbegrenzten U-Boot-Krieg. Die schwimmenden Festungen aber, die Schlachtschiffe, die Deutschlands »Platz an der Sonne« erkämpfen sollten, liegen jetzt im herbstlichen Nieselregen in den Häfen wie gestrandete Wale. Und sehr viele Offiziere, die verhinderten Helden, erregen mehr und mehr den Hass ihrer Matrosen.
In den Hafenstädten sind die Lebensmittel knapp, aber aus den Kasinos der Offiziere erklingt noch im Oktober 1918 fast jeden Abend die Musik fröhlicher Feste und Trinkvergnügungen heraus. Ein Universitätsprofessor beobachtet missmutig: »In den Krankenhäusern gab es keinen Wein mehr für Kranke und Verwundete, aber jeder Marineoffizier bekam noch regelmäßig alle Monate zwanzig Flaschen Wein und den üblichen Rum geliefert.«[2] Der Matrose Carl Richard Linke hat schon 1917 »starke Erbitterung an Bord« festgestellt, und zwar »über die ungerechte Lebensmittelverteilung. Während es für die Mannschaft sehr wenig Brot, fast kein Fett, aber um so mehr Steckrüben gab, bemühten sich unsere Offiziere zu keinerlei Einschränkung.«[3]
Selbst der spätere Schriftsteller Joachim Ringelnatz, der als Marineleutnant in Cuxhaven einen leicht amüsierten Blick auf den Stand und das Gebaren der Offiziere wirft, wird den Verlust seiner Privilegien während der Revolution als Zumutung empfinden: »Wir geldlosen Offiziere, also besonders die jüngeren Leutnants, waren natürlich übel dran. Wir bekamen nur Mannschaftskost, und auf manchen Schiffen mußten die Leutnants mittags mit dem Eßnapf zwischen den Leuten an der Kombüse anstehen.«[4] Wenn ein Artillerieoffizier auf der SMSHelgoland den Matrosen Richard Stumpf mit »Geh weg, Schwein, stinkst« anspricht, spürt dieser hilflose Wut aufsteigen, aber überrascht ist er nicht: »Während meiner Dienstzeit war noch niemals die Kluft zwischen der Messe und dem Back, dem Mann und dem Offizier, so groß wie gerade jetzt während der Kriegszeit.«[5] Stumpf wird einige Jahre später Mitglied eines Untersuchungsausschusses über die Zustände in der kaiserlichen Marine sein und 1927 das viel gelesene Buch Warum die Flotte zerbrach veröffentlichen; seine Hinterlassenschaft einschließlich der Tagebücher gehören zu den erstaunlich wenigen Selbstzeugnissen von Matrosen und Mannschaften über die Revolution und ihre Vorgeschichte.[6]
Die Mannschaften dagegen hausen in engen Kajüten voller Stockbetten und müssen parieren vor 20-jährigen Jungoffizieren, die ihre Unsicherheit und Unerfahrenheit durch Arroganz und Willkür zu kompensieren versuchen. Richard Stumpf, an sich kein revolutionärer Geist, hasst diese »kaum beförderten Leutnants und Fähnriche, welche sich wichtig machen wollen, indem sie die Leute unnötig schikanieren«; die Führung der untätigen Hochseeflotte, welche »die besten und intelligentesten Offiziere« an die U-Boot-Flotte abgeben muss, will ihm erscheinen wie eine »Abfallsammelstelle«.
Aber jetzt soll Schluss sein mit dem Unsinn, mit dem Krieg, auf jeden Fall mit dem Plan vom kollektiven Untergang, den die Seekriegsleitung ausgeheckt hat. Noch Wochen zuvor undenkbar, diskutieren Trauben von Männern auf Deck den Befehl zum Auslaufen, statt ihn zu befolgen. Wenn die Offiziere so gern sterben wollen – deren Sache. Abschiedsbriefe der Offiziere auf der SMS Markgraf machten es, so ein zeitgenössischer Bericht, »der Besatzung zur Gewißheit, daß das Seeoffizierkorps Politik auf eigene Faust machen und die deutsche Flotte in einem letzten wahnsinnigen Verzweiflungskampf aufs Spiel setzen wollte«[7].
In den Händen halten die Matrosen heimlich gedruckte Flugblätter: »Schmeißt die Arbeit nieder! Wir wollen Frieden oder nicht? Nieder mit dem Krieg!«[8] Viele Besatzungsmitglieder unternehmen erst mal gar nichts, eine Art Streik. Als es Nacht wird demonstrieren sie auf mehreren Schiffen gegen die befohlene Fahrt. Niemand glaubt an die Lüge, es gehe doch nur um »ein Gefechtsbild mit Evolutionieren« Richtung Helgoland, also eine Übungsfahrt. Größere Gruppen beschließen Aktionen, sie würden die Löschanlagen anwerfen und so das Feuer in den Kesseln löschen, ihre Gefechtsstationen nicht einnehmen, sich wehren. Dutzende verlassen ihr Schiff einfach, verstecken sich in der Stadt oder finden Unterschlupf bei den Hafenarbeitern, wo die Stimmung nicht besser ist. Auf der SMS Derfflinger fehlen am Morgen des 30. Oktober gut hundert Mann. Die Kapitäne lassen sie durch die Militärpolizei suchen.
»Der 1. Schuß hat unberechenbare Wirkung«: Der Funke von Wilhelmshaven
Das Linienschiff Thüringen ist eine schwimmende Festung. 167 Meter lang, mehr als 1100 Mann Besatzung, gepanzert mit dickem Stahl. Seine Hauptwaffe sind zwölf Geschütze vom massiven Kaliber 30,5 cm, angeordnet in vier Panzertürmen. Über tausend Granaten liegen bereit, um Tod und Verderben auszuspucken, so wie 1916 in der Seeschlacht am Skagerrak, als die Thüringen den britischen Panzerkreuzer HMS Black Prince beschoss, bis er in einem Feuerball verging und sank, mit allen 857 Mann Besatzung, keine Überlebenden. Aber jetzt sieht der aufgebrachte Kapitän den Feind nicht draußen auf See. Er sieht ihn in den eigenen Leuten.
Am 30. Oktober sollen die Kriegsschiffe auslaufen, zu ihrem letzten Gefecht. Über der Nordsee liegt dichter Nebel, die Wellen schlagen hoch. Aber das Wetter ist jetzt nicht mehr das Hauptproblem der Marineleitung. Schon am Vorabend sind bei den Verbandschefs die ersten Mitteilungen eingelaufen: Immer mehr Soldaten verweigern den Gehorsam. Die Mannschaft der Thüringen macht ganz offen nicht mehr mit. Sie hat eine Erklärung verfasst, in der es heißt: »Greift uns der Engländer an, so stehen wir unseren Mann. Aber wir selbst greifen nicht an. Weiter als bis Helgoland fahren wir nicht. Andernfalls wird Feuer ausgemacht«[9] – das Feuer in den Kesseln. Und die Thüringen ist nicht allein, ähnlich geht es auf der Helgoland zu; der Chef des I. Geschwaders meldet »ernste Unruhen« auf seinen Schiffen.[10]
Die Flottenleitung beschließt, es mit der harten Methode zu versuchen und lässt am 31. Oktober das Torpedoboot B 97 direkt vor den Stahlkoloss auffahren. Der Flottenchef, Admiral Franz Ritter von Hipper, erinnert sich später: »Die Kerle wurden darauf aufmerksam gemacht, dass das Schiff torpediert werden würde, wenn sie nicht herauskämen.«[11] Der Soldat, der bald danach in seinem Brief an die Eltern den dramatischen Tag schildern wird, muss mit der gesamten Mannschaft im Wohndeck von B 97 antreten, wo der Kommandeur des I. Geschwaders eintrifft und die Lage schildert; sie ist finster, aus seiner Sicht. Die Kriegsflotte kann nicht auslaufen, die Mannschaften mehrerer Schiffe machen nicht mit, sie haben das Feuer in den Kesseln gelöscht. Der Befehlshaber der Torpedoboote ordnet an, »hier wieder Ordnung zu schaffen«, und so gehört auch die Mannschaft von B 97 zu den Unglücklichen, welche die Meuterei ersticken sollen. Sie machen ihre Geschütze und Torpedorohre klar und laufen langsam auf die Thüringen zu: »Lieber Papa, wenn Du wüßtest, wie es mir zumute gewesen ist, als wir die Kanonen auf unsere Kameraden gerichtet haben, welche ohnmächtige Wut ich hatte.« Auf den Torpedobooten wird der Stander Z gesetzt: Das Schiff ist bereit zum Feuern.
Allerdings ist es, als fordere ein Zwerg einen Riesen heraus, die Thüringen und die Helgoland ragen hoch und gewaltig über die kleinen Torpedoboote hinaus. Doch auf so kurze Entfernung sind Torpedos eine tödliche Gefahr für ein großes Schiff. Es kann nicht ausweichen und liegt wie auf dem Präsentierteller, die Sprengladungen mehrerer Torpedos würden unter Wasser die Stahlflanke aufreißen, Menschen töten, das Meerwasser hineinfluten lassen; es in ein Wrack verwandeln und vielleicht sogar zum Sinken bringen.
Auf der Helgoland wollen es die Rebellen nicht so weit kommen lassen. Dort ist es kurz davor, dass das große Schiff die erste Granate der deutschen Revolution abfeuert. Die Meuterer, durch den Anblick des Torpedobootes, das seine Rohre auf sie richtet, aufs Äußerste gereizt, besetzen drei Geschütztürme, drehen sie und richten Kanonen vom mittleren Kaliber 15 Zentimeter auf das viel kleinere Schiff. Eine einzige Salve aus dieser Entfernung, und »von ›B 97‹ wäre kein Holzsplitter mehr übriggeblieben«, schreibt der Marinesoldat lakonisch nach Hause.[12] Doch niemand schießt, auch die Marineleitung vermeidet es dann doch noch, Torpedos in den Bauch ihrer eigenen Schiffe jagen zu lassen. Hipper notiert: »Ein Glück, die Folgen wären sonst nicht auszudenken gewesen. Der 1. Schuß, der auf die Revoltierenden gelöst wird, hat unberechenbare Wirkungen und namentlich ein Torpedoschuß.« Er weiß, wie hoch das Risiko wäre, Wind zu säen und Sturm zu ernten. Aber es sind die revoltierenden Matrosen, die eigentlich das Blutvergießen verhindern. Sie verschanzen sich unter Deck.
Die Matrosen kommen nicht heraus und die Marineinfanteristen, die an Bord gehen, nicht hinein. Die Tür zum Mannschaftsraum ist verrammelt. Aber oben an Deck gibt es noch ein Luk. Es ist verschlossen, von innen mit Tauen zugebunden, aber mit Mühe brechen die Soldaten es auf. Nun schauen sie, die Gewehre schussbereit, vorsichtig hinein. Es ist nichts zu sehen, die Meuterer haben das Licht gelöscht und sich in einen hinteren Winkel des großen Raumes zurückgezogen. »Kommt heraus!«, rufen die Marineinfanteristen, aber nichts rührt sich dort unten. Aber schließlich gehen sie an Deck.
300 Mann auf der Thüringen, mehr als ein Viertel der Besatzung, hundert weitere auf der Helgoland geben auf. Sie blicken in die Gewehrläufe der Marineinfanterie und werden abgeführt. Noch wissen sie nicht, dass sie die Sieger sind. Sie haben Weltgeschichte geschrieben. Es wird keine »Operation Nr. 19« geben, die Seekriegsleitung sagt die Götterdämmerung der deutschen Kampfflotte ab. Zu labil ist die Stimmung an Bord der Schiffe, zu wütend das Gros der Besatzungen. Der Soldat auf dem Torpedoboot erkennt klarsichtig, was hier geschehen ist: »Den Zweck haben sie ja erreicht, die Flotte wird in der nächsten Zeit nicht auslaufen, und wenn wir jedenfalls auch darunter leiden müssen: Unsere Zeit kommt bald oder der Friede muß bald kommen.« Aber dass die Vorgesetzten ihn zwingen wollten, Torpedos gegen seine eigenen Kameraden abzuschießen, das verzeiht er ihnen nicht: »Ich werde den 31. Oktober in meinem Leben nie vergessen, es war tausendmal schlimmer wie bei Ösel oder im Kanal.«[13]
Auf der SMSMarkgraf hat ein Deckoffizier seine Mannschaften angefleht: »Ich appelliere an sie, daß sie auf die schlechten Elemente einwirken, daß sie keine militärische Insubordination begehen. Ich bitte euch, geht schlafen, tut mirs zuliebe!« Der Matrose Karl Bock schreibt an seine Schwester: »Die ganze Rede war begleitet von Zwischenrufen wie ›Hört, Hört!‹ – ›Die Zeiten sind vorbei!‹« Als der Deckoffizier ruft: »Was wollt Ihr eigentlich?«, wissen die Männer die Antwort: »Wir werden nicht rausfahren! Wir wollen uns nicht kaputtschießen lassen!«[14]
Um die Lage zu beruhigen, beschließt die Flottenleitung besonders unsichere Kantonisten aus Wilhelmshaven zu entfernen und das unruhige III. Geschwader nach Kiel an die Ostsee zu verlegen. Auch diese Entscheidung wird historische Folgen haben. In einer langen Linie laufen die Kolosse durch den Kaiser-Wilhelm-Kanal ihrem Ziel zu: König, Bayern, Großer Kurfürst, Kronprinz, die Markgraf. Wie die Stimmung an Bord ist, zeigt sich auf der Markgraf. Der Geschwaderkommandeur, Vizeadmiral Hugo Kraft, lässt 47 Seeleute festnehmen, angebliche »Rädelsführer« des Wilhelmshavener Aufstands. An Bord haben die Schiffe nun 200 gefangene Männer; auf sie wartet das Kriegsgericht. Die Revolution beginnt nicht in Kiel. Sie wird nach Kiel gebracht.
Die Nacht zum 1. November. Die Schiffe haben das Ende des Kanals erreicht und passieren die Holtenauer Schleusen. Dort werden die Inhaftierten an Land gebracht, die einen ins Arrestgebäude der Marine in Kiel, die anderen ins Fort Herwarth nahe Schilksee, eine düstere frühere Geschützbastion mit tiefen Verliesen. Der Flottenverband fährt weiter zur Kieler Förde und geht dort vor Anker.
»Soldaten, schießt nicht auf Arbeiter!«: Feuer in Kiel
Auf der Kieler Förde liegen die riesigen Schiffe, der Stolz der Alldeutschen und des Kaisers. Ihr Bau hat ein Drittel des Militäretats verschlungen. Die »schwimmenden Särge, wegen denen Deutschland sich mit aller Welt verkrachen mußte« (der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann)[15], haben die Seemacht Großbritannien dem Reich entfremdet und in die Reihen der Gegner getrieben. Der Flottenbau trug das Seine dazu bei, die Welt in den Krieg zu treiben; doch in diesem ist die Flotte fast nutzlos. Wenn die ehrpusseligen Offiziere außer Hörweite sind, erzählen sich die Mannschaften Spottverse, zum Beispiel: »Lieb’ Vaterland, magst ruhig schlafen, denn wir verrosten hier im Hafen.«
Keine Stadt des Reichs ist mehr von der Kriegsmarine geprägt und durchdrungen. Hier liegen zahlreiche der stählernen Großkampfschiffe, dazu kleinere Einheiten; wenn die Schiffe auslaufen, legt sich schwarzer Rauch aus den Kohlekesseln in ihrem Rumpf wie Nebel über die sanfte Küstenlinie. Hoch wie Kirchtürme ragen Schlote und die Kräne der Howaldtswerke, der Germaniawerft, der Kaiserlichen Werft. Artilleriegespickte Forts bewachen die Zugänge zum gewaltigen Naturhafen der Förde; Tag und Nacht herrscht Lärm in den Betrieben und Rüstungsfabriken. In den Torpedowerkstätten bauen Facharbeiter die tödlichen Waffen für den unbeschränkten U-Boot-Krieg. Es ist eine Stadt der Soldaten, 50 000 sind in den Kasernen von Kiel stationiert, und der Arbeiter, sie stellen zusammen mehr als zwei Drittel der Erwerbstätigen und werden in den Rüstungsbetrieben besser bezahlt als Industriearbeiter anderswo. 1910 hat die SPD hier bei den Stadtratswahlen mehr als die Hälfte der Stimmen geholt, zusammen mit den Gewerkschaften ist sie sehr stark in diesem proletarischen Milieu, das sie dann freilich im Sinne des Burgfriedens ruhig hält. Der linkssozialistischen USPD fällt es erstaunlich schwer, in diese Bastionen einzubrechen, zumal sie vom Staat hier besonders scharf verfolgt wird. Wie gereizt die Stimmung dennoch ist, hat sich während der großen Januarstreiks 1918 gezeigt, als 30 000 Arbeiter auf dem Kieler Wilhelmsplatz für einen Frieden ohne Eroberungen und gerechtere Verteilung von Nahrungsmitteln demonstrierten. Zu den Parolen gehört der Vers eines USPD-Aktivisten:
Der Krieg geht für die Reichen,
die Armen zahlen mit Leichen![16]
Selbst den privilegierten Rüstungsarbeitern werden 1917/18 Rationen gekürzt, ohne Käufe auf dem blühenden Schwarzmarkt können viele ihre Familien nur noch schwer durch die Steckrübenwinter bringen. Eingaben der Stadtverwaltung und der MSPD bürstet die Marineführung ungnädig ab.
Zu den Aktivisten der USPD gehört der Oberheizer Karl Artelt von der I. Torpedodivision, zwangsverpflichtet für die Arbeit in der zyklopischen Germaniawerft, deren Helgenkrangerüste – unter denen die fertigen Schiffe zu Wasser gelassen werden – in den Himmel ragen wie rätselhafte Bauten für Riesen. Artelt berichtet später frustriert von seinen vergeblichen Versuchen, den Genossen radikalere Ideen nahezubringen: »Um das proletarische Bewußtsein vieler Schiffbauer war es schlimm bestellt. Auf der Kaiserlichen Werft rühmten sich die Kumpel, daß bei ihnen noch nie gestreikt worden wäre. Es bedurfte erst bitterer Erfahrungen während der Kriegsjahre, ehe sich ein Sinneswandel vollzog.«[17] Kiel ist 1918 also keineswegs, wie es die Hassprediger der Dolchstoßlegende später behaupten werden, im Griff bolschewistischer und linksradikaler bestens organisierter Rädelsführer.[18]
In dieser Stadt mit ihren vielen Seemannskneipen und schummrigen Bars sollen die Männer des aus Wilhelmshaven verlegten III. Geschwaders sich ein wenig austoben und Dampf ablassen, so das Kalkül des Kommandeurs. In seinem Roman Des Kaisers Kulis wird der Schriftsteller Theodor Plievier, der selbst Matrose und an der Revolte 1918 beteiligt ist, die Atmosphäre der Hafengegend anschaulich beschreiben (allerdings in den Tagen vor Kriegsausbruch): »Vater Lampl muß selbst mit eingreifen. Sein Vize hat alle Hände voll zu tun. Beladen mit Getränken läuft er zu den Tischen und mit leeren Gläsern zurück zum Schanktisch – Bier! Schnaps! Grog! Wenn die bemalten Scheiben des Orchestrions rot aufflammen, die Lampen über den Tischen ausgehen und die Kneipe im Halbdunkel versinkt, verwischen sich die Gesichter, scheint der Geruch der Weiber heißer und betäubender zu sein. Wenn es wieder hell wird, stoßen Einzelheiten durch die Wolken dichten Tabakqualmes – Gruppen, Holztische, an den Wänden Schiffsmodelle. … ›Hier gefällts mir am besten‹, sagt Lene. ›Sonst gehe ich ins ›Eldorado‹ oder in ›Wachtmanns Ballhaus‹. Sehr elegant. Teppiche, Garderobe. Aber hier ist mehr Leben!«[19]
In solcher Umgebung – wenn auch mit erheblichen Abstrichen aufgrund von Mangelwirtschaft und Kriegsrecht – sollen die Männer auf andere als revolutionäre Gedanken kommen. Vizeadmiral Kraft ist zu dem Schluss gelangt, dass nur die lange Abwesenheit von der Basis in Kiel »Hauptgrund der Mißstimmung« sei, ein ebenso bezeichnender wie ignoranter Gedanke. Den ersten Landgang nutzen sehr viele Matrosen aber nicht, um die Hafenwirtschaften aufzusuchen. Sie fürchten um das Leben ihrer inhaftierten Kameraden. Meuterei gilt als schweres Vergehen. Sie wollen etwas tun, noch am Abend treffen sie sich im Gewerkschaftshaus an der Fährstraße mit Vertretern von SPD und USPD. Die Fragen sind dringend. Was sollen sie unternehmen, wenn der Verband wieder den Befehl zum Auslaufen erhält? Und vor allem: Wie können sie den Gefangenen helfen? Sie fordern jedenfalls deren Freilassung und verabreden sich zu einer weiteren Versammlung am nächsten Abend.
Mit dabei ist Karl Artelts Genosse Lothar Popp. Mit Freunden hat er kleine Flugzettel auf einer Schreibmaschine getippt, die er jetzt verteilt: »Soldaten, schießt nicht auf Arbeiter!«, »Arbeiter, laßt die Soldaten nicht im Stich!«, »Soldaten, laßt Eure Kameraden nicht im Stich!«[20]
Am 1. November 1918 ist die Stimmung auf der größten Marinebasis des Reichs angespannt. Das Kieler Gouvernement und die Marine lassen das Gewerkschaftshaus dichtmachen; aber das ist keine kluge Idee, die Sache spricht sich schnell auf allen Schiffen herum; und so kommen am 2. November noch mehr Männer dorthin, nur um vor dem Gebäude auf aufmarschierte Marineinfanterie zu treffen, das I. See-Ersatz-Bataillon. Es soll die Aufsässigen zur Räson bringen, da »der Geist der Meuterei doch stärker und gefährlicher war«[21] als angenommen, wie sich die Offiziere eingestehen müssen. Doch die Marineinfanteristen verhalten sich auffallend passiv und lustlos; viele grüßen freundlich, als sie in den Straßen auf Matrosen treffen, und in der Dunkelheit hört ein Reporter einen bewaffneten Wachposten rufen: »Wir tun niemandem etwas!«[22]
Sie halten sich daran. Die meisten Matrosen kehren unbehelligt zu ihren Schiffen zurück, aber schlafen gehen sie nicht, sie schmieden nun Pläne für die Befreiung der Gefangenen des I. Geschwaders. Die Gegenseite setzt zögernd auf Gewalt, zögernd nicht aus moralischen Erwägungen, sondern aus Furcht vor einer unkontrollierbaren Eskalation. Der Stadtkommandant Heine lässt den Marinesoldaten befehlen: Die Kompanie dürfe »nicht davor zurückschrecken, das Blut deutscher Kameraden zu vergießen«. Vizeadmiral Wilhelm Souchon, der noch sehr neue Gouverneur von Kiel, schickt nun einen folgenreichen Hilferuf an die Reichsregierung in Berlin: Sie möge doch dringend einen »hervorragenden sozialdemokratischen Abgeordneten herschicken, um im Sinne der Vermeidung von Revolution und Revolte zu sprechen«. Im Reichskanzleramt löst diese Nachricht blankes Entsetzen aus, auch unter den Sozialdemokraten wie Scheidemann, die Reichskanzler Max von Baden in sein Kabinett aufgenommen hat: »Das konnte mehr sein: der Funke, der ins Pulverfaß fliegt!«[23] Die Revolution ist da. Die Regierung schickt den Militärexperten der MSPD-Fraktion, Gustav Noske, und einen Staatssekretär. Noske empfiehlt als Erstes, keine militärischen Maßnahmen gegen Kiel zu ergreifen.
In der Stadt selbst versammeln sich am Nachmittag des 3. November gut 6000 Demonstranten auf dem Exerzierplatz am Viehhofer Gehölz. Sie fordern Frieden und Freiheit, ein Ende des Krieges; dann brechen sie in einem langen Zug auf in die Kieler Innenstadt, überrumpeln die überraschten Wachmannschaften einer Kaserne, in der etliche Kameraden eingesperrt sind. Matrosen schlagen die Fenster ein, klettern von allen Seiten in das Gebäude und befreien die Gefangenen; sie nehmen auch die Gewehre aus der Waffenkammer mit, die Wachen wehren sich nicht. Der Zug wächst immer weiter an, aus Kneipen, Theatern, Häusern und Militärgebäuden kommen Männer hinzu. Als ihm Soldaten in den Weg treten, rufen zwar einige: »Dicke Luft! Nun haut ab!« In der Tat hat Kiels Gouverneur Souchon befohlen, ohne Rücksicht zu schießen. Aber die wenigen Soldaten werden einfach entwaffnet.
Nahe der Arrestanstalt, in der Karlstraße hat ein Rest loyaler Truppen unter dem Reserveleutnant Oskar Steinhäuser eine Kette über die Straße gebildet, etwa vierzig Mann stark, überwiegend Offiziersanwärter und verängstigte Rekruten, die ihre Gewehre umklammern. Immer näher kommen die Rufe und Parolen der Demonstranten; diese sind schon lange zu hören, bevor sie ins Blickfeld der Soldaten geraten, aber dann ist es so weit: »Im fahlen Licht der Gaslaternen wälzte sich die Demonstrationsmenge in die Karlstraße hinein und überrannte die Polizisten, die in die Straße Langer Segen flüchteten«, so Dähnhardt, der Chronist der Kieler Revolte.[24] Von hinten drückt die Menge gegen die vordersten Demonstranten. Steinhäuser droht der Menge, das Feuer zu eröffnen. Lothar Popp, inzwischen einer der Matrosenführer, kann die Postenkette nicht gut sehen, aber plötzlich hört er viele Schüsse, eine Salve; er will aber nicht glauben, »daß deutsche Marinesoldaten auf ihresgleichen schießen konnten. Wir hatten uns davon überzeugt, daß die Salve blind war und drängten wieder vorwärts.«[25] Aber die Soldaten schießen gezielt, offenbar erwidern einzelne Demonstranten das Feuer, der Postenzug wird überrannt, Steinhäuser durch Schläge verletzt; die Menge rennt in Panik auseinander. Neun Menschen sterben, viele Verletzte bleiben auf dem Pflaster liegen. Ein 18-jähriger Matrose der I. Torpedodivision, unter Steinhäusers Kommando, berichtet später: »Der Leutnant Steinhäuser kriegte einen mit dem Kolben über den Schädel und er wurde dann in dieses Lokal neben dem Stadtcafé hineingeschleppt und wir waren der Meinung, sie hätten ihn totgeschlagen.«[26] Aber Steinhäuser überlebt. Popp und seine Kameraden tragen die Angeschossenen in das »Kaiserkaffee« nebenan, bald ist der Boden voller Blutlachen; Menschen stöhnen und schreien vor Schmerzen. Und, wie Popp später schreiben wird, »an den Leichen der Gefallenen gelobten sich die Genossen durch Handschlag, das Werk der Gefallenen zu vollenden«[27].
Die Revolution hat ihre ersten Toten.
Aber der Funke des Aufruhrs entzündet jetzt Flammen. Auf allen Schiffen, in den Kasernen stehen Gruppen debattierender Soldaten, sie streiten jetzt offen mit ihren Vorgesetzten, und deren Methoden, die Männer zur Räson zu bringen, erweisen sich oft als wenig hilfreich. Der Kommandeur der I. Torpedodivision, Kapitän zur See Bartels, hält in bemerkenswerter Verkennung der Stimmung unter seinen Leuten eine Ansprache darüber, warum Soldaten sich nicht mit Politik zu befassen hätten. Sie endet mit den Worten: »Soldat soll gehorchen, Soldat muß gehorchen und Soldat gehorcht.« Zu seinem Erstaunen reagiert die Menge nicht mit Einsicht, sondern mit Pfiffen und Buhrufen.[28] Ein von Artelt geführter Trupp überreicht dem Kommandeur schließlich einen Forderungskatalog, den sie selbst formuliert haben und der diesen erbleichen lässt: Abdankung des Hohenzollernhauses, Aufhebung des Belagerungszustandes, Freilassung aller inhaftierten Kameraden und politischen Gefangenen sowie »Einführung des allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlrechts für beide Geschlechter«. Bartels erwidert entgeistert: »Aber meine Herren, das ist ja ein politisches Programm!«
In der Tat – aber mit dem Bolschewismus, den man in der Reichskanzlei über Kiel hereinbrechen sieht, hat dieses Programm nicht das Geringste zu tun, es fordert weder Rätediktatur noch Rache. Es handelt sich um bis ins Mark sozialdemokratische Forderungen, gerichtet nicht gegen die Berliner Übergangsregierung, sondern den kaiserlichen Militärapparat. Wenn die sozialdemokratischen Führer Scheidemann und Ebert sich in Berlin vor dem »Pulverfass« der Kieler Erhebung fürchten, dann fürchten sie sich vor ihrer eigenen Gefolgschaft. Dieses Grundmissverständnis beginnt bereits hier in Kiel, in den allerersten Tagen der deutschen Revolution. Denn wer sitzt an der Lunte des angeblichen Pulverfasses? Der Kieler Regionalforscher Klaus Kuhl und seine Mitstreiter werden in den Siebzigerjahren eine Reihe höchst aufschlussreicher Interviews mit inzwischen greisen, aber wachen Beteiligten führen – eine bislang nicht ausreichend gewürdigte Quelle zur deutschen Revolution 1918. So 1978 mit Jonny Pump, Jahrgang 1900, eingezogen 1918: »Der Vater war selbst Beamter, also es war schon mehr das Nationalbewußtsein, Krieg ist Krieg, mußt du Soldat spielen. Aber man war ja froh, daß das nicht so weit gekommen ist. Durch die Revolution war es zu Ende.« Er erinnert sich noch, dass die Schleswiger Garnison, der er angehörte, »den Regimentskommandeur bereits eingesperrt hatte«. Louis Streichert, geboren 1890, lief mit der SMSStraßburg in die Kieler Förde ein: »Wir fuhren mit der Kriegsflagge in den Hafen und sahen die Hochseeflotte mit der roten Flagge. Die schweren Dinger richteten ihre Türme auf uns. Und nun Maschinen stopp.«
Klaus Kuhl hat auch schriftliche Zeugnisse gesammelt, etwa jenes von Alfred Schwabe, Jahrgang 1892. Eigentlich U-Boot-Fahrer, hat Schwabe im November 1918 »das fürchterliche Völkermorden satt, die Sehnsucht nach Frieden war vorherrschend«. Als der Matrosenaufstand beginnt, wird der junge Obermatrose mit Pistole und Munition ausgestattet, er und seine Kameraden hören die Ansprache eines Leutnants, gehalten in einer Turnhalle am Hafen: »Heldentum und Treue zu den Offizieren, Kampf gegen die Meuterer war der Inhalt. Minuten war es kirchenstill. Plötzlich ein Gebrüll von weit her, aber es kam näher und näher: ›Achtung, Achtung! Pistolen laden und sichern!‹ Im Flüsterton bei den Obermatrosen; ›Wir schießen nicht, wir schießen nicht!‹« Die jungen Männer schließen sich sofort den Revolutionären an: »Das Abtackeln (die Entwaffnung der Offiziere; d. V.) war manchen Matrosen eine wahre Wollust, konnten sie sich doch für Drill und Erniedrigungen rächen.«[29]
Zwei Revolutionäre: Karl Artelt und Lothar Popp
Zu den wenigen überlieferten biografischen Zeugnissen revolutionärer Matrosen gehören auch jene von Lothar Popp und Karl Artelt. In den Siebzigerjahren werden die Historiker Dirk Dähnhardt, Volker Ullrich und der Kieler Revolutionsforscher Klaus Kuhl noch Interviews mit Lothar Popp führen, der schon weit über 80, aber noch wachen Geistes ist; Dähnhardt empfindet noch den alten Herrn als »imponierende Persönlichkeit«. Soweit seine weit jüngeren Interviewer, wie Kuhl das tut, den Veteranen der Bewegung mit linken Idealen ihrer Zeit konfrontieren und fragen, warum nicht sofort konsequent der Umsturz durchgesetzt worden sei, will der Kieler Revolutionär davon wenig hören: »Hören Sie doch mal zu! Ja, ich konnte doch die SPD nicht ausschalten, wenn Sie einer sind und die anderen sind zehn!«[30]
Lothar Popp ist es wahrlich nicht in die Wiege gelegt, einmal revolutionärer Arbeiter in Kiel zu werden. Er wird 1887 in Furth im Wald geboren, einem kleinen Städtchen in der Oberpfalz, das im selben Jahr einen Höhepunkt seiner Geschichte erlebt: Das sommerliche Festspiel für den »Drachenstich«, einen auf das 16. Jahrhundert zurückgehenden Umzug rings um das Thema des Kampfes Gut gegen Böse, wird erstmals aufgeführt. Nach dem Tod der Mutter zieht Popp nach Kiel. Ein klassischer Proletarier ist er keineswegs, eher ein Selfmademan, geschäftstüchtig, ein gewinnender Typ mit einer schwarzen Haarmähne auf dem Kopf. Er liebt das Leben, und das Leben liebt ihn. Schon vor dem Krieg besitzt er mehrere Läden für Bonbons und Süßes. Er wird Sozialdemokrat, doch als überzeugter Pazifist wendet er sich nach dem Burgfrieden innerlich von der Partei ab, er politisiert sich nun rasch. 1915 wird er eingezogen, aber nach anderthalb Jahren als dienstunfähig entlassen. Doch der Klammer der preußischen Kriegsmaschinerie entgeht er nicht, als Dienstverpflichteter arbeitet er auf den Kieler Werften. Er bleibt in der SPD aktiv, mit starken Sympathien für den linken Flügel. Gleichgesinnte findet er in einem örtlichen Arbeiterklub, dem »Sozialdemokratischen Verein Groß-Kiel alte Richtung«. Alte Richtung, als, wie Popp die Sache sieht, noch kein Sozialist für imperialistische Kriege votiert hätte. Er betreibt die Sache mit der üblichen Energie und rückt in den Vorstand auf, den Vorsitz hat ein Mann namens Arthur Sens inne: »Der hatte ein Holzbein, konnte deshalb nicht eingezogen werden« und wurde »deshalb zum Vorsitzenden bestimmt«.[31] Als 1917 die Abtrünnigen der SPD die linke USPD gründen, ist Lothar Popp von Anfang an ihr Mann.
In der Marinestadt fasst die neue Partei freilich nur schwer Boden; der Druck der politischen Polizei ist zudem brutal. Im Herbst 1917 wird der Mann mit dem Holzbein, Arthur Sens, zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt; sein Vergehen: Als Vorstand der Kieler USPD hat er bei einer Hinterzimmerversammlung vor 14 Matrosen gesprochen; unter dem Belagerungszustand eine unerlaubte Versammlung. In die Lücke stößt nun der fliegende Bonbonhändler Lothar Popp. Und er hat das Format dazu. Im Gewerkschaftshaus legt er sich eines Mittags in der Kantine mit Carl Legien an, dem Vorsitzenden der mächtigen Generalkommission der Gewerkschaften. Legien fragt voll Missfallen, wer den jüngsten Streik veranlasst habe und was dieser erreichen solle. Popp erwidert: »Wir konnten nicht warten, bis die Gewerkschaften den Streik inszeniert hätten, denn dann wäre er sicher niemals ausgebrochen.« Es sei ein »spontaner Protest gegen Brest-Litwosk« gewesen, den brutalen Friedensvertrag, den das Reich Anfang 1918 dem Sowjetstaat in Russland aufzwingt.
In den Interviews mit Dähnhardt, Ullrich und Kuhl wird Popp berichten, unter welchen Umständen das letzte Aufgebot der Unabhängigen 1917/18 die konspirative Arbeit betrieb: »Sie nannten uns in Kiel die ›Henke-Garde‹. Henke spielte eine große Rolle in der ganzen Bewegung, auch in der Marine. Wir haben mit Henke illegale Versammlungen im Walde bei Kiel abgehalten. Ich sehe ihn noch auf einem Baumstumpf stehen.« Alfred Henke, Reichstagsabgeordneter und Mitbegründer der USPD, wird die Mühen der politischen Ebene auch bei einem Zwischenfall gespürt haben, den Popp überliefert. Ein offenbar nicht gut beratener Genosse überreicht Henke 1917 auf einer Vorstandssitzung des Bezirks Wasserkante eine Liste, »auf der alle Mitglieder der USPD in der Marine verzeichnet waren. Henke fühlte sich aber schon damals – trotz Immunität – nicht mehr sicher und gab die Liste dem Wirt (der war auch Genosse). Kurze Zeit später gingen wir hoch. Man kann sich vorstellen, was passiert wäre, wenn die Liste gefunden worden wäre.«[32]
Als 1918 die Januarstreiks für den Frieden losbrechen, ist Kiels USPD ein trister Torso, fast alle Vorstandsmitglieder sitzen im Gefängnis. Popp hat daher zahlreiche Sitzungen der Partei geleitet und spricht zu vielen Tausenden von Streikenden, die sich am 27. Januar auf dem Wilhelmsplatz versammeln: »Ich bin auf eine Laterne geklettert und habe eine halbe Stunde lang zu den Massen geredet. Ich habe erklärt, daß die Regierung stets gesagt habe, es sei ein Verteidigungskrieg. In Brest-Litowsk hat General Hoffmann jedoch erklärt, wir sind die Sieger. Wenn der Krieg jetzt nicht mit einem Verständigungsfrieden beendet wird, dann wird der Krieg nicht ausgehen ohne Sieger und Besiegte, sondern mit einer Niederlage Deutschlands, wir müssen das mit allen Mitteln verhindern.«
Es ist ein eindrucksvoller Auftritt, und als Popp noch vorschlägt, einen Arbeiterrat zu gründen, wählen ihn die Zuhörer per Akklamation zum Vorsitzenden. Wenige Tage später verhaften ihn Marinesoldaten in der Stadt. Er entgeht nur knapp einer Anklage wegen Hochverrats und kommt, obwohl ihn gleich vier Kriminalbeamte schwer belasten, mit zwei Monaten Gefängnis wegen Abhaltens einer illegalen Versammlung davon. Für den Rest des Krieges ist er der populärste und wichtigste Mann der Kieler Unabhängigen.
Im Herbst 1918 ist sein engster Mitstreiter Karl Artelt, ein 27-jähriger Seemann von kräftiger Statur, nun dienstverpflichteter Maschinenbauer auf der Germaniawerft und Torpedospezialist, kein Intellektueller, aber einer, der wenig fürchtet. Ein Militärarzt bescheinigt ihm, er habe »Nerven wie Stahl«. Wie Popp hat er vor 1914 an die Losung der SPD geglaubt: »Diesem System keinen Mann, keinen Pfennig«; die Bewilligung der Kriegskredite durch die Partei im August 1914 trifft ihn wie ein Schlag. Er baut in den Betrieben ein Netz von Vertrauensleuten auf und ist Anfang 1917, während des »Kohlrübenwinters«, Mitinitiator eines Großstreiks gegen die katastrophale Lebensmittelversorgung. Zu dieser Zeit unterhält die Eisenbahn noch Käfigwägen, in denen verurteilte Delinquenten angekettet werden; in einem davon sitzt nach dem Streik Karl Artelt, verurteilt zu einem halben Jahr Festungshaft in Groß-Strehlitz. Dort erfährt er von den ersten Unruhen in der Flotte 1917 und den Mordurteilen der Marinejustiz gegen mehrere Beteiligte: »Und ich saß in der Festung, als es in der Marine losging!« Nach der Haft wird er in ein Strafbataillon nach Flandern versetzt.
Im Frühjahr 1918 kehrt er nach Kiel zurück und arbeitet als Spezialist in der Torpedobootsreparaturwerkstatt; gleichzeitig strickt er ein neues Netz von USPD-Vertrauensmännern in der Marine. Artelt ist der politischere Kopf, Popp der Gelassenere. Beide aber wollen schon am Abend der ersten, so blutig endenden Kieler Großdemonstration mehr erreichen als die Befreiung der inhaftierten Besatzungsmitglieder. Sie ahnen, dass sie damit erst am Anfang stehen, dass eine Bewegung, welche die kaiserliche Marine lahmzulegen droht, zusammen mit den Arbeitern ein weit größeres Potenzial hat als die Streiks von 1917 oder sogar vom Januar: Artelt verlangt »die Niederkämpfung des Militarismus«, notfalls müsse »Gewalt angewendet werden«.[33]
Tod auf SMS König: Die Revolution und ihre Feinde
Der 5. November ist ein herrlicher Herbsttag, in der Morgensonne leuchten die roten Fahnen, die von den Masten der Kriegsschiffe und den Türmen der Stadt wehen. Sie wehen nicht auf dem Linienschiff SMS König, das im Dock liegt. Der Kapitän Carl-Wilhelm Weniger lässt die Reichskriegsflagge hissen, der Revolution zum Trotz. Als Bernhard Rausch, der Chefredakteur der sozialdemokratischen Zeitung Kiels, gerade zu einem Treffen mit den Vertrauensmännern in den Reichshallen geht, hört er vom Dock her Schüsse: »Die Offiziere hatten sich mit Waffengewalt der Absicht der Mannschaften, auf dem Schiffe die rote Fahne zu hissen, entgegengestellt.« Die genauen Vorgänge werden nie ganz geklärt, am Ende sind ein Matrose und zwei Offiziere tot, Weniger hat vier Kugeln im Leib und überlebt schwer verletzt. Er wird im Lazarett später behaupten, von Land aus hätten Heckenschützen mit Gewehren auf ihn und seine Fahnenwache gefeuert, er selbst habe schon am Boden liegend einen an Bord stürmenden Matrosen erschossen; es ist aber wahrscheinlicher, dass Weniger mit dieser, eher nach Notwehr klingenden Version Racheakten oder einer Anklage wegen Mordes entgehen will.[34]
Wahrscheinlicher ist es, dass der Kapitän selbst den Schusswechsel provoziert und einen Signalgast niederschießt, der die verhasste Kriegsflagge herunterreißen will. Auf die weit hallenden Schüsse hin rennen viele Matrosen zur König, fast alle Männer tragen ihre Karabiner mit sich. Dem Bericht des Matrosen Kurt Kluge vom Panzerkreuzer SMSFrankfurt zufolge, haben sich die Offiziere nach dem Tod des Signalgastes in den hinteren Geschützturm des Schlachtschiffs zurückgezogen und feuern aus den Sehschlitzen wie aus Schießscharten auf die heranstürmenden Matrosen: »Wir richteten gezieltes Feuer auf die Sehschlitze des Panzerturms. Aber natürlich prallten die allermeisten Kugeln vom Turm einfach ab. Einige wenige aber drangen ins Innere und verfehlten ihre Wirkung nicht.«[35] Nach einer Weile, so Kluge, hätten die Offiziere mit einer weißen Fahne gewunken und die Matrosen stürzten an Bord und zogen eine rote Fahne hoch. Dann allerdings müssten Schwerverletzte die weiße Fahne gezeigt haben. Der Erste Offizier, Bruno Heinemann, ist tot, und der 20-jährige Leutnant zur See Wolfgang Zenker hat nicht mehr lange zu leben. Eine Kugel hat seine Lunge und das Rückenmark verletzt, er ist am Unterkörper gelähmt und stirbt im Lazarett.
Wolfgang Zenker wird fünf Tage nach den tödlichen Schüssen auf dem Südfriedhof in Leipzig beigesetzt; der Geist, in dem er aufwuchs, prägt noch sein letztes Geleit. Der Onkel, der nationalkonservative Leipziger Superintendent Walther Zenker, vollzieht, wie er berichten wird, »mit stolzer Trauer meine letzte Verwandtenpflicht an ihm«. Auf dem Grabstein hat die Familie einen Satz aus dem letzten Brief Wolfgang Zenkers einmeißeln lassen: »Es ist nicht nötig, daß wir leben, aber es ist nötig, daß wir unsere Pflicht tun.« Wie der Prediger berichtet, »hat der Vater die furchtbare Anklage daruntergesetzt: Er starb von einer deutschen Kugel.«[36] Der junge Seeoffizier wird zu einem Idol der Rechten in der Weimarer Republik und dann der Nationalsozialisten, die ein Kriegsschiff nach ihm benennen und ihn als Vorbild für die wehrfreudige Jugend inszenieren. Und der Militärjustiz der Wehrmacht, welche im Zweiten Weltkrieg Zehntausende der eigenen Soldaten wegen geringster Vergehen ermorden lässt, wird das »Erlebnis von 1918« stets als Schreckbild vor Augen stehen – die Furcht, dass noch einmal Mannschaften und Besatzungen gegen einen Krieg aufstehen, der nicht der ihre ist, und auf ihre Offiziere schießen.