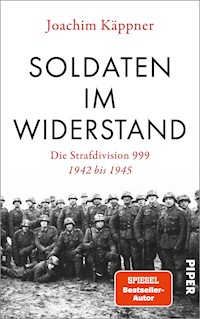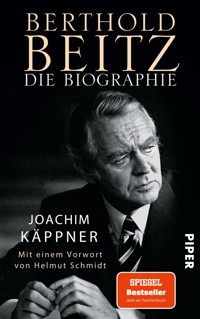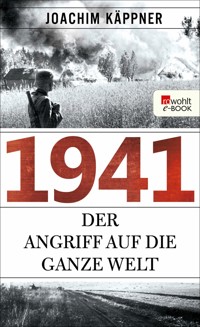
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
1941 beginnt ein Krieg, der anders ist als alle anderen zuvor Als das Jahr 1941 begann, beherrschte das Deutsche Reich halb Europa. Nur Großbritannien, das letzte Bollwerk der Freiheit, widersetzte sich dem Triumph der Nazis. Trotz dieses Kampfes der Systeme und des NS-Terrors in Polen erschien der Konflikt den meisten Zeitgenossen noch als ein «europäischer Krieg», wie so viele zuvor zwischen den Mächten Europas. Bis zum 22. Juni 1941 – ab diesem Tag wird er zu einem Krieg, wie ihn die Welt noch nicht erlebt hat: Er wird zum Vernichtungskrieg, als Hitlerdeutschland die Sowjetunion überfällt und eine Eroberungs- und Mordmaschinerie in Gang gesetzt wird, vom Holocaust bis zum «Generalplan Ost». Am Ende des Jahres ist der Angriff auf Moskau gescheitert, und Deutschland hat den USA den Krieg erklärt. Der globale Krieg kostet viele Millionen Menschenleben und wird schließlich das Land zerstören, von dem er ausging. Joachim Käppner schildert packend und prägnant die wichtigen Ereignisse dieses zentralen Kriegsjahres. Er erzählt von ihren Ursachen und Folgen, von Wendepunkten und Entscheidungen. Und er stellt die Frage, warum große Teile der deutschen Elite und Gesellschaft Hitlers Politik unbeirrt folgten, obwohl sie 1941 Monat für Monat mörderischer, irrationaler und selbstzerstörerischer wurde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Joachim Käppner
1941
Der Angriff auf die ganze Welt
Über dieses Buch
1941 beginnt ein Krieg, der anders ist als alle anderen zuvor
Als das Jahr 1941 begann, beherrschte das Deutsche Reich halb Europa. Nur Großbritannien, das letzte Bollwerk der Freiheit, widersetzte sich dem Triumph der Nazis. Trotz dieses Kampfes der Systeme und des NS-Terrors in Polen erschien der Konflikt den meisten Zeitgenossen noch als ein «europäischer Krieg», wie so viele zuvor zwischen den Mächten Europas.
Bis zum 22. Juni 1941 – ab diesem Tag wird er zu einem Krieg, wie ihn die Welt noch nicht erlebt hat: Er wird zum Vernichtungskrieg, als Hitlerdeutschland die Sowjetunion überfällt und eine Eroberungs- und Mordmaschinerie in Gang gesetzt wird, vom Holocaust bis zum «Generalplan Ost». Am Ende des Jahres ist der Angriff auf Moskau gescheitert, und Deutschland hat den USA den Krieg erklärt. Der globale Krieg kostet viele Millionen Menschenleben und wird schließlich das Land zerstören, von dem er ausging.
Joachim Käppner schildert packend und prägnant die wichtigen Ereignisse dieses zentralen Kriegsjahres. Er erzählt von ihren Ursachen und Folgen, von Wendepunkten und Entscheidungen. Und er stellt die Frage, warum große Teile der deutschen Elite und Gesellschaft Hitlers Politik unbeirrt folgten, obwohl sie 1941 Monat für Monat mörderischer, irrationaler und selbstzerstörerischer wurde.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, April 2016
Copyright © 2016 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Die Seitenzahlen im Text beziehen sich auf die Seiten der Printausgabe
Umschlaggestaltung Frank Ortmann
Umschlagabbildung ullstein bild; akg-images
Karten Peter Palm, Berlin
ISBN 978-3-644-12181-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Für Jurek Rotenberg, ...
Things fall apart; ...
Vorwort
Fünf Menschen, 1941
«Der stille Typ»: Johannes Blaskowitz
«Ich danke Ihnen, dass Sie so menschlich waren»: Bob Doe, Jagdflieger (Großbritannien)
«Lord Kern der Sache»: Harry Hopkins, Berater des Präsidenten (USA)
«Ich könnte zu jedem Grabstein etwas erzählen»: Boris Dorfman, Rotarmist (Ukraine)
«Wir spazieren durch den dunklen Wald»: Alki Zei, Partisanin (Griechenland)
1939–1941: ein europäischer Krieg?
«Trauer und Schande»: Hitlers Aufstieg und die Appeaser
«Eine neue Form des Kampfes»: der Blitzkrieg 1939/40
«Wir werden uns niemals ergeben»: Entscheidung in London
«Welche Reserven besitzen wir noch?»: die Luftschlacht um England, Hitlers erste Niederlage
Hybris: 1941 – der Weg in den globalen Krieg
Neujahr 1941: das seltsame Patt
«Rußland muß erledigt werden»: der Entschluss
«Der Judaskuß»: Alternativen zum Russlandkrieg
«Fuchs auf freiem Feld erlegt»: die Italiener
Griechisches Feuer: der deutsche Balkan-Feldzug
Der Schakal und der Bär: Deutschlands Aufmarsch gegen Russland
Armageddon: der Überfall auf die Sowjetunion
«Ein stolzes Gefühl für jeden Deutschen»: Operation «Barbarossa»
«Niemals sah ich einen Menschen lächeln»: Leningrad
«Taifun»: Entscheidung vor Moskau
Inferno: der Zivilisationsbruch
«In Rußland ist alles schwarz»: Wehe den Besiegten
«Die Schlucht liegt stumm, darüber das Vergessen»: Holocaust
«Kein falsches Mitleid»: der Generalplan Ost
«Wir kennen ja keine Rücksicht mehr»: Kommissarbefehl und «Partisanenkrieg»
«Ich wundere mich, dass ich überlebte»: der Massenmord an den sowjetischen Gefangenen
«Träger einer unerbittlichen völkischen Idee»: die Schuld der Wehrmacht
Sechs Tage im Dezember: der Weltkrieg
«Hier muss ich also sterben»: die Wende vor Moskau
«Japans große Stunde»: der fremde Verbündete
«Tora, Tora, Tora!»: Pearl Harbor
«With all her power and might»: Roosevelt gegen Hitler
«Die Flamme des Zorns»: Epilog
Literatur
Dank
Karten
Für Jurek Rotenberg, meinen Freund, von dem ich so vieles lernen durfte
Things fall apart; the centre cannot hold.
Mere anarchy is loosed upon the world.
The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere
The ceremony of innocence is drowned;
The best lack all conviction, while the worst
Are full of passionate intensity.
Alles zerfällt; das Zentrum hält nicht stand.
Schiere Anarchie wird losgelassen auf die Welt.
Blutrot schwappt frei die Flut, und rings umher
Das Spiel der Unschuld wird ertränkt.
Die Besten haben keine Überzeugung mehr; die Schlimmsten
Sind von der Kraft der Leidenschaft erfüllt.
William Butler Yeats (1865–1939): The Second Coming
Vorwort
Als Boris Dorfman geboren wurde, das war im Jahre 1923, gehörte seine Heimatstadt Cahul zu Rumänien. Das Städtchen, heute Teil der Republik Moldawien, liegt in Bessarabien, auf das die Sowjetunion Ansprüche erhob, weil es einst zum russischen Zarenreich gehört hatte. Die jüdische Familie Dorfman zählte zum gebildeten und aufstrebenden Bürgertum, man sprach zu Hause jiddisch. Als Boris Dorfman sechzehn Jahre alt war, teilten die Diktatoren Adolf Hitler und Josef Stalin Osteuropa heimlich unter sich auf. Bessarabien gehörte zur «Interessenssphäre» der Sowjets, die 1940 einrückten und das Land gewaltsam okkupierten. Er war nun sowjetischer Staatsbürger rumänischer Herkunft und jüdischer Identität. Zu den Zehntausenden, welche die neuen Herren als verdächtige Elemente tief nach Russland deportieren ließen, gehörten auch die Dorfmans. Er kämpfte als Rotarmist ab 1941 gegen die Rumänen und die Deutschen, 1944 kam er nach Lemberg in der Ukraine und blieb. Von den einhundertsechzigtausend Juden Lembergs lebte kaum noch jemand, die Deutschen hatten fast alle ermordet. Boris Dorfman erlebte, wie Stalin Zehntausende Polen aus der Stadt nach Westen «umsiedeln» ließ und wie die letzten Spuren jüdischer Kultur von den Kommunisten unterdrückt wurden.
Jetzt ist Boris Dorfman früherer Rumäne, früherer Bürger der Sowjetunion und heutiger Bürger der Ukraine; er fühlt und versteht sich als Jude, der die Geschichte und Traditionen seiner Gemeinde lebendig erhält. Er liebt seine Stadt und sein Land, aber viel lieber wäre ihm, dass nicht schon wieder Krieg herrschen würde, diesmal zwischen der Ukraine und den russischen Separatisten im Donbass. Er sagt heute: «Warum ist keine Seite bereit zu Kompromissen? Wir haben doch 1941 erlebt, welche Schrecken der Krieg bringt.»
Drei Staaten, drei Systeme, drei Kriege: das Leben des Boris Dorfman.
Die Staaten: Rumänien, die Sowjetunion, die Ukraine. Die Systeme: nationalistische Diktatur, Sowjetkommunismus von Stalin bis Gorbatschow, die postsowjetische Ukraine in allen ihren Zuständen von 1991 bis heute. Die Kriege: 1940, 1941 bis 1944, 2012 bis heute.
Für Menschen seiner Generation ist das nicht einmal ein ungewöhnlicher Lebensweg. Der Krieg riss sie fort wie ein Sturm, es gab kein Halten; er schleuderte sie durch einen Wirbel neuer Herren und Ideologien, und der Einzelne konnte fast nichts dagegen tun. 1941, vor fünfundsiebzig Jahren, überfiel die Wehrmacht die Sowjetunion und entfesselte den Vernichtungskrieg, der alle Schrecken der bisherigen Feldzüge um ein Vielfaches vergrößerte, so schlimm die Bombenangriffe, Massaker und Kämpfe auch gewesen sein mochten. Es ist das Jahr, in dem die Flamme des Krieges von Mitteleuropa übersprang auf den Balkan, nach Griechenland, nach Russland und schließlich in den Pazifik. Er hatte, als es begann, wie ein europäischer Krieg ausgesehen, wenn auch ein besonders brutaler, und viele hofften, er habe seinen Höhepunkt bereits überschritten und werde bald zu Ende gehen. Doch er war ein Weltkrieg, als es endete, die größte militärische Auseinandersetzung der Geschichte, die alle Kontinente erfasste und wenige Staaten der Welt unberührt ließ. Es war das Jahr, in dem der Zivilisationsbruch durch Hitlerdeutschland zwar nicht begann, das war schon 1939 in Polen geschehen, aber zu einer ungeheuren Zahl neuer Opfer führte und als systematischer Genozid organisiert wurde: der Mord an den Juden, den sowjetischen Kriegsgefangenen, der Beginn des «Generalplans Ost» als Basis des deutschen «Lebensraums» im Osten.
Es leben nicht mehr viele Menschen, die dieses entscheidende Jahr noch als Erwachsene miterlebt haben und davon berichten können. Mit der Lebenswirklichkeit der Jüngeren hat es äußerlich so wenig zu tun wie der Mongolensturm von 1241, sieben Jahrhunderte zuvor. Selbst die Großeltern, die meisten von ihnen waren 1941 noch Kinder gewesen wie meine Mutter, deren Vater am 22. Juni im Radio vom Angriff auf die Sowjetunion hörte, das Gerät ausschaltete und sagte: «Der Hitler, dieser Verbrecher.» Für die Generation, die in den sechziger und siebziger Jahren geboren wurde, war die Zeitzeugenschaft der Älteren noch so selbstverständlich, dass man sich oft erst, als wieder einmal eine Beerdigung anstand, Vorwürfe machte, sie nicht noch mehr und noch genauer gefragt zu haben. Viele wären freilich nicht bereit gewesen, die Wahrheit oder überhaupt etwas zu sagen. Und für die anderen, die etwas zu sagen gehabt hätten, kam das Interesse der Nachgeborenen zu spät.
Dieses Buch möchte heutigen Lesern in verständlicher und anschaulicher Weise nahebringen, welche großen und unwiderruflichen Weichenstellungen das Jahr 1941 brachte und welche Motive die Handelnden umtrieben. Es ist kein fachwissenschaftliches Werk, sondern gedacht für ein breites Publikum; aber es beruht auf den Erkenntnissen, welche die Historiker gerade in den vergangenen zwei Jahrzehnten so reichlich gewonnen haben.
Es ist ein Buch über den Krieg. Über den Krieg als Mittel der Politik und über die Politik im Banne eines Krieges, in dem es keinen Ausgleich und keine Kompromisse geben konnte. Diesen Krieg würde Hitlerdeutschland gewinnen, oder seine Feinde, die es angegriffen hatte, würden es tun. Das Buch handelt von den Politikern, die ihn beschlossen und betrieben; von den Soldaten, die ihn führten; von den Menschen, über die er hinwegrollte wie eine Walze aus Feuer; es handelt von Grausamkeit und Verzweiflung, von Mut und Widerstehen.
Und es handelt von der Verantwortung des Menschen für sein Handeln. Ein Krieg ist so wenig wie eine Diktatur eine Sturmflut oder eine Lawine, er ist keine Naturkatastrophe, die unverhofft hereinbricht. Sehr viele Menschen haben Handlungsspielräume, und mögen sie noch so klein sein. Sie haben die Wahl, die richtige oder die falsche Entscheidung zu treffen, wenn auch oftmals nur in Details und innerhalb jener winzigen Ausschnitte des Geschehens, innerhalb deren sie sich bewegten. Ein junger Mann aus, sagen wir, dem Spessart hatte 1941 keine Wahl, ob er zu den Soldaten ging oder nicht; er war durch Wehrpflicht und die mordlustige Militärjustiz dazu gezwungen, gleich, ob er sich für den Krieg begeisterte, ihn fürchtete oder ablehnte. Er war aber nicht gezwungen, in Russland Wehrmachtsbordelle aufzusuchen, auf Zivilisten zu schießen, Speisekammern in Dörfern zu plündern oder lachend Fotos von Judenpogromen zu machen. Es gab sehr viele Soldaten, die solche Dinge getan haben; es gab auch viele, die das nicht taten. Es gab Spielräume. Das Erschreckende ist, wie viele sie nicht nutzten und damit zu Trägern des Vernichtungskrieges wurden. Und doch ist Schuld immer eine individuelle Frage.
Aber weil es so viele, sehr viele waren, die schuldig wurden, handelt das vorliegende Buch auch von der Frage, warum die Wehrmacht sich in solchem Ausmaß an einem verbrecherischen Krieg beteiligte. Heute, zwanzig Jahre nach der Wehrmachtsausstellung des Hamburger Instituts für Sozialforschung und den Arbeiten vieler Historiker wie Jürgen Förster, Johannes Hürter, Christian Hartmann, Wolfram Wette und anderen, muss man nicht mehr darüber diskutieren, ob die Wehrmacht einen verbrecherischen Krieg führte. Natürlich tat sie es.
Das macht nicht jeden zum Verbrecher, der in ihr diente oder dienen musste, solch kollektive Urteile sind immer falsch. Doch sie hat auch nicht, wie es noch Jahrzehnte nach 1945 behauptet wurde, einen richtigen Krieg im falschen, einen «normalen» oder «fairen» Krieg für ein mörderisches System geführt. Das ist an sich ein Widersinn. Aber das Selbstbild einer in großen Teilen «sauberen Truppe», das die beteiligten Generäle gleich nach dem Krieg zeichneten, blieb lange lebendig.
Es hat die «Traditionspflege» der Bundeswehr, ausgerechnet der Armee des Parlaments und des «Staatsbürgers in Uniform», noch über die Ära Kohl hinaus belastet und mitgeprägt. Es hat dazu geführt, dass die ersten klugen Ansätze einer kritischen Militärgeschichtsschreibung, entworfen von Manfred Messerschmidt, am Militärhistorischen Forschungsamt in den Siebzigern auf wenig Gegenliebe stießen. Die Kämpfe von damals muten heute selbst schon wie ein Stück Geschichte an. Sie spiegeln sich noch wider in den ersten Bänden des Standardwerks «Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg». Im Band über den Überfall auf die Sowjetunion, erschienen 1983, haben einige Verfasser wie Jürgen Förster das Konzept des Vernichtungskrieges, den die Wehrmachtsführung bewusst mittrug, klar erfasst und beschrieben. Andere behaupteten noch, «Barbarossa» sei im Grunde ein deutscher Präventivkrieg gegen einen russischen Überfall gewesen. Was den Historikern misslang, schaffte die Wehrmachtsausstellung 1995. Sie enthielt garstige Fehler und manche Übertreibungen, aber sie war es, die den Bann gebrochen hat. Seitdem ist es leichter, das Jahr 1941 in Gänze zu betrachten, in dem Hitler seine willigen Generäle den Vernichtungskrieg planen und ausführen ließ.
Es markiert den großen Wendepunkt in der Geschichte des Zweiten Weltkrieges. Als es begann, stand Großbritannien allein gegen das triumphierende Hitlerreich. Als es endete, führte dieses Reich Krieg gegen die Sowjetunion und die USA. Es war ein Krieg geworden, den es nicht gewinnen konnte und glücklicherweise auch nicht gewonnen hat. Es war auch die Entscheidung zwischen drei Systemen und Weltanschauungen. Anfangs triumphierte der Faschismus, und Hitlers Deutschland, ausgerechnet, war im Bunde mit der Sowjetunion. Zur gleichen Zeit folterte und ermordete die SS in den Konzentrationslagern deutsche Kommunisten. Das perverse Bündnis, das die totalitären Diktaturen 1939 geschlossen hatten, nutzte beiden. Stalin bekam erhebliche Teile Osteuropas und sah erst einmal zu, wie Hitler sich anschickte, die Demokratie in Europa auszulöschen. Aus sowjetischer Sicht war der fortwährende Krieg zwischen Deutschland und England nur ein Gemetzel kapitalistischer Staaten unter sich. Solange es dabei blieb, würden sie sich nicht gegen die Sowjetunion richten, so das Kalkül.
Es hatte unrichtiger nicht sein können. In der Strategie des deutschen Diktators und seiner Umgebung war es das erklärte Ziel schon seit 1940, die Sowjetunion zu vernichten, die in der NS-Ideologie ein «jüdisch-bolschewistisches» System darstellte. Das eroberte Land sollte zum deutschen «Lebensraum im Osten» werden. Mit dem Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941, dem «Fall Barbarossa», erreichte dieser Krieg eine ganz neue Dimension des Schreckens. Zwei das Leben ihrer Bürger allumfassende, ideologisch begründete Diktaturen mobilisierten alle ihre gewaltigen Kräfte und Ressourcen. Nie zuvor hatten so große Armeen so erbittert gegeneinander gekämpft, nie zuvor hatten Eroberer ein solches Ausmaß an Mord und Verwüstung gebracht wie die Deutschen.
Die Sowjetunion hätte wahrscheinlich nicht überlebt ohne die letzte Bastion der – von ihr so verachteten – demokratischen Freiheit Europas: Winston Churchills Großbritannien. Churchills stolze Kampfansage an Hitler, «wir werden uns niemals ergeben», beraubte den deutschen Diktator jeder Hoffnung, er werde im Osten jemals freie Hand für seinen Vernichtungsfeldzug bekommen. Der Versuch Hitlers, seinen Ostkrieg gegen Interventionen der Briten abzusichern, trug den Krieg auf den Balkan, nach Griechenland und Nordafrika. In der perversen Logik der Nazi-Ideologie musste der Russlandfeldzug gewonnen sein, bevor die Amerikaner Großbritannien beispringen würden. Um sie zu schwächen, verbündete sich das Deutsche Reich mit Japan, und im Dezember 1941, binnen weniger Tage, entschied sich nach dem Angriff auf Pearl Harbor das Schicksal der Welt.
Diese historischen Entscheidungen und vor allem das Ringen dreier Systeme 1941 will das vorliegende Buch beschreiben. Der epochale Einschnitt jenes Jahres war ohne jeden Zweifel der Überfall auf die Sowjetunion, er steht daher im Mittelpunkt, samt seinen Zielen und Verbrechen. Es will nicht der Versuchung erliegen, die Verbrechen Hitlers und Stalins ganz oder fast gleichzusetzen. Gewiss, viele, die nach 1939 in Stalins finsteren Machtbereich geraten waren – Polen, Balten, Bessarabier, Juden –, hätten nicht für möglich gehalten, dass es noch schlimmer kommen könnte; diese Zwangsherrschaft aus Terror und Indoktrination übertraf alles Bisherige. Die Deutschen aber belehrten sie eines Schlechteren: Es konnte noch schlimmer kommen, viel schlimmer. Wenn heute Bücher wie Antony Beevors «Stalingrad» und «Berlin» oder Timothy Snyders «Bloodlands» die Gräuel beider Seiten schildern, ist das nur angemessen, solange man sie nicht gleichsetzt. Diese Werke sind aber auch ein verdienstvoller Versuch, die angelsächsische Perspektive auf den Krieg zurechtzurücken, in welcher Stalins Reich jahrzehntelang weder in seiner moralischen Abgründigkeit noch in seinem entscheidenden Beitrag zum Sieg über Nazideutschland angemessen erfasst worden war.
Aber darüber darf man nicht vergessen, dass auch die demokratische Welt 1941 zu ihrer Kraft und ihren Werten zurückfand, obwohl die USA noch lange am Rande des Krieges verharrten. Wahrscheinlich wäre es den angelsächsischen Mächten ohne den Kampf der Sowjetunion nur mit äußerster Mühe – oder der Atombombe – gelungen, Hitlerdeutschland zu schlagen und Europa zu befreien. Und umgekehrt: Ohne die allein gegen die Nazis kämpfenden Briten und ohne die Amerikaner, die mit Geld, Material und Waffen halfen, hätte die Sowjetunion das Jahr 1941 kaum überlebt. Auch davon handelt dieses Buch: von der späten, beinahe zu späten Selbstbehauptung der freien Welt, einer ethisch fundierten Welt, die wir heute als viel zu selbstverständlich betrachten. Aber das ist sie nicht. Sie ist eine historische, einmalige Errungenschaft, und 1941 markiert das Jahr, in dem sie ihre Stimme, ihre Würde und ihre Kraft wiederfand.
München, im Januar 2016
Joachim Käppner
Fünf Menschen, 1941
«Der stille Typ»: Johannes Blaskowitz
Als der Krieg begann, mit dem deutschen Überfall auf Polen, hatte Johannes Blaskowitz fast sein gesamtes Leben in Uniform verbracht. Er wurde 1883 als Sohn eines Pfarrers geboren und stammte aus Wehlau im tiefsten Ostpreußen, gelegen in einer wehmütigen Landschaft aus Birkenwäldern und Seen nahe der Grenze zum Zarenreich. Bereits im Alter von zehn Jahren trat der Junge, der sehr früh seine Mutter verloren hatte, in die Kösliner Kadettenschule ein. Die einheitliche Kluft der Kadetten, die brachiale Disziplin, das Gehorsamsprinzip, das ältere Kadetten den Neuen gern einprügelten: von nun an bis zu seinem letzten Tag bestimmte das Militär sein Leben. Selbst als junger Offizier trug Johannes Blaskowitz die Ausgehuniform, wenn er in Berlin auf Bällen Damen zum Tanz bat. Er war ein guter Reiter und Fechter. 1902 hieß es in der Beurteilung seines Infanterieregiments, er eigne sich als intelligenter und herausragender Soldat aus zwei Gründen zum Offizier: wegen seines militärischen Talents und seines klaren moralischen Standpunktes.[1]
Der Erste Weltkrieg war für Blaskowitz wie für seine ganze Generation ein einschneidendes, die gewohnten Deutungen der Welt erschütterndes Erlebnis. Er war Kompaniechef und Generalstabsoffizier und diente an fast allen Fronten. 1920 übernahm ihn die Reichswehr, wo Blaskowitz als Mann galt, der bis ins Mark von alter Schule sei. Zehn Jahre später war er Landeskommandant von Baden. Die Rettung der wankenden Republik betrachtete er wie die allermeisten Offiziere in keiner Weise als Aufgabe der Truppe, ganz im Gegenteil, der «Parteienhader» sei das «eigentliche Unglück Deutschlands», wie Blaskowitz sagte.
Die Reichswehr und ihre späteren Apologeten bezeichneten deren Haltung gern als unpolitisch. Sie war das genaue Gegenteil. Es war Politik, sich von der Republik und der demokratischen Reichsverfassung zu distanzieren, deren Schutz man gelobt hatte. Es war Politik, sich als eigentlichen Hüter der Nation zu begreifen und die aufsteigende Nazibewegung, je nach Sichtweise, als natürlichen oder auch unnatürlichen, auf jeden Fall hilfreichen Verbündeten zu behandeln. Wie etliche Angehörige des Militärs und der alten Eliten hing auch Blaskowitz der Illusion an, Hitler zur Not in die Schranken weisen zu können: Sollten die Nazis «Dummheiten machen», sagte er 1932 auf einem Truppenübungsplatz, «wird ihnen mit aller Gewalt entgegengetreten werden, und man wird selbst vor blutigsten Auseinandersetzungen nicht zurückschrecken».
Natürlich kam es anders. Hitler entmachtete 1934 die Kampf- und Pöbeltruppe der SA, und die Armee war nun – wie sie es gewollt hatte – alleinige bewaffnete Macht der Nation. Aufrüstung, Soldatenkult und die mühelose Entmachtung möglicher Opponenten festigten Hitlers Griff auf die Wehrmacht, wie die Truppe nun hieß. Generalmajor Johannes Blaskowitz hatte nach der Besetzung Prags im März 1939 die «vollziehende Gewalt» in Böhmen inne. Er war – in seiner, und nur in seiner Welt – ein bedeutender Mann geworden, ein «Glückskind», wie er sich selbst bescheinigte.[2]Wenig deutete darauf hin, dass Johannes Blaskowitz einmal den Zorn des «Führers» auf sich ziehen würde. Der Generalmajor gehörte zu den führenden Kommandeuren beim Angriff auf Polen 1939, er schlug deren Armee in der verlustreichen Schlacht an der Bsura und nahm die Kapitulation eines polnischen Generals in Warschau entgegen, dem er «ehrenvolle» Behandlung versprach. Nach dem Feldzug übernahm er das Amt des Oberbefehlshabers Ost («Ober-Ost»), des höchsten militärischen Vertreters im besetzten Polen («Generalgouvernement») und in Ostpreußen.
Wenn Johannes Blaskowitz von «alter Schule» war, bedeutete dies zunächst: Disziplin, Strenge, Gehorsam, antidemokratische Haltung. Alte Schule bedeutete aber nicht: Massenmorde, willkürliche Exekutionen, brennende Dörfer. Das unterworfene Land bot der deutschen Führung eine Art Blaupause für den späteren Vernichtungskrieg, von Beginn an herrschte Terror gegen Juden und Polen. Verantwortlich waren die SS und weitere Mordorgane wie die Sicherheitspolizei, die Sipo, vor allem aber die Zivilverwaltung des Generalgouvernements unter Hans Frank in Krakau.
Polen erlebte die ersten systematischen Mordaktionen durch die SS-Einsatzgruppen, Opfer waren überwiegend Juden und Angehörige der polnischen Führungsschichten, aber auch Geiseln und angebliche Partisanen. In Będzin brannte die SS mit Flammenwerfern die Synagoge nieder und ermordete binnen zweier Tage fünfhundert jüdische Menschen.[3] Schon am 27. November 1939 verfasste Johannes Blaskowitz einen Lagebericht, in dem er die Verbrechen scharf verurteilte und es ablehnte, «mit den Gräueltaten der Sicherheitspolizei identifiziert zu werden», geschweige denn sie zu unterstützen. OKH-Oberbefehlshaber Walther von Brauchitsch las das Memorandum und ließ es Hitler vorlegen. Der «Führer» tobte: Sein oberster Soldat in Polen habe wohl «kindliche Einstellungen» und vertrete «Heilsarmee-Methoden». Hitler hatte Blaskowitz schon mehrfach gerüffelt, weil er ihm militärstrategisch zu konservativ erschien.
Wenn konservativ bewahrend heißt, dann versuchte der Generaloberst nun, wenigstens ein Minimum herkömmlicher Behandlung der Besiegten zu bewahren. Weiterhin prangerte er den «Blutrausch» von Franks Mordtruppen an. Er war nicht einmal ganz allein, mehrere hohe Offiziere trugen ihm Informationen zu und unterstützten seine Haltung. Ulrich von Hassell, der 1944 von der NS-Justiz ermordet wurde, berichtete am Tag vor Heiligabend 1939: «Erschießungen unschuldiger Juden nach Hunderten am laufenden Band. Blaskowitz hat eine Denkschrift gemacht, in der alles offen dargelegt werde und in der ein Satz stehe, daß zu befürchten sei, die SS werde nach Art ihres Verhaltens in Polen später sich in der gleichen Weise auf das eigene Volk stürzen.»[4] Blaskowitz selbst schrieb: «Die Ansicht, man könne das polnische Volk mit Terror einschüchtern und am Boden halten, wird sich bestimmt als falsch erweisen. Dafür ist die Leidensfähigkeit des Volkes viel zu groß.»[5] Unbeirrt ließ Blaskowitz bis Mai 1940 weitere Eingaben und Memoranden folgen; direkt in Polen eingreifen konnte er nicht, weil die innere Verwaltung, sprich das Mordregime, Hans Frank in Krakau oblag. Blaskowitz bemühte sich aber, jüdische Arbeiter in den Fabriken zu belassen, statt sie in Lager zu sperren, und den Soldaten die Teilnahme an allen Ausschreitungen zu untersagen. Die Wehrmacht war an den Morden in vielen Fällen beteiligt. Etliche Bilder sind erhalten, auf denen Soldaten alte jüdische Orthodoxe umringen und ihnen feixend die Schläfenlocken abschneiden. Die Männer fotografierten sich dabei, Selfies des beginnenden Zivilisationsbruchs.
Blaskowitz wird hier nicht angeführt, weil sein Protest typisch für die Wehrmacht gewesen wäre. Sein Beispiel ist genannt, weil es so untypisch, eine solche Ausnahme ist. Kein anderer General während des gesamten Krieges ist der Vernichtungspolitik so klar und offen entgegengetreten – kein einziger. Während des Vernichtungskrieges in der Sowjetunion ab 1941 gab es niemanden wie ihn. Dabei galt Johannes Blaskowitz keineswegs als Sturkopf, den sein kantiger Schädel und sein preußisches Erscheinungsbild hätten vermuten lassen können. Luftwaffen-Generalfeldmarschall Erhard Milch nannte ihn «den stillen Typ» und nicht besonders charakterstark. Und doch zeigte er mehr Charakter als alle seinesgleichen. Am 8. Dezember 1939 flog Blaskowitz’ Stabschef, General Jäneke, zum Oberkommando des Heeres und legte dort einen weiteren Report über die unfassbaren Verbrechen in Polen vor. Er schilderte Verfolgung und Ghettoisierung der Juden, die Auswirkungen auf die Moral der Truppe und der polnischen Bevölkerung; das besetzte Land sinke in einen Zustand der Gesetzlosigkeit herab. Es gab Debatten und «große Erregung», dann ignorierte OKH-Chef von Brauchitsch den Bericht und gab ihn nicht an Hitler weiter, obwohl Blaskowitz ihn persönlich dazu aufforderte.[6] Von Brauchitsch fiel ihm sogar in den Rücken und ließ den Soldaten in Polen per Befehl mitteilen, der «Volkstumskampf» erfordere eben Härte.
Mitte Mai 1940 warf Hitler den lästigen und ungeliebten «Ober-Ost» schließlich hinaus und versetzte ihn in den Westen. Sein Nachfolger, General Georg von Küchler, unterband jede weitere Kritik aus dem Offizierskorps und arbeitete eng mit dem Vernichtungsapparat zusammen.[7] Die weiteren Jahre sind ein trauriger Epilog. Blaskowitz wurde Oberbefehlshaber im besetzten Frankreich und ließ seine 1. Armee 1942 auf Hitlers Befehl in den unbesetzten Teil des Landes einmarschieren. Gegen die Kämpfer der Résistance ging er hart vor, verbot aber die sonst üblichen willkürlichen Geiselerschießungen. Am Ostfeldzug nahm er nicht teil, vom Widerstand des 20. Juli 1944 distanzierte er sich. In den letzten Kriegstagen war er noch Oberbefehlshaber der «Festung Holland».
Leider wird man niemals erfahren, was Johannes Blaskowitz vor den Richtern des Internationalen Militärtribunals in Nürnberg über das Mordsystem des NS-Staates und die Rolle der Soldaten darin gesagt hätte. Im Prozess gegen das Oberkommando der Wehrmacht 1948 gehörte er zu den Angeklagten. Ein Begleiter sah ihn am 5. Februar plötzlich von der Freitreppe im dritten Stock des Gerichtsgebäudes in die Tiefe der Rotunde stürzen. Johannes Blaskowitz war offenbar freiwillig gesprungen und sofort tot. Für Gerüchte, er sei Opfer eines Mordkomplottes jener ehemaligen Kameraden, die seine Aussage fürchten mussten, haben sich niemals Belege finden lassen.[8]
Mit den Protesten in Polen hat Johannes Blaskowitz nicht viel erreicht. Seine Demarchen loteten aus, wie groß der Spielraum eines Militärbefehlshabers sein konnte. Sie gefährdeten nachhaltig seine Karriere, niemals aber Leib und Leben. Er folgte in diesen Monaten 1939/40 seinem Gewissen, weil sein Gewissen stark genug war. Seine historische Bedeutung liegt weniger in dem, was er geleistet und getan hat. Sie lässt sich nur im Vergleich zu dem ermessen, was alle anderen seinesgleichen nicht geleistet und getan haben. Er zumindest hat den Versuch unternommen, dem Bösen entgegenzutreten, einen Versuch nur, der aber immer mit seinem Namen verbunden bleiben wird.
«Ich danke Ihnen, dass Sie so menschlich waren»: Bob Doe, Jagdflieger (Großbritannien)
Neujahr ist sehr kalt gewesen, der 2. Januar 1941 ebenso. Rings um den RAF-Stützpunkt Warmwell Station liegt Schnee. Dorset im Winter, eine melancholische Landschaft, wie erstarrt in Frost und Nebel. Im Kriegstagebuch der 238. Squadron ist für die beiden ersten Tage des neuen Jahres notiert: «Nothing of interest.» Nichts von Interesse. Über Dorset haben, nur wenige Monate ist das her, die härtesten Kämpfe der Luftschlacht um England getobt. Aber jetzt ist alles still. Erst am dritten Tag geschieht etwas.
Bob Doe, Jagdflieger, sieht die Winterlandschaft aus 15000 Fuß Höhe, hell scheint der Mond auf Felder und Dörfer. Er hat keinen Blick dafür. Irgendetwas stimmt nicht mit seiner Hurricane, dem einmotorigen Jagdflugzeug, das doch so robust und zuverlässig ist. Der Öldruck sinkt, der Motor macht merkwürdige Geräusche. Dank des neuen, störungsfreien VHF-Funks alarmiert er den Stützpunkt. Er solle zurückkommen, so schnell wie möglich, heißt es dort. Es sind keine deutschen Flugzeuge in der Gegend, unten in Warmwell schießen sie Leuchtraketen ab; von oben winzige bunte Sterne, die den Weg heim weisen. Auf 10000 Fuß bleibt der Motor stehen. Aber eine Hurricane fällt dann nicht vom Himmel; Does Flugzeug segelt auf den starken Tragflächen abwärts, gelenkt von der ruhigen Stimme aus dem Funkgerät. Er kommt vor der Landebahn herunter, besser könnte es nicht sein, denkt er. Er sieht noch dunkel den Schatten des Hangars zu seiner Rechten. Und dann ist alles schwarz, kein Licht mehr.
Die Hurricane ist in ein Hindernis gekracht, Bob Doe wird von der Wucht des Aufpralls aus dem Gurt gerissen und schlägt voll mit dem Gesicht in die Armaturen. Das Bodenpersonal holt ihn rasch aus dem Wrack. Er erwacht erst viele Stunden später, bandagiert, betäubt von der schweren Narkose: «Eine junge Krankenschwester, noch in der Ausbildung, hat mit mir gesprochen, sie wollte mich bei Bewusstsein halten, glaube ich. Das Mädchen war sehr hübsch, anders als ich mit dem zertrümmerten Gesicht. Dann habe ich begriffen, wovon sie die ganze Zeit redete: Ich hätte Glück, denn genau in meinem Bett hier sei Lawrence von Arabien gestorben.» Ein Schönheitschirurg wird sein Gesicht später fast ganz wiederherstellen, Bob Doe wird auch wieder fliegen, in Burma, und Flugschüler ausbilden, die grün und verängstigt sind, wie er es einmal war. Aber seinen wichtigsten Beitrag hatte er im Januar 1941 schon geleistet.
Im Hospital hat er oft zurückgedacht. Bob Doe hat zu jenen Jagdpiloten gehört, die den Deutschen am Himmel über Südengland ihre erste und historische Niederlage zufügten. Zwei Tage nach dem 13. August 1940, den der deutsche Luftwaffenchef Hermann Göring tönend zum «Adlertag» ausgerufen hatte, hatte er seinen ersten Kampfeinsatz: «Ich dachte nur: Ich bin der schlechteste Pilot der ganzen Staffel.» Seine Performance in der Flugakrobatik hatte die Ausbilder verdrossen den Kopf schütteln lassen. Da saß er in der modernsten Jagdmaschine der Welt, die Bodenstation führte ihn unaufhaltsam den deutschen Angriffsverbänden entgegen, und er fühlte sich klein, hilflos, ohne Kompetenz. Anderen erging es nicht besser, zwei der jungen Männer flogen sogar aus Versehen nach Frankreich. Und dann fand sich die RAF-Staffel unversehens mitten in einem deutschen Bomberpulk wieder. Doe folgte seinem Kommandanten in eine scharfe Kurve und hatte plötzlich eine Me 110 im Reflexvisier, einen großen zweimotorigen Begleitjäger mit zwei Mann Besatzung; er eröffnete das Feuer aus acht Maschinengewehren. Zu seiner Verblüffung kippte die Messerschmidt über die Tragfläche zur Seite und stürzte direkt ins Meer. Eine zweite Me 110 näherte sich ihm von hinten, er hatte sie nicht einmal bemerkt. Doch der deutsche Pilot war zu schnell und zog an ihm vorbei. Wieder drückte Doe auf den roten Knopf, und wieder schoss er ein Flugzeug mit Hakenkreuzzeichen ab. Er hatte getroffen und getötet, er war im Krieg. Bob Doe war gerade 20 Jahre alt.
Am 7. September, die Luftschlacht tobte immer noch, waren nur noch drei der 15 Piloten dabei, mit denen die Staffel den Einsatz begonnen hatte. Die anderen: tot, vermisst, verwundet. Am 10. Oktober erwischte ihn ein deutscher Jäger, als sein Flugzeug gerade aus einer Wolke kam; Doe wurde verwundet und stieg gerade noch rechtzeitig mit dem Fallschirm aus. Zu diesem Zeitpunkt hatte die RAF die «Battle of Britain» fast schon gewonnen – solange sie den Himmel über Südengland nicht preisgab, würde es keine Invasion der Wehrmacht über das Meer geben können, gleichgültig, ob Hitler in Berlin drohte, er werde Englands Städte «ausradieren» lassen. Mit 14 bestätigten und einigen wahrscheinlichen Luftsiegen gehörte Doe jetzt zu den «Assen» – und zu den Männern, denen Churchill voller Pathos, aber zu Recht bescheinigte, die letzte Bastion der Demokratie in Europa gerettet zu haben: «Niemals in der Geschichte des Krieges haben so viele so wenigen so viel verdankt.»
Aber Bob Doe hat nie jenen Sieg vergessen, den er nicht errang. Es war auf dem Höhepunkt der Schlacht, wie er später erzählte: unter ihm das Meer, unruhig, schäumend, bedrohlich, vor ihm der deutsche Messerschmidt-Jäger, eine Me 109. Bob Does Spitfire hängt am Himmel hinter ihr, folgt ihr, es gibt kein Entkommen, die deutsche Maschine qualmt, das Glasdach des Cockpits ist abgerissen, darin der Pilot. Die Messerschmidt trudelt ins Visier, ein Druck auf den roten Knopf am Steuerknüppel, und Doe würde ein Ende machen mit dem «Hunnen», der übers Meer kam, um die Briten in die Knie zu zwingen, einer von so vielen.
Aber Doe schießt nicht. Sein Herz rast. Er sieht, wie der deutsche Pilot mühsam die Kontrolle über seine Maschine bewahrt, ein junger, gut aussehender Mann. Bob Doe ist nun Herr über dieses fast verwirkte Leben. Er lenkt die Hurricane neben den Deutschen und schaut hinüber, der andere starrt fassungslos zurück. Doe gibt ihm das universale «Thumbs up»-Zeichen und legt seine Jagdmaschine in eine steile Kurve. Zurück, nach Hause.
Lange nach dem Krieg, so wird Doe später berichten, «bekam ich einen Brief einer Frau Pingel aus Deutschland. Sie schrieb mir: Mr. Doe, ich danke Ihnen, dass Sie so menschlich waren und meinen Mann leben ließen. Ohne Sie würde es meine Kinder und Enkel nicht geben.» Rolf Pingel war ein deutscher Jagdflieger; 22 alliierte Maschinen sind ihm zum Opfer gefallen. Luftkriegshistoriker, eine in Großbritannien sehr beliebte Spezies, streiten bis heute: War der Mann in der Messerschmidt wirklich Rolf Pingel, wie allgemein vermutet wurde, oder ein anderer? Aber eigentlich tue das wenig zur Sache, sagte Bob Doe im Interview 2009, ein Jahr vor seinem Tod: «Man muss sich auch in einem Krieg an den Werten messen, die man verteidigt.»[1] Als er weitersprach, ein alter Gentleman, brachte er das Gespräch lieber schnell auf seinen Hauscocktail: Noilly Prat, Gin, ein wenig Zitrone. Etwas für Männer, sagte er, lachte und sah zur Seite. Seine Augen waren feucht. Der Krieg nimmt keine Rücksicht auf Gefühle. Und über sie zu sprechen, über das Töten, das er niemals wollte, fiel Bob Doe noch 69 Jahre nachher sehr, sehr schwer.
«Lord Kern der Sache»: Harry Hopkins, Berater des Präsidenten (USA)
Das Flugzeug kam rasch näher über das ruhige Meer der Karibik, bald war das Dröhnen der Propeller zu hören. Gefolgt von einer Fontäne aus Gicht, setzte es direkt neben dem schweren Kreuzer USS Tuscaloosa auf: Ein Flugboot der Navy brachte am 9. Dezember 1940 Post aus Washington – einen einzigen Brief. Ein Offizier des Schiffes trug ihn in die Kabine des Gastes, der sich hier häuslich eingerichtet hatte, mit Akten und Verschlusssachen, Romanen, Pokerkarten und Zigarren aus Kuba: Franklin D. Roosevelt, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Offiziell diente diese Reise dem Zweck, Marinebasen zu inspizieren; aber eigentlich gehörte sie zu jenen kleinen Fluchten aufs Meer, mit denen Roosevelt Erholung und neue Kraft suchte und meistens auch fand. Der Präsident genoss Sonne und Wärme, angelte, sah sich an Bord Kinofilme an, und bei alldem war nur ein kleiner Kreis von Vertrauten dabei sowie Pala, sein neuer Foxterrierwelpe.
Und, wie immer, Harry Hopkins. Der Fünfzigjährige sah zu, wie Marinesoldaten den Rollstuhl des Präsidenten auf einen windgeschützten Platz an Deck brachten und sich diskret zurückzogen. Hier saß Roosevelt allein und las, wie Hopkins dem Absender später berichtete, «den Brief wieder und wieder». Dieser Absender war Winston Churchill, Premierminister Großbritanniens, des letzten Staates Europas, der sich Hitlers Kriegsmacht widersetzte. Nur: Wie lange noch? Genau davon handelte das Schreiben, auf vielen Seiten, verfasst mit allem Gefühl für Drama und Überredungskunst, über das Churchill so reichlich verfügte. Es war, sollte er später sagen, «einer der wichtigsten Briefe meines Lebens».[1]
Zu diesem Zeitpunkt mussten die bedrängten Briten jede einzelne Patrone, jedes Ersatzteil, sämtliche Hilfsgüter aus den USA umgehend bezahlen, so sah es ein Gesetz vor, das die Isolationisten in den USA vor längerem schon durchgesetzt hatten. Ohne materielle Hilfe aus Amerika aber würde England diesen Krieg nicht durchhalten, trotz aller Ressourcen des Empires und der Kolonien. Die Ökonomie des Krieges war unbarmherzig: Die Dollarreserven gingen schneller zur Neige als die Bestände an Schiffen und Kampfflugzeugen, und das nach vierzehn Monaten eines Krieges, dessen Ende unabsehbar war.
Die britischen Streitkräfte seien derzeit außerstande, schrieb Churchill offen, «den immensen Armeen Deutschlands auf irgendeinem Schauplatz des Krieges standzuhalten». Zwar sei in Großbritannien selbst die Invasionsgefahr «stark zurückgegangen» seit dem Sieg in der Luftschlacht und der Neuaufstellung der Armee. Die Schiffsverluste auf der lebenswichtigen Atlantikroute aber, überwiegend durch U-Boote verursacht, hatten katastrophale Ausmaße erreicht, Tendenz steigend. Neben vielen anderen Bitten äußerte Churchill schließlich den entscheidenden Wunsch: «Ob geschenkt, geliehen oder geliefert: eine große Zahl amerikanischer Kriegsschiffe, vor allem Zerstörer, sind unverzichtbar, um die Atlantikroute offenzuhalten.»[2]
Das war der entscheidende Punkt. Hopkins hat Roosevelts Reaktion später so geschildert: Zwei Tage habe der Präsident nachgedacht, von Churchills Brief tief bewegt – konnte das Schicksal der freien Welt wirklich von Barzahlungsklauseln der amerikanischen Außenhandelsgesetze abhängen? «Dann schilderte er plötzlich die Lösung – das ganze Programm. Er schien keine genaue Vorstellung davon zu haben, wie man das rechtlich tun könnte. Aber er hatte keinen Zweifel, dass er einen Weg finden würde.» Das Lend-Lease-Programm war geboren, die Idee, den Briten zunächst Dutzende älterer Zerstörer zu «leihen», im Gegenzug zu Nutzungsrechten für einige britische Übersee-Stützpunkte: So technisch das klang, es war der Anfang eines gewaltigen Hilfsprogramms, ja der erste ganz große Schritt der USA in Richtung Krieg gegen Nazideutschland – und zugleich der Weg, den Widerstand des Kongresses und der öffentlichen Meinung in den USA auszuhebeln: Amerika würde fürs Erste nicht kämpfen, aber dem Bedrängten helfen. In dieser entscheidenden Frage der Weltpolitik sollte nicht, wie es Roosevelt nach seiner Rückkehr vor der Presse ausdrückte, das «Dollarzeichen» entscheiden. Hopkins hatte die Idee zusammen mit dem Präsidenten entworfen, dem er nachher gelassen Ruhm und Urheberschaft überließ.
Er hat nie ein offizielles Amt bekleidet und gehört doch zu den Schlüsselfiguren der Demokratien im Zweiten Weltkrieg: Hopkins, der treue Diener seines Herrn; die «graue Eminenz» im Weißen Haus, der über lange Jahre einflussreichste Berater Roosevelts; groß und dünn, the «half man», wie der magenkranke, oft bleiche, ausgezehrt wirkende Freund des Präsidenten in Washington genannt wurde; der Mann mit den strengen Zügen, zurückweichendem Haar und Augen voller Leidenschaft und Konzentration, der trotz Krankheit und Stress geistreich und voller Witz war, vor allem, wenn letzterer zulasten pompöser Würdenträger und Verursachern von Ungerechtigkeiten aller Art ging.
Das lag gewiss an seiner Herkunft aus sehr schlichten Verhältnissen. Als Sohn eines Veteranen aus dem amerikanischen Bürgerkrieg hatte der junge Hopkins nach dessen Tod bei der Mutter im Laden geholfen. Als engagierter Mitarbeiter der Arbeitslosenhilfe fiel er Roosevelt auf, damals Senator in New York. Hopkins beschrieb die große Depression nach dem Bankencrash von 1929 so: «Jedes Mal, wenn der Sekundenzeiger auf der Uhr vorrückt, verliert ein Mann seinen Job.» Er wurde zum Chefarchitekten des so unkapitalistischen New Deal – das erfolgreiche staatliche Arbeitsbeschaffungsprogramm schuf Jobs für mindestens fünfundzwanzig Millionen US-Bürger – und damit zum Lieblingsfeind der amerikanischen Erzkapitalisten, Großkonzerne und der politischen Rechten. Viel von dem Hass, der eigentlich dem Präsidenten galt, traf ungefiltert Hopkins. Selbst im eigenen Lager war er nicht beliebt, vielen erschien er unheimlich, zu nah am Präsidenten. In Washington galt er, wie sein Mitarbeiter Robert E. Sherwood kurz nach dem Krieg schrieb, als «spezielle Iowa-Mischung aus Machiavelli, Svengali und Rasputin».[3] Hier mischten sich giftiger Hauptstadttratsch mit Neid und Bewunderung. Vor allem gingen alle drei Namen, Sinnbilder für jeder Moral entkleidete Suche nach Macht, an Hopkins’ sozialen und demokratischen Grundwerten vorbei. Der Kampf an Roosevelts Seite gegen den Faschismus und für die Freiheit wurde die zweite große Mission dieses so unideologisch wirkenden Mannes.
Roosevelt war Churchill nur ein Mal beiläufig begegnet, 1918 in London, wo er ihn als selbstgefälligen Vertreter der englischen Oberschicht empfand. Churchill konnte sich daran nicht erinnern. Nun, Anfang 1941, von der erholsamen Ruhe auf der Tuscaloosa in den Washingtoner Betrieb zurückgekehrt, schickte der Präsident seinen diskreten Berater nach London, um die Lage, die Stimmung und vor allem die Möglichkeiten der weiteren Unterstützung auszuloten. Selbst für einen VIP wie Hopkins war ein Flug über den Atlantik eine zermürbende Angelegenheit. Zwar flog er im «Yankee Clipper», einem riesenhaften viermotorigen Flugboot der Pan American mit allen Annehmlichkeiten. Doch mit kriegsbedingten Umwegen und mehreren Tankstopps kam er erst nach drei Tagen in England an, am 9. Januar 1941. Churchills Mitarbeiter Brendan Bracken erwartete den Gast in Poole an der Südküste und war, wie Hopkins’ Biograph David Roll schreibt, «alarmiert, als er Hopkins sah: bleich, dünn wie ein Skelett, mit vor Fieber glitzernden Augen, lag er in seinem Sitz», unfähig, die Maschine zu verlassen oder auch nur den Sitzgurt zu öffnen.[4] Als man Churchill berichtete, Roosevelt schicke einen privaten Vertrauten namens Harry Hopkins, soll er gefragt haben: «Harry wer?»[5]
Das war kein vielversprechender Auftakt. Auch die ersten politischen Begegnungen mit Außenminister Anthony Eden und Lord Halifax («ein hoffnungsloser Tory», der glücklicherweise im Krieg gegen Hitler nichts mehr zu sagen habe) beeindruckten den Emissär wenig. Am Freitagmittag stand er schließlich in Downing Street Number 10, dem Sitz des Premierministers, und betrachtete Handwerker beim Beseitigen von Bombenschäden; abends schrieb Hopkins an Roosevelt: «Ein runder, rotgesichtiger Mann erschien und lächelte, er streckte mir eine fette, aber nichtsdestoweniger überzeugende Hand hin und hieß mich in England willkommen.» Es war der Beginn einer großen Freundschaft, persönlicher vielleicht als die von Churchill und Roosevelt, und einer immens wichtigen Arbeitsbeziehung.
Churchill ernannte Hopkins, der das direkte Wort liebte und bis an die britische Schmerzgrenze benutzte, so scherzhaft wie respektvoll zum «Lord Root of the Matter». Lord Kern der Sache verbrachte sechs Wochen in England, Churchill zeigte ihm Bunker und Flakstellungen an der südlichen Steilküste, nahm ihn mit auf ein Minensuchboot, von dem Hopkins beinahe ins Meer gefallen wäre, und in die Zirkel aller wichtigen Entscheider. Viele Tage verbrachte der Amerikaner in Chartwell, Churchills Landhaus, und erweckte sogar Eifersucht: «Es erscheint mir, als sei das Allererste, wonach Churchill fragt, wenn er morgens erwacht, Harry Hopkins. Und Harry ist der Letzte, mit dem er noch spricht, bevor er zu Bett geht», murrte der US-Minister Harold Ickes, nicht ohne hinzuzufügen, dass Churchill sicher ebenso gewinnend auftreten würde, hätte ihm Roosevelt einen Mann mit einer ansteckenden Seuche geschickt.[6]
Man darf nicht vergessen, dass viele US-Diplomaten, etwa der einflussreiche, erst nach Roosevelts Wiederwahl im November 1940 zurückgetretene US-Botschafter in London, Joseph P. Kennedy, aufseiten der Appeaser standen und Churchill nicht zutrauten, gegen Hitler zu bestehen. Hier war nun jemand in London, der eine andere Botschaft verkündete: «Alles, was wir wollen, ist, den verdammten Hurensohn Hitler fertigzumachen.» Iowa pur, zur hellen Freude des Premiers, und dass Hopkins damit ohne Zweifel seine Befugnisse überschritt, störte Churchill kein bisschen. Er hatte einen Mann nach seinem Herzen gefunden, und wenn der Mann verknitterte Anzüge trug, wirre Haarsträhnen über die Stirn strich und schlagfertige Witze riss, umso besser.
Hopkins berichtete Roosevelt vom Kampfgeist der Briten und Churchills Entschlossenheit, sich den Nazis niemals und unter keinen Umständen zu beugen: «Wenn Mut allein einen Krieg entscheiden könnte – dessen Ausgang wäre unvermeidlich … Diese Regierung braucht unsere Hilfe, Mr. President, sie braucht alles, was wir ihr nur geben können.»[7] Von da an war Hopkins die Schaltstelle zwischen Präsident und Premierminister, Mittler und Mediator; nicht im Bunde der Dritte, das wäre viel zu viel gesagt, aber der richtige Mann an der richtigen Stelle. Er war es, der das erste persönliche Treffen der beiden 1941 vor Neufundland organisierte, das in der Atlantik-Charta für eine freie Welt endete, und der Churchill bei seinem Besuch in Washington im Dezember desselben Jahres kaum von der Seite wich. Noch auf der Konferenz von Jalta mit Stalin 1945 war er dabei, gleich seinem Präsidenten vom nahenden Tod gezeichnet; er starb 1946, nur ein Jahr nach Roosevelt.
Sein Nachruhm wäre weit größer, hätte er im Entscheidungsjahr 1941 nicht noch einen anderen engen Gesprächspartner gefunden: Josef Stalin. Nach dem deutschen Überfall flog Hopkins, auf noch mühsameren Wegen, nach Moskau, wieder als Roosevelts Vertrauter, und traf den Tyrannen im Kreml. Es war Ende Juli 1941, die Wehrmacht errang in Russland Sieg auf Sieg. Stalin mochte krankhaft misstrauisch und verschlagen sein, und doch war Hopkins einer der ganz wenigen Politiker aus dem Westen, die er sofort respektierte und auf deren Wort er etwas gab. Hopkins selbst behauptete scherzhaft, dass sei nur seiner Fähigkeit zu verdanken, Wodkaabende mit den russischen Gastgebern durchzuhalten: «Wodka has authority.»
Natürlich, Stalin wusste die Gelegenheit zu nutzen und versicherte sich in dieser Stunde der Bedrängnis amerikanischer Hilfe durch Lend-Lease-Waffen und Material, die fortan reichlich flossen. Aber er gab auch etwas dafür: kämpfende Armeen. Hopkins hatte im Januar verstanden, dass Churchill und die Briten niemals aufgeben würden, jetzt im Juli erkannte er denselben eisernen Willen in Moskau. In beiden Fällen hatten Amerikas Außenpolitiker das Gegenteil behauptet und einen Sieg Hitlers vorhergesagt. In beiden Fällen wusste es Hopkins nicht nur besser, er überzeugte auch Roosevelt davon. Gewiss spürte er die Aura von Macht und Bedrohung, die um Stalin herrschte, die Angst in den Augen der Kreml-Mitarbeiter, wenn der Diktator ihnen über den Mund fuhr. Aber Macht verkörperte Hopkins selbst – die des Präsidenten der USA.
Ein deutscher Luftangriff unterbrach das Gespräch, Stalin nahm Hopkins mit zum großen Bunker in der Metrostation Kirowskaja. Dort wartete bereits NKWD-Chef Berija, um seinen Gebieter eilfertig in die Sicherheit der Tiefgeschosse zu bringen. Oleg Chlewijuk überliefert in der neuen Stalin-Biographie den Bericht eines Funktionärs über die anschließende Szene: «Berija nahm Stalins Arm. … Stalin reagierte grob und heftig, so wie er es immer tat, wenn er zornig war: ‹Fort mit Ihnen, Sie Feigling!›» Hopkins und Stalin sahen in den Nachthimmel, zuckende Scheinwerfer suchten nach den deutschen Bombern. «Dann passierte etwas, was während der nächtlichen Luftangriffe selten geschah»: Rasch hintereinander traf die Flugabwehr zwei Flugzeuge, die brennend durch die Dunkelheit hinabstürzten. «‹Das wird jedem passieren, der mit dem Schwert zu uns kommt›, sagte Stalin. ‹Und jeder, der im Guten kommt, wird als Gast willkommen geheißen.› Er nahm den Arm des Amerikaners und führte ihn nach unten.»[8]
Später, nach dem Krieg, in der Ära des eifernden Gesinnungsschnüfflers McCarthy, entstand in der amerikanischen Rechten die bis heute nachwirkende Verschwörungstheorie, Hopkins sei ein sowjetischer Spion gewesen oder habe zumindest dem Stalinismus nahegestanden. So hat der Kalte Krieg das Denken verzerrt. Hopkins war ein Realist. Er erkannte, dass allein Hitlers Aggression die Demokratien und den Sowjetkommunismus zusammengeführt hatte. Und wenn dies so war, so konnte der Westen die Rote Armee als Bündnispartner dringend brauchen; sie trug, über den ganzen Krieg gesehen, ja die Hauptlast des Landkrieges gegen die Wehrmacht. In diesem Juli 1941, todmüde und krank, begegnete er Stalin auf Augenhöhe: «Wir (die USA) hatten keine Zeit, uns lieber zurückzuhalten, weil Russlands Wege nicht die unseren waren. Wenn wir Hitlers Macht brechen konnten, indem wir Russland mit Waffen unterstützten, dann war der Präsident bereit, diese Hilfe zu leisten.»[9]
Gewiss verabscheute er, ähnlich wie Roosevelt, den Sowjetführer bei weitem nicht so sehr, wie Churchill dies tat, der das Verbrecherische in Stalins System viel tiefer erfasste. Offenbar vermied Hopkins Stalin gegenüber jedes Wort über die Millionen Toten des sowjetischen Terrorsystems. Aber wenn am Ende des Jahres die «große Allianz» stand, die den NS