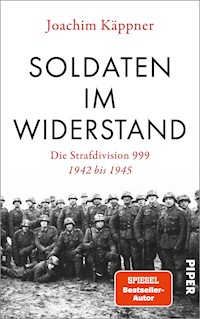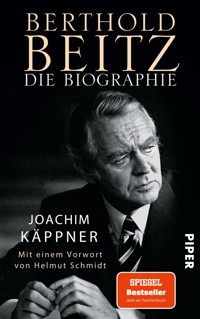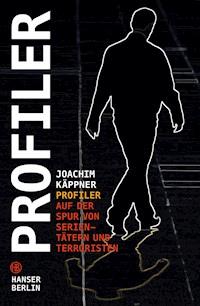
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser Berlin
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Spätestens seit dem Film "Das Schweigen der Lämmer" ist um Profiler ein enormer Kult entstanden. Joachim Käppner erzählt davon, wie "operative Fallanalytiker" in Deutschland wirklich arbeiten. Ausführlich beschreibt er vor allem die Münchner Profiler um Alexander Horn, die bereits 2006 die Neonazi-Morde des NSU an neun Ausländern als Verbrechen extremistischer oder wahnsinniger Einzeltäter einstuften. Damals glaubte ihnen keiner, und die Ermittler suchten weiter eine ominöse ausländische Mafiagruppe. Was Käppner über die Hintergründe und Ermittlungspannen berichtet, liest sich selbst wie ein Krimi.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 535
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanser Berlin E-Book
Joachim Käppner
PROFILER
Auf der Spur von
Serientätern und Terroristen
Hanser Berlin
ISBN 978-3-446-24415-3
© Hanser Berlin im Carl Hanser Verlag München 2013
Schutzumschlag: Peter-Andreas Hassiepen, München, unter Verwendung einer Fotografie © imago/Rainer Unkel
Alle Rechte vorbehalten
Satz: Greiner & Reichel, Köln
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
INHALT
Einleitung:
Zwei Männer, zwei Wahrheiten
1 Das Verbrechen verstehen:
Eine Vorgeschichte des Profilings
Der Vampir: Peter Kürten (1930) - Der Albtraumspiegel: Verbrechen und Zivilisationskritik - Dunkle Barone, Bluttrinker, Mordschlösser: Finstere Welten - »Brief aus der Hölle«: Jack the Ripper (1888) - Wolfsmenschen: Serienmord und Öffentlichkeit (ab 1918) - Das Antlitz des Mörders: Erste wissenschaftliche Ansätze
2 »Dark Dreams«:
Die Pioniere des FBI
»Ein besonderer Zorn«: Anchorage 1987 - Der große weiße Unbekannte: Washington 2002 - »Ich könnte Ihnen jetzt den Kopf abreißen«: Die ersten FBI-Profiler - Handschrift, Modus Operandi, Serie: Definitionen - Der Profiler-Hype: Kritik und Korrekturen - Der Professor: Internationale Entwicklungen
3 »Blick in die Glaskugel«:
Die Gründerzeit der Operativen Fallanalyse in Deutschland
Täter unbekannt: Mord im Hölzl - »Mister 100 Prozent«: Udo Nagel und die Gründung der OFA München (ab 1995) - Wiener Blut: Thomas Müller - Tod am Franzosenbunker: »Versionsbildung« in der DDR - »Da kommen die Forscher«: Das BKA - Meisterprüfung: Der Fall Nelly 1998 - Lernziele: OFA-Einheiten in den Bundesländern - Die Liebe eines Mörders: Der Hamburger Weg
4 Drei Fälle
Der Mann ohne Mitleid: Suche nach einem Sadisten - Die Angst wirft lange Schatten: Der Kehler Frauenmörder - Ein Doppelleben: Frank G.
5 Zu Besuch bei der OFA München:
Der Alltag der Profiler
Tod in Königsbrunn - Die Fallanalyse, Phase eins: Informationssammlung - Die Fallanalyse, Phase zwei: Auswertung - Das Team - Der Psychologe - Die Datenbank ViCLAS - Die Fallanalyse, Phase drei: Präsentation - Der freundliche Kollege: Mareike
6 Ein Exkurs über das Böse
Dunkle Sterne: Karolina (2004) - Monster und Bestien: Was ist normal?
7 Die Spur der Phantome:
Grenzen der Fallanalyse
Berufsrisiko: Falsche Hypothesen - Die unheimliche Frau: Ein Fahndungsdebakel - Eine Glaubensfrage: Peggy - Zerwürfnisse: Thomas Müllers Abschied 2005
8 Ein Bild von einem Täter:
Fallanalyse und Forschung
Was zuvor geschah: Lebensgeschichten von Sexualverbrechern - Bewegungsmuster (I): Geographisches Verhalten von Sexualstraftätern - Bewegungsmuster (II): Der »Brummimörder« - Kinder als Opfer von Sexualverbrechen (I): Erhöhtes Risiko - Kinder als Opfer von Sexualverbrechen (II): Michelle - Der Lockvogel: Künftige Einsatzmöglichkeiten
9 Fallanalyse und Justiz:
Beweismittel im Strafverfahren?
Der übliche Verdächtige: Die OFA und der Fall Harry Wörz - Achtzehn rote Rosen: Eine Frage der Schuld
10 Wie ein Albtraum:
Der Mann mit der Maske
Sein längster Fall: Die Suche (1992–2011) - Tränen eines Mörders: Der Mann ohne Maske (2011–2013)
11 Terror von rechts:
Chiffren eines tödlichen Codes
4. November 2011: Das Ende des NSU - Sieben Morde und kein Täter: 2000–2005 - Die Fahnder: So viele Spuren, und alle führen ins Nichts - 2006: Die Mörder sind zurück - Horns Hypothese vom Ausländerfeind: »Der Moment, an dem alles zusammenpasst« (2006) - Weil nicht sein kann, was nicht sein darf: Die fixe Idee - Verpasste Chancen: Nichts hören und nichts sehen wollen - Pleiten, Pech und Pannen: Die Suche im rechten Milieu - 2007: Zurück auf null: Die Krise der OFA - Post aus Quantico: Das FBI schaltet sich ein - Ein trister Epilog und eine Hoffnung (2008–2011)
Fazit
Dank
Abkürzungen
Literatur
Quellen/Andere Medien/Internet
Anmerkungen
EINLEITUNG: ZWEI MÄNNER, ZWEI WAHRHEITEN
Ein warmer Frühlingstag im Berliner Regierungsviertel. Es ist Mai 2012. Draußen tuckern die Touristenboote vorbei, die Sonne scheint durch die Panoramafenster in den Sitzungssaal des Paul-Löbe-Hauses. Der Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages ist bei der Arbeit, unter den Fragen der Abgeordneten windet sich ein Leitender Oberstaatsanwalt.
Nein, er kann nicht erklären, was eigentlich falsch gelaufen ist. Nein, er weiß keine Auskunft zu erteilen, warum Neonazis mehr als ein Jahrzehnt lang mordend und raubend durchs Land gezogen sind, warum sie neun Männer ausländischer Herkunft und eine Polizistin erschießen konnten, ohne dass der Sicherheitsapparat auch nur eine Ahnung von der Existenz der Terrorzelle NSU hatte. Und nein, eigentlich weiß er bis heute nicht, was man ihm und den Strafverfolgern eigentlich vorwirft und wo er jemals etwas falsch gemacht hätte.
Die Anhörung zieht sich, zäh, unerfreulich, uneinsichtig wirkt alles, was der Zeuge vorbringt. So haben viele hier gesprochen und werden es weiter tun: Polizeichefs, Ministerialbeamte, Verfassungsschützer, Politiker. Der Oberstaatsanwalt erregt erst gegen Ende Aufsehen, als er doch noch etwas zugeben muss. Zu seiner Zeit habe die Sonderkommission in Nürnberg eine eigene Dönerbude betrieben, und dies nicht zur Versorgung der Heerscharen von Polizisten, welche vergeblich nach dem großen Unbekannten suchten. Nein, sie eröffnete den Dönerladen, um Tatverdächtige anzulocken. Einige der Verbrechen waren in Imbissständen geschehen. Nur ist der Mörder niemals beim Döner vom Amt erschienen.
»Und wenn er doch gekommen wäre – wer hätte den Dönerbrater im Dienste der Polizei dann geschützt? Lag für diesen Fall draußen Tag und Nacht ein Scharfschütze auf der Lauer?«, fragt sarkastisch ein Abgeordneter. Ein peinliches Detail nur, gewiss, aber eines, das illustriert, wie sehr sich die Strafverfolger in die Idee verrannt hatten, die Taten seien das Werk einer ominösen Drogenbande, der organisierten Ausländerkriminalität, der türkischen Mafia.
Die beiden Männer haben währenddessen gewartet, Stunde um Stunde; es ist später Nachmittag, als sie sich auf die Zeugenstühle setzen. Rechts nimmt Udo Haßmann Platz, links Alexander Horn. Haßmann ist Profiler aus Baden-Württemberg, mit Glatze, tiefer Stimme und Goldkette am Arm eine eindrucksvolle Erscheinung, fast wie aus dem Kriminalroman. Horn hat den gleichen Job beim Polizeipräsidium in München, er ist schlank, hochgewachsen, und wenn er lächelt, wirkt er ein wenig jungenhaft. Doch das mag täuschen.
Ohnehin gibt es wenig zu lächeln an diesem Spätnachmittag. Horn und sein Team hatten2006, nach dem neunten Mord, die Ermittlungen grundsätzlich in Zweifel gezogen und sich gefragt: Können wir etwas sehen, was die anderen nicht sehen? Und sie hatten etwas gefunden. Sie glaubten nicht mehr an Mafiakiller im Auftrag einer Türkenbande, von der die Polizei noch nicht einmal wusste, ob sie überhaupt existierte. Horn war zu einem ganz anderen Schluss gekommen, als sie ein Profil des Täters zu umreißen versuchten. Dieser handele aus Zerstörungswut, getrieben von einem ausländerfeindlichen Vernichtungsmotiv. Es handele sich womöglich auch um zwei Personen. Eine Kleinstgruppe wie den NSU, wie sich im November 2011 herausstellen wird, als Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos sich auf der Flucht vor der Polizei erschießen und Beate Zschäpe sich stellt.
Natürlich hatten die Münchner Profiler nicht exakt dieses Horrortrio vor Augen gehabt, auch ein verwirrter Einzelgänger wäre denkbar gewesen. Aber die Eckpfeiler ihrer Hypothese stimmten – und wurden doch vom Fahndungsapparat mit einer Verve verworfen, als habe man niemals etwas Dümmeres hören müssen. Eilig bestellte die Kripo 2006 ein Zweitgutachten, diesmal von Horns Kollegen Haßmann aus Stuttgart. Und der brachte die Fahnder aufs gewohnte Gleis zurück: Die Mörder müssten einer organisierten Ausländergruppierung zuzurechnen sein. Die rechte Spur verlief sich daraufhin im Sande, bis zu jenem Tag im November2011, als der NSU am Nordplatz in Eisenach eine Bank zu viel überfiel. »Wir haben es«, sagt Haßmann so ehrlich wie beklommen, »eigentlich verworfen, dass es sich um eine rechte Gruppierung handelt.«
Für Haßmann ist es kein guter Tag vor dem Ausschuss, wie auch. Er trägt seine Niederlage mit Haltung, versucht nicht, die Dinge schönzureden wie so viele Zeugen vor ihm. »Natürlich haben wir damals gesagt: Wir halten unsere Analyse für die plausiblere. Das Gleiche hat Herr Horn von seiner Analyse gesagt. Aber irgendwie müssen wir dann wieder einen gemeinsamen Weg finden.«
Doch diesen Weg gab es nicht. Die beiden Analysen waren wie Feuer und Wasser. Die eine hätte zum NSU führen können, die andere führte weit von den Mördern fort. Zwei Männer sitzen hier, die mit derselben Waffe der Kriminalistik arbeiten, der Hypothese. Beide sind erfahrene Profis. Der eine trifft, wenn nicht ins Schwarze, so doch in dessen Nähe. Der andere schießt in die Wolken.
Wie in einem Brennglas zeigt diese Zeugenbefragung vor dem Ausschuss Stärke und Schwäche, Realität und Mythos, ja sogar Triumph und Tragödie des Profilers, oder im Polizeideutsch: der Operativen Fallanalyse. Sie hat etwas erkannt, was ein Großaufgebot erfahrener Fahnder, unterstützt von einem gewaltigen Hightechapparat, über Jahre nicht erkannte. Sie hat gezeigt, dass die Ermittler die Sprache der Spuren, der Tatorte, die Zeichen der Täter falsch interpretiert hatten. Und sie hat, in Gestalt des Stuttgarter Gegengutachtens, all diese Erkenntnisse wieder überdeckt.
Keine andere Abteilung der Polizei, nicht einmal die Mordkommission, genießt einen solchen Nimbus wie die Profiler. Keine andere Dienststelle ist so sehr vom Hauch eines Mythos umweht, der so wenig mit der Realität gemein hat. Über keine andere gibt es so viele so falsche Vorstellungen, geprägt von Krimis, Crime-Dokus, Kinothrillern und dunkel raunenden Sachbüchern, bei denen Realität und Fiktion unrettbar verschwimmen.
Am Anfang des Profiler-Kults war der Serienmörder, der Antipode des Profilers. Ich jagte Hannibal Lecter heißt der so absurde wie bezeichnende deutsche Titel eines Buchs, das der Mitbegründer des Profilings, der frühere FBI-Agent Robert Ressler, verfasst hat. Hannibal Lecter ist der genialische Serienkiller und Kannibale aus dem Oscar-gekrönten Hollywood-Klassiker Das Schweigen der Lämmer. Der Film kam 1991 in die Kinos, mit Anthony Hopkins’ Paraderolle als hannibal the cannibal und Jodie Foster als sensibler, verwundbarer und doch so lernfähiger FBI-Profilerin. Der Trend zur Mystifizierung und Verklärung sowohl des Serienmörders als auch seines nicht minder genialen Verfolgers hält seitdem an. Erfolgreiche TV-Serien wie Profiler, Criminal Minds, Die Methode Tony Hill bedienen dieses Klischee ebenso wie die höchst populären Serienmörder-Romane von Patricia Cornwell, Thomas Harris, Val McDermid und vielen anderen. Etliche wurden als Verfilmung Welterfolge, etwa Roter Drache oder Hannibal Rising. All diesen Werken folgt bis zum heutigen Tag ein unübersehbarer Rattenschwanz von mehr oder weniger trivialen Nachahmern. Die Serienmörder-Welle ist ungebrochen, in Buchhandlungen haben die einschlägigen Werke mitunter schon eigene Tische. Krimiautoren lieben solche Mörder, und der Buchmarkt liebt Krimiautoren, die in Zeiten des Internets eines der schwindenden verkaufsträchtigen Genres bedienen.
Gewiss, Verfasser und Drehbuchautoren von Krimis genießen jede dichterische Freiheit. Wenn sich Leser und Fernsehzuschauer in großer Zahl daran erbauen, ist das nur ihr gutes Recht. Und trotzdem: Wenn den Autoren gar nichts mehr einfällt, dann ist der Serienkiller gefragt (und der grüblerisch-geniale Kriminalpsychologe nicht fern). Zu einem nicht geringen Teil stammen die Werke, in denen weibliche Opfer missbraucht und ausführlich geschilderten Torturen unterworfen werden, übrigens von Frauen selbst.
Problematischer ist, wie der Mythos auch in nichtfiktionalen Darstellungen dominiert. »In den letzten 40 Jahren hat die Zahl der Serienmörder wiederum stark zugenommen«, behauptet ohne jeden Beleg eines der typischen Bücher aus jüngster Zeit. Von allen Staaten Europas, heißt es weiter, sei außer in Großbritannien in Deutschland die Gefahr am größten, einem von ihnen zum Opfer zu fallen. Tatsächlich aber ist die Zahl der Sexualmorde deutlich gesunken. Der deutsch-österreichische Kino-Dokumentarfilm Blick in den Abgrund (2013) stellt sechs echte oder angebliche Profiler aus sechs Ländern vor. Auf der Homepage zum Film heißt es: »Neben erfahrenen und abgeklärten Profilern, die an den Abgründen der menschlichen Seele beinahe zerbrachen, finden sich junge Profiler, die besessen sind nach Antworten über den Ursprung des Bösen, sowie Profiler, die mittlerweile die Existenz des Teufels nicht mehr anzweifeln, um zu verstehen, oder von einem Killer-Gen überzeugt sind, das es zu entfernen gelte.«
Derlei Geschwätz enthält alle heute gängigen Klischees: die unauslotbare Tiefe des Bösen, der diabolische Killer – und natürlich sein Gegenüber, der Profiler (oder noch besser die junge, bildschöne Profilerin), der einsam dem Monster entgegentritt und es überwinden will, indem er sich in dessen Gedankenwelt versetzt; er wird am Ende siegen, doch um welchen Preis …
Die Wirklichkeit sieht in den allermeisten Fällen völlig anders aus. Im Gegensatz zu dem, was in Schlagzeilen, Fernsehkrimis und unzähligen Romanen verbreitet wird, »ist ein Serienmord ein sehr seltenes Phänomen«, so Harald Dern, Leiter der Fallanalytiker beim Bundeskriminalamt, selbst in den USA und erst recht in Deutschland. Die Polizeiliche Kriminalstatistik zeigt seit Jahren einen Rückgang brutaler Gewaltdelikte. Und doch sind viele Menschen überzeugt, das genaue Gegenteil sei der Fall. Gerade die Häufigkeit tödlicher Sexualverbrechen werde, so schreibt der Münchner Forensiker Herbert Steinböck in dem Handbuch Theory of Mind, »in der Öffentlichkeit durchweg fehleingeschätzt«. Aber für viele TV-Sender sind spannender als Statistiken eben unbekannte, vom Nebel des Grauens umwaberte Kindermörder.
Da mag das FBI selbst den Tausenden Anwärtern, die jährlich Profiler werden wollen, nüchtern mitteilen: Man biete hier keine Jobs an, die dem verbreiteten Bild des Profilers entsprechen würden, es gehe um das Bewerten von Verhaltensweisen. Es hilft nichts. Da mögen Wissenschaftler wie der Kölner Kriminologe Frank Neubacher noch so sehr mahnen: »Der Serienmörder ist in der Realität weder ›genial‹ noch ist er ›künstlerisch‹ tätig … Ebenso wenig sind die Kriminalbeamten, die ihm entgegentreten, Supermänner oder Superfrauen. Ihre Ermittlungen nehmen nicht die Form des Duells mit dem Bösen an, sondern sind nüchterne kriminalistische Arbeit.« Sie finden kaum Gehör. Der Mythos verabscheut nichts mehr als die Nüchternheit, deshalb verdrängt er sie.
Man kann argumentieren, dass schon der Begriff »Profiler« Teil des Mythos und daher besser zu vermeiden sei. Die deutsche Polizei spricht sehr viel lieber von der »Fallanalyse« oder »Operativen Fallanalyse«, abgekürzt OFA. Diese Termini aus der Behördensprache sagen der breiten Öffentlichkeit freilich wenig; sie verwendet den »Profiler« einfach als Synonym für sie, auch wenn das im Detail nicht immer dasselbe bedeutet. Die Vielfalt der deutschen und englischen Bezeichnungen sorgt immer wieder für Verwirrung. Dieses Buch behält das Wort Profiler daher schlicht der Verständlichkeit wegen bei. Jenseits der kriminalwissenschaftlichen Diskurse taugt es schon wegen seiner Verbreitung als Sammelbegriff, wie auch die Kriminalpsychologin Cornelia Musolff argumentiert: »Ausnahmslos hinter allen Fallanalyse- und Profiling-Verfahren steht die Idee, das Verhalten von Tätern und den psychosozialen Kontext von Straftaten als Informationsquelle zur Unterstützung der Verbrechensaufklärung zu nutzen.« Auch Harald Dern vom BKA lässt den Begriff in seinem wissenschaftlichen Handbuch über »Profile sexueller Gewalttäter« gelten: Die Fallanalyse sei »kurz gesagt die Form des Profilings, die bei der deutschen Polizei praktiziert wird«.
Und diese Form sieht, im besten Kriminalistendeutsch der offiziellen Definition, so aus: »Bei der Fallanalyse handelt es sich um ein kriminalistisches Werkzeug, welches das Fallverständnis bei Tötungs- und sexuellen Gewaltdelikten sowie anderen geeigneten Fällen von besonderer Bedeutung auf der Grundlage objektiver Daten und möglichst umfassender Informationen zum Opfer mit dem Ziel vertieft, ermittlungsunterstützende Hinweise zu erarbeiten.«
Der britische Psychologieprofessor David Canter beschreibt das Prinzip mit mehr Eleganz, aber im Kern nicht anders: »Ein Krimineller lässt nicht nur materielle Spuren zurück, sondern auch psychologische: verräterische Verhaltensmuster, die darauf hinweisen, welche Art von Mensch er ist. Diese Spuren kann man nicht in ein Labor bringen und unter einem Mikroskop sezieren. Sie gleichen mehr den Schatten, die ohne jeden Zweifel zu dem Täter gehören, der sie wirft; aber sie flackern und verändern sich, und oft weiß man nicht einmal, von wo sie kommen. Und doch: Wenn es gelingt, sie festzuhalten und zu interpretieren, können diese Schatten uns zeigen, wo die Ermittler hinsehen und was für einen Typ von Person sie suchen sollten.«
Zum Thema gibt es eine rege wissenschaftliche Debatte, zum Beispiel in den Spalten der Zeitschrift Kriminalistik, beteiligt sind auch Mitbegründer des deutschen Profilings wie der Münchner OFA-Leiter Alexander Horn oder die BKA-Spezialisten Harald Dern und Michael C. Baurmann. Gerade die Wiesbadener Zentralbehörde hat die kriminalistische Forschung von Beginn an als Teil ihrer Aufgabe verstanden. Die erfahrenen Psychologen Cornelia Musolff und Jens Hoffmann haben 2006 in zweiter, erweiterter Auflage ein akademisches Standardwerk über Täterprofile bei Gewaltverbrechen im deutschen Sprachraum herausgegeben. All diese Texte sind aber nicht für ein breites Publikum geschrieben.
Mehrere Gründerväter des amerikanischen Profilings, überwiegend frühere FBI-Agenten, berichten dagegen in populären Büchern über ihre Fälle und auch ausgiebig über sich und ihre »Reise in die Finsternis«. Sie haben etliche Nachahmer gefunden. Manche Autoren des Genres sind nur schwer ernst zu nehmen, etwa die Amerikanerin Pat Brown, die sich selbst zur Profilerin ernannt und es mit ihrem Kreuzzug gegen das Böse oder das, was sie dafür hält, in die Bestsellerlisten gebracht hat. Für die echten und vermeintlichen Täter aus ihrem Buch fordert sie die Todesstrafe: »Keiner dieser mörderischen Bastarde sollte existieren.«
In Deutschland hat dieser selbstdarstellerische Personenkult wenig Parallelen. Keiner der führenden deutschen Fallanalytiker hat Memoiren veröffentlicht, gegenüber den Medien sind die meisten sehr zurückhaltend. Eine Ausnahme bildet Axel Petermann aus Bremen, Leiter der kleinsten deutschen OFA-Einheit. Er berichtet in seinen beiden Büchern (2011 und 2012) und als Gast zahlreicher TV-Sendungen und Talkshows über seine Tätigkeit als Mordermittler und später als Profiler in der Hansestadt. In Bestie Mensch (2004) wiederum blickt der Mitbegründer des Profilings in Österreich und Deutschland, der Wiener Kriminalpsychologe Thomas Müller, auf seine lange Karriere zurück. Beide Autoren arbeiten stark autobiographisch, die Bücher sind spannend zu lesen und schildern reale Ereignisse. Ein repräsentatives Bild der Operativen Fallanalyse, ihrer Methodik und ihrer großen Fälle, bieten sie gleichwohl nicht.
In jüngster Zeit, nach den Bestsellern Verbrechen und Schuld von Ferdinand von Schirach, sind Bücher in Mode gekommen, die eigene berufliche Erfahrungen in der Auseinandersetzung mit Kriminalität zum Thema haben. Der Berliner Strafverteidiger schilderte literarisch verfremdet Fälle aus seiner Praxis, in denen es stets um Grenzen der Schuld geht, um die Verwobenheit von Gut und Böse, um Grauzonen des Rechtssystems. Im Kielwasser dieser Werke schrieben zuletzt, um einen ähnlichen Stil bemüht, frühere oder noch aktive Leiter von Mordkommissionen, Pathologen und Gerichtsgutachter. Sie schildern jeweils viele Personen, darunter Opfer, Zeugen, Patienten und natürlich Täter. Jüngst hat ein Richter des Bundesgerichtshofs, Thomas Fischer, in der Zeit harte Kritik an den Autoren der real crime-Welle geübt: »Es ist das dreiste Unternehmen, aus dem hoheitlichen Zugriff auf das Schicksal der anderen privaten Gewinn zu wringen, sei es als Geld oder Einladung zur Talkshow.« Man muss dem in dieser Schärfe nicht zustimmen. Vieles in diesen Büchern ist nachdenklich und bringt neue Erkenntnisse, anderes eher weniger. Aber es gibt hier ein Problem, das zu Recht angesprochen wird, schon wegen der Angehörigen der Opfer, deren Schicksal mitunter in blutigsten Einzelheiten und so thrillerhaft geschildert wird, als habe der Autor direkt danebengestanden.
Das vorliegende Buch möchte daher einiges bewusst nicht leisten. Es hat nicht die Absicht, den Profiler-Mythos weiterzustricken oder den Titeln über Serienkiller als Verkörperung des Bösen noch einen hinzuzufügen. Es ist auch keine real crime-Story mit den üblichen fiktionalen Elementen. Es handelt von Verbrechen und ihrer Bekämpfung, aber es will keinen Blick auf diese Verbrechen und vor allem nicht auf deren Opfer werfen, der als journalistischer Voyeurismus verstanden werden könnte. Es spart deshalb und mit Rücksicht auf Angehörige der Opfer mit der Schilderung grausiger Details, soweit diese für das Verständnis der Operativen Fallanalyse nicht unbedingt notwendig sind. Es ist kein wissenschaftliches Buch, sondern für eine breite Leserschaft geschrieben; es hat aber den Anspruch, sich auf der Basis der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu bewegen.
Es möchte realitätsnah und kritisch sowie an konkreten Fällen die Geschichte und die Arbeit der Operativen Fallanalyse in Deutschland erzählen – und deren internationale Vorgeschichte, ohne die sie nicht richtig zu verstehen ist. Nicht Heldenstorys vom Kampf gegen Psychomonster werden geschildert, sondern der Aufstieg einer Disziplin, die sich in überraschend kurzer Zeit von einem belächelten exotischen Feldversuch zu einem bedeutenden Ermittlungsinstrument entwickelt hat. Denn dass die öffentliche Wahrnehmung von Serienmördern und Sexualverbrechen weit übertrieben ist, heißt ja nicht, dass es solche Verbrechen gar nicht gebe. Der wissenschaftlich gestützte Versuch, sich auf psychologischem Wege dem Mörder und seinen Motiven zu nähern, ist in Wirklichkeit sogar spannender als die immer gleichen Horror-Abziehbilder.
Das Buch beruht auf eigenen Recherchen, Dokumenten, Auswertung der Literatur und Interviews mit Beteiligten: Polizisten und Wissenschaftlern. Im Mittelpunkt steht das OFA-Team des Münchner Polizeipräsidiums. Schon in den späten neunziger Jahren gehörte Alexander Horn als junger Mann zu den Mitbegründern der Methodik in Deutschland. Heute ist er einer der erfolgreichsten Fallanalytiker des Landes. Der Autor hat Horn und die Münchner OFA-Kollegen seit Jahren immer wieder begleitet, für Beiträge in der Süddeutschen Zeitung etwa über die Suche nach dem »Maskenmann« oder nach den Mördern der acht Türken und des Griechen. Als erstem Berichterstatter hat ihm die OFA gemeinsam mit der damaligen Sonderkommission im Jahr 2006 die neue Hypothese mitgeteilt, dass die Morde an neun Männern mit Migrationshintergrund ein ausländerfeindliches Motiv haben müssen. Zu Wort kommen außerdem die Fallanalytiker des Bundeskriminalamtes, mit denen der Autor ebenfalls wiederholt zu tun hatte und welche die Fallanalyse systematisch weiterentwickelt haben, sowie Profiler aus anderen Bundesländern, besonders aus Hamburg, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.
Viele der Fallanalytiker haben für dieses Buch erstmals einen so tiefen Einblick in ihre Arbeit gewährt. Außerdem wurden Fachleute befragt, wie zum Beispiel die forensischen Psychiater Norbert Nedopil und Franz Joseph Freisleder aus München, sowie Mordermittler, die aus ihrer Sicht schildern, was die Fallanalyse zur Aufklärung von Verbrechen beitragen kann und was nicht.
Das Buch beginnt mit einer Vorgeschichte des Verbrechens und der Versuche, ihm mit psychologischen Mitteln beizukommen. Kriminalisten wie der berühmteste Mordfahnder der Weimarer Republik, Ernst Gennat, betrieben bereits Vorformen des Profilings. Systematisch entwickelt wurde die Methodik erst seit den siebziger Jahren durch die amerikanische Bundespolizei FBI. Der Hauptteil des Buches beschäftigt sich mit der Operativen Fallanalyse in Deutschland – ihrer Gründung, ihren ersten Fällen, ihren nicht einfachen Versuchen, gestandenen Mordermittlern ans Herz zu legen, was diese noch zu lernen hätten; und umgekehrt mussten die Profiler sich fragen lassen, ob das, was sie als Ermittlungshilfe anboten, nicht bloß modisches Spielzeug oder »alter Wein in neuen Schläuchen« sei. Es begleitet sie durch einige Fälle, in denen die Profiler bewiesen, wie wertvoll ihre Methodik ist, und durch Mordermittlungen, die auch sie keiner Lösung zuführen konnten. Denn eines ist die Fallanalyse nicht, wie Alexander Horn sagt: »Sie ist kein Wundermittel, sondern ein kriminalistisches Handwerk.«
Das Buch will Aufstieg und Etablierung dieses Handwerks zeigen – und seine Krise. Denn das letzte Kapitel ist den Versuchen der Fallanalytiker gewidmet, Licht in die damals so rätselhafte Mordserie an Ausländern in Deutschland zwischen 2000 und 2006 zu bringen. Dazu standen dem Autor auch zahlreiche bisher unveröffentlichte Quellen und Dokumente zur Verfügung. Aus ihnen lässt sich klar belegen, wie verantwortungslos und voreingenommen Teile des Sicherheitsapparats mit der Hypothese umgingen, die Täter könnten deutsche Ausländerfeinde sein. Die Fallanalyse hätte bei dieser langen Fahndung ihre größte Stunde erleben und die Kripo in die richtige Ermittlungsrichtung führen können – wenn man nur auf sie gehört hätte.
Ein Profiler, ein Fallanalytiker sieht in seinem Berufsleben viele Dinge, die einem normalen Bürger und auch den meisten Polizeibeamten in aller Regel erspart bleiben: Bilder von Kinderleichen, entstellten Opfern, das Ausmaß der Unmenschlichkeit, zu der Menschen fähig sind. Man muss nicht den Mythos vom Abgrund des Bösen bemühen, um die seelischen Belastungen zu begreifen, mit denen ein Profiler zu leben lernen muss. Einem freilich wird er wohl niemals begegnen, wie Harald Dern vom Bundeskriminalamt sagt, nämlich dem genialischen Gegenüber, mit dem er dann ein Psychoduell auf Leben und Tod ausficht wie im Thriller: »Einen Hannibal Lecter hatten wir noch nie. Und ich bezweifle sehr, dass wir jemals einen antreffen werden.«
Anmerkungen
1 DAS VERBRECHEN VERSTEHEN: EINE VORGESCHICHTE DES PROFILINGS
Der Vampir: Peter Kürten (1930)
»Ich hatte eigentlich dauernd die Stimmung, Sie werden es Drang nennen, zum Umbringen. Je mehr, umso lieber. Ja, wenn ich die Mittel dazu gehabt hätte, dann hätte ich ganze Massen umgebracht, Katastrophen herbeigeführt. Jeden Abend, wenn meine Frau Spätdienst hatte, bin ich herumgestreift nach einem Opfer. Es war aber nicht so leicht, eins zu finden.«
Der Mann, der dies 1930 in der Haftanstalt sagte, hieß Peter Kürten. Ihm gegenüber saß Professor Karl Berg, ein bekannter Gerichtsmediziner der Weimarer Republik. Berg war von Kürten so fasziniert wie abgestoßen. Er versuchte nachzuvollziehen, was im Kopf dieses ganz normal aussehenden 47-jährigen Mannes wohl vorging. Das tat er nicht allein aus wissenschaftlicher Neugier. Der Professor sollte herausfinden, ob der Häftling, wie man damals sagte, »geisteskrank« war – und damit unzurechnungsfähig. Oder ob Kürten, so monströs und wahnhaft seine Verbrechen auch wirkten, sich vor einem Gericht würde verantworten müssen.
Und diese Verbrechen hatten Düsseldorf in Atem gehalten; Reporter aus dem ganzen Reich berichteten über die rätselhafte Mordserie. Boulevardblätter warnten in großer Aufmachung vor dem »Vampir von Düsseldorf«, dem unheimlichen Lustmörder, der zu einer Chiffre des unerklärlich Bösen geriet.
Kürten, 1883 in Köln geboren, stammte aus einer armen Familie. Seinen Vater hatte er, wie er später vor Gericht erklärte, als »Ungeheuer« erlebt, der soff, Frau und Kinder schwer misshandelte und wegen »versuchter Blutschande« mit seiner Tochter zeitweilig in Haft war. Als der junge Kürten 1925 mit seiner Frau nach Düsseldorf zog, hatte er ebenfalls bereits eine erhebliche Gefängniskarriere hinter sich. Er hatte schon als Kind Tiere gequält und Welpen in einem Bach ertränkt und dann in jungen Jahren mehrfach in Haft gesessen, wegen diverser Brandstiftungen, Diebstahls, Einbruchs und anderer kleinerer Delikte. Wegen Sexualstraftaten wurde er damals nicht verurteilt. Er lebte in den zwanziger Jahren ganz bürgerlich und fiel der Polizei nicht mehr auf, noch nicht. Niemand wusste, dass er bereits 1913 in Köln in ein Wirtshaus eingebrochen war und ein schlafendes kleines Mädchen erwürgt hatte – und dass ihn weiterhin Mordphantasien umtrieben.
An einem Sonntagabend Anfang Februar 1929 brachen diese Phantasien durch. Kürten durchstreifte stille Düsseldorfer Straßen, auf der Suche nach einem Opfer. Als er eine Frau allein auf sich zukommen sah, rief er: »Halt, kein Wort!«, und stach mit einer Schere mehrfach auf sie ein. Die 55-jährige Apollonia Kühn überlebte schwer verletzt, sie hatte den Täter kaum gesehen.
Wenige Tage später erstach Kürten, wieder abends, Rosa O., ein erst achtjähriges Mädchen, das auf dem Heimweg von einer Freundin war. Kürten schleppte das Kind hinter einen Bretterzaun nahe der Düsseldorfer Rheinwiesen und tötete es mit 13 Messerstichen; später versuchte er, die Leiche zu verbrennen. In der Hose des Mädchens fand der Gerichtsarzt Spermaspuren. Das Bild des kleinen Opfers, von der Polizei veröffentlicht, mit seinem trotz aller sonstigen Versehrungen intakten, wie schlafend wirkenden Gesicht berührt und verstört noch heute – in einer Zeit, die sich an die Darstellung von Gewalt aller Art, echter wie fiktionaler, hat gewöhnen müssen. In Düsseldorf löste die Tat damals Hysterie und Fassungslosigkeit aus.
Kürten begab sich, nachdem er Rosa erstochen hatte, ins Kino. Er verfolgte nach seinen Morden stets die Berichterstattung, auf den Rheinwiesen mischte er sich unter die Schaulustigen vor den Polizeisperren. Es erregte ihn. »Die Wirkung war in den meisten Fällen noch intensiver als wie bei der Begehung der Tat«, sagte er später im Gefängnis zu Berg.
Im Lauf des Jahres 1929 tötete Kürten acht Menschen, scheinbar wahllos ausgesuchte Opfer, Frauen, kleine Mädchen, einen Mann. Viele von ihnen hatte er vorher angesprochen und in harmlose Gespräche verwickelt, darunter am 25. August 1929 auch die Hausangestellte Gertrud Schulte. Obwohl es in den Tagen zuvor gleich mehrere Überfälle gegeben hatte, ließ sie sich von einem Fremden zum Spazierengehen überreden. Einige Stunden schlenderten sie durch die Stadt. Es wurde Abend, Kürten lenkte sie zum Pappelwäldchen am Rheinufer, er blickte sich um, niemand war zu sehen. Als er plötzlich versuchte, ihr die Kleider herunterzureißen, wehrte sich die junge Frau und schrie laut, worauf der Mann, der sich als »Herr Baumgart« vorgestellt hatte, in Wut geriet und zischte: »Dann sollst du sterben.« Er stach mehrfach mit einem Dolch auf sie ein, ehe er aus Furcht, jemand habe ihre Schreie gehört, flüchtete. In der Tat rannten einige junge Leute herbei, und dank ihrer Hilfe überlebte Gertrud Schulte, die einzige Zeugin, die den Mörder länger gesehen hatte. Kürten hatte mit solchem Furor auf sie eingestochen, dass die Spitze des Dolchs in ihrem Rücken abgebrochen war.
Mit der jungen Maria Hahn ging Kürten sogar im Neandertal wandern. Er erstach sie und vergrub sein totes Opfer. Per Post schickte er an die Zeitungen und die Polizei »Mörderbriefe«, in diesem Fall handgezeichnete Pläne, wo die Leiche Maria Hahns vergraben sei: »Mord bei Pappendelle, an der angekreuzten Stelle, welche nicht mit Unkraut bewachsen ist und mit einem Stein bezeichnet ist, liegt die Leiche vergraben.«
»Ihm kam es darauf an«, so die heutige Einschätzung des Kriminalisten Stephan Harbort, »den angeblich Unwissenden, seiner Unwürdigen seine Macht vorzuspielen. Er wollte tatsächlich für seine Morde bewundert werden.«
Die Polizei in Düsseldorf war auf eine solche Serie in keiner Weise vorbereitet. Zwischen den Opfern gab es keine Verbindung, Beziehungstaten schieden aus. Und das sehr herkömmliche Bild, das sich die Beamten und mit ihnen die erregte Öffentlichkeit vom Mörder machten, erschwerte die Ermittlungen zusätzlich, wie Psychiater Berg in den Protokollen seiner Gespräche mit Kürten festhielt: »Ein weiterer schwerwiegender Irrtum bei der Suche nach dem Haupttäter war die vorgefasste Meinung: es müsse ein Geisteskranker sein. Die Scheußlichkeit der Morde, das Grauen, das alle nicht abgehärteten Gemüter schließlich ergriff, hat offenbar den Irrtum nahegelegt … So fahndete man auch in Düsseldorf nach einem irren Mörder.«
Doch den Irren gab es nicht. Sehr zum Unwillen der ermittelnden Kriminalbeamten wurde schließlich einer der berühmtesten Polizisten der Weimarer Zeit geholt: Ernst Gennat.
Gennat war zu diesem Zeitpunkt das, was man heute »Kult« nennen würde, eine öffentliche, von Reportern umschwärmte Figur. Der Kriminalpolizeirat und Leiter der Berliner Zentralen Mordinspektion wurde von seinen Leuten »der Buddha« genannt oder auch »der volle Ernst«, beides in Anspielung auf sein erhebliches Übergewicht. Lag ein Mordopfer in den oberen Stockwerken einer Berliner Mietskaserne, war der Aufstieg des schwitzenden und schnaubenden Kolosses durchs steile Stiegenhaus zum Tatort ein Ereignis, das die Untergebenen nicht ohne Schadenfreude betrachteten; ein klein wenig aber nur, denn Gennat genoss ihren vollen Respekt.
Er baute Mitte der zwanziger Jahre in der Hauptstadt die modernste Mordfahndung der Republik auf, nicht nur wegen des »Mordautos«, das alle modernen Mittel zur Untersuchung eines Tatorts mitführte. Er setzte vor allem auf Psychologie. Hatte man bei der Kripo zuvor durchaus noch keine Todsünde darin gesehen, Verdächtige zur Förderung ihrer Aussagebereitschaft zu schlagen und zu bedrohen, verbot Gennat solche Praktiken rundheraus: »Wer mir einen Beschuldigten anfasst, fliegt! Unsere Waffen sind Gehirn und Nerven.«
Der »volle Ernst« ist auch einer der Gründerväter des Profilings, wenngleich es den Begriff damals noch nicht gab. Dafür hat er bei der Fahndung in Düsseldorf ein anderes Wort geprägt, das viel später der FBI-Profiler Robert Ressler für sich in Anspruch nehmen würde: »Serienmörder«. Als solchen bezeichnete Gennat den Düsseldorfer Täter. Was der Kripochef an Aufwand betrieb, um diesen zu überführen, mutet schon sehr modern an – und brachte ihm einen missgünstigen Kalauer der enervierten Düsseldorfer Kollegen ein: »der Zirkus Gennat«.
Die Ermittlungen waren bis dahin mit den üblichen Mitteln betrieben worden, in einer Zeit ohne DNA-Analyse, elektronische Datenbanken, Überwachungskameras und Funkzellenauswertung. Fingerabdrücke zu nehmen, das war schon möglich; auch Fahndungsbücher mit einer Fotosammlung gab es. Ansonsten befragte die Polizei mögliche Zeugen, bat die Bevölkerung durch öffentliche Aushänge um Mithilfe, setzte Spürhunde ein. Alles vergeblich. Der »Zirkus Gennat« inszenierte nun etwas gänzlich Neues. Der Kriminaler aus Berlin versuchte erstmals, das besondere Verhalten des Düsseldorfer Täters am Tatort kriminalpsychologisch zu analysieren – und aus dieser Analyse Empfehlungen und Hilfestellungen für die Ermittler abzuleiten.
Diese Aufgabe wäre noch heute denkbar schwer. Es gab eine Vielzahl von Morden, Mordversuchen und Überfällen, die Opfer waren Frauen, Kinder, ein erwachsener Mann. Nicht alle Taten mussten zudem von ein und demselben Mörder verübt worden sein, für einige konnte es auch ganz andere Motive geben. Manche Opfer wurden erstochen, andere erschlagen oder erwürgt. Und noch dazu wurde die Kriminalpolizei überflutet mit falschen Beschuldigungen und panischen Hinweisen, die oftmals aus der Luft gegriffen waren: Ein Mann, der vom Rad geplumpst war, gab der Polizei an, der Vampir habe ihn angefallen. Dieses Gewirr versuchte Gennat nun zu ordnen.
Er untersuchte systematisch den »Sitz der Verletzungen« an den Opfern sowie die »Mordinstrumente«. Gennat verglich die Taten miteinander und mit Fällen der Vergangenheit und er folgerte: »Verschiedenheit der Ausführung schließt daher noch keineswegs die Täterschaft ein und derselben Person aus.« Er glaubte nicht, dass die unterschiedlichen »Mordinstrumente« auch auf unterschiedliche Täter schließen ließen. Immerhin hatte der Mörder beim Überfall auf Gertrud Schulte seinen Dolch zerbrochen und konnte ihn danach nicht mehr verwenden. Die Wahl der Waffen sei weniger aussagekräftig als der Wunsch, immer wieder zu töten.
In Wahrheit waren, wie sich später herausstellte, von der Vielzahl der Fälle nur zwei einem anderen zuzuschreiben, einem Mann namens Stausberg: Er hatte zwei Frauen überfallen, die aber entkommen konnten. Ein Mord blieb ungeklärt, die übrigen hatte Kürten zu verantworten. Gennat ordnete ihm die meisten Taten also korrekt zu, nämlich die große Mehrheit der Mordfälle, die Düsseldorf in Angst hielten – ihm, dem »Serienmörder«. Die Anhaltspunkte zu dessen Ermittlung seien »durch die Eigenart der Persönlichkeit des Täters gegeben«.
Diesen hielt Gennat für einen Sadisten, Mordlust für das verbindende Motiv: »Besonders bemerkenswert ist, daß Sadisten in ihrem gewöhnlichen Leben nur höchst selten brutale, rohe, gewalttätige Naturen sind. Seltsamerweise trifft meist das Gegenteil zu. Es handelt sich fast stets um Menschen, die ihrer Umgebung sanft, weich und gutherzig erscheinen.« Gennat nahm die Aussage der gerade noch davongekommenen Gertrud Schulte ernst, wonach ihr Begleiter sich vor dem plötzlichen Mordversuch »durchaus anständig benommen« und »keinerlei zweideutige Redensarten geführt« habe. Oft werde ein solcher Täter nicht erkannt, »weil seine Persönlichkeit in einem so krassen Gegensatz zur Tat steht«.
Gennat hielt es für möglich, dass der Täter bereits früh »durch seine Neigung aufgefallen ist, andere Lebewesen grausam zu quälen«. Und »mit großer Wahrscheinlichkeit kann angenommen werden, daß der spätere Täter in seinem Vorleben mit Behörden einschlägiger Art in Berührung gekommen ist, sei es Gericht oder Polizei, Erziehungsanstalt oder Gefängnis, Nervenklinik oder Irrenanstalten«. Der Kommissar aus Berlin nahm an, dass es bei den Behörden bereits Akten über den Mörder gab und dass »das über den Täter schon bekannte Material in seiner außergewöhnlichen Bedeutung bisher noch nicht erkannt worden« sei.
Genauso war es bekanntlich: Kürten besaß ein langes Vorstrafenregister. »Weich und gutherzig« mag der eitle Kürten seinen Nachbarn nicht gerade erschienen sein, aber doch harmlos genug, um niemals als der Serientäter verdächtigt zu werden. Er sah durchschnittlich aus, war schlank und kleidete sich gut.
Gennats Hypothese mutet bereits recht modern an, weil sie auf die Dämonisierung des Verbrechers verzichtet (wie man sie allerdings auch heute noch häufig erleben kann). Damals überschlugen sich die Schlagzeilen mit Beschreibungen des Angeklagten als »Bestie in Menschengestalt«, »Blutsäufer«, »Mörder mit dem Blick einer Bestie« und in Kürtens Fall eben sogar als Vampir, als sei er Nosferatu, herabgestiegen von seinem Schloss in den Karpaten. Mehr noch, der Glaube, dem Bösen sei das Böse anzusehen, schaue man nur scharf genug hin, war in den zwanziger Jahren noch eine verbreitete Strömung in der kriminologischen Wissenschaft; ebenso die Überzeugung, dass es geborene, genetisch festgelegte Verbrechernaturen gebe.
Gennat hielt derlei für den Hokuspokus, der es war und ist. Der Kripo-Boss aus Berlin brachte mit »Gehirn und Nerven« einen neuen Ansatz in die Fahndung, die so festgefahren war. Er fasste alle Verbrechen zusammen, die dem noch unbekannten »Lustmörder« zuzurechnen waren, und schickte sämtlichen Polizeidienststellen eine ausgearbeitete Analyse zu, die »Bitte um Mitfahndung«. 1949 schrieb der Spiegel in einer Serie über die deutsche Kriminalpolizei: »Der Fuchs Gennat mit seiner unheimlichen Kenntnis jedweder Mörderpsychologie gedachte den Täter sich selbst fangen zu lassen.« Es wäre ebenso spekulativ wie reizvoll, sich vorzustellen, zu diesem »Profil« von 1930 hätte es damals schon die heutigen Datenbanken über Sexualstraftäter gegeben. Oder jene Studie des BKA, welche die polizeilichen Vorerkenntnisse zu Vergewaltigern untersuchte – viele von ihnen sind früh durch eine Vielzahl ganz unterschiedlicher, meist nicht sexueller Delikte aufgefallen, exakt wie Kürten.
Kürten fing sich dann tatsächlich »selbst«, letztlich aber nicht mit Hilfe von Gennats Ermittlungshinweisen. Im April 1930 lockte der Mörder die Haushaltshilfe Maria Budlies in die Grafenberger Wolfsschlucht. Die junge Frau, 26 Jahre alt, war fremd in Düsseldorf. Treuherzig folgte sie dem gepflegten Herrn, der sich anbot, ihr den Weg zu einem Mädchenwohnheim zu zeigen. In der Wolfsschlucht, sie heißt wirklich so, drehte er sich plötzlich zu ihr um: »Weißt du auch, wo du jetzt bist? Du bist ganz allein mit mir im Wald!« Obwohl sie sich heftig wehrte, würgte und vergewaltigte er sie.
Maria Budlies aber überlebte und schrieb einer Freundin einen Brief, in dem sie das furchtbare Erlebnis berichtete, und dieser Brief gelangte auf Umwegen zur Polizei. Budlies führte die übrigens wenig einfühlsamen Beamten – sie hielten sie für eine weitere Hysterikerin, die ihnen die Zeit stahl – durch die Straßen, in denen sie den unheimlichen Mann getroffen hatte. Eine Nachbarin gab dort schließlich den entscheidenden Hinweis: Peter Kürten, Mettmanner Straße 71. Kürten wurde auf der Flucht verhaftet.
Der Psychiater Karl Berg, der ihn in der Haftanstalt analysierte, fand in langen Befragungen heraus, dass Kürten zunächst »jede sexuelle Triebfeder für seine Verbrechen ablehnte« und diese als Vergeltung an einer Gesellschaft schilderte, die ihm stets nur Übles getan habe. In Wahrheit aber habe die sadistische Sexualität das Motiv der Taten gebildet. »Die Hauptsache war für mich das Blutsehen«, sagte Kürten schließlich zu Berg.
Kriminalpolizeirat Ernst Gennat war übrigens keineswegs entmutigt, dass am Ende doch nicht seine Hypothesen über den Täter zu dessen Ergreifung geführt hatten. Der Zufall hatte Kürten entlarvt, dem Kommissar sollte es recht sein. Dennoch war Gennat überzeugt, dass der »Einheitsfahndung«, wie er sie versucht hatte, die Zukunft gehörte: all die Fakten der Verbrechen und die Schlussfolgerungen daraus aus einem Guss für Polizei, Staatsanwaltschaften, Gefängnisse und Anstalten zu präsentieren. Das Interesse an solchen Informationen war groß gewesen, »Dutzende von Funksprüchen« anderer Dienststellen hatten zuvor darum gebeten, um ihre Fälle mit denen aus Düsseldorf abzugleichen. Insofern betrachtete Gennat sein daraufhin erstelltes Profil als Pionierleistung, und das nicht zu Unrecht. »Mögen die Lehren«, schrieb er, »die der Fall Kürten erteilt, sich allgemein auswirken im Sinne einer Vertiefung unserer Erkenntnisse gerade auf dem Gebiet der Beurteilung von Sexualverbrechen.«
Der Prozess gegen Peter Kürten zog Heerscharen von Journalisten an und wurde deshalb eigens in eine umgebaute Turnhalle verlegt. 1931 starb Kürten im Kölner Gefängnis Klingelpütz unter dem Fallbeil. Wissenschaftler untersuchten das Gehirn anschließend auf klinische Auffälligkeiten. Sie fanden aber nichts. Der Leichnam wurde ohne seinen Kopf begraben.
Der Albtraumspiegel:Verbrechen und Zivilisationskritik
Vieles am Fall des »Vampirs von Düsseldorf«, wie ihn die Reporter bald getauft hatten, mutet heute seltsam vertraut an, so als sei die Handlung des Hollywood-Thrillers Das Schweigen der Lämmer in die Weimarer Zeit zurückverlegt worden: die Geschichte vom unheimlichen Mörder, der mit seinen Verfolgern Katz und Maus spielt; die Furcht, die seine Taten auslösen, denn diese können jedermann treffen und an jedem Ort; sein genialischer Verfolger, der es versteht, die Sprache der Zeichen zu enträtseln, die der Mörder hinterlässt; nicht zuletzt die öffentliche Erregung über den Fall.
Wahrscheinlich ist der Versuch, den Gennat unternahm, aus den Umständen eines Mordes etwas über die Seele des Mörders herauszulesen, so alt wie das Verbrechen selbst. Der Glaube, man lebe in einer Epoche besonders schrecklicher Verbrechen, ist ebenfalls nicht jünger. Er war in der bewegten, innerlich zerrissenen Weimarer Republik verbreitet; er ist es heute in der ruhigen und gefestigten Bundesrepublik, in der sehr viele Bürger der festen Überzeugung sind, nie zuvor seien Kinder gefährdeter gewesen, einem Sexualmörder in die Hände zu fallen, oder, noch ein Beispiel, niemals seien Jugendliche brutaler und gewalttätiger gewesen als heute. Beides ist durch die Kriminalstatistiken und die Forschung eindeutig widerlegt. Die Macht solcher Bilder aber ist stark, sie setzen sich fest, und jedes neue Verbrechen scheint sie zu bestätigen. Das Verbrechen fasziniert die Menschen so sehr, wie es sie ängstigt – besonders dann, wenn der Täter ein Fremder ist und wie eine Verkörperung des Bösen erscheint, das jederzeit in den Alltag jedes Einzelnen einbrechen kann.
Und der Inbegriff dieses Bösen ist der Serienmörder. Etliche Autoren halten diesen für ein Produkt der Moderne, den Albtraumspiegel unserer fehlerhaften Gesellschaften. So schreibt selbst der Kriminalbeamte Stephan Harbort, Experte für Serienmorde, in einem seiner zahlreichen Bücher zum Thema: »Serienmörder passen in unsere Zeit. Die sozialen und seelischen Probleme unserer hochtechnisierten und hochgezüchteten Ein-Weg-Gesellschaft verarbeiten und spiegeln diese Täter in ihren häßlichen Morden: Jeder ist sich selbst der Nächste.«
Derlei Zivilisationskritik hat eine suggestive, verführerische Kraft; sie greift das Unbehagen auf, das viele Menschen angesichts der Moderne und ihrer Unübersichtlichkeit empfinden, und stimuliert es weiter durch Behauptungen, die nach Expertenwissen klingen, aber eher das Gegenteil sind. Manchmal freilich ist sie deutlich dümmlicher formuliert. In ihrem jüngsten Bestseller behauptet etwa die amerikanische Privat-Profilerin Pat Brown über Gesellschaft und Justiz der USA: »Dieses System … ist kaputt. Sehen Sie sich in den Vereinigten Staaten um, sehen Sie in Ihren eigenen Hinterhof, und Sie können sich ausrechnen, wie viele Serienmörder frei herumlaufen.«
Aber leben die westlichen Gesellschaften nicht sicherer, sozialer, friedlicher als je zuvor? Sind die Verbrechensraten in den vergangenen Jahren nicht deutlich gesunken, selbst in den USA mit ihren Drogenproblemen und der Verfügbarkeit von Schusswaffen? Wie passt das zueinander? Die Antwort ist einfach: gar nicht.
Die US-Kriminologen James Allen Fox und Jack Levin halten »die Zahl der Wissenschaftler, die Serienmorde untersuchen, wahrscheinlich für größer als die der Täter, die sie begehen«. Die Beschwörung des Bösen sagt jedenfalls mehr über unsere Ängste als über dessen wirkliches Ausmaß. Durch alle Epochen, auch die des 19. und 20. Jahrhunderts, zieht sich eine Überzeugung wie ein Wandermythos, den eine Generation an die andere weiterreicht: Früher gab es so etwas nicht. Die Welt war sicherer, die Kinder konnte man noch auf die Straße schicken, die Justiz griff noch durch – heute hingegen, wo all diese Segnungen angeblich nichts mehr gelten, triumphiert das Verbrechen. Dabei wird schon im Mittelalter von Serientätern berichtet. Alles das, was solche Menschen ausmachen kann – psychische und soziale Fehlentwicklungen, frühe Traumatisierungen in der Kindheit, Sadismus und Perversionen, Gefühlskälte und Wahnvorstellungen, Psychopathie –, all das ist ja nichts Neues, sondern gehört von jeher zu den dunklen Möglichkeiten der menschlichen Natur.
Schon die antiken Philosophen hatten sich Gedanken über das Böse gemacht, das sich im Verbrechen zeige, und für sorgfältige Unterscheidungen plädiert. Aristoteles lehrte, dass ein solches Verbrechen nicht bestraft werden dürfe, wenn es einem Wahn oder einer Krankheit entsprungen sei. Mit derselben Begründung nahm das römische Recht Täter von Strafe aus, falls sie »Rasende«, »Verblödete« oder »Toren« waren. Selbst die zivilisatorischen Segnungen der Antike, wie ein verbindlicher Rechtskodex und eine halbwegs funktionierende, Verbrechen ahndende Staatsgewalt, hatten immer nur für einen Teil der griechisch-römischen Gesellschaften gegolten; nicht für Sklaven, nicht für »Barbaren«, nicht für Unterworfene: »Vae victis«, wehe den Besiegten.
Sexuelle Gewaltdelikte etwa »gab es immer und zu allen Zeiten«, wie die forensische Psychiaterin Nahlah Saimeh schreibt. Ihr zufolge besteht freilich ein enormer Unterschied zu heute: »Der gesellschaftliche Boden … für die Opfer, sich und ihrem Recht eine Stimme zu geben, ist besser bereitet. Das alles sind zivilisatorische Fortschritte.«
2011 veröffentlichte Steven Pinker ein aufsehenerregendes Buch: The Better Angels of Our Nature, die besseren Engel unseres Wesens. In der deutschen Ausgabe trägt es den etwas irreführenden Titel Gewalt – dabei beschreibt der Psychologieprofessor von der Harvard University deren Rückgang und Ächtung in den vergangenen Jahrzehnten: »Heute dürften wir in der friedlichsten Epoche leben, seit unsere Spezies existiert«; dies sei »von der Kriegsführung bis zur Züchtigung von Kindern« zu erkennen. Pinker warnt vor der verbreiteten Haltung, »in der Welt einen nicht endenden Albtraum aus Verbrechen, Terrorismus, Völkermord und Krieg« zu sehen. Dies ist treffend beobachtet. Eine solche Haltung führt direkt in den Irrglauben, die Kriminalität sei in den westlichen Gesellschaften auf einem unaufhaltsamen Siegeszug oder spiegele deren innere Morschheit wider – ein Deutungsmuster, das Feinde dieser freiheitlichen Gesellschaften schon immer ausgeschlachtet haben.
In früheren Jahrhunderten, ja bis tief in die Moderne hinein, unterlag Sexualität vielen Tabus, die auch die Aufklärung und das Verständnis sexuell motivierter Gewalt massiv erschwerten – von den mangelnden kriminalistischen Möglichkeiten einmal ganz abgesehen. Wer aber liest und im Fernsehen sieht, wie Mörder und Kinderschänder als Raubtiere, Dämonen, Bestien und Monster dargestellt werden, kann fühlen, wie dünn der Firnis dieser Zivilisation ist. Es klingt, als kämen diese Täter direkt aus der Hölle oder einem satanischen Reich der Finsternis – und genau das haben die Menschen einst fest geglaubt, wenn sie mit furchtbaren Verbrechen konfrontiert waren.
Dunkle Barone, Bluttrinker, Mordschlösser: Finstere Welten
An der alten Kirche von Saint-Étienne-de-Mer-Morte in Frankreich berichtet eine Inschrift vom Ende des Gilles de Rais, Marschall von Frankreich: »Johann V., Herzog der Bretagne, ließ Gilles … gefangennehmen. Er gestand seine Verbrechen; nachdem er gerichtet und verurteilt ward, hängte man ihn am 26. Oktober 1440 auf der Ebene von Biesse bei Nantes an den Galgen.«
Gilles war an der Seite von Jean d’Arc, der »Jungfrau von Orleans«, im Hundertjährigen Krieg gegen die Engländer zum Helden des spätmittelalterlichen Frankreichs geworden. Das Land war daher schockiert, als seine Untaten ans Licht kamen: Gilles, der als Wohltäter, Galan und Inbegriff des höfischen Ideals galt, entpuppte sich als »der dunkle Baron«. So wurde er später genannt. Er hatte mindestens 140 Kinder, überwiegend Knaben, in seine Festungen entführen lassen, wo er sie folterte und schließlich umbrachte – nach heutigen Kriterien ein sadistischer Serienmörder, nach damaligen eine Ausgeburt der Hölle, ein Beleg, wie groß Macht und Verführungskräfte des Teufels in der Welt geworden waren. Georges Bataille schrieb später in einer Biographie über ihn: »Was uns an der Persönlichkeit des Gilles de Rais interessiert, ist unsere eigene Bindung an das Monströse, das dem Mensch wie ein Alp von früher Kindheit innewohnt.«
Gilles de Rais gehört zu den Vorbildern des Märchens vom Blaubart und zahlreicher anderer Werke, in denen das Motiv des unheimlichen Mörders vorkommt, der seine Opfer unter fremden Menschen auswählt. Der reiche Blaubart nämlich, »der schreckliche Gatte«, gebietet auf seinem Landsitz über eine heimliche Kammer, in der seine junge Frau dann die Leichen ihrer Vorgängerinnen findet.
Ganz ähnlich geht es zu im Märchen Das Mordschloß, das ursprünglich zu den Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm gehörte. Hier ist es die schöne Schuhmacherstochter, die dem Charme eines vornehmen Herrn verfällt und sich von ihm auf sein Schloss führen lässt. Als sie sich dem unheimlichen Haus in der Kutsche nähern, spricht der Mann:
Der Mond scheint so hell,
meine Pferdchen laufen so schnell,
süß Lieb, reuts dich auch nicht?
»Nein, warum sollt michs reuen? Ich bin immer bei Euch wohl bewahrt«, antwortet sie, doch das Märchen fährt fort, »da(ss) sie doch innerlich eine Angst hatte«. Aus guten Gründen. Als er einen Tag später das Schloss verlässt, schaut sie alles an »und fand alles so schön, daß sie damit völlig zufrieden war, bis sie endlich an einen Keller kam, wo eine alte Frau saß und Därme schrappte: ›Ei Mütterchen, was macht ihr da?‹, ›Ich schrapp Därme, mein Kind, morgen schrapp ich eure auch!‹« Das Mädchen aber entkommt und sorgt gar dafür, dass »der Herr von dem Mord-Castell« von der Staatsgewalt gefangen genommen wird.
Neben Gilles des Rais kennt das Mittelalter viele weitere unheimliche Mörder. Die schottische Kannibalenfamilie Bean lebte der Legende nach in einer Höhle im unwegsamen Bergland, ihre Mitglieder, angeblich insgesamt 48, überfielen Reisende und Dorfbewohner. Als man sie endlich geschnappt hatte, ließ König Jakob I. die Gefangenen 1436 öffentlich zerhacken und verbrennen. Das Mordregister des gefürchteten Christman Gniperdoliga aus Kerpen wiederum soll fast 1000 Namen enthalten haben, auch habe er, heißt es, das Blut Neugeborener getrunken. Diese Geschichte aus dem 16. Jahrhundert trägt stark sagenhafte Züge, spiegelt aber die Ängste ihrer Zeit drastisch wider.
Auch in der frühen Neuzeit gibt es solche Täter. Am bekanntesten unter ihnen ist vielleicht die mächtige ungarische Gräfin Elisabeth Bathory. Auf ihrer Burg Cachtice, deren imposante Ruine noch erhalten ist, soll sie unaussprechliche Grausamkeiten an Bauernmädchen verübt haben, die sie eigens zu diesem Zweck fangen ließ. Es ist freilich auch denkbar, dass die Bathory ihre Hintersassen lediglich, nach der beklagenswerten Sitte vieler ihres Standes, brutal behandelte und die katholischen Habsburger die Stürmung der Festung 1610 und den Prozess gegen die »Blutgräfin« bloß inszenierten, um den evangelischen Adel der Ungarn zu schwächen. Elisabeth Bathory wurde in ihrer Burg eingemauert, nur ein kleines Loch nach draußen blieb offen. Wenn es denn eine Habsburger Intrige war, dann nutzte sie geschickt die Ängste einer grausamen, aufgewühlten Zeit am Vorabend des Dreißigjährigen Krieges – der dann Schrecken brachte, für welche die Taten der Bathory, real oder fiktional, nur ein grausiger Prolog gewesen waren. Als weiblicher Vampir, »Comtesse des Grauens« und Figur in lüsternen Gruselfilmen wie Blut an den Lippen lebt ihr zweifelhaftes Andenken bis heute im Horror-Trash aller Art fort.
Wie fasziniert eine breite Leserschaft schon früh von Geschichten über unheimliche Mörder war, zeigt Paul Johann Anselm von Feuerbachs Aktenmäßige Darstellung merkwürdiger Verbrechen von 1829/30. Unter anderem enthält der Band den Beitrag »Andreas Bichel, der Mädchenschlächter«. Feuerbach (1775–1833), der große Rechtsgelehrte und begnadete Erzähler, hatte in Bayern maßgeblich zur Abschaffung der Folter beigetragen und den seinerzeit höchst modernen, heute verbindlichen Grundsatz nullam poenam sine lege verbreitet: Keine Strafe dürfe ohne gesetzliche Grundlage erlassen werden.
Im Fall des Andreas Bichel beschreibt Feuerbach bereits eine psychologische Vorgehensweise der Strafverfolger. 1806 und 1808 verschwanden im bayerischen Regendorf zwei junge Frauen, Barbara Reisinger, Tochter eines Tagelöhners, und Katharina Seidel. Ein Jahr später entdeckte Walburga, eine Schwester von Katharina, bei einem Schneider Stücke vom Rock der Vermissten. Die Spur führte zu einem Mann namens Bichel, und Walburga Seidel alarmierte das Landgericht Burglengenfeld: »Hier erzählte sie, vor ungefähr dreizehn Wochen, während ihrer Abwesenheit, habe Andreas Bichel morgens um halb acht eine Weibsperson in das Haus ihrer Schwestern geschickt und die Katharina unter einem Vorwande zu sich rufen lassen.« Nach ihrer Rückkehr erzählte das naive Mädchen, »Bichel wolle sie in einen Erdspiegel sehen lassen, in welchem sie ihr künftiges Schicksal lesen werde; hierzu müsse sie aber so viele Kleider mitbringen als nötig, um sich dreimal einzukleiden«.
Gerichtsdiener fingen schließlich Bichel im Wald und durchsuchten das Haus seiner Familie. Sie fanden verdächtige Kleiderreste, aber kein Blut und keine Leiche. Das gelang erst einem Hund der Gerichtsbediensteten, der wütend und laut vor einem nahen Schuppen anschlug; dort stießen die Suchenden dann auf die zwei schrecklich verstümmelten Überreste der vermissten Frauen. Bichel stand nun unter Verdacht, die beiden bei lebendigem Leibe zerstückelt zu haben. Doch wies er alle Vorwürfe zurück. »Während dieses ganzen Verhörs, welches 91 Fragstücke enthielt, bewährte sich [der] Inquisit standhaft als entschlossener Bösewicht«, schrieb Feuerbach. »Glücklicherweise« habe sich das Gericht »der Abschaffung der Tortur erinnert«; es sann daher auf feinsinnigere Wege, den Verstockten zum Reden zu bringen – und setzte ihn psychologisch unter Druck.
Die Gerichtsdiener führten ihn zurück in sein Haus, wo die grässlich anzusehenden Leichname seiner Opfer, »jede[s] so gut als möglich zusammengefügt«, auf Brettern lagen: »Jetzt vermag er sich nicht mehr zu halten, er sinkt auf einen Stuhl; alle seine Muskeln zittern, sein Gesicht verzerrt sich zu gräßlichen Zuckungen.« Bichel gestand beide Taten. Er hatte die Opfer gefesselt und ihnen die Augen verbunden, angeblich als Vorbereitung zum Blick in den wundersamen Zukunftsspiegel: »Dann habe ich ihr mit dem Messer, das ich in Bereitschaft hatte, in den Hals gestochen, daß das Blut herausgeflossen. Da habe ich nun auch sehen wollen, wie sie inwendig aussieht und habe daher ein Spanschnitzer genommen …« Es folgen grausame Details.
Es wäre vermessen, Feuerbach einen Vorgänger des Profilings zu nennen; dennoch versuchte er sich nachträglich an einem Täterprofil und verzichtete darauf, den Verbrecher schlicht als Ausgeburt der Hölle zu brandmarken. Zwar verglich er, im Stil noch ganz Kind seiner Epoche, den verdammenswerten Angeklagten sowohl mit »der im Finstern furchtsam schleichenden Kröte« wie auch »der tückisch lauernden, durch Blick und Hauch bezaubernden Klapperschlange«. Insgesamt aber entwarf er ein differenzierteres Charakterbild des Mörders.
So erkennt er jenseits der exzessiven Gewalttaten deren sexuelle Motive, »wollüstige Absichten«, die sich in der »Neugier nach der inneren Beschaffenheit eines weiblichen Körpers« offenbarten. Es werde oftmals verkannt, doziert Feuerbach, »wie genau Wollust und Blutdurst miteinander verbunden sind«. Auch erkannte er, wie heutige Psychologen es ebenfalls tun würden, wie der erste Mord die Hemmschwelle sinken ließ. Bei mehreren Frauen hatte Bichel den Spiegeltrick versucht, doch glaubten ihm diese zu ihrem Glück kein Wort; erst die schlichte Katharina Seidel fiel wieder darauf herein. Interessant ist die Feststellung, dass im Gegensatz zu einer verbreiteten Auffassung an dem Mörder äußerlich nichts Dämonisches zu erkennen war: »Sein Ruf war nicht eben der schlimmste. Er war weder der Völlerei noch dem Spiele, noch der Zänkerei ergeben. Auch zeichnete er sich sogar durch seine Religiosität vorteilhaft aus.«
Bichel war freilich durch Diebstähle und kleine Betrügereien aufgefallen. In ihm war etwas Triebhaftes, das er zu verbergen verstand: »Selbst die Friedfertigkeit gegen sein Weib, die Verträglichkeit gegen seine Nachbarn« seien erklärbar durch »eine feige Gemütsart, welche nicht beleidigt, bloß um nicht beleidigt zu werden, welche Beleidigungen erträgt, weil sie zu furchtsam ist, sie zu rächen, alsdann aber um so furchtbarer losbricht, sobald sie einmal in sicherer Heimlichkeit Macht und Gelegenheit gefunden hat«. Feuerbach sieht »eine kalte Natur, von menschlicher Lebenswärme verlassen«. Vieles davon würde in heutige Täterprofile passen.
»Brief aus der Hölle«: Jack the Ripper (1888)
Als Inbegriff des Bösen gilt bis heute der Serienmörder Jack the Ripper, der in einer kaum noch überschaubaren Vielzahl von Krimis, Thrillern, Horrorfilmen und Verschwörungstheorien fortlebt; noch heute sind Menschen im Internet bemüht, »die fehlenden Teile des Puzzles zu finden«.
Zum Ripper-Mythos trug erheblich bei, dass der Mörder nie gefunden wurde. 1888 tötete er im heruntergekommenen Londoner East End wohl fünf Prostituierte, vier von ihnen verstümmelte er mit einem Messer und entnahm ihnen innere Organe, daher der Beiname »Ripper« – der Schlitzer. Er verschickte womöglich selbst den bekannten »Brief aus der Hölle«, a letter from hell, dem er eine halbe menschliche Niere beifügte. Dies mag auch der makabre Scherz eines Unbeteiligten gewesen sein – das Problem falscher Bekenntnisse hat die Ermittlungen gerade bei spektakulären Fällen seither begleitet. Als der »Yorkshire Ripper« Peter Sutcliffe Ende der 1970er Jahre mindestens 13 Frauen ermordete, lockten angebliche Bekennerschreiben die Polizei in eine völlig falsche Richtung.
Die von der Presse ausführlichst geschilderte Mordserie Jack the Rippers erzeugte zum ersten Mal einen internationalen Medienhype als Folge eines Verbrechens – eine neue Zeit war angebrochen. Auch hier war bald das Motiv zu erkennen, diese unerhörte Reihe scheußlicher Mordtaten mitten in London, der Hauptstadt des britischen Empire, auf einen Verfall der Sitten und der sozialen Ordnung zurückzuführen. Verdächtigt wurden insbesondere Juden aus Osteuropa und sonstige mit Argwohn betrachtete Einwanderer. Mit Schaudern sah das Publikum auf den frühindustriellen Slum des East Ends, wo Elend, Prostitution und Kriminalität den dunklen Bodensatz der Metropole bildeten. Robert Anderson, einer der leitenden Polizeibeamten des Ripper-Falls, beschrieb 1910 in seinen Memoiren den Mörder als sexual maniac, als sexuellen Triebtäter, und behauptete: »Wenn ich sage, daß Jack the Ripper ein polnischer Jude war, konstatiere ich lediglich eine unumstößlich abgesicherte Tatsache.« Tatsache war das Gegenteil: Anderson hatte den Mörder nicht stellen können; nur einer unter den nicht wenigen Verdächtigen war ein – seelisch kranker – Jude aus Polen.
Wolfsmenschen: Serienmord und Öffentlichkeit (ab 1918)
Von nun an erregte in den Industriestaaten jedes ähnliche Verbrechen großes Aufsehen. Täter wie der Kannibale Paul Denke und der Hausierer Carl Großmann hatten ihre Mordserien noch in der Kaiserzeit begonnen. Aber erst die Medienlandschaft der Weimarer Republik war besessen vom Typ des »Massenmörders«, wie es seinerzeit hieß. In einer aufschlussreichen Dissertation dazu schreibt die Historikerin Anne-Kathrin Kompisch: »Der Serienmörder wurde in den 1920er Jahren sowohl zur Symbolfigur einer urbanen, technisierten, kapitalistischen Gesellschaft, aber auch als Manifestation des Eindringens vormoderner, atavistischer, primitiver Eigenschaften zu einer Bedrohung derselben stilisiert.« In der Kaiserzeit waren die Zeitungen durch Gängelungen seitens der Obrigkeit und durch eine pressefeindliche Rechtsprechung noch vergleichsweise zurückhaltend gewesen. In der neuen Freiheit der Republik änderte sich das schlagartig, Medien wie Kino-Wochenschauen und Rundfunk kamen hinzu.
All das hatte es nie zuvor gegeben: Groß aufgemachte Fotos gesuchter »Gewohnheitsverbrecher«, Fahndungsaufrufe als Pausenfüller auf der Kinoleinwand, Filme wie M – eine Stadt sucht einen Mörder. Künstler wie George Grosz malten blutrünstige Mordtaten, als Kritik der Zeit, der Verhältnisse, der Gesellschaft. Schrill und sensationsheischend kämpften die Blätter um Leser und Auflage, der »Boulevard« entwickelte sich zu einem Massenphänomen, über das Kulturkritiker seinerzeit nicht weniger klagten und lamentierten als später über das Fernsehen und noch später das Internet. Die Verwerfungen der Großstadt, materielle Not, politische Krisen wie der Kapp-Putsch1920, die Ruhrbesetzung und die Inflation 1923 sowie die wachsende Radikalisierung auf der Straße boten den Reportern Stoff genug. Noch dazu war die Presse, ganz wie die Weimarer Republik selbst, in zutiefst verfeindete Lager gespalten; und sie alle nutzten die »Massenmörder«, um ihre Botschaft an die Leser zu bringen.
So geriet das Verbrechen zum öffentlichen Ereignis, das an tiefsitzende Ängste ebenso rührte wie an politische Überzeugungen. Niemand hat die fiebrige Atmosphäre jener Zeit besser beschrieben als der Philosoph Theodor Lessing. Er berichtete 1924 über den spektakulären Prozess gegen den Knabenmörder Fritz Haarmann. Und ein Jahr zuvor, als der Mörder noch unerkannt umging, schrieb Lessing: »Seit Monaten machte sich in der Umgebung Hannovers eine Epidemie des Aberglaubens bemerkbar. Mädchen, die in die Stadt zum Einkaufen geschickt wurden, weigerten sich, in die Läden zu gehen. Im Volke herrschte das gruselige Gerede, in Fleischerläden der Vororte werde Menschenfleisch feilgehalten. Dann wieder wurde herumerzählt, es gäbe in den winkligen Straßen der Altstadt geheime Versenkungen. Kinder würden in die Häuser hineingelockt und kämen dann nicht wieder zum Vorschein. Besonders knüpften sich solche Faselgeschichten an die phantastischen alten Gäßchen in der Gegend des ›Hohen Ufers‹. Von den alten Häusern am Leineufer führen Treppen zum Wasser hinab. Die Keller liegen oft unter dem Niveau des Flusses. Hier sollen Kinder verschwunden sein …«
Lessing fährt fort: »Von 1918 bis 1924 konnte in einer deutschen Stadt ein Mordherd bestehen, konnte ein perverser Mensch Mord auf Mord verüben, ohne daß es in einem dieser Fälle der Polizei gelang, die Spur vermißter Knaben und Jünglinge aufzufinden … Man greift sich an den Kopf und fragt: Wie ist das möglich? Und wenn das möglich ist, in welcher Zeit, in welchem Staate leben wir?«
Für viele Menschen in der Weimarer Republik war ebendas die Frage. Ihnen galten die Serienmorde als scheußlichstes Symptom einer aus den Fugen geratenen Zeit. Die Demokratie war schwach und ungeliebt, die alten Strukturen des Zusammenlebens hatte der Krieg zersprengt, und die Polizei schien die Bürger nicht schützen zu können vor den Unholden, die nachts umgingen. Die Rechten gingen so weit, den Versailler Vertrag von 1919 und Deutschlands Niederlage im Krieg für Verbrechen wie Haarmanns Knabenmorde verantwortlich zu machen sowie den »ungeheuren Druck, der auch heute noch von Deutschlands Feinden ausgeübt wird«. Diese sorgten »nach Kräften dafür …, die sittliche Verwahrlosung des deutschen Volkes zu fördern«. Die Kommunisten argumentierten umgekehrt, Haarmann sei ein Produkt der bürgerlichen Klassengesellschaft, eine extreme Ausgeburt ihrer »Macht, Unterdrückung und Willkür«.
Für Lessing war Haarmann, der mindestens 24 Jungen ermordet und meist zerstückelt hatte, ein Spiegelbild amoralischer Verhältnisse. »Dieses Wolfstum bei Radio und Elektrizität, der Kannibalismus in eleganter Wäsche und Kleidung, dürfte damit ein Merkmal sein für die Seele der abendländischen Wolfsmenschheit überhaupt«, so der Philosoph, der 1934 von den Nazis ermordet wurde. »Der Mensch ist dem Menschen von Natur aus der Wolf.« Er erinnerte sich daran, 1914 in einem Lazarett einen Menschen behandelt zu haben, »dessen Ruhm und Glück es war, wiederholt an Wachposten der Feinde herangeschlichen zu sein und sie mit den Händen erwürgt zu haben; dessen Brust aber schmückte das Eiserne Kreuz«.
Wenn man so will, hat sich dieser Kulturpessimismus gar nicht sonderlich verändert. Durch alle Zeiten dominiert die Vorstellung, die Veränderung, ja der Niedergang des Gewohnten, sozialer Ordnungen, der Wertvorstellungen und der Gesellschaft selbst fänden im Serienmörder ihren abgründigsten Ausdruck.
In den Jahrzehnten nach 1945 waren viele Deutsche erneut überzeugt, in einer Epoche des Verbrechens zu leben. Berichtete die Boulevardzeitung oder das neue Medium Fernsehen über spektakuläre Straftaten, lautete ein gängiger Satz: »So etwas wäre früher nicht vorgekommen.« Früher, das hieß im Dritten Reich, unter Hitler. Der Glaube, damals hätten noch Ordnung und Sicherheit geherrscht, war eine Nachwirkung der NS-Propaganda. In Wirklichkeit gab es auch während der NS-Diktatur zahlreiche schwere Verbrechen, die der Staat in den nunmehr gelenkten Medien freilich sorgsam totschweigen ließ – einmal ganz abgesehen davon, dass es ab 1933 dieser Staat selbst war, der bis dahin unvorstellbare Verbrechen begehen ließ. Wahrscheinlich ist, nach jüngeren Forschungen, die Zahl der klassischen Kapitaldelikte während des Dritten Reiches gar nicht signifikant gesunken, auch nicht während des Krieges, der eine normale polizeiliche Arbeit massiv erschwerte. Als in den dreißiger Jahren zwei Berliner Brüder nachts Liebespaare und Autofahrer überfielen und mehrere Menschen verletzten oder töteten, verbot Propagandaminister Joseph Goebbels der Kripo, öffentlich nach den Tätern zu fahnden. Offiziell durfte es solche Schwerverbrechen im NS-Staat nicht geben. Der Polizei war es damit untersagt, mögliche Opfer zu warnen oder die Öffentlichkeit in die Fahndung mit einzubeziehen. Als Folge begingen die Serientäter zahlreiche weitere Verbrechen, bis sie 1938 durch einen Zufall aufflogen.
Demnach gab es also, wie in der verfemten Republik zuvor, auch nun wieder Fälle von Serientätern. Keiner von ihnen wurde offenbar durch das brutalisierte Strafrecht der NS-Justiz abgeschreckt (ein interessanter Präzedenzfall bis zur rechtspolitischen Debatte von heute, in der vor allem Konservative immer neue Gesetze und höhere Strafen gegen Kriminelle fordern).
So tötete der Serienmörder Johann Eichhorn zwischen 1931 und 1939 fünf Frauen, vier davon nach