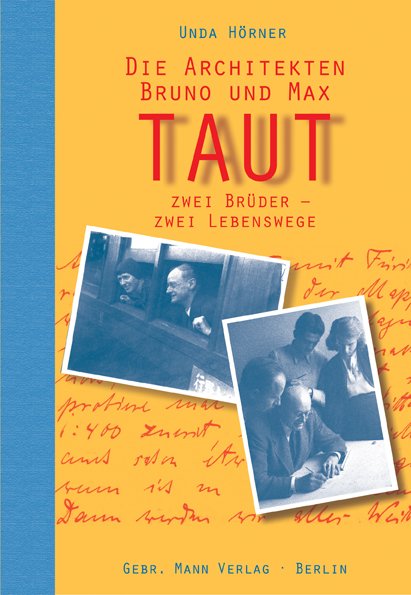19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ebersbach & simon
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Eine spannende Zeitreise ins Schicksalsjahr berühmter Frauen. Unda Hörner folgt den Spuren berühmter Frauen in zwölf lebendig erzählten Kapiteln durch das Jahr 1939: Hannah Arendt gelingt die Flucht nach New York, Helene Weigel zieht mit dem Brecht-Tross nach Schweden. Marlene Dietrich nimmt die amerikanische Staatsbürgerschaft an, Erika Mann veröffentlicht mit Bruder Klaus ein Who's who der deutschen Kultur im Exil. Frida Kahlo macht Furore mit einer Ausstellung in Paris, während Kafkas einstige Gefährtin Milena Jesenská in den Prager Widerstand geht. Simone de Beauvoir schreibt im Café de Flore ihr Kriegstagebuch, Annemarie Schwarzenbach und Ella Maillart touren im Auto von Zürich nach Kabul und Else Lasker-Schüler träumt derweil im »Hebräerland« vom Romanischen Café. Eine fulminante Zeitreise in das Schicksalsjahr 1939, an dessen Ende nichts mehr so sein wird, wie es war. Nach »1919« und »1929« – der 3. Band von Bestsellerautorin Unda Hörner!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Unda Hörner
1939Exil der Frauen
ebersbach & simon
Inhalt
Januar
Simone de Beauvoir in den besten Jahren * * * Else Lasker-Schüler schickt der Zürcher Fremdenpolizei eine Postkarte * * * Frida Kahlo verflucht die Pariser Surrealisten * * * Luise Mendelsohn richtet in Jerusalem eine Windmühle ein * * * Asta Nielsen sagt Nein
Februar
Gisèle Freund zeigt ihre Farbfotos in der »Maison des Amis des Livres« * * * Dorothy Thompson sprengt Versammlung amerikanischer Nazis * * * Annemarie Schwarzenbach kauft einen Ford * * * Eleanor Roosevelt wirbt für Auswanderung in die USA
März
Frida Kahlo verkauft ein Bild nach Frankreich * * * Milena Jesenská denkt an Franz Kafka * * * Gisèle Freund porträtiert James Joyce und Virginia Woolf * * * Else Lasker-Schüler nimmt Abschied von der Limmat * * * Ruth Berlau macht Behördengänge für Brecht * * * Olympisches Gold für Leni Riefenstahl
April
Else Lasker-Schüler zurück im Hebräerland * * * Ingrid Warburg wirbt in den USA für Flüchtlingshilfe und lauscht MarianAnderson * * * Erika Mann stellt »Escape to Life« vor * * * Ruth Berlau besorgt die »Svendborger Gedichte« * * * Simone de Beauvoir hat Angst um Sartre * * * Lotte Jacobi trifft Albert Einstein * * * Virginia Woolf schreibt ihre Erinnerungen auf
Mai
Annemarie Schwarzenbach und Ella Maillart machen sich schlau * * * Gisèle Freund blickt zufrieden auf das »Time Magazine« * * * Ingrid Warburg sucht Gastfamilien für Flüchtlingskinder * * * Luise Mendelsohn und Else Lasker-Schüler trauern um Ernst Toller * * * Helene Weigel schreibt an Walter Benjamin * * * Gertrude Stein gratuliert dem Eiffelturm * * * Anna Freud lebt sich in London ein
Juni
Peggy Guggenheim schüttet Gisèle Freund ihr Herz aus * * * Luise Mendelsohn organisiert eine Lesung mit Else Lasker-Schüler * * * Dorothy Thompson for President * * * Erika Mann schreibt in Paris Gedichte * * * Eva Braun fährt zu den Fjorden
Juli
Luise Mendelsohn und die Liebe fürs Leben * * * Frida Kahlo hat Liebeskummer * * * Milena Jesenská unterstützt die Zentralstelle für jüdische Auswanderung in Prag * * * Simone de Beauvoir geht wandern * * * Hannah Arendt schreibt über Rahel Varnhagen * * * Lale Andersen singt »Lili Marleen«
August
Ruth Berlau inszeniert Einakter in Stockholm * * * Simone de Beauvoir schockiert über Hitler-Stalin-Pakt * * * Ingrid Warburg reist nach Polen * * * Annemarie Schwarzenbach und Ella Maillart erreichen Kabul * * * Virginia Woolf fürchtet um ihre Träume
September
Böses Erwachen für Virginia Woolf * * * Erika Mann diskutiert in Stockholm * * * Simone de Beauvoir beginnt ein Kriegstagebuch * * * Gisèle Freund sorgt sich um Walter Benjamin * * * Anna Freud trauert um ihren Vater * * * Annemarie Schwarzenbach und Ella Maillart gehen getrennte Wege * * * Unity Mitford ist maßlos enttäuscht
Oktober
Simone de Beauvoir besucht Sartre mit einer Notlüge * * * Ingrid Warburg und Adam von Trott zu Solz zu Gast bei Eleanor Roosevelt * * * Augenzeugin in Warschau, die Schriftstellerin Aurelia Wylezynska * * * Else Lasker-Schüler will sich nicht entzaubern lassen
November
Simone de Beauvoir isst Choucroute * * * Frida Kahlo lässt sich scheiden und braucht Geld * * * Milena Jesenská wird verhaftet * * * Adrienne Monnier und Gisèle Freund retten Walter Benjamin * * * Erika Mann wieder auf »lecture tour« * * * Zarah Leander auf dem Adventsbasar
Dezember
Simone de Beauvoir wartet auf Sartre * * * Gisèle Freund, Lotte Jacobi und das Glück der Kamera * * * Frida Kahlos Abendmahl * * * Ingrid Warburg baut Rettungsorganisation für Flüchtlinge aus * * * Luise Mendelsohn spielt Bach * * * Helene Weigel packt wieder die Koffer * * * Annemarie Schwarzenbach im glücklichen Tal * * * Virginia Woolf liest Freud * * * Gertrude Steins Welt ist rund
Quellen
Januar
Simone de Beauvoir in den besten Jahren * * * Else Lasker-Schüler schickt der Zürcher Fremdenpolizei eine Postkarte * * * Frida Kahlo verflucht die Pariser Surrealisten * * * Luise Mendelsohn richtet in Jerusalem eine Windmühle ein * * * Asta Nielsen sagt Nein
Das Gold der Zwanzigerjahre ist längst zerstoben wie die Funken des Feuerwerks, mit dem das neue Jahr begrüßt wird: 1939. Ferne Sterne der Erinnerung sind die glanzvollen Theateraufführungen am Schiffbauerdamm und auf der Piscatorbühne, die Kostümfeste am Bauhaus, die Revuen und Filmpremieren am Kurfürstendamm. Die Protagonisten der Dreigroschenoper, die Architekten des Neuen Bauens, die Dichter, die an den Tischen des Romanischen Cafés gesessen haben, die Filmstars aus den Kinopalästen, sie sind in alle Himmelsrichtungen versprengt, Emigranten allerorten, in Paris und London, in Stockholm und Prag, in Jerusalem und New York. Indessen bezieht Hitler seine überdimensionierte Reichskanzlei in der Berliner Voßstraße, seit fast sechs Jahren ist er schon an der Macht. Faschisten regieren auch in anderen Ländern Europas, Mussolini in Italien, Franco in Spanien; noch am Silvestertag des Jahres 1938 richten italienische Kampfflugzeuge unter der Zivilbevölkerung von Barcelona ein Massaker an. Wer an den Fortschritt der Menschheit und an Frieden in Europa geglaubt hat, reibt sich fassungslos die Augen. Das 1919 in Deutschland eingeführte Frauenwahlrecht ist keinen Pfifferling wert in einer gleichgeschalteten Gesellschaft, und zur Wahl stellen dürfen Frauen sich auch nicht mehr, die Nationalsozialisten sind eine reine Männertruppe. Die Weltwirtschaftskrise von 1929 hat ihren Aufstieg befördert, und mit ihnen überzieht der Antisemitismus Europa.
Rund zwanzig Jahre nach dem Frieden von Versailles droht nun erneut Krieg in Europa. Im März 1938 ist Hitler in Österreich einmarschiert. Nun reklamiert er das Sudetenland, die tschechischen Gebiete an der deutschen Grenze, in denen eine deutsche Minderheit angesiedelt ist. Um die Kriegsgefahr abzuwenden, geben Großbritannien, Frankreich und Italien klein bei und willigen in die Forderung ein. Münchner Abkommen, so heißt die Erpressung vom 30. September 1938. Louis Aragon macht seiner Verachtung für diesen faulen Frieden im kommunistischen Blatt Ce Soir Luft: »Es wird keinen Frieden geben, der diesen Namen verdient, der es zulässt, dass solche Rechtsverweigerung und solche Empörung in Europas blutendem Herzen fortbestehen. Ich wünsche mir einen Frieden, der die Erinnerung an München bis auf die Grundfesten zerstört. […] Ich für meinen Teil wünsche mir, dass 1939 den Weltfrieden verkündet.«
Nasskalt ist es in diesem Januar in Paris, Simone de Beauvoir sitzt im Café de Flore und trinkt ihren dritten Kaffee an diesem Spätnachmittag, im Aschenbecher qualmt eine Zigarette. Reger Feierabendverkehr auf dem Boulevard Saint-Germain, Menschen unterwegs zur Métro holen aus einer Boulangerie noch rasch Baguette und eine galette des rois, den traditionellen Dreikönigskuchen, in dem sich ein Glücksbringer verbirgt. Wer das Stück erwischt, in dem ein Figürchen in Form eines Kleeblatts oder eines Schweins steckt, darf eine goldene Papierkrone aufsetzen, das neue Jahr ist ihm hold. Einen Glücksstern bräuchte es jetzt allerdings am Himmel, der sich über ganz Europa verdüstert hat. Hitler, das bedeutet Krieg.
Bloß das nicht, nicht schon wieder! Simone de Beauvoir erinnert sich noch gut daran, wie sie als Zehnjährige den Waffenstillstand im November 1918 erlebte, sie sieht die weinenden Witwen und das Elend der Kriegsheimkehrer in Rollstühlen und an Krücken oder mit Binden vor den blinden Augen. Auch die Frauen waren nach dem Krieg nicht mehr dieselben wie davor; so selbstbewusst waren sie geworden, standen im Berufsleben und ließen sich nicht mehr in die zweite Reihe zurückdrängen. Doch welch hohen Preis haben sie für die Emanzipation zahlen müssen! Simone schiebt den Gedanken an einen erneuten Krieg weit fort und versucht, sich wieder ganz und gar auf ihre Arbeit zu konzentrieren. Seit vergangenem Herbst arbeitet sie an einem Roman, der sich um ein Paar mit fortschrittlichen Liebesidealen dreht. Nicht schwer, hinter der Schriftstellerin Françoise und dem Regisseur Pierre die Autorin selbst und ihren Gefährten Jean-Paul Sartre zu vermuten. Die junge Xavière, mit der sie sich auf eine Ménage-à-trois einlassen, ist im wahren Leben als Olga Kosakiewicz wiederzufinden, eine Schülerin am Lyzeum in Rouen, wo Simone de Beauvoir 1932 eine Stelle als Philosophielehrerin angetreten hatte. Einen Roman über ihr Beziehungsgeflecht jener Zeit zu schreiben, ist nicht nur eine intellektuelle, sondern auch eine emotionale Herausforderung, denn mit der Erinnerung steigt die Eifersucht in ihr auf und brennt wie an jenem Tag, als Sartre sich mit Olga einließ. Um ehrliche, wahrhaftige Worte für ein offenes Liebesideal ohne Besitzansprüche zu finden, müsste Simone sich ganz von der Angst befreien können, Sartre an eine andere Frau zu verlieren. Sie liebt ihn so sehr, noch immer. Gerade ist Sartres Kurzgeschichtenband erschienen, Le Mur – Die Mauer, und gewidmet hat er das Buch Olga Kosakiewicz. Aber gehört Sartre nicht zu ihr allein, zu ihr, Simone?
Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre haben vor zehn Jahren einen Pakt miteinander geschlossen. Unbedingtes gegenseitiges Vertrauen haben die beiden Geistesverwandten sich geschworen, keine Lügen, keine Ausreden, niemals; als Einheit wollen sie sich verstehen, ein Paar in höheren Sphären, erhaben über gelegentliche Affären. »Wir waren der Ansicht, dass die menschlichen Beziehungen dauernd neu erfunden werden müssten, dass keine Form a priori privilegiert, keine unmöglich sei: dieses schien uns zwingend.« Die monogame Ehe wollen sie als bloßes Konstrukt, als Illusion der bürgerlichen Gesellschaft, hinter sich lassen. Simone hat im Sommer 1929 sogar Sartres Heiratsantrag abgelehnt, doch eine offene Beziehung, das weiß sie inzwischen, birgt Sprengstoff. Immer wieder muss sie beim Schreiben innehalten, um Worte zu finden für die Komplexität menschlicher Gefühle, ohne dass Misstöne durchs Hohelied auf die offene Liebe schrillen. Bei der Arbeit am Roman wird ihr deutlich, wie sehr sie sich in den letzten Jahren und Monaten verändert hat, realistischer ist sie geworden, nüchterner, abgeklärter. Es fällt ihr schwer, sich in ihr früheres Empfinden hineinzuversetzen, um die Figur Françoise glaubhaft zu gestalten. Doch Simone muss sich sputen, wenn der Roman noch dieses Jahr erscheinen soll, und Konzentration auf die Arbeit ist ohnehin das beste Mittel, um sich von den Gedanken an eine drohende Katastrophe abzulenken. Was wäre, wenn Hitler Frankreich angreifen würde, was hieße das für die vielen Emigranten im Land, die dort wieder in der Falle säßen? Sie mag es sich nicht ausmalen: Sartre in Uniform, Sartre an der Front, Sartre im Schützengraben. Simone muss den Kopf schütteln, wenn sie an ihre Eifersucht denkt, diese kleinliche Missgunst wegen ein bisschen Sex, lächerlich! Die Tortur, die ihr das Erinnern zumutet, ist doch harmlos angesichts der aufsteigenden Angst vor dem Krieg. Sie schreibt gegen die Zeit, schreibt an gegen die ungewisse Zukunft. L’Invitée – Sie kam und blieb, so soll der Roman heißen.
Simone de Beauvoir steht mitten im Leben. Seit Herbst 1936 unterrichtet sie wieder in ihrer Heimatstadt Paris, am Lycée Molière in Passy, dem bürgerlichen 16. Arrondissement. Die Schülerinnen lauschen ihren Ausführungen über Descartes und Husserl, sind nicht nur von ihrer Klugheit und Gedankenschärfe angetan, sondern ebenso von ihrer Eleganz und Aufgeschlossenheit, von der außergewöhnlichen Erscheinung ihrer Philosophielehrerin in Schneiderkostüm und modischen Pumps, sie hängen an den Lippen einer Dame von Welt. Als Lehrerin ist Simone überaus beliebt, und einer Karriere als Schriftstellerin sieht sie hoffnungsvoll entgegen, nichts wird sie davon abbringen, auch Hitler nicht. Am 9. Januar 1939 wird Simone de Beauvoir einunddreißig. Eine Frau in den besten Jahren.
* * *
»Hochzuverehrender Herr Direktor«, adressiert Else Lasker-Schüler eine farbige Ansichtskarte ans Passzimmer 41 der Fremdenpolizei in der Züricher Uraniastraße, »mit den lila Margaritten [sic] noch im Stein, darf ich doch danken?« So charmant versucht die Dichterin, den Amtsschimmel bei Laune zu halten. In der Schweiz, wohin sie am 19. April 1933 geflüchtet ist, wird sie bloß geduldet; alle drei Monate muss sie das Land wieder verlassen, um ihren Aufenthaltsstatus zu erneuern. Für die Nationalsozialisten in Deutschland ist sie »die typische Vertreterin der in der Nachkriegszeit in Erscheinung getretenen ›emanzipierten Frauen‹. Durch Vorträge und Schriften versuchte sie, den seelischen und moralischen Wert der deutschen Frau verächtlich zu machen.« 1938 wurde ihr die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt. Nun ist Else Lasker-Schüler ›schriftenlos‹, wie es in der Schweiz heißt. Das bedeutet auch, dass sie hier keine Arbeitserlaubnis bekommt. Einer der besten Lyrikerinnen der Weimarer Republik, der 1932 der renommierte Kleist-Preis verliehen wurde und die demnächst, am 1. Februar 1939, ihren siebzigsten Geburtstag begeht, hetzt man regelmäßig die Fremdenpolizei auf den Hals.
Dabei hat Lasker-Schüler in Zürich gute Kontakte aus früheren Aufenthalten hier; zu ihren treuen Unterstützern gehört etwa der Feuilletonredakteur der Neuen Zürcher Zeitung Eduard Korrodi. Auch der Verband der Schweizer Israelitischen Armenpflege hat sich für sie eingesetzt und zugesichert, für ihre Lebenshaltungskosten aufzukommen, das lässt ein wenig hoffen. Im Hotel Seehof an der Schifflände oder im Café Select, der »Urenkeltochter des Romanischen Cafés« in Berlin, wo Else Lasker-Schüler von ihrem Stammplatz vertrieben wurde, schreibt sie wehmütige Tagebuchzeilen aus Zürich nieder: »Einlullende Radiomusik wiegt unsere Emigration leise ein. Und warten doch im Traume nicht mehr auf das Wunder. Das Romanische Cafe im balkonbesetzten Gebäude am Ende des Tauentzien gehörte uns Künstlern und dem Bürger Berlins, der sich heimisch zwischen uns abenteuerlichen Menschen fühlte, zwischen hell- und dunkeläugigen.« Und sie dichtet: »Durch die blanken Scheiben der Romanischen Terrasse, / Blickt mancher Blick noch über seine Cafetasse, / Manch eines Cafehausbesuchers Augen nach uns aus.«
Als am 31. Januar in der Londoner Galerie Matthiesen in der New Bond Street eine Ausstellung mit Zeichnungen Else Lasker-Schülers eröffnet wird, ist die Dichterin leider nicht anwesend. Man hat ihr dringend von einer Reise nach England abgeraten, da sich das Land schon morgen im Krieg befinden könnte. Aber die drei Monate Schweizer Schonfrist sind bald wieder um, und warum nicht erneut nach Palästina reisen, das britische Mandatsgebiet im Nahen Osten? Lasker-Schüler kennt sich doch schon bestens aus in ihrem Hebräerland, über das sie gleich nach ihrer ersten Reise, 1937, ein Buch geschrieben hat: »Demut, Genügsamkeit und Hingabe heißen die drei Eigenschaften Jerusalems, drei schneeweiße Eselinnen, die den armen Hebräerjungen gehören. Auf denen ich zu reiten pflegte abwechselnd, manchmal warfen sie mich widerspenstig in den Sand. Doch auf den lebendigen reinen Lehren durchstreifte ich Gottes Lieblingsstadt.« Also nichts wie wieder hin!
Zur Stunde verhandelt in Berlin der amerikanische Rechtsanwalt George Rublee mit dem deutschen Ministerialdirektor Helmuth Wohlthat über die organisierte Auswanderung der jüdischen Bevölkerung aus dem Dritten Reich. Die Emigration nach Palästina wird in Deutschland durchaus mit Argwohn gesehen, die Nationalsozialisten befürchten, dass sich ein Palästina mit einer starken und gebildeten Bevölkerung aus europäischen Einwanderern rasch zu einer Keimzelle der Macht entwickelt. Im Raum steht die perfide Idee, die europäischen Juden allesamt nach Madagaskar abzuschieben, die Insel als riesiges Ghetto vor der Küste Ostafrikas, wo sie völlig isoliert, fern und unbemerkt von Europa zugrunde gehen sollen, doch der Plan ist allzu aufwendig, strategisch schwierig und wird wieder verworfen. Stattdessen wird alles daran gesetzt, die Auswanderer finanziell und moralisch zu schwächen, ihnen nicht viel mehr zu lassen als das letzte Hemd am Leib. ›Reichsfluchtsteuer‹, so der bürokratische Name der Zwangsabgabe, die Emigranten leisten müssen, nachdem sie ihr Hab und Gut zum Schleuderpreis haben veräußern müssen. Welches Land der Welt hat schon ein Interesse daran, einen Haufen armer Schlucker aufzunehmen? Mit derartigen Methoden heizt man im Dritten Reich den weltweiten Antisemitismus immer noch weiter an. Jene Juden, die Deutschland jetzt noch verlassen können, sind ab sofort mit einem Pass unterwegs, in dem sie der eingetragene Beiname ›Sara‹ oder ›Israel‹ auf den ersten Blick brandmarkt. Dann doch lieber schriftenlos.
* * *
Auch Frida Kahlo soll in diesem Winter eine eigene Ausstellung bekommen, in Paris. Ihr Mann Diego Rivera hat ihr geraten, persönlich in die Stadt zu fahren, wo schon so viele Maler ihr Glück gemacht haben: »Sei nicht dumm. Schon um meinetwillen möchte ich nicht, dass Du Deine Chancen in Paris verpasst. Nimm alles mit, was das Leben Dir bietet, was es auch sei. Hauptsache, es ist für Dich interessant und macht Dir Freude. Wenn man alt ist, weiß man, was es heißt, Gelegenheiten verpasst zu haben, die sich einem boten und die man nicht beim Schopf ergriffen hat.«
Am 9. Januar geht die Mexikanerin in New York an Bord der SS Paris, Europa mit Zuversicht entgegenblickend. Kurator der Ausstellung ist der berühmte Surrealist André Breton. Man hat sich vergangenen April kennengelernt, als die Bretons auf Vortragsreise in Mexiko waren. Besonders mit Bretons zupackender Frau Jacqueline Lamba, auch sie Malerin, verbindet Frida seither ein freundschaftliches Verhältnis. Zugegeben, Frida fand André Breton von Anfang an ziemlich elitär und selbstbezogen, doch was er im November 1938 im Katalog zu ihrer Einzelausstellung in Julien Lévys New Yorker Galerie schrieb, lässt sie über seine Borniertheit hinwegsehen: »Heute füge ich hinzu, dass keine Malerei mir so ausschließlich weiblich erscheint – in dem Sinne, dass sie, um durch und durch verführerisch zu sein, nur allzu gern bereit ist, sich bald im Gewand der vollendeten Reinheit, bald in der Rolle höchster Verderbtheit zu präsentieren. Die Kunst der Frida Kahlo ist eine Schleife um eine Bombe.« Die New Yorker Ausstellung war ein durchschlagender Erfolg, ein gesellschaftliches Ereignis, warum nicht genauso reüssieren in Paris?
Als Frida Kahlo am 21. Januar 1939 in Le Havre an Land geht, erwartet Breton die Weitgereiste mit ernüchternden Nachrichten. Er hat es bislang versäumt, ihre Bilder vom Zollamt abzuholen, habe versprochene Fotografien nie von ihr bekommen und überhaupt, das erwähnt Breton jetzt ganz nebenbei, besitze er schon lange keine eigene Galerie mehr. Die Fotos seien schon vor langer Zeit abgeschickt worden, entgegnet Frida ärgerlich. Ihre Stimmung wird nicht besser, als man ihr in der Wohnung der Bretons in Rue Fontaine 42 ihr Gästebett zeigt, teilen soll sie sich das Zimmer, mit der Tochter Aube!
Zu allem Übel halten sich die Surrealisten, unter ihnen auch Max Ernst und Paul Éluard, mit Spielen bei Laune, die ihre Fantasie befeuern sollen. Die Psychoanalyse, die Einblick in tiefste Bewusstseinsschichten gewährt, ist eine Goldmine, in der Maler und Literaten schürfen. Beim sogenannten Wahrheitsspiel müssen Fragen nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet werden. Oberster Richter über dieses Spiel ist natürlich Breton. Frida will ihr wahres Alter partout nicht verraten, zur Strafe muss sie einen Liebesakt mit einem Sessel mimen. Das Polstermöbel liebkosend, spielt sie die Scharade mit, doch gegenüber ihrem Geliebten Nickolas Muray macht sie sich Luft: »Du kannst Dir nicht vorstellen, was diese Leute für Kanaillen sind«, schreibt sie ihm nach New York. »Sie sind so verdammt ›intellektuell‹ und mies, dass ich sie nicht länger ertragen kann. Es ist wirklich zu viel für mich. Lieber hocke ich mich auf den Markt von Toluca und verkaufe Tortillas, als etwas mit diesen schäbigen Pariser ›Künstlern‹ zu tun zu haben. Sie sitzen stundenlang in den ›Cafés‹, wärmen ihre feinen Ärsche und quatschen ununterbrochen über ›Kultur‹, ›Kunst‹, ›Revolution‹ und so weiter, und so fort. Sie halten sich für Gott, fantasieren den aberwitzigsten Unsinn zusammen und verpesten die Luft mit immer neuen Theorien, die nie Wirklichkeit werden.«
Breton hat noch nicht einmal in Sachen Ausstellung Fortschritte gemacht. Was soll Frida überhaupt hier? »Es war sinnlos hierherzukommen, nur um zu sehen, warum Europa vor die Hunde geht und wie diese ganzen Taugenichtse den Hitlers und Mussolinis Tür und Tor öffnen.«
Zu Fridas Ärger kommt eine ernsthafte Infektion, sie muss eine Nierenentzündung im Amerikanischen Krankenhaus in Neuilly auskurieren. ›Sobald ich hier raus kann, fahre ich ab‹, sagt sie sich und bucht für den 8. März schon mal einen Platz auf der Isle de France. Sie glaubt nicht mehr an ihre Ausstellung. Eine weitere, geplant für Peggy Guggenheims Londoner Galerie Guggenheim Jeune, will sie lieber sausen lassen, als noch einen einzigen Tag länger in Europa zu bleiben. Die Lage ist ohnehin ungünstig für den Kunstmarkt: »Die Leute haben eine Heidenangst vor dem Krieg, und alle Ausstellungen waren Misserfolge, weil die reichen Säcke nichts kaufen wollen. Was hat es also für einen Sinn, nach London zu gehen? Mit einer solchen Anstrengung in London würde ich bloß meine Zeit verlieren.«
Rettung naht in Gestalt von Marcel Duchamp. Der übernimmt Bretons Job, löst Fridas Gemälde beim Zoll aus und gewinnt die Galerie Pierre Colle für die Ausstellung. Kaum kommt die Sache in Gang, meldet sich Breton wieder zu Wort und verlangt, neben Fridas Bildern vierzehn mexikanische Porträts aus dem 19. Jahrhundert und dreißig Fotografien von Manuel Álvarez Bravo auszustellen, nebst Kunsthandwerk, das er auf Märkten in Mexiko zusammengekauft hat. Lauter Plunder, kitschige Folklore, muss sich die Künstlerin schon wieder aufregen. Überdies stellt sich heraus, dass die alten mexikanischen Ölbilder noch restauriert werden müssen, bevor man sie zeigen kann. Breton jedoch hat die 200 Dollar, die das kostet, nicht flüssig. Damit es vorangeht, lässt sich Frida überreden, ihm Geld zu leihen. Mitte März soll es endlich so weit sein. Als dann der Kompagnon des Galeristen befindet, man könne nur zwei von Fridas Bildern zeigen, der Rest sei zu shocking fürs Publikum, ist die Geduld der Künstlerin endgültig erschöpft, die Ausstellung droht doch noch zu scheitern. »Ich könnte diesen Kerl umbringen«, flucht Frida.
Am 26. Januar 1939 ist das linke, intellektuelle Paris schockiert über die Nachricht, dass Francos Truppen Barcelona besiegt haben. Nach zweieinhalb Jahren Bürgerkrieg müssen sich die Republikaner den Faschisten ergeben. Venceremos! – solch kämpferische Stimmen sind verstummt. Frida Kahlo schnürt sofort Pakete mit ihren mexikanischen Kleidern als Spende für Flüchtlinge, die über die Pyrenäen nach Frankreich kommen. Sie schreibt an Diego, er müsse sich unbedingt dafür einsetzen, spanischen Republikanern die Überfahrt nach Mexiko zu ermöglichen. »Diese erbärmlichen Franzosen haben sich gegenüber den Flüchtlingen wie Schweine verhalten; sie sind Dreckskerle von der schlimmsten Sorte, die ich je kennengelernt habe. Diese ganzen verkommenen Leute in Europa widern mich an, diese jämmerlichen ›Demokratien‹ sind keinen Pfifferling wert …«
* * *
Die Möglichkeit, die Else Lasker-Schüler gerade erst ins Auge fasst, ist für Erich und Luise Mendelsohn längst beschlossene Sache: »Wir gehen nach Palästina.«
Das Paar pendelt seit fünf Jahren zwischen London und Jerusalem, in beiden Städten unterhält Erich Mendelsohn ein Architekturbüro, auch im Exil ist er gut beschäftigt. Ein jeder kennt den Stararchitekten der Weimarer Republik, sein Universum-Kino am Kurfürstendamm, das Verlagshaus Mosse oder das Columbushaus am Potsdamer Platz, wo er sein Büro hatte. Im März 1933 hat Mendelsohn es ein letztes Mal betreten. Am 31. März 1933 verließen die Mendelsohns Berlin, denn schon am nächsten Tag, so wurde ihnen zugetragen, sollte die Gestapo vor der Tür stehen. Sicherheitshalber hatten sie ihre Flucht geheim gehalten, gelangten per Nachtzug über die holländische Grenze nach Amsterdam. Freunde aus Diplomatenkreisen wollten sie zum Bleiben bewegen, so schlimm werde es für die Juden schon nicht kommen, doch Schulklassen, die, das Horst-Wessel-Lied auf den Lippen, an der Mendelsohn-Villa Am Rupenhorn vorbeimarschierten, stimmten andere Töne an.
Vor Kurzem wurde Erich Mendelsohns eleganter Strandpavillon in Bexhill-on-Sea an Englands Südküste eröffnet, und auch Palästina hat er bereits seine Handschrift aufgeprägt. In Jerusalem hat er 1936 eine elegante Villa gebaut, für Vera und Chaim Weizmann, sie Präsidentin der WIZO, der Women’s International Zionist Organisation, er Präsident des Zionistischen Weltkongresses; Mendelsohn schuf Bibliothek und Wohnhaus für den Verleger Salman Schocken, und dieses Jahr wird die Anglo-Palestine-Bank in der Jaffa Street eröffnet. Luise Mendelsohn hält schon seit einiger Zeit die Stellung in Jerusalem, während ihr Mann noch den Umzug der gesamten Familie von London aus organisiert. Das neue Domizil der Mendelsohns steht wie ein Wahrzeichen über dem Jerusalemer Stadtviertel Rehavia, eine Windmühle aus dem 19. Jahrhundert, die sie von einer Engländerin gemietet haben. Die Mühle ist erstaunlich geräumig und erinnert ein wenig an Mendelsohns Einsteinturm auf dem Potsdamer Telegrafenberg. Aller Lieblingsplatz ist im Garten, unterm Feigenbaum.
Am Rupenhorn 6, nur noch selten denkt Luise an diese Adresse, das elegante weiße Haus hoch über dem Stößensee, das sie erst 1930 bezogen hatten: »Wir glaubten an unsere Zeit und an eine zukünftige Zivilisation, die aus dem Chaos unserer Zeit entstehen müsse. Deshalb sollte unser Haus als ein Versprechen gestaltet sein, als ein Zeichen konstruktiver Haltung einer zukünftigen Welt gegenüber.« Mit Wandbildern von Amedée Ozenfant und Gemälden von Lyonel Feininger präsentierte sich das Haus als modernes Gesamtkunstwerk. 1933 verließ Luise ihr Heim, in das so viel künstlerisches Herzblut geflossen war, dennoch ohne Sentimentalität: »Ich habe nie an Besitz gehangen. Ich liebte dieses Haus zweifellos und genoss es sehr, darin zu wohnen; ich war mir seiner Vollkommenheit stets bewusst. Manchmal hatte ich eine Vorahnung, dass all dies nicht von Dauer sein könnte. Als wir dann weggingen, verließ ich es ohne Bedauern.« Wenigstens hausen jetzt keine Barbaren dort, die Villa wird von der französischen Botschaft genutzt, darauf hatte man sich vor der Abreise mit befreundeten Diplomaten verständigt. Das Interieur wurde nach London geliefert, jetzt wird es erneut verschifft.
Am Rupenhorn gab es auch ein Musikzimmer mit eingebautem Celloschrank für zwei Instrumente. Der ließ sich nicht mitnehmen, wohl aber die wertvolle französische Vuillaume, die Luise 1910 als Sechzehnjährige in London erworben hatte, bei Hill Brothers, der besten Adresse für Musikinstrumente. Wenn Erich erst da ist, wird es in der Windmühle hoch über Jerusalem Salonkonzerte geben, so wie früher in Berlin. »Musik erfüllte unser Haus«, erzählt Luise Mendelsohn, die studierte Musikerin, jedem Besucher der Jerusalemer Mühle. Auch Einstein frequentierte ihren Berliner Salon, per Segelboot kam er über den See, die Violine an Bord. »Er war ein ausgezeichneter Musiker, technisch gesehen allerdings ein Amateur. Manchmal spielte er sehr gut, aber manchmal schienen seine Gedanken in andere Sphären abzugleiten. Er bevorzugte Haydn, was mich verblüffte.« Luise Mendelsohn liebt Bach. Sie holt ihr Cello hervor und beginnt zu spielen, das berühmte Air.
* * *
Auf dem Berliner Presseball am 28. Januar 1939 erklingen andere Töne: Zarah Leander tritt dort als Stargast auf, »ihr erster Gesangsauftritt in Deutschland«, annonciert die Deutsche Allgemeine Zeitung. Die schwedische Diva mit der tiefen Stimme sieht in dem Auftritt eine glanzvolle Gelegenheit, »der deutschen Presse wenigstens einen Teil des Dankes abstatten zu können, zu dem ich mich ihr gegenüber gedrängt fühle. Es ist doch noch gar nicht so lange her, dass ich als Fremde nach Deutschland kam.«
Die einen lassen sich mit offenen Armen empfangen, die anderen wenden sich mit Grausen ab. Zarah Leanders dänische Kollegin Asta Nielsen hatte Deutschland, wo sie in der Zeit der Weimarer Republik zu einer Ikone des Stummfilms wurde, bereits 1936 wieder den Rücken gekehrt, und das, obwohl Joseph Goebbels ihr schon 1933 den roten Teppich ausgerollt und ihr wärmstens angeboten hatte, ihre eigene Produktionsgesellschaft in Deutschland zu gründen. Asta Nielsens ironische Antwort: »Aber wissen Sie denn gar nicht, wie viel gegen Deutschland vorliegt, Herr General?«
Februar
Gisèle Freund zeigt ihre Farbfotos in der »Maison des Amis des Livres« * * * Dorothy Thompson sprengt Versammlung amerikanischer Nazis * * * Annemarie Schwarzenbach kauft einen Ford * * * Eleanor Roosevelt wirbt für Auswanderung in die USA
17. Februar 1939, 15 Uhr: großes Gedränge in der Pariser Buchhandlung La Maison des Amis des Livres in der Rue de l’Odéon. Wer genau hinschaut, erkennt lauter Schriftsteller und Intellektuelle. Adrienne Monnier, die Hausherrin, erhebt ihre Stimme und begrüßt die Gäste: »Gisèles Porträts sind nach meiner Ansicht die schönsten und lebendigsten, die man derzeit sehen kann. […] Dank ihrer besitzen wir die ergreifendsten Bilder der meisten unserer Schriftsteller.«
»Darf ich mal durch?« Eine junge Frau bahnt sich den Weg in den hinteren Bereich des Buchladens, wo ein Diaprojektor aufgebaut ist. Es ist die Fotografin, deren Bilder heute hier gezeigt werden. Sie ist angespannt, denn die Gäste sind der Einladung in die Buchhandlung vor allem gefolgt, um sich selbst in Augenschein zu nehmen. Ganz klar, denkt Gisèle Freund, manch einer hier wird nicht begeistert sein, denn ich habe die Bilder nicht retuschiert, will das unverfälschte Wesen einer Persönlichkeit einfangen. »Ich hatte nicht versucht, ihnen die Schönheit von Stars angedeihen zu lassen, sondern vielmehr wollte ich auf den Film dieses ›Double‹ fixieren, das nach Michaux der ›natürliche Charakter und die bizarren Verschlingungen sind, die wir Gefühle nennen und die kaum merklich die Physiognomie überschatten.‹«
Der Diaschlitten ist bestückt, die elektrische Birne glimmt. Als Gisèle Freund wieder aufblickt, sieht sie Elsa Triolet, Louis Aragon und André Breton. Georges Duhamel und Jean Paulhan sind da, Jules Romains und Léon-Paul Fargue, Jules Supervielle, und Charles Vildrac, Jean Genet, Jean Cassou und Jean Prévost, meine Herren, wer denn noch? Neben Paul Nizan sitzen Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre samt Mutter. Auch Jules Cain, Direktor der Bibliothèque Nationale, ist gekommen. Diesem Heiligenschrein hat Gisèle 1937 eine Fotoreportage im Magazin Vu gewidmet, Walter Benjamin dort an seinem Arbeitsplatz aufgespürt. Paul Valéry ist gerade auf Lesetour in England, aber Frau und Sohn sind da; André Gide bereist derzeit Ägypten, ihn vertreten seine Tochter und die enge Freundin Maria van Rysselberghe. Auf ein Zeichen löscht Adrienne Monnier das Licht, der Projektor beginnt zu surren.
Eines nach dem anderen zogen die Fotos an den Augen der Gäste vorüber. Die Nahaufnahmen wurden durch die Projektion noch mehr vergrößert, jede Pore wurde sichtbar, die Bilder waren von einem Realismus, vor dem manche gar erschraken. Marcel Duchamp im grünen Hemd, Jean Cocteau mit einer rotlackierten Hand im Hintergrund, Elsa Triolet mit rosa Blumenbrosche unterm Kinn, Aragon blickt selbstverliebt in die Kamera, Gide grübelt unter Giacomo Leopardis Totenmaske, Sartre raucht seine Pfeife. Der Anblick des eigenen Gesichts als Farbfoto ist ungewohnt. Hin und wieder geht ein Raunen durch die Reihen.
»Wir sehen alle aus, als kämen wir aus dem Krieg«, sagt Sartre.
»Ich hätte mich besser rasieren sollen an dem Tag«, stöhnt Georges Duhamel.
»Wenn Sie sich nicht fotogen finden«, ruft Léon-Paul Fargue, »Ihre Krawatte ist es sicherlich.« Duhamels Krawatte ist knallrot.
»Breton sieht aus wie ein Erzengel«, findet Adrienne Monnier. Gerade der strenge Surrealist ist so schwer zufriedenzustellen, reglos sitzt er da und verzieht keine Miene.
Das nächste Dia zeigt nur ein Telegramm: ›Nichts zu machen, Dank, Ablehnung und Bedauern + stop + Absolut unnötig, dass Madame Fotografin die Reise macht + stop + habe beschlossen, meine Visage mit ins Grab zu nehmen, ohne Spuren zu hinterlassen.‹ Absender: Roger Martin du Gard, Autor des Familienepos’ Die Thibaults.
Natürlich hat Gisèle Freund auch Adrienne Monnier aufgenommen, gehüllt in eine hellblaue Häkelstola, mit Strickhaube auf dem Kopf. Ihre Freundin Sylvia Beach, Inhaberin der Leihbücherei Shakespeare and Company, hält lachend eine kleine Vogelfigur in der Hand. Gisèle kennt beide Frauen seit 1936, als sie an der Sorbonne ihren Abschluss in Soziologie machte, Adrienne hat Gisèles Doktorarbeit über Die Fotografie in Frankreich im 19. Jahrhundert ins Französische übersetzt und verlegt. Die Deutsche, die Französin und die Amerikanerin sind längst Freundinnen. Kürzlich, bei Adrienne zum Essen, hatten sie Joyce unisono zu einem Porträtfoto zu überreden versucht, das sei doch eine perfekte Werbung für sein neues Buch Finnegan’s Wake. Erstaunlich, dass Sylvia noch mit ihm spricht, seinen Ulysses hat sie finanziert, und als er sich damit einen Namen machte, verkaufte er die Rechte einem anderen Verlag. Wenigstens Sylvia ist Joyce etwas schuldig.
An der Wand erscheint das letzte Bild, eine vornehme Dame, roter Lippenstiftmund und Perlenkette. Victoria Ocampo ist eine vermögende Argentinierin, Herausgeberin der Zeitschrift Sur, durch die europäische Literatur in Lateinamerika bekannt wird. Nachdem Gisèle Freund den Diaprojektor ausgeschaltet hat, hebt eine lebhafte Diskussion an. Die meisten Schriftsteller meinen, dass die Porträts der anderen sehr gut gelungen seien, was aber ihr eigenes Bild betrifft, so sind sie nicht einverstanden. ›Das liegt allein an unserer Unfähigkeit, unsere beiden Bilder in Übereinstimmung zu bringen‹, denkt die Fotografin, ›das, welches wir von uns selber haben und jenes, welches man uns vorhält, das der Reflex unserer Persönlichkeit ist, so wie sie die anderen wahrnehmen.‹ Noch lange stehen die Gäste beieinander und staunen über diese neuartige Fotografietechnik.
»Die 35-mm-Farbfilme sind erst vergangenes Jahr auf den Markt gekommen und extrem kostspielig«, erklärt Gisèle Freund. »Das war für mich eine Offenbarung. Das Wunder, alle subtilen und sich verändernden Rot-, Grün- und Gelbschattierungen festzuhalten, die Transparenz einer weißen Haut um das Blau eines Auges herum. Die Zeit, in der man die Dinge in Licht oder Schatten sah, war vorbei.«
François Mauriac macht aus seiner Unzufriedenheit keinen Hehl: »Warum haben Sie mich nicht zwanzig Jahre früher fotografiert?«
»Ihre Defizite bringen Ihre besten Eigenschaften doch erst zum Ausdruck«, antwortet Gisèle ungerührt. »Das Leiden an Ihren Fehlern schafft erst den Reichtum. Jede einzelne Falte ist kostbar.«
Adrienne Monnier stellt den Damen eine sehr private Frage: »Haben Sie sich schon mal gefragt, ob sie einen Mann mehr lieben würden, wenn er keine Falten hätte?«
Simone de Beauvoir hat über diese Frage noch nie ernsthaft nachgedacht. Sie liebt Sartre haargenau so, wie er ist, und vor allem die Denkerfalte auf seiner vom Pfeifenrauch umnebelten Stirn.
»Die Schriftsteller haben mit den Filmstars nur eins gemein, die Berühmtheit«, stellt Gisèle Freund fest. »Von den Ersten verlangt man nicht, schön zu sein, sondern intelligent auszusehen. Von den Zweiten verlangt man nur, schön zu sein. Nun erklären Sie mir, warum Schriftsteller immer wie Filmstars fotografiert werden wollen, und Letztere immer wie Schriftsteller.«
André Maurois ist auch nicht ganz glücklich mit seiner Erscheinung: »Sie hätten mich in meiner Uniform der Académie Française aufnehmen sollen, sie ist umso vieles fotogener als ich.«
Gisèle Freund hält nichts von solchen Verkleidungen: »Nichts ist so irreführend wie der Glaube, die Kamera sei ein objektives Mittel zur Wiedergabe unserer Persönlichkeit. Jeder Fotograf wird von Ihnen ein unterschiedliches Bild machen, wie zwei Maler Sie eben malen, jeder auf seine eigene Weise.«