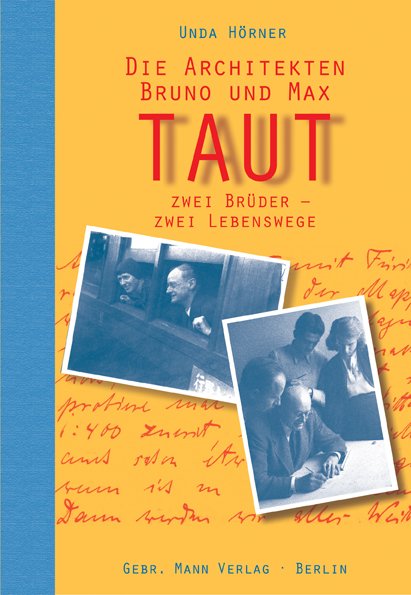19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ebersbach & simon
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ein fulminante Zeitreise ins Jahr 1949 mit Erika Mann 1949: Erika, die älteste Tochter von Katia und Thomas Mann, begleitet die Eltern nach Jahren des Exils in den USA auf ihrer Europareise. Die zweifache Verleihung des Goethe-Preises an den Vater in Deutschland steht kurz bevor, als die Familie in Stockholm die erschütternde Nachricht von Klaus Manns Freitod ereilt. Während Erika beginnt, den Nachlass des geliebten Bruders zu ordnen, erinnert sie sich – an die behütete Kindheit in München, die wilden Zwanziger in Berlin, gemeinsame Werke und die Weltreise als Mann-Twins, das Engagement gegen die Nazis im Exil. Unda Hörner verwebt die Lebenswege der Manns und die historischen Ereignisse virtuos zu einer atmosphärisch dichten Erzählung und entfaltet ein faszinierndes zeitgeschichtliches Panorama bis ins Schicksalsjahr 1949, in dem die Teilung Deutschlands für Jahrzehnte besiegelt wird. Für alle Fans der Jahreszahlen-Trilogie »1919 – Das Jahr der Frauen«, »1929 – Frauen im Jahr Babylon« und »1939 – Exil der Frauen«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Unda Hörner
Solange es eine Heimat gibtErika Mann
ebersbach & simon
Christian in liebender Erinnerung
Für seine Kinder
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Literatur
Ein eigener Pilotenschein, ja, das hätte sich wirklich gelohnt, eine ausgezeichnete Automobilistin ist sie ja bereits. So viele Flüge über den Atlantik hat Erika in den letzten Jahren hinter sich gebracht, erst in den letzten Tagen hat sie in Chicago schon wieder eine Maschine bestiegen, Washington und New York, von dort weiter nach England, wo Termine in London und Oxford absolviert werden mussten. Und heute, an diesem 19. Mai 1949, geht es weiter auf dem Luftweg nach Stockholm. Erika Mann ist nicht alleine unterwegs. Vor ihr in der Maschine die Eltern Thomas und Katia, in der Lücke zwischen den beiden Sitzen sieht sie die Hände der Eltern, die rechte der Mutter ruht auf der Armlehne, des Vaters linke Hand ist erhoben und hält eine unsichtbare Zigarre zwischen Zeige- und Mittelfinger; sobald die Maschine gelandet ist, wird er sich wieder eine seiner geliebten Havannas anstecken wollen. Doch ein wenig wird er sich noch gedulden müssen, gerade erst hat die Stewardess verkündet, das Flugzeug sei airborne und habe die maximale Flughöhe bereits fast erreicht. Airborne, wie schön das klang. So leicht und abgehoben.
Im Flugzeug nach Stockholm, den Blick auf das Wasser der Nordsee gerichtet, wandern Erikas Gedanken in die ferne Vergangenheit; das bedeutende Jahr 1929, der Triumph vor zwanzig Jahren, der Nobelpreis. Bei ihrem Bruder Klaus hatte die epochale Nachricht gemischte Gefühle ausgelöst. Klar, er freute sich über den Glanz, der durch die Ehrung über die ganze Familie kommen würde, nicht zu reden vom vielen schönen Geld, mit dem die Schulden beglichen werden konnten, die Erika und Klaus auf ihrer jüngst zurückliegenden Weltreise angehäuft hatten. Während der Preisverleihung hockten die Geschwister zu Hause in München am Radio und verfolgten die Übertragung der Zeremonie aus dem Stockholmer Konserthuset, schütteten sich aus vor Lachen, mit andächtiger Stimme bezeichnete der Reporter den Vater als »frackgewohnte Erscheinung«, die sich gemessenen Schrittes auf den schwedischen König Gustav V. zubewege.
Klaus war nicht nur amüsiert. Er hatte soeben seinen ersten Roman veröffentlicht, ein Opus über Alexander den Großen, nun grätschte ihm der alte Herr in die Parade, nicht zum ersten Mal stand er im Schatten des Vaters. Zu allem Überfluss ließen so scharfzüngige Kritiker wie Kurt Tucholsky und Axel Eggebrecht kein gutes Haar an dem angehenden Schriftsteller, bescheinigten ihm gar einen infantilen, operettenhaften Stil. Rudolf Arnheim hatte Klaus in der Weltbühne erbarmungslos vorgeführt: »Er wandte den streng gewordenen Blick zum Wasser, das erbleichte und sich frierend kräuselte.« Diesem Zitat aus Klaus’ Roman hatte der Kritiker einen sarkastischen Kommentar folgen lassen: »So etwas darf kein Schriftsteller vom Wasser verlangen.« Erika konnte darüber nur lachen, er solle sich nicht entmutigen lassen, ihm stehe eine steile Karriere bevor. Und Klaus’ Bücher kamen an beim Lesepublikum, Der Vulkan oder Flucht in den Norden, seine Romane über Emigrantenschicksale wie die ihren. Wenn Erika den Erfolg einem Menschen aus tiefstem Herzen gönnt, dann dem geliebten Bruder.
Die Stewardess meldet sich wieder. Man befindet sich bereits im Landeanflug auf Stockholm. Die Schwerelosigkeit der Gedanken weicht schon wieder der Sorge um die reibungslose Organisation der anstehenden Termine. Denn trotz Erikas verlässlichem Beistand könnte die Europatour für die Eltern noch anstrengend werden, denn es liegt auch eine Einladung nach Deutschland vor, sogar eine doppelte. Man schreibt 1949 ein Goethe-Jahr, zum 200. Geburtstag des großen Dichterfürsten will man den Vater mit dem Goethepreis und einem Festakt in der Frankfurter Paulskirche ehren; gleiches Ansinnen in der sowjetischen Zone, Zeremonie im Deutschen Nationaltheater zu Weimar und Verleihung der Ehrenbürgerschaft. Eine zweifache Würdigung der Preis, und wer, wenn nicht er, sollte ihn bekommen, er, der Autor der Buddenbrooks. Als Thomas Mann vor genau zwanzig Jahren den Nobelpreis für diesen seinen ersten Roman erhielt, hatte er erklärt, den Preis seiner deutschen Heimat zu Füßen legen zu wollen. Doch seitdem war die Welt eine andere geworden, und um verbindliche Zusagen hat der Schriftsteller sich bislang herumgedrückt. Konnte man jetzt wirklich wieder in die kriegszerstörte Heimat reisen, das erste Mal nach rund sechzehn Jahren? In jenes Land, das ihm und seiner Familie die Staatsbürgerschaft genommen, sie all ihrer Bürgerrechte beraubt und in die Flucht geschlagen hatte? Wo Erika im Völkischen Beobachter wegen ihrer »pazifistischen Frechheiten« verunglimpft worden war und ihr Bruder Klaus aufgrund seiner Homosexualität höchstwahrscheinlich hinter Schloss und Riegel gekommen wäre? Vor allem ist Deutschland das Land, das einen Krieg angezettelt und Millionen von Menschen auf dem Gewissen hat. Mit Theodor W. Adorno hatte Thomas Mann sich bereits über die heikle Preis-Frage zu beraten versucht, war aber nicht recht schlau geworden aus dessen wortreicher Geißelung des Verblendungszusammenhangs und seiner feierlich vorgebrachten Äußerung, dass es kein richtiges Leben im falschen gebe. Klaus hatte sich Erika gegenüber launig zu diesem Thema geäußert: »Da die Frankfurter Visite ja so ziemlich mit der Etablierung des Westdeutschen Staates koinzidiert, läge es doch nahe, dass man dem Vater die Präsidentschaft anböte. … Das Dichterschicksal würde sich bedeutend runden, es wäre eine fette Pointe für die Biografen da. Und die Deutschen könnten sich ins Fäustchen lachen. Wer stünde ihnen sonst zur Verfügung? Dieser Präsident wäre in beiden Zonen akzeptabel und angesehen: er gehört zum Westen, wird aber vom Osten höflich anerkannt. Und was für eine schöne Familienpolitik wir machen könnten! Major Hindenburg und Papen sind nichts dagegen. Ich würde dafür sorgen, dass nur Schwule gute Stellungen kriegen; der Verkauf des heilsamen Morphium wird freigegeben; E amtiert als graue Eminenz in Godesberg, während der Vater in Bonn mit dem russischen Gesandten Rheinwein schlürft …«
Wie immer braucht Thomas Mann also Erikas Rat, will er zu einer Entscheidung kommen. Die hat eine entschiedene, kompromisslose Meinung, so wie immer, schwarz oder weiß, kalt oder heiß, alles oder nichts. »Natürlich wirst du diesen Preis nicht entgegennehmen! Weder in Frankfurt, noch in Weimar! Im Westen brandmarkt man Klaus und mich als Kommunisten, und im Osten, da lügen sie wie gedruckt über die angeblichen Wahrheiten des Kommunismus«, so lautet ihr Urteil. »Und vergiss nicht, dass sie dich in Deutschland als Vaterlandsverräter beschimpfen, weil du nicht dageblieben bist.«
Eine solche Entgegnung ist von Erika zu erwarten gewesen, jedoch nicht die Antwort, die Thomas Mann sich gewünscht hätte. Erika weiß es genau, sie kennt ihren Vater so gut wie sich selbst. Er ist ja nicht gerade uneitel, bewegt im Kopf seine schöne Rede über Goethe und die Demokratie, die er mit ihrer bewährten Assistenz geschrieben hatte, und die so ganz ausgezeichnet zu dem feierlichen Akt in Frankfurt und in Weimar passen würde, in Goethes hessischer Geburtsstadt und an seiner thüringischen Wirkungsstätte. Im Geiste sah der Vater sich doch schon bei der Preisverleihung, im weihevollen Rund eines Kirchenschiffs. In der Stadt am Main hatte man nicht gezögert, die Paulskirche, Wiege der deutschen Demokratie, Symbol für ein neues freies Deutschland, alsbald wieder aufzubauen. Dem Vater klang seine eigene Stimme bereits in den Ohren, wie sie sich zum Lobpreis auf Goethe erhob bis unter die hohe Kuppel des geweihten Hauses. »Es kann doch nicht falsch sein, den Dichter in seiner Heimat zu ehren«, wendet er also ein.
»Der Heimat derer, die Auschwitz und Buchenwald zugelassen haben«, sagt Erika. In ihr brodelt noch immer der unerbittliche Hass auf die Nazis, der sie in den vergangenen Jahren befeuert hat. »Wenn ihr dorthin fahren wollt, bitte sehr, aber ohne mich.«
An die rasche Folge öffentlicher Auftritte und Empfänge ist der allerorten hofierte Thomas Mann seit Langem gewöhnt, die Reisestrapazen werden aufgewogen durch Ehrenbezeugungen und den gebührenden Respekt, den man ihm allerorten zollt. Straffe Organisation der langen Vortragstournee ist das A und O, Thomas Mann weiß, auf Erika ist Verlass, auch wenn sie ihren eigenen Kopf hat. »Es muss abrollen, und man muss seinen Mann stehen«, sagt er. Und Erika den ihren. Aber wenn es um eine Deutschlandreise geht, nein danke, diese Herausforderung werden sie wohl ohne Erika schaffen müssen. In diesen Ring wird sie die Eltern alleine schicken.
Bei der heutigen Ankunft in Stockholm, zwanzig Jahre nach der Nobelpreisverleihung und zehn Jahre nachdem man ausgerechnet hier vom Ausbruch des Zweiten Weltkriegs erfuhr, ist die Reisegesellschaft recht entspannt, kaum gerädert vom Transport, der Flug ist glatt und angenehm verlaufen, Hiobsbotschaften wie die vom Überfall der Wehrmacht auf Polen sind nicht zu erwarten, wenngleich die Lage zwischen den USA und der Sowjetunion derzeit äußerst angespannt ist. Erst vor einer Woche, am 12. Mai, ist die Berlin-Blockade aufgehoben worden, die nach Einführung der D-Mark im Westen letztes Jahr am 24. Juni begonnen hatte und mit der Moskau das freie Berlin in die Knie zwingen wollte. Die Berliner hielten durch, nicht zuletzt wegen der solidarischen Haltung der Amerikaner, die die Stadt per Luftbrücke mit Lebensmitteln und Kohlen versorgten, freilich nicht ohne Eigennutz.
Einziger Schönheitsfehler bei der Ankunft im Grand Hotel in Saltsjöbaden, etwas außerhalb des Stadtkerns und an den Schären, ist ein wenig Ärger über die Belegung – eines der Zimmer, die für die Manns reserviert sind, ist nicht ganz zufriedenstellend.
»Wissen Sie nicht, wen Sie vor sich haben?«, herrscht Erika den Portier an. Der sieht sofort zu, dass er tätig wird, diese Dame könnte unangenehm werden, wenn man ihren Wünschen nicht entspricht, er händigt Erika den Schlüssel zur noblen Suite im zweiten Stock aus.
»Na bitte, warum nicht gleich!«
Zu Tisch im Hotelrestaurant drängt sich die Salonmusik eine Spur zu laut auf, will man sich vernünftig unterhalten. Geht’s nicht leiser? Beim Kaffee auf der Dachterrasse werden die drei Manns versöhnlich gestimmt. Am Anleger der Ausflugsschiffe zu den Schäreninseln stehen Touristen Schlange. Über dem im Sonnenlicht glitzernden Wasser drehen Möwen kreischend ihre Runden. Es ist sommerlich warm, ein Hauch von venezianischer Lagune liegt über dem Wasser und macht den Vater sentimental, Erika liest in ihm wie in einem offenen Buch. Der Goethe-Vortrag, den Thomas Mann bereits in London und Oxford zu Gehör gebracht hat, wird auch hier glänzen. Wenn Thomas Mann es recht bedenkt, so sprechen die Gefühle, die Erikas rigorose Antwort in ihm ausgelöst hat, klar für die Deutschlandreise. Ja, wenn jemand den Goethe-Preis verdient hat, dann er! Ein Erbe und Bewahrer der Tradition des größten Dichters, den Deutschland je besaß! Die heimliche Entscheidung für die Deutschlandreise, die er dank Erikas strenger Ansage inzwischen für sich getroffen hat – seine Älteste ist immer gut als Reibungsfläche –, gerät allerdings wieder ins Wanken. Denn beim Blick in die Zeitungen, die im Hotel ausliegen, müssen die Eltern ernüchtert zur Kenntnis nehmen, dass wütende Leser der Frankfurter Täglichen Rundschau schon im Vorfeld der Ehrung per Zuschrift Dampf ablassen: Thomas Mann sei des Goethe-Preises nicht würdig. Er, der dem Land den Rücken gekehrt, sich gemein gemacht hat mit der Dietrich. Wer weiß, wie viel Feindseligkeit ihm erst vor Ort entgegenschlägt. Wäre es nicht ratsamer, die Nerven zu schonen, allein um Katias willen, die ihn wird beruhigen müssen? Vielleicht ist eine Reise nach Deutschland ja sogar gefährlich, erst recht ohne den kämpferischen Beistand seiner wehrhaften Adjutantin Erika. Die ist, was ihre Absage an Deutschland angeht, partout nicht umzustimmen. »Ich habe es euch ja gesagt, für die so gründlich indoktrinierten Landsleute bist du der Vaterlandsverräter.«
Am 21. Mai wird die Reisegesellschaft durch ein volles Tagesprogramm abermals von der schwierigen Deutschlandfrage abgelenkt. Nach dem Empfang in einer Schule, in Begleitung des alten Freundes Edgar von Uexküll, besucht man das prächtige barocke Schloss Skokloster am Mälarsee, geht in herrschaftlicher Umgebung zu Tisch, nach dem Menü exklusive Schlossführung. Prunkstück in der düsteren Waffenkammer der Degen des berühmten Feldmarschalls Carl Gustav von Wrangel. Aus dem Halbdunkel glänzen wie von unsichtbaren Geistersoldaten präsentierte Armbrüste und Exekutionsschwerter hervor.
Die Herumgereichten sind ein wenig müde, aber hochzufrieden, als sie abends gelöster Stimmung ins Grand Hotel zurückkehren. Huldigende Grußgesten auch hier in der Lobby, Erika überlegt einen Moment; noch ein Drink an der Bar? Doch der Tag war lang, der Vater will sich seines Fracks entledigen, in den bequemen Morgenmantel schlüpfen. Man schwebt im Lift den oberen Etagen entgegen und betritt die Suite. Mitten auf dem Tisch im Salon liegt ein Telegramm. Wenn es sich da mal nicht schon wieder um die Deutschlandreise dreht. Können sie einen denn nicht noch ein paar Tage in Ruhe lassen mit der Entscheidungsfrage? Erika greift zu dem Telegramm. Es ist nicht aus Frankfurt. Auch nicht aus Weimar. Es wurde in Cannes aufgegeben, von Klaus’ Freundin aus Kindertagen am Tegernsee, Doris von Schönthan, die ihn finanziell unterstützt, wenn es not tut. »Klaus in Klinik in verzweifeltem Zustand«.
Natürlich, sein Schwesterchen, so nannte er die Drogen. »Zu viel davon«, sagt Erika mit erstickter Stimme, »dass es passieren musste.«
Das klingelnde Telefon lässt der Hoffnung keine Zeit, sich breitzumachen, Hoffnung darauf, dass es sich um falschen Alarm handelt, Klaus sich in der Klinik stabilisiert haben könnte. In der Leitung ist Doris. »Klaus«, sagt sie mit metallischem Klang, »ist in der Klinik verstorben.« In jener Klinik, wohin die Freundin ihn am frühen Abend gebracht hat. »Eine Überdosis Schlaftabletten. Alle Wiederbelebungsversuche umsonst.«
Schlagartig hat sich die heiter-maritime Kulisse vor dem Fenster verwandelt. Die See ein öliger Pfuhl, der Himmel ein bleierner Deckel, darunter der kreischenden Möwen unheilvoller Flug. Erika, Katia und Thomas sitzen beieinander, fassungslos, ratlos, hilflos, auf dem Tisch das Telegramm. »Klaus in Klinik in verzweifeltem Zustand«. Der Satz, umstanden von zweimal drei Kreuzen, ist von der Zeit überholt worden.
Lange sagt niemand ein Wort. Katia ist auf ihrem Stuhl zusammengesunken, Thomas Mann sitzt wie vom Donner gerührt da, Erika verbirgt das Gesicht in den Händen. Das Unvorstellbare ist Wirklichkeit geworden, aber es lässt sich nicht in Worte fassen, noch nicht.
Thomas Mann bricht als Erster das Schweigen: »Wie konnte er euch das antun«, steht seine Frage im Raum, »diese finale Kränkung, diese immense Rücksichts- und Verantwortungslosigkeit?« Abwechselnd blickt er zu Frau und Tochter.
Erika sieht den Vater indigniert an. »Es geht nicht um uns. Es geht um Klaus.«
»Niemand wird uns verübeln, wenn wir zu Klaus’ Beerdigung nach Cannes reisen und hier alles absagen«, beeilt sich Thomas hinzuzufügen.
»Verkraften wir dieses Begräbnis überhaupt?«, will Katia wissen. »Helfen können wir Klaus durch unser Beisein jetzt auch nicht mehr.«
»Aber nun sind wir schon mal in Europa«, sagt Erika ungewohnt tonlos und flau.
»Und wenn wir gleich auf direktem Wege nach Hause fliegen?«, schlägt Katia vor. »Zurück nach Hause, nach Pacific Palisades?«
Nach Hause. Bei den Worten der Mutter steht Erika das weiße Haus am Meer vor Augen, es weiß noch nichts von der Katastrophe, im hellen Sonnenglanz steht es da in Kalifornien, auf der anderen Seite der Welt. Nach Hause, Klaus wollte nach Hause.
»Der Fall ist so sehr merkwürdig und schmerzlich, diese Gewandtheit, Liebenswürdigkeit, Weltläufigkeit und dabei der Todesdrang im Herzen«, sinniert Thomas, als sei dies eine Antwort auf die Frage seiner Frau.
»Darauf gefasst sein musste man ja bei ihm ständig, und das war ich ja auch«, sagt Katia. »Aber es lag doch im Augenblick durchaus kein akuter Grund vor.«
»The Turning Point. Der Wendepunkt. Klaus hat doch gerade erst seine Autobiografie ins Deutsche übersetzt. Er war doch voll der Hoffnung auf die Zusage eines deutschen Verlegers«, sagt Erika und wiederholt es nun schon zum dritten Mal: »Ich habe ihn zu lange alleine gelassen. Ich hätte es wissen müssen. Warum war ich nicht bei ihm? Es muss ein Unfall gewesen sein. Ich kann mir, ich will mir einfach nicht vorstellen, dass er bei klarem Verstand gewesen ist im Moment der Tat. Seine Liebe zu mir, sie muss doch größer gewesen sein als die Todessehnsucht.«
Katia wahrt die Contenance, aber Thomas Mann treibt eine Frage besonders um: »Hätte man wirklich nichts mehr tun können?«
»Es war ein Unfall«, dieser Ansicht ist auch Katia. »Klaus hat sich nicht umbringen wollen.«
»Es war eine Frage der Zeit«, befindet Thomas. »Er starb gewiss auf eigene Hand und nicht, um als Opfer der Zeit zu posieren. Aber er war es in hohem Grade.«
Die Beantwortung der Frage, ob man nach Deutschland fahren soll, ist durch den Schicksalsschlag gänzlich ins Hintertreffen geraten. Ohne eine Unklarheit beseitigt, ohne eine Entscheidung getroffen zu haben, ohne heiß vergossene Tränen und ohne Trost geht man zu Bett am Ende dieses Tages, jeder für sich allein.
»Bei Ankunft im Hotel schwerster Schock«, notiert Thomas Mann anderntags. Er hat schlecht geschlafen, trotz einer der erprobten Kapseln, auch aus Sorge um die leidende, sich unablässig mit Vorwürfen quälende Erika, und dann die weiterhin ungewisse Deutschlandfrage. Beim Frühstück beraten sich Thomas und Katia aufs Neue mit ihrer Tochter.
»Ich habe mich an der Rezeption nach Flügen erkundigt«, teilt Erika ihnen mit. »Es gibt noch freie Plätze nach Paris.«
Thomas Mann klopft mit dem Löffel an sein Ei. Mit angedeutetem Schütteln der Silberkanne am ausgestreckten Arm signalisiert Katia einer der Saaltöchter, der Kaffee sei aus. Das Ei ist wachsweich, genau richtig. Der Kaffee eine Spur zu dünn für ein Grand Hotel. Erika kramt in einer großen Handtasche nach Zigaretten, sie inhaliert, bereits halb im Gehen, einen langen Zug. Ein angebissenes Brötchen bleibt auf ihrem Teller zurück, unangerührt die Glasschälchen mit Marmelade, rot und gelb.
»Das Erikind isst ja sowieso schon viel zu wenig, ein Strich in der Landschaft ist sie«, sorgt sich Katia. »Vielleicht ist die Vortragsreise ja eine Ablenkung von den tragischen Geschehnissen für sie. Sollte man nicht wenigstens die Vorträge hier in Schweden mit Anstand zuende bringen, und die Auftritte in Kopenhagen und der Schweiz? Man muss die anstrengendsten Termine ja nicht unbedingt wahrnehmen, also Frankfurt und Weimar auf gar keinen Fall. Was meinst du, Tommy?«
»Ja, der Abstecher nach Deutschland ginge nun doch über meine Kräfte«, stimmt der schwach ein.
Auch ein Verzicht auf die gesellschaftlichen Rahmenveranstaltungen in der tragisch gewandelten Situation ist geboten. Am heutigen Abend steht ein Theaterbesuch in Drottningholm auf dem Programm, Audienz beim Kronprinzenpaar inklusive, ganz ausgeschlossen, man hat den Kopf nicht frei für Bühnenkunst und ein hochoffizielles, anstrengendes Protokoll.
Im Hotel treffen erste Kondolenzschreiben ein. Mit den anderen Kindern, Golo, Monika, Michael und Elisabeth, hat man telefoniert. Golo, den Erika per Telegramm von dem Drama unterrichtet hat, erinnert daran, dass Klaus erst vergangenes Jahr im Sommer versucht habe, sich das Leben zu nehmen, im Haus der Eltern. »Diese Geldsorgen, die Erfolglosigkeit, Echolosigkeit, Einsamkeit haben seinen Hang zum Untergang beschleunigt … Denn der Selbstmord war in ihm, unabhängig von den äußeren Umständen. Er war von der Idee des Selbstmordes doch behext von früher Jugend an.« Klaus hatte sich vor ein paar Monaten in Kalifornien die Pulsadern geöffnet, obendrein noch den Gashahn aufgedreht, ein Nachbar roch das Gas, Rettung nahte im letzten Moment. Ein Psychiater prophezeite damals, Klaus werde es neun Monate später wieder versuchen. Als man nun mit Golo am Telefon spricht, empfiehlt der ganz vernünftig und pragmatisch die planmäßige Fortsetzung der Reise.
»Wir wissen, was das bedeutet«, sagt Erika, »wir bleiben der Beisetzung in Cannes fern.« Sie hat sich entschieden, den Eltern vorerst beizustehen. »Klaus kann ich ja doch nicht mehr helfen.«
Zu Klaus’ Beerdigung hat sich ein sehr übersichtlicher Kreis um Doris von Schönthan versammelt. Klaus’ jüngster Bruder Michael steht an der offenen Grube und spielt auf der Bratsche ein Largo von Benedetto Marcello. Michael ist das einzige Mitglied der Familie Mann, das zur Beisetzung gekommen ist. Eher zufällig ist er in der Gegend, gastiert gerade mit seinem Orchester an der Côte d’Azur.
Am 24. Mai, dem Tag, als vier Flugstunden von Stockholm entfernt ein Sarg über den Cimetière du Grand Jas in Cannes getragen wird, besorgt sich Thomas Mann in einem Kaufhaus in der Stockholmer Innenstadt einen neuen schwarzen Anzug und eine schwarze Krawatte, beraten von Katia und Erika. Die Fortsetzung der Vortragsreise steht unter dem Vorzeichen der Trauer um Klaus, dem muss auch die Garderobe Rechnung tragen. Als Erika mit der Mutter in der Abteilung Herrenmoden zwischen Kleiderständern wartet, während sich der Vater hinter einem schweren Vorhang umkleidet, erscheint ihr die Szene völlig absurd. Warum steht der Vater hier, in Unterhosen in diesem Kaufhaus, statt im Flugzeug nach Paris zu sitzen? Und warum sitzt die Familie am Nachmittag in einem Eisenbahnabteil und fährt hinauf nach Uppsala, anstatt in einer Limousine, die sie über französische Straßen hinunter nach Cannes bringt, zum Friedhof, zu Klaus?
Die Stimmung, die Thomas Mann und den Frauen an seiner Seite während der Vortragstermine entgegenschlägt, ist seit dem 21. Mai spürbar verändert. Die feierliche Heiterkeit ist gewichen, an ihre Stelle ist ein nicht minder feierlicher, indes gedämpfter Ernst getreten. Nachdem Thomas in Uppsala in der Aula der Universität gesprochen hat, streichelt der Erzbischof ihm sanft über die Hand. Standing Ovations im Saal, vor dem Gebäude stimmen Studenten ihm zu Ehren andächtigen Gesang an, als sei ein Geistlicher aus dem Portal getreten, um der wartenden Menge den Segen zu erteilen.
Abends in der Schwedischen Akademie erhebt sich das Publikum beim Eintritt der Manns schweigend von den Plätzen. Erika kämpft mit den Tränen, die nun doch fließen, sie kann nicht verbergen, wie es ihr wirklich geht. Prompt hat sie sich einen starken Schnupfen eingefangen, immerhin, das erkältete Geschniefe ist die beste Tarnung ihrer Trauer. Sie sitzt unter den Zuhörern, da vorn steht der Vater und hält seinen Goethe-Vortrag, in Gedanken aber wandert sie im Jenseits zu den Weggefährten, die nicht weitergegangen, auf der Strecke geblieben sind. Ricki Hallgarten, der Nachbarsjunge aus München-Bogenhausen, Sohn eines angesehenen Juristen und Germanisten und einer Frauenrechtlerin. Zehntausend Kilometer durch ganz Europa sind sie zu zweit gebraust, ein Wettrennen durch Frankreich, Spanien, Portugal, Österreich, Italien, Ungarn, Jugoslawien. Tempo, Tempo! Für Ricki ein Wettrennen gegen die Zeit, das er am Ende verlor. Am 5. Mai 1932, zur Mittagsstunde, hatte er sich erschossen. Am nächsten Tag hatten sie wieder aufbrechen wollen, Ricki, Erika, Klaus und die Freundin Annemarie Schwarzenbach, auf eine Autoreise durch Kleinasien, Persien und Russland. Man glaubte ans Leben, all die Planungen, Besorgungen, das pralle Dasein, und plötzlich stieg einer aus. Klaus war untröstlich: »Ricki. Konnte er nicht warten, bis wir alle zusammen zum Teufel gehen?« Auch Annemarie nur noch Erinnerung, der Unfall vor sieben Jahren, vollgepumpt mit Drogen auf dem Fahrrad, auf abschüssigen Wegen hatte die Freundin das Fatum herausgefordert.
Das Totenreich ist groß. Klaus’ französischer Freund René Crevel hatte sich das Leben genommen, bevor die Lungentuberkulose ihn dahinraffte, an einem schönen Junitag des Jahres 1935 drehte er den Gashahn in seiner Küche auf, erst vierunddreißig. Seine Abschiedsbotschaft: »Alles ekelt mich an.« Als Klaus davon erfuhr, hatte er ins Tagebuch geschrieben: »Ich wusste es ja, dass dieser Frühling nicht ohne solch ein Ereignis vorbeigehen wird. Wer ist der Nächste? Ich kenne alle seine Gründe. … Die Krankheit war der geringste.« Welch unerträgliche Hitze über Paris geherrscht hatte in jenem Juni.
Erst ein Jahr zuvor, im Mai 1934, war Klaus’ Freund Wolfgang Hellmert gegangen, eine Überdosis Morphium. Er war Jahrgang 1906 wie Klaus, der damals notiert hatte: »Wolfgangs Tod ist in gewisser Weise schwerer zu ertragen als alles andere.« Erika wusste es: »Als Wolfgang sich umgebracht hatte, wollte Klaus nicht mehr weiterleben.« Ob Selbstmord in der Familie liegt? Erika war erst vier, als die tragische Tante Carla, Thomas’ Schwester, sich vergiftet hatte. Sah sie nicht aus wie ein Todesengel auf dem Bildnis in des Vaters Arbeitszimmer? Seine andere Schwester Julia hatte sich erhängt. Und nun Klaus. Dreiundvierzig wäre er dieses Jahr geworden, ein Novemberkind, wie Erika. Todeswunsch, wie oft hatte sie das Wort gelesen in seiner Autobiografie, im Wendepunkt! Aber Klaus’ Tod hat eine neue Qualität, ihm ging der Verlust scheinbar unerschütterbarer Gewissheiten voraus, der Verlust der Heimat, die tödlichen Kränkungen der Nationalsozialisten. Klaus’ Tod stürzt Erika in ein endloses Dunkel, und in der bodenlosen Weite schwarzer Fluchten wie abgetrennt vom Körper ihre vergeblich nach Halt tastende Hand. Der 21. Mai 1949 ist der Tag ihres Weltuntergangs.
Prasselnder Applaus reißt Erika aus ihren Gedanken. Sie hört den Vater, der mit getragenem Pathos Goethe zitiert: »Entzieht Euch dem verstorbenen Zeug, Lebendiges lasst uns lieben!«
Zurück im Hotel, überreicht der Portier Erika zusammen mit dem Schlüssel einen weiteren Stoß Kondolenzschreiben, zwischen Beileidswünschen und Anteilnahme auch ein Brief von Doris aus Cannes. Erika reißt ihn auf, liest und erhebt die Stimme: »Klaus’ Gesicht soll im Tode den Ausdruck kindlicher Wunscherfüllung gehabt haben.«
»Das Gift, wahrscheinlich hat er es von dem idiotischen Klopstock erhalten«, vermutet Thomas Mann, »dieser Arzt aus Budapest, der schon vor gut zehn Jahren vergeblich versucht hat, Klaus zu helfen.«
»War der nicht eher Lungenspezialist?«, fragt Katia.
»Er war ein Freund von Kafka«, sagt Erika, als sei dies eine Erklärung für Klaus’ Tod.
Benzedrin hieß das Zeug. Das Amphetamin aus dem Chemielabor versetzte einen in eine euphorische Stimmung. Zu den mannigfachen Nebenwirkungen gehörte eine erhöhte Risikobereitschaft, bis hin zur völligen Furchtlosigkeit. Keine Angst mehr vor dem Fluchtpunkt im Unendlichen. Dem Tod.
In den Zeitungen sind dieser Tage viele wohlwollende Artikel über Klaus und sein Werk zu lesen. »Er war außerordentlich beliebt in Stockholm durch seine freien englischen Vorträge, die großen Erfolg hatten«, schreibt Thomas seinem Bruder Heinrich.
Die Reisenden nehmen aus den Zeitungen auch zur Kenntnis, dass Adenauer als Präsident des Parlamentarischen Rates am 23. Mai 1949 das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland verkündet hat. Am Tag, als Klaus zu Grabe getragen wurde, trat es in Kraft. Diskutiert wird bereits über Militärbündnisse, Adenauer ist für den Beitritt zur im April gegründeten NATO, das bedeutet Wiederbewaffnung, obwohl von einem reinen europäischen Verteidigungsbündnis die Rede ist. Vor allem Frankreich warnt vor deutscher Wiedererstarkung. Bei der Lektüre zerrt die kurzfristig verdrängte Frage nach der Deutschlandreise erneut an den Nerven, die deutsche Presse will endlich wissen, was Sache ist, Thomas Mann antwortet weiterhin ausweichend und mit diplomatischer Zurückhaltung.
»Absagen wird schwer sein, das weißt du hoffentlich«, mahnt Erika, »du hast schon zu lange gezögert.«
Thomas Mann nickt. Es kann doch nicht sein, dass ihm diese Frage den Schlaf raubt, ihm Kopfschmerzen bereitet. »Es geht um Goethe, einen Klassiker, der vor zweihundert Jahren geboren wurde. Den Geist der Dichtung. Die Sprache.«
Erika widerspricht: »Es geht um Politik.«
Wie auch immer er sich am Ende entscheiden mochte, das macht sie dem Vater klar, man kann Zu- oder Absage hüben wie drüben gegen ihn verwenden. Die beiden biografischen Pole seines persönlichen, seines privaten Deutschland gibt es nicht mehr, seine Geburtsstadt Lübeck im Norden und seine Wahlheimat München im Süden. Es gibt nur noch Ost und West.
Am 1. Juni fliegen Thomas und Katia mit einer Maschine der Swiss Air von Malmö nach Zürich, Erika ist den Eltern vorausgereist. Großer Bahnhof am Flughafen Klothen: Michael, Monika, die alte Freundin Therese Giehse. Die Familie steigt im Hotel Baur au Lac in Zürich ab, jenes berühmte Haus an der Stirnseite des Zürichsees, wohin schon Katias und Thomas’ Hochzeitsreise geführt hatte. Bei der Zimmerschlüsselübergabe überreicht ihnen der Portier weitere Kondolenzschreiben. Aber das ist noch nicht alles. Bald nach der Ankunft der Manns treffen schwere Koffer aus Cannes im Zürcher Hotel ein, die aus allen Nähten platzen. »Darf ich sie auf Ihr Zimmer bringen, Fräulein Mann?«, fragt ein Page und bugsiert das Gepäck auch schon in den Fahrstuhl.
Bei einer Mahlzeit im Grillrestaurant des Hotels spricht die Familie über Klaus’ Tat, seinen Seelenzustand, seine widerspruchsgeplagte Verfassung und den obsiegenden Todeswunsch.
»Ich habe ihn zu lange allein gelassen.«
»Lass diesen Gedanken endlich los, Erika!«
»Ich habe ihm doch noch Mitte Mai geschrieben, als er die Entziehungskur machte.«
»Doris war doch bei ihm.«
»Doris, nicht ich.« Ihr Versagen als Schwester, Erika zermartert sich das Hirn mit Selbstvorwürfen. Wie oft sie sich vorgenommen hatte, selbst weniger zu trinken und zu rauchen, die Drogen sein zu lassen, um Klaus mit gutem Beispiel voranzugehen – vergebens, am Ende erlag sie selbst stets der Versuchung des Giftes. Schniefend, schluchzend verschwindet Erika im Foyer und hinter der Fahrstuhltür. Ohne Hilfsmittel aus der gut bestückten Reiseapotheke wird es auch diesen Abend nicht gehen. Schlafen, endlich einschlafen. Nicht noch einmal erwachen müssen, mit offenen Augen hinein in den schrecklichen Alptraum: Klaus ist nicht mehr da. »Es sind«, da gibt es keinen Zweifel für Erika, »die dunkelsten Minuten meiner einsam-gejagten Existenz.«
Erika betritt ihr Hotelzimmer, knipst das Licht an, Klaus’ Koffer mitten im Raum, stumme Hauptdarsteller im Scheinwerferlicht. Sie muss sie öffnen, hilft ja alles nichts. Sie wuchtet einen der Koffer aufs Bett. Legt beide Hände an die metallenen Verschlüsse, lässt sie aufschnappen. Hebt den Deckel. Oft geübte Gesten, von Hotelzimmer zu Hotelzimmer, die vielen gemeinsamen Reisen, check in, check out, Berlin, Amerika, Riviera. Schicht um Schicht, Doris muss alles, was sie im Pavillon Madrid vorgefunden hat, ungeordnet und mit hastiger Hand in die Koffer gepackt haben, Klaus’ Hemden und Hosen, ein paar Mäntel, seinen seidig glänzenden Schlips, eine letzte Fotoaufnahme, er schaut Erika ins Gesicht, verklärter Blick aus sanften Augen. Seine stehen gebliebene Armbanduhr, Viertel vor vier. Ein leichtes Sommerjackett, weiße Einstecktücher, schwarze Schuhe, in den Seitenfächern des Koffers verkrochene Dinge, eine Nagelfeile, ein Brieföffner, silberne Manschettenknöpfe, Fahrscheine und Kleingeld, amerikanische Cents, französische Centimes, niederländische Gulden. Im zweiten Koffer etliche Stifte und Papiere, ein Adressbuch, die letzten Tagebücher. Erika steigt Klaus’ Geruch in die Nase, sie hört seine Stimme, seine eilige, sich überstürzende Art zu sprechen, in einen leeren Raum fallende Satzkaskaden. Unerträglich, nur mit Beistand zu überstehen, Erikas rascher Griff in ihre Handtasche, die Hand, die im Inneren nach dem Gesuchten tastet, ein wenig Geduld, gleich wird es besser gehen, das Schwesterchen, der Rettungsanker, das Gegenglück. Auf die richtige Dosierung kommt es an.
Wahllos schlägt Erika Klaus’ Tagebücher auf, schwarzweiße Schreibhefte mit gerundeten Ecken, marble cover, amerikanisches Format, und die letzten, kleineren, in Leder gebundenen Kladden. Fahrig, mit halb geschlossenen Augen schaut sie hinein, begeht sie eine Indiskretion? 23. Januar 1933: »Wieder die Stimmung nahe an Trauer; dies Leben, das eigentlich nur mit E. zu teilen wäre; uns nicht beschieden. Vielleicht nicht so wichtig, da doch alle in der sozialen Katastrophe umkommen, die heraufbeschworen durch grenzenlosen Frevel der Gesellschaft.« 5. Juli 1933: »Unterwegs, wie auch sonst oft tagsüber, sehr nachgedacht, wie ungehörig und traurig es ist, dass ich allein bin, wo ich so bereit wäre --- Der Zusammenhang mit E. Aber die hat die Theres, hatte Pamela. Das Gesetz unserer Bindung würde es also gestatten, dass auch ich mich noch nach einer anderen Seite binde. Ich überdenke all die geglückten und missglückten Versuche.« 25. Juli 1933: »Das Einzige, was ich fürchte, wäre zu sterben, solange E. lebt, weil das Bild ihres Zusammenbruches meine letzte Sekunde mit Qual füllen müsste.« Alles hat mit ihr zu tun, mit Erika. Es ist erdrückend.
Sie schlägt das Tagebuch zu, ein anderes auf, auf der Suche nach einem Trostwort, einer Erklärung, einer letzten Botschaft, einem Hinweis zwischen den Zeilen, etwas, was sie freispricht. Abermals wird Erika nicht erlöst. 22. Juni 1943: »Habe immer das Gefühl, vergessen zu sein, von allen verraten … Alle meine Gedanken sind mit Schmerz beladen wie Sprengladungen mit Dynamit. … Am Ende jeden Tages frage ich mich, wie es mir gelang, ihn durchzustehen. Jede Nacht, wenn ich einschlafe, hoffe ich, nicht mehr aufwachen zu müssen. Jeder Morgen ist eine bittere Enttäuschung …« Da stand auch etwas über Doris von Schönthan: »Gefährtin meiner Grenzgänge zwischen Selbsterfahrung und Selbstzerstörung« nannte er sie. »Großer Abend mit Doris. Auf der Suche nach Kokain. Mit Transvestiten Taxi in die City … Endlich das Zeug. Zu Doris. Genommen.« Warum zur Hölle hatte sie Klaus alleine gelassen mit dieser selbst ebenfalls so labilen Person. Doris machte in den Zwanzigern als eine Art It-Girl von sich reden, nach 1933 schloss sie sich dem Widerstand an, der Résistance in Frankreich. Die Erlebnisse hatten Doris zerstört, auch sie. Aber es war Erika ein Ding der Unmöglichkeit, noch aus der Ferne die Kontrolle über Klaus zu behalten, die Lenkerin zu bleiben wie früher auf Achse im Coupé. Sie wusste es besser. Wusste, dass sie nichts finden würde, keinen letzten Gruß. Denn sie hielt weiterhin an der Überzeugung fest, dass Klaus sich nicht das Leben hatte nehmen wollen. Dass es ein Unfall war.
»Der Bruder hinterließ kein Wort für mich. Ganz wortlos ging er fort. War auch für mich nichts da? Gar keine Zeile?« So lautete der Text eines Couplets, das Klaus für Erikas Kabarett Die Pfeffermühle geschrieben hatte. »Ich habe nichts zu denken, als nur dies: Wie leicht vermeidbar es gewesen wäre, und dass man ihn doch hätte halten können. Man hat so viel versäumt. Es liegt an uns.«
Erika tut die ganze Nacht kein Auge zu, im Bann von Klaus’ Tagebüchern und Erinnerungen, die er schon so früh zu Papier brachte, im Glauben an das Werden der Gegenwart in der Erinnerung, da wandelte er auf den Spuren des berühmten Vergangenheitsbeschwörers Marcel Proust. »Nicht allein die abgelebten Abenteuer und Lieben, sondern mehr noch die Gerüche, Lichtreflexe und Luftberührungen, die wir empfangen haben und in den geheimen Schatzkammern unseres Gedächtnisses verwahren, bilden den ungeheuren Kräftevorrat, aus dem heraus wir alles, was wir neu leben müssen, speisen, steigern und ergänzen. … Deshalb halte ich so viel vom Pathos der Dankbarkeit. Dem Vergangenen dankbar sein – einfach dafür, dass es war – ist kein retardierendes Gefühlsmoment, wenn man es richtig versteht. Es kann dem Kühnsten und Neuesten, auf das wir uns einlassen, nur förderlich sein, wahren wir dem Vergangenen in einer Ecke unseres Herzens die Anhänglichkeit. Ich halte viel von der Treue und von der Anhänglichkeit.«
Erika findet im Koffer Briefe von eigener Hand: »Schönster Stinkfisch«, so hatte sie ihn angesprochen, und war auf seinen Gesundheitszustand, die Drogen gekommen: »Hat ja doch, mein sehr Lieber, nicht den geringsten Sinn und ist nur dazu angetan, größt’ Ungemach zu bringen über Dich und die Deinen und über die auch, die gern mal was Hübsches lesen.« Sie stellte ein baldiges Treffen in Aussicht, blieb aber vage: »Lass uns doch recht bald zusammenfahren, uns zusammensetzen und ein wenig gesunden fun haben, damit Du Dich erholst. Ob Du in die Schweiz zu kommen beabsichtigst? Ich gedenke (vaguely), scharf Ende Juni nach Österreich zu gehen …« So salopp klang ihr allerletzter Brief an den Bruder, den sie ihm eine Woche vor seinem Tod aus dem Londoner Hotel Savoy geschrieben hatte. Unerträglich ist Erika, als sie die Zeilen überfliegt, nun ihr eigener, künstlich heiterer Ton. Hatte sie sich damit nicht selbst eins in die Tasche gelogen, sehenden Auges bagatellisiert, wie es um Klaus stand, ein Ausdruck ihrer eigenen Hilflosigkeit? Es war beschämend.
Noch immer ungeöffnet ist der kleinste Koffer, ein Transportkoffer für die Reiseschreibmaschine. Erika hätte niemals gedacht, dass ein Mensch, ein furchtloser Mensch wie sie, jemals solch eine Heidenangst vor einer Schreibmaschine haben könnte. Der kleinste Koffer ist der schwierigste.
Ihre Hand umschließt den Tragegriff, sie setzt sich auf die Bettkante, nimmt den Koffer auf die Knie, zieht den Reißverschluss auf, klappt den Deckel hoch. Beschwörend legt sie die Finger auf die Tastatur der Schreibmaschine, A, B, C, D, zuletzt haben Klaus’ Fingerspitzen dieses Alphabet berührt. Über diese Tasten sind sie geeilt, auf ihnen hat er seine Essays geschrieben, seine Romane, seine Briefe an sie.
Ist das eine alte Remington? Schreibmaschinen, erstmals gefertigt von einem Waffenhersteller. Dass eine in Deutschland hergestellte Maschine aber auch Erika heißen muss, was fällt ihr ein, jetzt über sowas zu lachen? Eine ganze Weile sitzt Erika so da, den geöffneten Koffer mit der Schreibmaschine auf den Knien. Als sie den Hebel betätigt, durchschneidet ein hoher, schriller Glockenton die nächtliche Stille. Ihr kommt eine vergangene Melodie wieder in den Sinn, ein Satz aus frühester Jugendzeit, als sie miteinander Theater spielten, Klaus und sie. Ein Satz aus Anja und Esther, dem Stück, das Klaus ihnen damals in den wilden Jahren der Jugend auf den Leib geschrieben hatte: »Einer von uns muss das Lied singen, unser Lied. Wie wird es sein?«
Als Erika morgens am Frühstückstisch erscheint, wirkt sie zur Erleichterung ihrer Eltern überraschend heiter. Macht einen Scherz über die ewige Monotonie der Frühstücksmarmelade, immer nur Erdbeere und Aprikose. »Ich werde den Kellner mal um Stachelbeere mit Meerrettich bitten, mal sehen, was für ein Gesicht er dann macht.« Auch ihre Erkältung scheint auf dem Rückzug zu sein.
»Es geht ihr doch immer am besten, wenn sie sich ins Geschäft stürzen kann«, raunt Thomas seiner Frau über den Tisch zu.