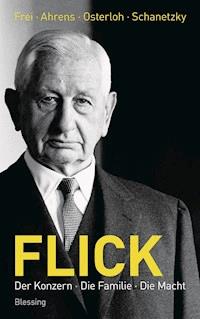9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Jugendrevolte und globaler Protest Die Chiffre »68« steht für ein Jahrzehnt der Rebellion. Nicht nur in der Bundesrepublik, sondern in ganz Europa und rund um den Globus erhob sich damals eine kritische Jugend, einen kurzen Sommer lang sogar hinter dem Eisernen Vorhang. Der eindringliche Überblick stellt die deutsche Studentenbewegung in jenen internationalen Zusammenhang, aus dem heraus vieles überhaupt erst zu verstehen ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 376
Ähnliche
Norbert Frei
1968
Jugendrevolte und globaler Protest
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Aktualisierte und um ein Postskriptum erweiterte Neuausgabe
Paris, Mai 1968
»L’imagination prend le pouvoir.«
»Il est interdit d’interdire.«
»Le rêve est la réalité.«
Parolen der Pariser Studenten,
Mai 1968[1]
Vielleicht war es tatsächlich die Bitte um Feuer, mit der begann, was ein paar Monate später so vielen als die Französische Revolution erschien. Der junge Raucher allerdings, dessen simples Begehren am Ende steifer Feierlichkeiten im nagelneuen Universitätsschwimmbad von Nanterre eine ganze Staatsdelegation in Verwirrung stürzte, versichert noch heute, an jenem öden Januarnachmittag des Jahres 1968 lediglich das Gespräch mit dem Minister gesucht und nicht schon den Umsturz geplant zu haben. Er sei, das Feuerzeug des Angesprochenen in der Hand, einer spontanen Eingebung gefolgt, und erst die Reaktion des die Szene beobachtenden Dekans, der ihn abzudrängen suchte, habe den Wortwechsel provoziert.
Student: »Warum haben Sie in Ihrem Weißbuch über die Jugend nicht die sexuellen Probleme erwähnt?«
Minister: »Wenn Sie sich abreagieren wollen, dann springen Sie doch ins kalte Wasser.«
Ob darauf noch eine Entgegnung des Studenten folgte, den die schroffe Antwort an »Argumente der Hitler-Jugend« erinnert haben soll, wird nicht mehr zu klären sein.[2] Zweifelsfrei hingegen ist, dass der Fragesteller den Minister entlarvt zu haben glaubte: als autoritär, als arrogant, als völlig unfähig zur Kommunikation mit jener Jugend, für die dieser François Missoffe im Kabinett von Georges Pompidou Ressortverantwortung trug.
Und sicher ist auch: Dem wortgewandten Störer und seinen Freunden, einer kleinen Gruppe anarchistischer Studenten, kam der Vorfall sehr zupass, fügte er sich doch nahtlos in ihr düsteres Bild von der Staatsmacht. Folglich sorgten sie dafür, dass die Geschichte unter ihren Kommilitonen in Nanterre rasch die Runde machte.
Über den trostlosen, seit Jahren halbfertigen Neben-Campus der Sorbonne im armen Westen von Paris wäre die Nachricht vermutlich gleichwohl kaum hinausgedrungen, hätte es dort nicht schon seit Monaten gebrodelt – und hätten Minister und Dekan jetzt nicht den Fehler begangen, die allem Anschein nach gezielt gestreute Behauptung im Raum stehen zu lassen, dem aufmüpfigen jungen Raucher drohten Strafantrag und Relegationsverfahren. Damit aber ist die »Affäre Missoffe« in der Welt – und ein Star geboren: Daniel Cohn-Bendit.
Angesichts derart überzogener möglicher Sanktionen kann der 22-jährige Soziologiestudent jetzt auf die Unterstützung auch von Kommilitonen rechnen, die politisch weniger radikal denken als er. Das gilt zumal, als sich drei Wochen später, im Zusammenhang mit einer anderen Protestaktion, Polizei und Studenten in Nanterre handgreifliche Auseinandersetzungen liefern und ›Le Monde‹ darüber berichtet.[3] Dadurch wird auch die Schwimmbad-Szene einer breiteren Öffentlichkeit bekannt, und vor allem wird publik, dass der Sohn deutsch-jüdischer Emigranten im Falle einer tatsächlichen Relegation mit seiner Ausweisung aus Frankreich rechnen muß. Die nationale Studentengewerkschaft (FNEF) bekundet ihre Solidarität, und obwohl Cohn-Bendit den Minister inzwischen brieflich um Entschuldigung gebeten hat, Missoffe die Sache wohl auch vergessen will, weitet sich die Proteststimmung nun aus.
Die unschönen Arbeitsbedingungen an der von 12 000 Studenten besuchten Trabanten-Uni und der Verdruss über Wohnheime, die wie Internate geführt werden, sind dafür fortan nur noch zwei Gründe unter vielen. Immer mehr speist sich der Unmut aus anderen Quellen, etwa aus der Kritik des kapitalistischen Systems und der eskalierenden Kriegführung der Amerikaner in Vietnam. Als bei einer damit begründeten Aktion gegen die Pariser Filiale von American Express auch ein Student aus Nanterre festgenommen wird, proklamieren rund hundert Aktivisten verschiedener linker Campus-Grüppchen eine ›Bewegung des 22. März‹.[4] Das Ziel des Bündnisses ist klar: Dogmatische Streitereien sollen überwunden, eine »revolutionäre Kampfeinheit« soll geformt werden.
Zu diesem Zweck verabredet man sich – und hier ist der Einfluss des leidenschaftlichen Debattierers Cohn-Bendit evident – zu einem »Tag der allseitigen Diskussion«. Er soll eine Woche später stattfinden, und auf dem Programm stehen Themen wie »Universität und Kritische Universität«, »Der antiimperialistische Kampf«, »Der Kapitalismus 1968 und die Kämpfe der Arbeiterklasse«.[5] Doch der große Ratschlag in Nanterre scheitert erst einmal am Dekan, der die Universitätsgebäude am Vorabend kurzerhand schließen lässt.
Nach ein paar Tagen ist es dann aber doch soweit: Karl Dietrich Wolff ist angereist, der Vorsitzende des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS), und um ihn zu hören, besetzen mehr als tausend Studenten den größten Saal der Philosophischen Fakultät. Dabei erfahren sie, dass es genau ihre Themen sind, die die deutschen Kommilitonen schon seit über einem Jahr in Massen auf die Straße treiben: der Vietnamkrieg und die »autoritären Strukturen« – nicht nur, aber auch in den Universitäten. Wolffs Besuch ist die gleichsam offizielle Demonstration jener Kontakte zwischen deutschen und französischen Aktivisten, die schon seit geraumer Zeit bestehen. Vor allem Daniel Cohn-Bendit, der durch ein mehrstündiges Verhör auf dem Pariser Polizeipräsidium inzwischen noch weiter ins Rampenlicht der Medien gerückt ist und der nun ebenfalls spricht, hat sich bei den westdeutschen Gesinnungsgenossen immer wieder umgesehen und sich von ihren Teach-ins, Go-ins, Sit-ins inspirieren lassen.[6]
Doch auch rechts des Rheins wird an diesem 2. April 1968 deutlich, wie sehr die Anliegen und Aktionsformen der Protestierenden einander ähneln, ja wie sehr sie in mancher Hinsicht zusammenhängen: Die junge Berlinerin, die an diesem Nachmittag »Nazi-Kiesinger, abtreten!«[7] in den Bonner Plenarsaal ruft – ein halbes Jahr später wird sie den Bundeskanzler ohrfeigen –, war bis vor kurzem Sekretärin des Deutsch-Französischen Jugendwerks in Paris und ist dort mit einem Anwalt verheiratet, dessen Vater in Auschwitz ermordet worden ist.[8] Und als acht Tage später, nach dem Attentat auf Rudi Dutschke in Berlin, eine Welle von Demonstrationen und Straßenschlachten durch die Bundesrepublik geht, ist dies ein Signal auch für die »Bewegung des 22. März«.
Nicht nur in Nanterre kommt es zu spontanen Solidaritätskundgebungen für »Rudi le Rouge«; auch in Paris, wie in zahlreichen anderen westlichen Metropolen, ist die Empörung groß. Am 19. April ziehen mehrere Tausend Studenten mit Spruchbändern durch das Quartier Latin: Gegen die Springer-Presse! Gegen die Notstandspläne der Großen Koalition! Gegen Kiesinger! Man ist auffallend gut informiert über die Situation im Nachbarland. Die Erklärung dafür liegt in dem Umstand, dass sich in der französischen Hauptstadt einige Mitglieder des dort inzwischen geradezu bewunderten SDS aufhalten und den zerstrittenen, an kubanischen, chinesischen und anderen Sozialismus-Modellen orientierten Gruppen die Notwendigkeit eines gemeinsamen Vorgehens predigen.[9]
Allem Anschein nach entfaltet diese deutsche Entwicklungshilfe eine gewisse Wirkung auch auf die politische Organisations- und Konfliktbereitschaft französischer Studenten in eigener Sache. Deutlich mehr trägt dazu aber die erneute Schließung der Fakultät Nanterre bei, die der Dekan für den 3. Mai verfügt, als das Gerücht umläuft, eine rechtsradikale Gruppe namens Occident (Abendland) plane einen Angriff auf die von Cohn-Bendit und seinen Mitstreitern angesetzten »anti-imperialistischen Tage«. Es ist dies der Moment, in dem der Funke auf die Sorbonne überspringt.
Feuereifer ist auf der Protestkundgebung gegen die »Aussperrung« der Kommilitonen in Nanterre zunächst allerdings nicht zu verspüren; der kommt erst auf, als nach der Mittagspause die Kunde geht, die Abendländler befänden sich im Anmarsch. Daraufhin lässt Rektor Roche ebenfalls die Hörsäle schließen – zum ersten Mal seit der deutschen Besatzung. Im Innenhof der Sorbonne versammeln sich jetzt ein paar Hundert linke Studenten, nicht wenige davon mit Knüppeln und (Motorrad-)Helmen bewaffnet. Aber auch im Quartier Latin bleiben die Rechtsradikalen aus. Statt ihrer kommt die Polizei. Als die Einheiten der kasernierten Compagnies républicaines de sécurité (CRS) versuchen, die Anführer der abziehenden Studenten festzuhalten, fliegen die ersten Pflastersteine, ein Polizist wird schwer verletzt. Bis in den späten Freitagabend dauert die Straßenschlacht, dann ist ein Großteil der Demonstranten vorübergehend verhaftet, der Rest mit Tränengas auseinandergetrieben – wie die Passanten, die zufällig in die Szene geraten sind.
Das Wochenende über herrscht äußerlich Ruhe in Paris. Doch in den Kreisen der Aktivisten finden Absprachen statt, und am Montag beschleunigt sich die im Entstehen begriffene »Bewegung«. Am Abend dieses 6. Mai 1968 wird sie ihre ersten Barrikaden bauen.
Der Tag beginnt mit der Vorladung Cohn-Bendits, sechs weiterer Studenten und einer Studentin vor den Disziplinarausschuss der Universität, wo sie sich wegen der Besetzung eines Hörsaals verantworten sollen. Etwa 200 Kommilitonen und ein Heer von Fotografen begleiten die Beschuldigten bis zum Eingang der Sorbonne, in deren Umkreis bereits 1500 Polizisten der CRS aufgezogen sind. Angesichts zweier Rechtsanwälte und der Bereitschaft von vier renommierten Hochschullehrern, für die bunt gemischte linke Truppe einzutreten, beschließt der Ausschuss sich zu vertagen (bald darauf wird der Dekan von Nanterre das ganze Verfahren einschlafen lassen). Die CRS hingegen erweisen sich als weniger flexibel und versuchen, die verbotene Demonstration vor den Toren der offiziell geschlossenen Universität zu zerstreuen. Das Ergebnis ist, dass die Zahl der Sympathisanten rasch anwächst und sich ein Protestzug mit mehreren Tausend Teilnehmern formiert, darunter auch Professoren. Am späten Nachmittag kommt es zur Eskalation: Die Polizei setzt Tränengas und Wasserwerfer ein, die Demonstranten verschanzen sich hinter quer gestellten Autos, von denen schließlich etliche in Flammen aufgehen.
Den einstigen Marxisten Stephen Spender, der die Stätten der »Revolution« in Europa und den USA in diesen Monaten mit viel Sympathie für die »jungen Rebellen« bereist, erinnern die auf diese Weise entstehenden Barrikaden an moderne Kunst.[10] Die Wahrnehmung des englischen Dichters reflektiert offenbar auch das Wohlwollen, das ein beträchtlicher Teil der hauptstädtischen Presse – und der Bevölkerung – den Demonstranten entgegenbringt. Es wird sich in den nächsten Tagen noch steigern.
Vor allem aber weitet die Protestbewegung sich aus: In Paris, wo Oberschüler in den Streik treten und die Studenten am Abend des 7. Mai einen »langen Marsch« zum Arc de Triomphe unternehmen, sind es schon mehrere Zehntausend (wie meist bei solchen Anlässen, liegen die Zahlen der Polizei unter denen der Demonstranten). Doch auch in der Provinz rührt sich die Jugend; Kundgebungen werden unter anderem aus Bordeaux, Le Mans und aus Marseille gemeldet, Universitätsbesetzungen aus Dijon, Lyon, Rennes und Toulouse. An der Sorbonne bleiben die Studenten derweil ausgesperrt. Die Öffnung am Nachmittag des 9. Mai war nur vorübergehend.
Was Aktion ist und was die Reaktion darauf, ist in diesen Frühlingstagen nicht nur in Paris immer schwerer auseinanderzuhalten. Mal sind es die Studenten, mal die Exponenten von Staat und Polizei, die das Geschehen vorantreiben; mal handelt es sich um ein planmäßiges Vorgehen, mal um ein aus dem Augenblick geborenes Treiben. Deutlich aber ist: Der Protest bleibt nicht länger die elitäre Sache sektiererischer und entsprechend oft eher gegen- als miteinander agierender linker Gruppen. Er nährt sich nun zunehmend aus sich selbst, genauer gesagt: aus der Solidarität mit denen, die der Ordnungsmacht entgegentreten und dafür Nachteile in Kauf nehmen. Er erfasst auf diese Weise ständig größere Kreise der französischen Jugend, und zwar mit einer rasant sich beschleunigenden Geschwindigkeit.
Dennoch wäre es verfehlt, wollte man allein aus der Dynamik der vorangegangenen Tage und Wochen erklären, dass Frankreich in der Nacht vom 10. auf den 11. Mai 1968 eine der gewaltsamsten Auseinandersetzungen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs erlebt und 48 Stunden später die vielleicht größte Demonstration in seiner Geschichte. Im Pariser Mai ist auch viel Zufall im Spiel.
Die Aufrichtung der Barrikaden beginnt kurz nach Einbruch der Dunkelheit.[11] Schon den ganzen Tag über waren Tausende junger Leute durch das Quartier Latin gezogen, auf dem Boulevard Saint Michel hatte es kleinere Auseinandersetzungen gegeben, aber nun weiß keiner so richtig, wie es weitergehen soll. Alain Geismar, Jacques Sauvageot und Daniel Cohn-Bendit diskutieren über den einzuschlagenden Weg, und das ist durchaus wörtlich zu verstehen; am Ende folgen die »drei Musketiere der Revolte« der Schwerkraft der Menge – man bleibt, wo man ist. Zwei teilnehmende Beobachter aus Deutschland registrieren die eigentümliche Stimmung: »Alle hatten an diesem warmen Maiabend das Gefühl, daß etwas geschehen würde, niemand war sich jedoch im klaren darüber, was. Man war sich nur darin einig, daß es etwas qualitativ Neues sein müßte, dem Charakter der Massenbewegung, ihrer Entschlossenheit, ihrer neuen Macht entsprechend.«[12]
Folgt man den beiden deutschen Sympathisanten, dann besteht das Neue des 10. Mai vor allem in dem Entschluss der Studenten, ihrerseits das Viertel um die von der Polizei nach wie vor abgeriegelte Sorbonne zu besetzen – und in einer straßenbaukundlichen Entdeckung, die sich sofort in Revolutionslyrik verwandelt: »Unter dem Pflaster der Strand«. Während die einen über Gewalt und Gegengewalt noch diskutieren, schaffen die anderen Fakten: »Plötzlich ertönten zwischen dem Jardin du Luxembourg und dem Métro-Eingang gegenüber schnelle, abgehackte Schläge, ein Geräusch, das für die kommenden 30 Tage nicht mehr aus Paris wegzudenken war: Einige Leute hatten die halbmondförmigen Eisengitter um die Bäume abgehoben und schlugen damit die Pflastersteine aus dem Boden.«
Von diesem Moment an geht alles sehr schnell, denn das so gewonnene Baumaterial wandert von Hand zu Hand. Es wird ergänzt durch quer gestellte Autos, Parkbänke und umgestürzte Zeitungsbuden. Zwei Stunden später sind etliche Straßen unpassierbar, manche der Barrikaden ein paar Meter hoch und durchaus imponierend, andere dicht hintereinander gestaffelt und eigentlich nur von symbolischem Wert. Aber Symbolen und dem Rekurs auf die Geschichte kommt jetzt hohe Bedeutung zu: Ein exaltiertes historisches Bewusstsein feiert sich selbst bereits als die »Kommune des 10. Mai«.
Zu dem Hochgefühl trägt maßgeblich bei, dass zwei Rundfunksender den Demonstranten dieser Nacht die Politikwerdung ihres Tuns unmittelbar zu Ohren bringen. Europe 1 und Radio Luxembourg nämlich sind mit Übertragungswagen präsent. Deshalb geht es direkt über den Sender, als Alain Geismar, der seine führende Rolle in der Bewegung mit der des Generalsekretärs der Gewerkschaft der Hochschullehrer (SNESup) verbindet, Claude Chalin, dem Prorektor der Sorbonne, am Telefon die Forderungen der Studenten mitteilt. Gleichwohl erklärt sich der Professor bereit, an Ort und Stelle mit den Studenten über die Wiedereröffnung der Universität und den Abzug der Polizei zu sprechen. Nur mit Blick auf die dritte Forderung – Amnestie für alle verurteilten und inhaftierten Demonstranten – kann der Prorektor keine Zusage machen. Doch will er sich beim zuständigen Minister in diesem Sinne verwenden.
Chalins Versuch der Deeskalation scheitert an den Hardlinern auf beiden Seiten: Die einen wollen die Amnestie sofort (was rechtlich nicht möglich ist), die anderen gar nicht. Auf Initiative des Soziologen Alain Touraine kommt es kurz nach Mitternacht zu einem letzten Vermittlungsversuch: Jean-Marie Roche, der Rektor, empfängt eine Delegation verhandlungswilliger Professoren und Studenten. Dann aber platzt in das Gespräch ein Anruf von Erziehungsminister Peyrefitte, der aus dem Radio weiß, dass unter denen, die Roche gegenübersitzen, auch Daniel Cohn-Bendit sein muss. Als dies sich bestätigt, bricht der düpierte Rektor die Unterredung sofort ab.
Es ist fast 2 Uhr nachts, als die Delegation das Gelände der Sorbonne verlässt. Nach wie vor ist der Rundfunk zur Stelle, und wo noch immer der Transistor läuft, weiß man nun, dass die Stunde der Entscheidung geschlagen hat. So sieht es auch Maurice Grimaud, der Polizeipräfekt von Paris. Er spricht von »Guerillagruppen« und bittet Innenminister Christian Fouchet um einen klaren Befehl. Um 2.12 Uhr beginnt die »Räumung der Barrikaden«.
Was sich während der nächsten dreieinhalb Stunden in den Gassen des Quartier Latin abspielt, sind Szenen von hoher Militanz, auf beiden Seiten: Zehntausend aus dem ganzen Land zusammengezogene Uniformierte der CRS gehen mit Tränengasgranaten, Rauchkerzen und Schlagstöcken gegen etwa ebenso viele Demonstranten vor. Schätzungsweise zwei Drittel derer, die tagsüber protestierten, sind inzwischen nach Hause gegangen; diejenigen aber, die bis jetzt ausgeharrt haben, setzen sich mit Pflastersteinen erbittert zur Wehr. Es fließt Blut, und es fliegen wohl auch Molotowcocktails – jedenfalls brennen etwa 60 Autos aus, doppelt so viele werden beschädigt. 251 der 367 Verletzten, von denen in der offiziellen Bilanz anderntags die Rede ist, sind Polizisten. 460 Demonstranten werden festgenommen.
Die hohen Kosten auf beiden Seiten sind Ausdruck einer Aggressivität, die sich nach stundenlangem angespannten Warten entlädt. Aber sie sind vielleicht auch Folge jener Gewissheit der Studenten, dass ihre Sache beträchtliche Sympathie in der Bevölkerung genießt. Sichtlich beeindruckt registriert der Korrespondent der ›Neuen Zürcher Zeitung‹, was diese Unterstützung in der »Nacht der Kommune« konkret bedeutet: »Die Anwohner der Rue Gay-Lussac nahmen für die Studenten Partei. Sie brachten ihnen vor dem Angriff der Polizei Wasser, Biscuits, Schokolade und andere Lebensmittel, warfen nachher Wasser von den Fenstern hinunter, um die Gasschwaden niederzuschlagen, gaben den Studenten nasse Tücher zum Schutz der Gesichter und Atmungsorgane, holten Flüchtende und Verletzte in die Häuser hinein, in einer Solidaritätsbewegung, wie sie in Paris nicht an der Tagesordnung ist.«[13]
Der Morgen nach dem Barrikadenkampf sieht die Fünfte Republik in einer dramatischen Krise, auch wenn ihr Präsident angeblich zu allem schweigt, was ihm der Justiz-, der Innen- und der Verteidigungsminister, Joxe, Fouchet und Messmer, bereits um sechs Uhr in der Früh im Élysée berichten. Den Rest dieses Samstags allerdings wird Charles de Gaulle in Beratungen verbringen; der Pariser Polizeipräfekt und der Rektor der Sorbonne sind zeitweise zugegen, und am Abend ist endlich auch Georges Pompidou von einer Afghanistan-Reise zurück.
Noch in der Nacht tritt der Premierminister vor die Fernsehmikrofone: Die Sorbonne, verspricht er den Studenten, werde am Montag wieder geöffnet, und das Berufungsgericht werde über die Gesuche der vier Demonstranten entscheiden, die im Laufe der vorangegangenen Unruhen verhaftet und zu Gefängnisstrafen ohne Bewährung verurteilt worden waren; alle vor knapp 24 Stunden Festgenommenen kommen bereits am Sonntag wieder frei.
Doch solche Konzessionen vermögen nicht zu besänftigen. Im Gegenteil, Pompidous Ansprache wird weithin geradezu als eine Bestätigung betrachtet – für die Legitimität des Protests im allgemeinen, für die Moralität und die politische Bedeutung der Barrikadennacht im besonderen. Damit aber stehen auch die etablierte Opposition und ihre Institutionen in der Pflicht zur Solidarität mit den Studenten. Schon haben für den kommenden Montag alle großen Gewerkschaftsverbände zu einem 24-stündigen Generalstreik aufgerufen.
Im Urteil der ›Neuen Zürcher Zeitung‹ ist Frankreichs Regierung an diesem Wochenende »vorübergehend ins Schwimmen« geraten, und das Blatt beschließt seinen Bericht mit einer ebenso drastischen wie präzisen Analyse: »Innert einer Woche hat sich die von Cohn-Bendit und kleinen Gruppen von Anhängern ausgehende Bewegung, vor allem nach der Besetzung der Sorbonne durch die Polizei am 3. Mai, zu einer wirklichen Lawine ausgewachsen, welche durch die Gewerkschaften die Gesamtheit der Bevölkerung erfaßt oder doch in Mitleidenschaft zieht. Eine für ihre Neigung zum Gaullismus bekannte Zeitung zitiert, wie Ludwig XVI. auf die Nachrichten vom Sturm auf die Bastille hin fragte, ob das denn ein Aufruhr sei, und darauf die Antwort erhielt: ›Non, Sire, c’est la révolution!‹. So weit ist es in Paris heute noch nicht. Aber der Abstand von einem kleinen Studentenkrawall zu einer echten revolutionären Situation hat sich in den letzten acht Tagen mit erschreckender Geschwindigkeit verringert.«[14]
Die Ereignisse des 13. Mai 1968 beschleunigen diese Entwicklung weiter. Das allerdings weniger, weil das Datum Anlass bietet für zeithistorische Assoziationen (es ist der zehnte Jahrestag des Putsches der französischen Algerien-Armee, mit dem der Untergang der Vierten Republik eingeläutet wurde und der Wiederaufstieg de Gaulles begann). Bedrohlich wird die Lage der Regierung vielmehr angesichts des schlagartig breiter gewordenen politischen Spektrums, das sich ihr an diesem strahlenden Frühlingstag entgegenstellt: Erstmals agieren die Neue und die Alte Linke gleichzeitig.
Derweil sich im Demonstrationszug der Studenten, angeführt von Geismar, Sauvageot und Cohn-Bendit, hauptsächlich linksradikale und anarchistische Gruppierungen zur Place de la République bewegen, marschieren von der anderen Seite die Parteikommunisten und -sozialisten heran, die in den militanten Richtungsgewerkschaften das Sagen haben, unter ihnen politische Hochkaräter wie Pierre Mendès-France, François Mitterrand, Guy Mollet und Waldeck Rochet. Hunderttausende[15] sind auf den Beinen, schwarze und rote Fahnen vermischen sich. Aber von Einigkeit kann so wenig die Rede sein wie davon, dass das zehn Meter lange Transparent mit der Aufschrift »Studenten, Lehrer und Arbeiter zusammen« die Realität widerspiegelt. Gewiss, auch etliche Professoren zeigen sich nun solidarisch, und viele engagierte Gewerkschafter bekunden ihre Sympathie mit den Studenten, die in den letzten Tagen Mut bewiesen haben im Kampf gegen die allseits verhassten CRS; die einfachen Arbeiter jedoch gönnen sich eher einen freien Montag.
Die Interessen all derer, die nun demonstrieren, sind nicht identisch, und ihre gemeinsame Überzeugung, zehn Jahre Gaullismus seien genug, reicht letztlich nicht weit. Schon das Stück des Weges, das die beiden Formationen zusammen marschieren, von der Place de la République zur Place Denfert-Rochereau, erweist sich als schwierig genug.[16] Dort angekommen, gehen die einen brav nach Hause, die anderen – es sind jetzt nur noch ein paar Tausend – machen sich auf zu der dank Pompidou wiedereröffneten Sorbonne, die sie in der Nacht besetzen. Die Revolte ist damit zurück an dem Ort, wo sie vor zehn Tagen begonnen hat. Hier richtet sie sich ein: als akademische Räterepublik.[17]
Doch der 13. Mai verdeutlicht auch, dass die Universität nicht schon das Universum ist und Paris nicht die Sonne, um die alles kreist: Respektable Demonstrationen gibt es in allen größeren Städten, Streikaktionen im ganzen Land. Von einem Stillstand des öffentlichen Lebens bleibt Frankreich an diesem Tag zwar weit entfernt, aber das Signal für ein massenhaftes Aufbegehren gegen die Kräfte des Konservatismus und der Tradition ist gegeben: In den nächsten 24 Stunden beginnen die ersten wilden Streiks, und binnen einer Woche legt eine Welle von Fabrikbesetzungen große Teile der Wirtschaft lahm. Nochmals ein paar Tage später sind sieben Millionen Franzosen im Streik, drohen die Städte im Chaos zu versinken, funktionieren weder Telefon noch Post noch Müllabfuhr. Die Pariser horten Benzin, und im Crazy Horse Saloon bleiben die Stripperinnen in ihren Kleidern.
Was bei alledem idealistische Solidarität mit den Studenten ist, was spielerische Übertragung ihrer Aktionsformen auf andere Lebensbereiche und Alltagswelten, was die Artikulation wohlverstandener eigener Interessen angesichts einer Situation, in der »alles möglich« zu sein scheint – die Urteile darüber liegen auch Jahrzehnte später noch weit auseinander. Aber man geht wohl nicht fehl in der Annahme, dass im Pariser Mai pure Begeisterung für die – immerhin höchst vagen – Ziele der »Enragierten« außerhalb der Bewegung nur selten anzutreffen ist, häufiger hingegen der Versuch ihrer kalten Instrumentalisierung für andere Zwecke.
Just in diesem kritischen Moment kehrt Daniel Cohn-Bendit dem Zentrum des Aufruhrs den Rücken. In West-Berlin, wo gerade die aussichtslosen letzten Proteste gegen die Notstandsgesetze über die Bühne gehen und man verzückt nach Frankreich blickt, lässt »Dany« sich als »neuer Danton« feiern. Was der »anarchistische Marxist«[18] und erklärte Gegner der Parti communiste français (wie überhaupt des real existierenden Sozialismus) seinen theoriebegeisterten deutschen Freunden bei dieser Gelegenheit verkündet – dass es nämlich, entgegen der Auffassung Herbert Marcuses, auch im Spätkapitalismus möglich sei, nicht nur Randgruppen, sondern die Arbeiterschaft für eine revolutionäre Bewegung zu mobilisieren –, das suchen seine französischen Genossen zur selben Zeit überall im Land in die Praxis umzusetzen: indem sie sich bemühen, die Heroen der »befreiten« Betriebe darüber zu belehren, dass es ihnen um mehr gehen muss als um höhere Löhne und kürzere Arbeitszeiten. Oft genug freilich bleiben den wilden jungen Linken die Werkstore auf Weisung der kommunistischen Partei- und Gewerkschaftsfunktionäre verschlossen.
In der Hauptstadt wird die Lage unterdessen immer unübersichtlicher. Doch als habe er nicht schon einen Haufen Probleme, ist Innenminister Fouchet töricht genug, gegen Cohn-Bendit ein Einreiseverbot zu verhängen. Natürlich provoziert er damit erneuten Aufruhr, diesmal sogar mit einem peinlichen historischen Unterton: »Wir sind alle deutsche Juden«, skandieren viele Tausend Studenten am Abend des 22. Mai im Quartier Latin, das sie inzwischen als »ihren« Stadtteil empfinden. Aber da gibt es noch eine andere Parole, und die verdeutlicht, in welcher Distanz sich die Protestbewegten gegenüber dem Establishment sehen, zu dem sie längst auch die staatsgläubigen Kommunisten und Gewerkschafter zählen: »Wir sind alle Unerwünschte«.
Keine 48 Stunden später, nach einem Teach-in an der Universität des Saarlandes, zu dem ihn der SDS-Vorsitzende Karl Dietrich Wolff begleitet, versucht Cohn-Bendit, eskortiert von etwa eintausend Studenten, am schwerbewachten Grenzübergang Goldene Bremm nach Frankreich einzureisen. Die Zurückweisung ihres internationalistisch gesonnenen Helden mit deutscher Staatsbürgerschaft kommentieren seine Saarbrücker Zuhörer mit eindeutigen Sprechchören: »Der Gaullismus führt zum Faschismus«. Und auch als »Dany le Rouge« vier Tage später mit schwarz gefärbten Haaren in Paris auftaucht und vage von der grünen Grenze erzählt, ist die geschichtliche Analogie nicht weit: Er habe es wie sein Vater gemacht, der 1933 vor den Nationalsozialisten nach Frankreich flüchtete, nur hätten ihn diesmal nicht die Deutschen gejagt.[19]
In den wenigen Tagen, in denen Cohn-Bendit die Revolution in Deutschland voranzutreiben sucht, ist sie, schenkt man dem ›Spiegel‹ Glauben, in Frankreich wirklich losgegangen. »Zwischen Atlantik und Mittelmeer, zwischen Alpen und Pyrenäen läuteten letzte Woche die Sterbeglocken des Gaullismus«, begründet das sympathisierende Magazin am 27. Mai sein Titelblatt, auf dem ein Stillleben mit ausgeglühten Autos die Schlagzeile »Französische Revolution« untermalt.[20] Ungeachtet der großen Krise hatte sich der General am 13. Mai auf eine seiner vielen Auslandsreisen begeben, auf denen er die Gloire der Grande Nation so eindrucksvoll zu entfalten weiß. Erst am 18. Mai bricht de Gaulle seinen Rumänien-Besuch ab, und seitdem versucht er zu taktieren.
Am 24. Mai, zwei Tage, nachdem die Regierung Pompidou einen Misstrauensantrag der Opposition knapp überstanden hat, meldet sich der Staatspräsident über Funk und Fernsehen endlich zu Wort. In der Sache bleibt de Gaulle auf jener Linie, die er bereits bei seiner Rückkehr aus dem Ausland in die unübersetzbar polemisch-verächtliche Formel faßte: »La réforme oui, la chienlit non.«[21] Diesmal immerhin bekundet er Bereitschaft, ein Referendum auf den Weg zu bringen, das die Reform der Hochschulen, die wirtschaftliche Erneuerung des Landes und soziale Partizipation befördern soll. Aber seine vagen und stockend vorgetragenen Worte finden kaum ein Echo – außer auf der Place de la Bastille, wo ihm 25 000 Demonstranten, darunter viele Gewerkschafter der kommunistischen CGT und der linkskatholischen CFDT, ein empörtes »Nein« und »Adieu de Gaulle!« entgegenschleudern. Eine militante Minderheit versucht anschließend sogar, die Pariser Börse niederzubrennen. Als dieser Angriff auf die Kathedrale des Kapitalismus von dessen vermeintlichen Sturmtruppen, den Compagnies républicaines de sécurité, erstickt wird, ziehen sich die jugendlichen Straßenkämpfer ins Quartier Latin zurück. Dort beginnt eine wüste Barrikadenschlacht, blutiger noch als vor 14 Tagen. Und es gibt den – einzigen – Toten des Pariser Mai: Ein Demonstrant wird von einer Tränengasgranate so schwer getroffen, dass er wenig später stirbt.[22]
Doch es sind nicht erst die erneuten Krawalle, die einen Umschwung der öffentlichen Meinung bewirken. Mehr noch ist es wohl die fehlende Aussicht auf ein Ende des nun schon wochenlangen Chaos, welche die Sympathien für die Studenten, zu denen sich Mitte Mai noch fast zwei Drittel der Pariser bekannten, schwinden lässt; inzwischen steht ihnen die Hälfte der Bevölkerung nach eigenem Bekunden »feindlicher« gegenüber.[23] Es naht die Stunde der Kräfte der Ordnung, in welcher Couleur und in welcher Formation auch immer sie erscheinen mögen.[24]
Unter dem Eindruck der schwachen Rede des Staatspräsidenten und wachsender Meinungsunterschiede innerhalb des Regierungslagers bittet der Premierminister für Samstag, 25. Mai, Vertreter der Gewerkschaften und der Unternehmerverbände an einen Tisch – um die Studenten und deren Anliegen geht es längst nicht mehr.
Ort der Verhandlung ist das Ministerium für soziale Angelegenheiten in der Rue de Grenelle, und neben dem Hausherrn, Sozialminister Jean-Marcel Jeanneney, sowie dem energischen jungen Staatssekretär Jacques Chirac kommt auch Pompidou selbst. Bis in den Montagmorgen suchen die Strategen nach einem Kompromiss, der noch dadurch erschwert wird, dass die Gewerkschaften untereinander streiten. Schließlich einigt man sich auf eine Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns um 35 und eine allgemeine Lohnerhöhung um 10 Prozent, auf einen 50-prozentigen Lohnvorschuss für die nachzuarbeitende Streikzeit und eine Fixierung der 40-Stunden-Woche. Das freilich heißt, wie sich rasch herausstellt, man hat die Rechnung ohne die rebellische Basis gemacht: Vor allem die jungen Radikalen bei Renault in Billancourt, einer Hochburg der CGT, aber auch die Arbeiter bei Citroën und Sud-Aviation, wo Streik und Betriebsbesetzung besonders früh und massiv begonnen hatten, weisen die Vorschläge vehement zurück.
Immer klarer wird jetzt, dass sich die Forderungen auch in der Arbeiterschaft nicht mehr nur auf wirtschaftliche Verbesserungen richten: Verlangt wird eine »Regierung des Volkes« – und, natürlich, der Rücktritt de Gaulles. Plötzlich liegt der Vergleich mit der Situation des Jahres 1936 in der Luft. Nicht wenige sehen Frankreich wie damals auf eine Volksfront zusteuern – die einen voller Hoffnung, die anderen mit Furcht. Aber es gibt auch die Angst vor einem Militärputsch.
Mit Pompidous Scheitern erreicht die Krise ihren Höhepunkt. Für zwei, drei Tage hat es den Anschein, als sei tatsächlich »alles« möglich. Doch als am Nachmittag des 29. Mai Gerüchte die Runde machen, de Gaulle habe sich per Hubschrauber mit unbekanntem Ziel davongemacht, sei unauffindbar, verunglückt, vielleicht sogar tot, da ist auch die Katharsis nicht mehr fern.
Tatsächlich wird nie ganz klar, worin der Sinn des Kurzausflugs nach Baden-Baden besteht, zu dem der Staatspräsident an diesem Tag unter größter Geheimhaltung aufbricht. Dass er dort seinen alten Kombattanten Jacques Massu, den Kommandierenden General der 5. Französischen Armee, wirklich ins Vertrauen zieht, ist wenig wahrscheinlich. Aber unrealistisch ist auch die Vermutung, dass der Stratege ausgerechnet rechts des Rheins damit beginnt, seine Truppen zu sammeln. So bleibt als plausibelste die Annahme, dass die Staatskrise in diesem Moment auch eine Nervenkrise war – verbunden vielleicht mit der Sehnsucht eines 78-Jährigen, die Metropole des Aufruhrs hinter sich zu lassen, um in der Anonymität des gepflegten Kurorts etwas Ruhe zu finden – und sei es nur für ein paar Stunden.[25]
Am Abend ist de Gaulle zurück auf seinem Landsitz in Colombey-les-deux-Églises, das Spötter voreilig umbenannt haben: Colombey-les-deux-Exile. Denn am nächsten Tag geht der General in die Offensive, und er benötigt dafür weniger als fünf Minuten: In einer von allen Radiostationen des Landes übertragenen Rede erklärt er mit fester Stimme, nicht er trete zurück und auch nicht sein Premierminister, wohl aber werde die Nationalversammlung aufgelöst. Neuwahlen würden angesetzt, und falls die Streiks nicht aufhörten, werde er, in Übereinstimmung mit der Verfassung, zu Notstandsmaßnahmen greifen. Von einem Referendum, wie vor knapp einer Woche noch angekündigt, will der Präsident nichts mehr wissen. Die Ansprache endet wie bei ihm üblich: »Vive la République! Vive la France!«
Jetzt ist es, als habe halb Paris nur darauf gewartet, daß der alte Haudegen Kampfeswillen zeigt. Die Worte des Staatspräsidenten sind kaum verklungen, da ziehen Hunderttausende in Richtung Champs-Elysées. Die schweigende Mehrheit hat – wenngleich nicht ohne Zutun der gaullistischen Partei, die ihre Anhänger schon seit Tagen aufzuwecken sucht – zur Sprache gefunden, und die ist nicht zimperlich mit denen, die man für die Anstifter aller Übel der letzten vier Wochen hält: »Mitterrand ins Gefängnis« (der Chef der Sozialisten hatte am 28. Mai besonders kaltschnäuzig über einen Rücktritt de Gaulles und/oder seiner Regierung nachgedacht), »Cohn-Bendit nach Dachau«, »Frankreich den Franzosen«. Es wird kräftig gehetzt und ausgegrenzt an diesem Abend; das bürgerliche Frankreich besinnt sich auf seine Stärke.
Damit ist, am Tag vor dem Monatsletzten, der Pariser Mai zu Ende. De Gaulles Entschlossenheit in einem Moment, in dem sein Mythos fast schon vergangen schien, macht alle Pläne der – zerstrittenen – Linken schlagartig zunichte. Die Fähigkeit des Generals, noch einmal massenhaft Vertrauen zu mobilisieren, indem er die Erinnerung hervorholt an seine Rolle als Retter Frankreichs in den Zeiten der Résistance, bedeutet das Aus für die kurzzeitig ventilierten Hoffnungen auf ein sozialistisches Experiment unter Pierre Mendès-France, das den Verfechtern einer Rätedemokratie freilich ebenso missfallen hätte wie den Orthodoxen von der PCF. De Gaulle hat die Bewegung zum Halten gebracht; als Faktum sehen die Studenten das nun kaum anders als die gescheiterten Strategen der Opposition oder die Auguren der öffentlichen Meinung.
Der Rest ist schnell erzählt: Nach den Pfingsttagen ebben die Streiks und Fabrikbesetzungen spürbar ab, und wo dies, wie etwa bei Renault in Flins, nicht der Fall ist, räumen die CRS das Betriebsgelände. Knapp zwei Wochen später beenden Ordnungskräfte das revolutionäre Theater in Jean-Louis Barraults Odéon; seit Mitte Mai »befreit«, stinkt dort inzwischen nicht nur der malträtierte Kostümfundus zum Himmel. Weitere zwei Tage später, am 16. Juni, verlassen die letzten 150 Besetzer die Sorbonne; nachdem ihnen die Polizei freies Geleit zugesichert hat, sind sie offenbar fast erleichtert, nicht länger unter katastrophal gewordenen hygienischen Verhältnissen ausharren zu müssen. Zwar kommt es vor dem Universitätsgelände erneut zu Straßenschlachten, aber das sind die Rückzugsgefechte einer Minderheit, die in der Gewaltanwendung inzwischen geübt ist. Die anarchistisch-bunte Bewegung ist längst wieder in jene theoretisch verfeindeten Sekten auseinandergefallen, aus denen sie die Strategen des »22. März« für ein paar Wochen zusammengeführt hatten. Nicht von ungefähr macht Daniel Cohn-Bendit sich nach Frankfurt davon.[26]
Ende Juni 1968 finden die von de Gaulle veranlassten Parlamentswahlen statt, von denen ein großer Teil der protestbewegten Schüler und Studenten angesichts des Wahlalters von 21 Jahren ausgeschlossen bleibt. Im zweiten Wahlgang erreichen die Gaullisten (UDR) und Giscards Unabhängige zusammen mit 354 (von insgesamt 487) Mandaten eine überragende Mehrheit, während die Linke praktisch halbiert worden ist; Mitterrands Sozialisten sind bloß mehr mit 57, die Kommunisten gar nur noch mit 34 Abgeordneten in der Nationalversammlung vertreten.[27] Seinen längst zum Konkurrenten gewordenen Premierminister kann der Staatspräsident nach diesem Triumph auswechseln, ohne Gefahr zu laufen, dadurch Rückhalt im eigenen Lager zu verlieren; an die Stelle von Pompidou tritt Maurice Couve de Murville.
Neun Monate später allerdings ist auch de Gaulles Zeit abgelaufen: Die politische Krise der Fünften Republik ist überwunden, jetzt steht jene entschlossene Modernisierung von Wirtschaft und Gesellschaft an, die auch treue Gaullisten lieber in jüngeren Händen sehen. So stimmt, als der Präsident das Referendum über die Regionalreform mit der Vertrauensfrage verknüpft, eine Mehrheit von 53 Prozent mit Nein. Im Juni 1969 wählen die Franzosen Georges Pompidou zum Nachfolger des Generals.
Ein Jahr danach, so scheint es, sind die Ereignisse des Pariser Mai nur noch eine ferne Erinnerung. So plötzlich, wie die verspätete Revolte losgebrochen war, so plötzlich war sie verloschen. Und obwohl der Protest der Studenten in Frankreich zu Anfang vielleicht auf mehr Verständnis traf als irgendwo sonst, obwohl der Brückenschlag gerade zu jungen Fabrikarbeitern mancherorts und streckenweise durchaus gelang, stand am Ende auch hier mitnichten der Umsturz der Verhältnisse. Mit ihren politischen Vorstellungen war die Bewegung gescheitert. Doch war sie deshalb auch gesellschaftlich folgenlos? Was eigentlich blieb von 1968? Und von welcher Art war das »merkwürdige Jahr«, das sich im kollektiven Gedächtnis – nicht nur der Franzosen – bis heute gehalten hat?
Antworten auf diese Fragen bedingen Ereignisschilderung und Analyse, Betrachtung und Vergleich. Denn »68« war (fast) überall.[28]
Kapitel 1
Im Anfang war Amerika
»There is a whole generation with a new explanation.«
Scott McKenzie, ›San Francisco‹ (1967)[29]
Wer nach den Wurzeln von »68« sucht, dessen Blick wandert unweigerlich zurück in die hohe Zeit des Kalten Krieges. Der Ost-West-Konflikt der beiden ersten Nachkriegsdekaden, die Formierung der Blöcke und das gesamte Syndrom des ideologischen und militärischen Konfrontationsaufbaus nach 1945 gehören zur Vorgeschichte des »rebellischen Jahrzehnts« – in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht anders als in Westeuropa und überall sonst, wo politischer Protest statthaft oder wenigstens möglich war. So bildete das atomare Wettrüsten der fünfziger Jahre vor allem in Großbritannien, aber auch in der Bundesrepublik einen frühen Kristallisationspunkt linker Kritik, und in Frankreich kam dem Kampf gegen den Algerienkrieg eine ähnliche Bedeutung zu.
Dennoch fällt es nicht schwer, die wichtigsten Vorläufer, Vorbilder und Anfänge der später weltweiten Protestbewegung in den USA auszumachen. Dort nämlich, im Herzland des modernen Kapitalismus, brach sich jener Typus radikaler Systemkritik, der nicht aus der Parteinahme für den real existierenden Kommunismus schöpfte, am frühesten und in besonders eindrucksvoller Weise Bahn: im Eintreten für ungeteilte Bürgerrechte, für umfassende politische Partizipation und für die konkrete Utopie einer neuen Gesellschaft.
Greensboro
Der Aufbruch der Civil Rights Movement
Im Unterschied zum Europa beiderseits des Eisernen Vorhangs, das noch geprägt war von den Erfahrungen und Erfordernissen des ökonomischen und politischen Wiederaufbaus, befanden sich die Vereinigten Staaten Ende der fünfziger Jahre bereits unter erheblichem inneren Veränderungsdruck. Die bei weitem wichtigste Ursache dafür war das noch nirgendwo im Land gelöste Problem der Diskriminierung der Schwarzen – und die in den Südstaaten faktisch herrschende Apartheid. Je mehr eine beispiellos boomende Nachkriegswirtschaft die von John Kenneth Galbraith (durchaus nicht unkritisch) beschriebene »affluent society« der weißen Mittelklasse hatte entstehen lassen, jenes scheinbar alle Unterschiede ausgleichende Suburbia des Massenwohlstands und Massenkonsums, desto sichtbarer waren die Folgen einer jahrhundertelangen Unterdrückung der schwarzen Minderheit geworden: in den innerstädtischen Armenvierteln des Nordens und Westens fast mehr noch als im von jeher agrarisch-rassistisch geprägten Süden. Die reichste Nation der Erde stand also nicht nur vor einer großen unerledigten Aufgabe; das freieste Land der Welt lebte mit einer uneingestandenen gesellschaftlichen Lüge.
Mit ein wenig Fantasie war diese Lüge mittlerweile allerdings leicht ans Tageslicht zu bringen, und wenn es angeht, die Szene im Schwimmbad von Nanterre als symbolischen Auftakt von »68« in Frankreich zu deuten, dann gilt Entsprechendes mindestens ebenso sehr für die Aktion, mit der vier Studenten des North Carolina Agricultural and Technical College acht Jahre zuvor, am 1. Februar 1960, im Woolworth’s von Greensboro für Aufregung gesorgt hatten. Dort jedoch war es kein vorenthaltenes Zigarettenfeuer, das den Protest entfachte, sondern eine verweigerte Tasse Kaffee.
Die Situation an einem Montagnachmittag im segregierten Süden wurde zum Politikum, als die abgewiesenen jungen Schwarzen den für Weiße reservierten lunch counter nicht verließen, sondern bis Geschäftsschluss sitzenblieben – und in den nächsten Tagen in immer größerer Zahl zurückkehrten. Nach 48 Stunden schlossen sich ein paar weiße Studenten der ruhigen Sitzblockade an, gegen Ende der Woche berichtete das Lokalblatt, schließlich schaltete sich der Bürgermeister ein. Aber da war schon nicht mehr aufzuhalten, was bald Sit-in-Movement genannt werden sollte: Die neue Woche begann mit ähnlichen Aktionen im benachbarten Durham, in Winston-Salem und in Charlotte, um dann rasch über North Carolina hinauszugreifen. Bis Jahresende 1960 waren in South Carolina, Virginia und vielen weiteren Bundesstaaten über 70 000 Menschen dem Beispiel der Greensboro Four gefolgt.[30]
Tatsächlich gelang es in etlichen Fällen, Inhaber von Restaurants und Läden, mitunter sogar ganze Gemeinden von diskriminierenden Praktiken abzubringen und menschenverachtende Parolen (»We don’t serve Mexicans, Niggers, and Dogs«) zurückzudrängen. Doch den Protestierenden ging es um mehr als um den Zugang zu ein paar Sportplätzen und die Benutzung öffentlicher Toiletten: Sie suchten das weiße Amerika aufzurütteln, ihm eine Vorstellung vom Ausmaß der nach wie vor herrschenden rassistischen Unterdrückung zu vermitteln, die in den Jim Crow Laws[31] des Südens als ein perfides System der ökonomischen, politischen und persönlichen Benachteiligung der Schwarzen noch immer rechtlich verankert war.
Den Kampf dagegen hatten, zum Teil schon seit einem halben Jahrhundert, von weißen Reformern und schwarzen Akademikern gegründete Verbände wie die National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) oder die Urban League (UL) aufgenommen, während des Zweiten Weltkrieges auch der pazifistisch orientierte Congress of Racial Equality (CORE), der zunächst allerdings ausschließlich im Norden tätig war und bereits 1943 in einem Chicagoer Restaurant ein erstes Sit-in organisiert hatte.[32] Nun, im Frühjahr 1960, waren es vor allem junge Leute aus der nachgewachsenen kleinen schwarzen Bildungselite, die sich über die Sit-ins im Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC) zusammenfanden.[33] »Snick« sollte auf den Gang der Ereignisse bald nicht weniger Einfluss nehmen als die von Martin Luther King jr. geführte Southern Christian Leadership Conference (SCLC), die seit 1957 als Dachorganisation politisch engagierter Kirchengemeinden fungierte und der neuen Studentenvereinigung Pate stand.
Wohl wurden die Proteste seit Greensboro häufiger und ihre regionale Verbreitung nahm zu, doch weiterhin galt das Prinzip der nonviolent direct action, wie es die Selbsthilfeorganisationen aus den Erfahrungen der vierziger und fünfziger Jahre heraus entwickelt hatten. Allerdings besaß die in Schwung kommende Bewegung mit King, dem promovierten Theologen und Pfarrer, inzwischen einen Repräsentanten, der sich auf Gandhi zu berufen wusste und ihre politischen Forderungen nicht nur theologisch zu begründen verstand, sondern mit wachsendem Charisma und steigender Beachtung in den Medien geradezu verkörperte.
Zugleich verfestigte sich bei der schwarzen Minderheit, zumal bei den jetzt hinzustoßenden jungen Aktivisten, das Bewusstsein dafür, wie wenig die im zurückliegenden Jahrzehnt erstrittenen Gerichtsurteile an der Lebenswirklichkeit in den Südstaaten verändert hatten. So war die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA, der die Rassentrennung in Schulen 1954 für ungesetzlich erklärt hatte (im Verfahren Brown vs. Board of Education), auf den erbitterten Widerstand der weißen Mehrheit gestoßen und hatte dem schon randständig gewordenen Ku-Klux-Klan neuen Zulauf beschert. Unter solchen Verhältnissen hatte es wie ein Erfolg erscheinen können, als Präsident Eisenhower sich im September 1957gezwungen sah, in Little Rock, der Hauptstadt von Arkansas, die 101st Airborne Division gegen den Gouverneur und den weißen Mob in Stellung zu bringen, um dem Recht einer Handvoll schwarzer Schüler Geltung zu verschaffen.[34] Doch zwei Jahre später gingen im Süden immer noch 99 Prozent der schwarzen Jugendlichen auf segregierte Schulen.[35] Angesichts solcher Beharrungskräfte wuchs die Ungeduld derer, die sich unterdessen als Civil Rights Movement begriffen. Und es wuchsen die Erwartungen an den Machtwechsel im Weißen Haus, der im Januar 1961 bevorstand.
Die Ablösung des in zwei Amtsperioden sichtlich müde gewordenen Weltkriegsgenerals Dwight D. Eisenhower durch den strahlenden Mittvierziger John F. Kennedy signalisierte nach allgemeiner Auffassung weit mehr als einen (wenn auch nur äußerst knapp) gelungenen Machtwechsel von den Republikanern zu den Demokraten: Vom ersten Moment an galt Kennedy als die Verkörperung der modernen Politik einer neuen Generation.
Mit Blick auf das ungelöste Apartheidproblem waren das allerdings bloße Vorschusslorbeeren. Wohl hatte sich der Senator von Massachusetts im Wahlkampf zu den Bürgerrechten bekannt, in der Schlussphase auch ostentativ mit der schwangeren Ehefrau von Martin Luther King telefoniert, der gerade wieder einmal in Haft genommen worden war. Doch als das dürftige innenpolitische Programm der neuen Regierung erkennbar wurde, sahen sich die schwarzen Anhänger Kennedys enttäuscht – darunter viele, denen es mit Unterstützung der Studenten des »Snick« zum ersten Mal gelungen war, sich in das Wählerverzeichnis eintragen zu lassen und ihr Stimmrecht auszuüben: Unter dem Druck seiner Parteifreunde aus dem Süden hatte sich der Präsident von der Idee einer weitreichenden Gesetzesinitiative schon verabschiedet, noch ehe die in diese Richtung drängenden Experten überhaupt zum Zuge gekommen waren.[36] Selbst das in der berühmten Fernsehdebatte mit Richard Nixon gegebene Versprechen, die Rassentrennung im bundesfinanzierten sozialen Wohnungsbau sofort nach seiner Wahl aufzuheben, erfüllte Kennedy nicht. Bürgerrechtler schickten ihm daraufhin Tausende von Kugelschreibern ins Weiße Haus, denn im Unterschied zu manch anderem auf ihrer Agenda konnte der Präsident diese Sache erledigen, ohne den Kongress zu konsultieren. Es bedurfte dazu bloß seiner Unterschrift, doch die zögerte JFK fast zwei Jahre lang hinaus.
Ungeachtet einiger freundlicher Gesten und des charmanten, offenen Stils, in dem er den Führern des schwarzen Amerika begegnete, erschien Kennedy zu Beginn seiner Amtszeit in Sachen Bürgerrechte geprägt von einer, so sein Berater und Biograf Arthur M. Schlesinger jr., »terrible ambivalence«.[37]
Unter den Aktivisten der Civil Rights Movement wuchs darüber die Ungeduld. Seit Rosa Parks sich 1955 in Montgomery/Alabama geweigert hatte, ihren Sitzplatz in einem Linienbus für einen Weißen frei zu machen, und ihre Verhaftung den bis dahin größten Boykott ausgelöst hatte,[38] war mehr als ein halbes Jahrzehnt vergangen; und obwohl das Oberste Bundesgericht die Rassentrennung im öffentlichen Busverkehr daraufhin für unzulässig erklärt hatte, galten »desegregierte« Busse in den Südstaaten noch immer als Provokation.
Genau darauf legte es der Congress of Racial Equality jetzt an. Unter der Regie seines neuen Direktors James Farmer bestiegen am 4. Mai 1961 sieben Schwarze und sechs Weiße in Washington zwei Überlandbusse Richtung Süden. Ihr einziges Ziel: mit den sogenannten Freedom Rides[39] eine Krise zu inszenieren, die es weltweit in die Schlagzeilen schaffen und Kennedy zu entschlossenerem Handeln zwingen würde.
Zwar blieb der letzte Teil dieser Rechnung einstweilen offen, aber die Bilder eines in Flammen aufgehenden Autobusses und die Berichte über zusammengeschlagene und inhaftierte Aktivisten – darunter ein älteres weißes Lehrerehepaar – verfehlten ihre Wirkung nicht: CORE gewann Zuspruch und Zulauf als eine Organisation, die sich den Missständen kraftvoll, ja inzwischen aggressiv entgegenstellte. Und obgleich der Aktion noch jahrelange Rechtshändel folgten (nicht wegen der Übergriffe des weißen Mobs, sondern wegen der exorbitanten Geldstrafen gegen die Freedom Riders), war die Rassentrennung in den Bahnhöfen und Bussen der großen Transportgesellschaften gegen Ende des Jahres praktisch beseitigt.
Es war zweifellos auch der Eindruck, dass man als Einzelner etwas tun konnte, dass moralisches Engagement nicht abstrakt bleiben musste, was nun vor allem junge Leute anzog. Nicht zufällig wurde das christlich inspirierte ›We Shall Overcome‹ zum Erkennungslied einer wachsenden Gemeinde enthusiastischer Aktivisten, die sich in vielfältiger und im Süden oft auch Mut verlangender Weise engagierten, vor allen in den Aktionen des studentischen SNCC.
Und doch wird man, wie eigentlich bei allen Protestbewegungen der sechziger Jahre, auch bei der amerikanischen Civil Rights Movement unterscheiden müssen zwischen den definierten Zielen organisatorischer Kerngruppen und den eher diffusen Motiven ihrer Anhängerschaft. Im Zweifelsfall erwuchs die Dynamik aus einer »von oben« geplanten Eskalation. Ein klares Beispiel dafür waren schließlich auch die Vorgänge in Birmingham/Alabama im Frühjahr 1963, mit denen Martin Luther Kings unter Druck geratene SCLC die Kennedy-Brüder aus der Reserve zu locken suchte.[40]
Nach einer Serie friedlicher Demonstrationen in Albany/Georgia im Sommer 1962, die King und viele seiner dortigen Gefolgsleute zwar ins Gefängnis gebracht, ansonsten aber nichts bewirkt hatte, setzte der Baptistenpfarrer jetzt auf einen Strategiewechsel. Aktueller Anlass war die Absicht der Washingtoner Regierung, allen Aktivitätsdrang auf ein großes »Voters Education Project« zu lenken, das viele Wohlmeinende binden, aber nicht auf den tiefen Süden ausgedehnt werden sollte, wo die Aktivisten – zu Recht – den größten Handlungsbedarf sahen. King erklärte daraufhin, dem System der Segregation müsse durch direkte Konfrontation das »Rückgrat gebrochen« werden. »Project C« (für Confrontation) folgte einer regelrechten Dramaturgie: Nach dem »B-Day« (für Boykott) am 3. April 1963 gab es Sit-ins und kleinere Demonstrationen, dann ein paar Protestmärsche zum Rathaus von Birmingham.
Als King eine Gerichtsentscheidung missachtete, die weitere Aktionen in dem als extrem rassistisch bekannten »Bombingham« untersagte, wurde er Mitte April erwartungsgemäß inhaftiert – und schrieb seinen berühmt gewordenen »Letter from Birmingham City Jail«. Darin verteidigte er nicht nur eindrucksvoll die moralische Legitimität des gewaltlosen zivilen Ungehorsams, sondern zieh die liberalen Weißen der Untätigkeit: »I have almost reached the regrettable conclusion that the Negro’s great stumbling block is not the White Citizen’s Counciler or the Ku Klux Klanner but the white moderate who is more devoted to ›order‹ than to justice.«[41]
Die Attacke auf die noch weitgehend schweigende weiße Mehrheit zwang zugleich auch jene zögerlichen Schwarzen in die Solidarität, die sich bis dahin abseits gehalten oder gar, wie einige ihrer lokalen Führer, gegen Kings Kampagne und für eine Verständigung mit der weißen Geschäftswelt ausgesprochen hatten. Im Ergebnis waren die Gefängnisse bereits übervoll mit Demonstranten, als Polizeichef Eugene »Bull« Connor am 3