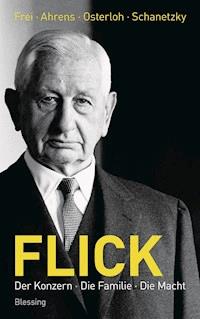19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Sehnsucht nach einer "konservativen Revolution" zieht sich durch die gesamte deutsche Nachkriegsgeschichte. Immer wieder forderten Nationalkonservative und Rechtsradikale die liberale Demokratie heraus. Doch seit der "Flüchtlingskrise" hat sich die Sprengkraft ihrer Argumente enorm verstärkt: Viele Positionen von AfD, Pegida und der Neuen Rechten sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen und das Verlangen nach einer heilen Geschichte heizt die Stimmung weiter an. Sind das noch die Deutschen, die glaubten, ihre Vergangenheit mustergültig "bewältigt" zu haben? Präzise führen die Autoren vor Augen, was derzeit auf dem Spiel steht – und wie es dazu gekommen ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Das Buch
Die Sehnsucht nach einer »konservativen Revolution« zieht sich durch die gesamte deutsche Nachkriegsgeschichte. Immer wieder forderten Nationalkonservative und Rechtsradikale die liberale Demokratie heraus. Doch seit der »Flüchtlingskrise« hat sich die Sprengkraft ihrer Argumente enorm verstärkt: Viele Positionen von AfD, Pegida und der Neuen Rechten sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen und das Verlangen nach einer heilen Geschichte heizt die Stimmung weiter an. Sind das noch die Deutschen, die glaubten, ihre Vergangenheit mustergültig »bewältigt« zu haben? Präzise führen die Autoren vor Augen, was derzeit auf dem Spiel steht – und wie es dazu gekommen ist.
Die Autoren
Norbert Frei lehrt Neuere und Neueste Geschichte in Jena und leitet das Jena Center Geschichte des 20. Jahrhunderts.
Franka Maubach ist Historikerin an der Universität Jena und schreibt derzeit an einer Arbeit über die Deutung des »deutschen Sonderwegs«.
Christina Morina lehrt Neuere und Neueste Geschichte Deutschlands in Europa an der Universität Amsterdam.
Maik Tändler ist Historiker an der Universität Jena und forscht zur Geschichte der intellektuellen Rechten in Deutschland.
Norbert Frei, Franka Maubach, Christina Morina, Maik Tändler
Zur rechten Zeit
Wider die Rückkehr des Nationalismus
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem Buch befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN: 978-3-8437-2058-8
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2019Umschlaggestaltung: BÜRO JORGE SCHMIDT, München
E-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
Inhalt
Über das Buch und die Autoren
Titelseite
Impressum
Einführung
Weil wir das (fast) alles schon mal hatten
KAPITEL 1
»Einmal muss doch Schluss sein«Die Gegenwart der Vergangenheit in der Ära Adenauer
Was bedeutete die Rückkehr der »Ehemaligen«?
Antisemitismus, Auschwitz und die Frage der Verjährung
Anmerkungen zum Kapitel
KAPITEL 2
»Antifaschistisch-demokratische Umwälzung«Geschichte und politische Kultur in der DDR
Antifaschismus, oder: Lehren ohne Lernen
Demokratie oder: »Plane mit, arbeite mit, regiere mit!«
Anmerkungen zum Kapitel
KAPITEL 3
»Widerstand«Mobilisierung von rechts in der frühen Bundesrepublik
»Konservative Revolution« oder: Das »Gute« am Nationalsozialismus
Die »Nationale Opposition« in den fünfziger Jahren
Der kurze Frühling der NPD
Anmerkungen zum Kapitel
KAPITEL 4
»Deutschland ist kein Einwanderungsland«
Von der Arbeit auf Zeit zum Aufenthalt auf Dauer
»Kanaken raus«
Sklavenarbeit im sozialistischen Bruderland
Anmerkungen zum Kapitel
KAPITEL 5
»Vergangenheit, die nicht vergehen will«
Entsorgungsbemühungen seit den Siebzigern
Die Präsenz der Überlebenden und die Wünsche nach »Normalität«
Anmerkungen zum Kapitel
KAPITEL 6
»Links-rot-grün verseuchtes 68er-Deutschland«
Nach Achtundsechzig – nationalistische Gewalt und Neue Rechte
Von den Republikanern zur »selbstbewussten Nation«
Anmerkungen zum Kapitel
KAPITEL 7
»Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!«
Nachwendepogrome
Mord in Serie
Anmerkungen zum Kapitel
KAPITEL 8
»Wir sind das Volk!«
Das Erbe von 1989
»Jetzt wächst zusammen …«
Anmerkungen zum Kapitel
Schluss
»Erinnerungspolitische Wende um 180 Grad«?
Anhang
Nachwort
Zum Weiterlesen
Abkürzungen
Zu den Abbildungen
Empfehlungen
EINFÜHRUNG
Weil wir das (fast) alles schon mal hatten
Zu lange haben wir Deutsche geglaubt, das alles ginge uns nichts an: die neue Fremdenfeindlichkeit der früher so weltoffenen Niederländer, die plötzliche nationale Engherzigkeit der Dänen und Schweden, der Rechtsruck in Ungarn, Polen und Tschechien, das Brexit-Votum der Briten, die Begeisterung so vieler Franzosen für Marine Le Pen, der Erfolg rechter Parteien in Italien und Österreich, der täglich neue Schock namens Donald Trump. Für fast ein Jahrfünft hatte es so ausgesehen, als sei rechter Populismus nur das Problem der anderen, die Bundesrepublik hingegen das kerngesunde Bollwerk westlicher Demokratie. Spätestens seit der Bundestagswahl vom September 2017 aber wissen wir, dass der globale Rechtsruck auch Deutschland erfasst hat.
Der Einzug der AfD in den Bundestag war eine Zäsur in der Geschichte der Bundesrepublik. Zwar scheint die Partei auf Bundesebene – anders als in den ostdeutschen Ländern, vor allem in Sachsen – von einer Regierungsbeteiligung momentan noch weit entfernt. Aber das kann sich ändern.
Darum ist es an der Zeit, sich klarzumachen, was die Renaissance rechten und rechtsradikalen Denkens bedeutet. Schon jetzt haben die Aktualisierung völkischer Stereotype, das Verlangen nach einer homogenen Nation und die Sehnsucht nach einer fleckenlosen Geschichte – kurz: hat die Rückkehr des Nationalismus – das Selbstverständnis der bundesrepublikanischen Gesellschaft spürbar erschüttert.
Aus zeithistorischer Sicht stellt sich nicht nur die Frage nach den Gründen dieser Entwicklung, sondern auch nach ihren Vorläufern in unserer Geschichte. Wer die jüngsten Erfolge der Rechtspopulisten verstehen will, tut gut daran, sich zu vergegenwärtigen, unter welchen Bedingungen in Deutschland nach 1945 rechte Denkweisen verfangen und Anhänger finden konnten. Dabei zeigt sich, dass es der Rechten ungeachtet ihrer hartnäckigen Bemühungen und mancher Konjunkturen über die Jahrzehnte nicht gelungen ist, ihre zeitweiligen Erfolge in dauerhaften politischen Einfluss zu übersetzen. Richtig ist allerdings auch, dass keiner ihrer Anläufe so erfolgreich war wie der gegenwärtige.
Das besorgniserregend Neue sind nicht die alten Parolen, von denen wir einige als Überschriften für die folgenden Kapitel verwenden. Schaut man genauer hin, haben sich die rechten Sprüche über die Jahrzehnte kaum verändert. Neu aber ist, dass und in welchem Ausmaß die unermüdlich recycelten Forderungen nach »Schlussstrich« und »sicheren Grenzen«, nach einer heilen Geschichte, einer »reinen« Nation und nationalstolzen »Leitkultur« auf Resonanz stoßen. Plötzlich erzielen sie, wie von einer Welle getragen, politische Wirkungsmacht – und verunsichern sogar Menschen, die von sich sagen, mit rechten Überzeugungen nichts im Sinn zu haben.
Dass der Nationalismus – ein im 19. Jahrhundert entstandenes politisches Konzept – wieder derart attraktiv geworden ist, stellt eine ebenso gefährliche wie erklärungsbedürftige Entwicklung dar. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte sich vor allem im Westen, langsam aber sicher und weit über die akademische Forschung hinaus, die Erkenntnis durchgesetzt, dass »Nationen« Imaginationen sind; dass sie, wie der amerikanische Politikwissenschaftler Benedict Anderson gezeigt hat, auf »erfundener« Gemeinschaft beruhen. Parallel dazu entstanden alternative Ordnungskonzepte: zum Beispiel das der Europäischen Integration, die zur Sicherung von Frieden und Wohlstand auf eine gemeinsame Werte-, Rechts- und Wirtschaftsordnung setzt statt auf die Idee einer historisch vorbestimmten, ewiggültigen Volks- oder Schicksalsgemeinschaft. Der inzwischen fast in Vergessenheit geratene »Verfassungspatriotismus« der alten Bundesrepublik war zugleich Ergebnis und wichtiger Antrieb dieses alternativen, postnationalen Denkens.
Nach dem Ende des Kalten Krieges hofften nicht wenige, dieses Denken könnte sich in ganz Europa oder gar weltweit durchsetzen; manche glaubten gar an ein Ende der Geschichte. Inzwischen sehen wir: Der Untergang des Kommunismus ermöglichte nicht nur Presse-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit auch im Osten, sondern zugleich die Rückkehr des Nationalismus. Die gemeinschaftsstiftende Kraft dieser Vorstellung entfaltet seitdem einen gefährlichen Sog. In den Staaten Ost- und Südosteuropas folgt der neue Nationalismus als Reaktion auf jahrzehntelange politische Unterdrückung, in vielen westlichen Staaten huldigen ihm populistische Bewegungen als vermeintliches Allheilmittel gegen die Defizite und Krisen der liberalen Demokratie.
Es ist dieser weltweit zu beobachtende, nun auch in die Mitte der deutschen Gesellschaft reichende Vorstoß nationalistischer Polemik, Programmatik und Politik, der beunruhigt. Er verlangt, über Gesellschaftsanalyse und Gegenwartsdiagnose hinaus, gerade auch nach historischer Einordnung – zumal angesichts der wiederholt von Deutschland ausgegangenen hypernationalistischen Gewalt.
So ist zu fragen, wie die Entwicklung der letzten drei, vier Jahre möglich wurde in einer Gesellschaft, die ihre – zum Teil doppelte – Diktaturerfahrung mustergültig »bewältigt« zu haben schien. Wie konnten diese Verschiebungen geschehen in einem Land, das wegen seiner ernsthaften, wenn auch hindernis- und windungsreichen Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus, Krieg und Holocaust anderen Staaten mit diktatorischer Vergangenheit für geraume Zeit sogar als Vorbild galt? War die Bereitschaft zu historischer Aufarbeitung und Erinnerung am Ende bloß das Trugbild von Deutungseliten, die sich abgekoppelt hatten von den tatsächlichen Auffassungen und Einstellungen breiter Bevölkerungsschichten? Oder sind, wie manche meinen, die Abwehr selbstkritischer Fragen an die eigene Nation und der Einzug einer rechten Partei ins Parlament nur ein Ausweis demokratischer Normalität?
Die Geschichte der zweiten deutschen Demokratie war immer auch die Geschichte einer – im Großen und Ganzen – erfolgreichen Auseinandersetzung mit Autoritarismus und antidemokratischem Denken. Aber um zu verstehen, was derzeit auf dem Spiel steht und wie es dazu gekommen ist, gilt es, die Geschichte der beiden deutschen Staaten nach 1945 noch einmal neu in den Blick zu nehmen. Sie unter dem Eindruck der gegenwärtigen rechten Konjunktur anders denn als gängige Erfolgsgeschichte zu erzählen: Das versuchen wir in den folgenden Kapiteln.
Das Wort Versuch ist dabei ernst gemeint. Dieses Buch ist keine Streitschrift, auch kein Leitfaden oder Ratgeber, der einen einfachen Weg aus der Krise weist. Vielmehr geht es uns darum, die gegenwärtigen Herausforderungen klarer herauszuarbeiten, indem wir sie zeithistorisch perspektivieren. Die Dinge im größeren Kontext der langen Geschichte Nachkriegsdeutschlands zu betrachten heißt auch, sich von den oft eher situativen Befunden der Politik- und Sozialwissenschaften zu lösen – und sich von einer medialen Alarmstimmung fernzuhalten, die mitunter zu befördern scheint, was sie zu bekämpfen sucht.
Die zweite deutsche Demokratie steht nicht vor ihrem Zusammenbruch, und schon gar nicht stehen wir vor einem neuen 1933; dafür sind die ökonomisch-sozialen, vor allem aber auch die historisch-politischen Rahmenbedingungen viel zu verschieden. Dennoch sind die jüngeren Entwicklungen, die aktuell verbreiteten Verunsicherungen, Konflikte und Krisengefühle als fundamentale Herausforderung unserer Gesellschaft zu verstehen, die sich ihrer Liberalität, ihrer Weltoffenheit und ihrer erfolgreichen »Aufarbeitung« der Vergangenheit vielleicht allzu gewiss geworden ist – und dabei zu wenig beachtet hat, dass unter dem Dach des seit 1990 in ganz Deutschland gültigen Grundgesetzes nach wie vor zwei sehr verschiedene politische Kulturen wohnen.
Der Erfolg der AfD bei der Bundestagswahl 2017 war nur der vorläufige Höhepunkt einer nicht leicht zu entschlüsselnden Entwicklung. Denn die rechtspopulistische Mobilisierung von Bevölkerungsschichten, die besonders, aber nicht nur im Osten Deutschlands von den Partizipationsmöglichkeiten eines demokratischen Gemeinwesens zuletzt kaum noch Gebrauch gemacht hatten, hat Grundsatzfragen der demokratischen Gesellschaft auf die Tagesordnung gebracht: Wer oder was ist deutsch? Was bedeuten Heimat, Patriotismus und Nation? Welche Grundrechte gelten für wen? Welchen Wert hat eine kritische Geschichtskultur? Und wie weltoffen und zugleich streitbar soll die Demokratie in Deutschland künftig sein?
In den Feuilletons der Republik wurden all diese Fragen zwar auch zuvor schon diskutiert, gesellschaftliche Gräben aufgerissen haben sie aber erst im Laufe der letzten Jahre, vor allem seit 2015. Ein wenig erinnert die Situation inzwischen auch hierzulande an die culture wars in den Vereinigten Staaten: an die fundamentale politische Polarisierung der Gesellschaft, die durch eine aggressive, um keine Verzerrung, Zuspitzung und im Zweifel auch Lüge verlegene Medienstrategie der Rechten vorangetrieben wird und die eine wichtige Rolle für den Wahlsieg von Donald Trump gespielt hat.
Die derzeit dominante Form nationalistischer Politik ist der Populismus. Rechtspopulistische Erfolge sind in Europa schon seit den neunziger Jahren zu verzeichnen – man denke an Silvio Berlusconi in Italien, der mit seinen Zoten, großspurigen Sprüchen und seinem Vorsatz, das Land zum vermeintlichen Wohle des Volkes wie ein Unternehmen zu führen, einige Charakteristika Donald Trumps vorweggenommen hat, sowie an den Aufstieg der FPÖ unter Jörg Haider in Österreich. Auch wenn das Phänomen des Populismus, das sowohl in rechten wie linken Varianten existiert, nicht leicht zu fassen ist, so gibt es doch einige charakteristische Eigenschaften: Typischerweise inszenieren sich populistische Politiker, obwohl häufig selbst privilegierten Kreisen entstammend, als einzig legitime Vertreter des einfachen, »wahren Volkes« im Kampf gegen das »Establishment« der politischen und kulturellen Eliten, deren behauptetes »volksschädliches« Verhalten gerne verschwörungstheoretisch erklärt wird. Damit einher geht die Verächtlichmachung des parlamentarischen Systems und der mühsamen Suche nach Kompromissen in der pluralen Gesellschaft. Rechte Populisten insistieren darüber hinaus auf der Identifikation des »wahren Volkes« als einer ethnisch homogenen Einheit, deren Vorrechte sie gegenüber Migranten und andere Minderheiten schützen wollen.
Jenseits dieser allgemeinen Merkmale passen Populisten ihre politische Programmatik den Umständen des jeweiligen Landes oder der jeweiligen Region flexibel an. Fragt man nach den Ermöglichungsbedingungen für den Aufstieg rechtspopulistischer Parteien und Politiker, gilt es deshalb, sowohl übergreifende transnationale Entwicklungen als auch nationalspezifische Besonderheiten zu berücksichtigen. Erstere seien hier nur stichwortartig genannt: die Durchsetzung »neoliberaler« Wirtschaftspolitik nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, die zu wachsender sozialer Ungleichheit und Verunsicherung geführt hat; das Fortschreiten der europäischen Integration in einer Weise, die von vielen als technokratisch und undemokratisch wahrgenommen wird; die 2007 einsetzende Finanzmarktkrise und die anschließende Eurokrise, deren Bewältigung diese Wahrnehmung verstärkt hat; die Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus seit dem 11. September 2001, die der von George W. Bush ausgerufene war on terror nicht eingedämmt, sondern verschärft und die zur Verbreitung einer islamfeindlichen Stimmung geführt hat; schließlich die digitalen sozialen Netzwerke, die als partizipatorisches Instrument der Demokratisierung gefeiert wurden und sich zugleich als ideales Medium populistischer Agitation entpuppten.
In Deutschland war der unmittelbare Auslöser für die Mobilisierung von rechts fraglos die »Flüchtlingskrise«. Schon die Etablierung dieses Ausdrucks kann als Erfolg rechter Rhetorik gelten, die mit der Ausrufung eines vermeintlichen Notstands radikale Maßnahmen rechtfertigen will. Dank solcher Strategien der Erzeugung und Verschärfung von Krisenstimmungen stehen Begriffe wie »Grenzsicherung« und »nationale Souveränität«, die in einem zusammenwachsenden Europa fast bedeutungslos geworden waren, wieder ganz oben auf der Agenda. Eine ethnisch definierte »Schicksalsgemeinschaft« wird gegen den Rechtsstaat in Stellung gebracht. Zu diesem Zweck verbreitet die Neue Rechte, die zuvor ein ideologisches Nischendasein fristete, den Mythos vom »großen Austausch«: die Behauptung, dass die kosmopolitisch-liberalen Eliten in Politik und Medien eine »Völkerwanderung« in Gang gesetzt hätten, um durch »Überfremdung« und »Islamisierung« die »abendländische Kultur« zu vernichten und ein deutsches, vielleicht sogar europäisches »Völkersterben« einzuleiten. Das ist die dystopische Vorstellung einer existenziellen Krise, an deren Ende sich Deutschland, wie Thilo Sarrazin schon 2010 zu wissen glaubte, angeblich »abgeschafft« haben wird.
Doch solche rechten Schreckensgemälde sind nicht neu. Der Blick in unsere Geschichte zeigt, dass viele dieser Parolen und Bedrohungsszenarien eine lange Tradition haben. Der Streit um die Flüchtlingspolitik der Regierung Merkel war, so gesehen, nur der willkommene Anlass, nationalkonservative und völkische Denkmuster zu reaktivieren, die im Laufe der letzten Jahrzehnte gesellschaftlich zurückgedrängt worden sind, aber niemals verschwunden waren.
Als Historikerinnen und Historiker wollen wir die wiederkehrenden rechten Logiken aufzeigen und durchschaubar machen. Wir wollen die Aufmerksamkeit schärfen für die Motive jener, die damit hantieren – aber auch helfen, kritischen Abstand zu unproduktiven Dramatisierungen zu gewinnen, die über den Entrüstungsmotor der sozialen Netzwerke inzwischen vieltausendfach potenziert werden.
Wir versuchen dies in zweimal vier Kapiteln, die über den Zeitraum von 1945 – mit einem Einschnitt in den achtziger Jahren – bis zur Gegenwart die lange Nachgeschichte des Nationalsozialismus und der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit dieser Vergangenheit ebenso in den Blick nehmen wie die Ideen-, Organisations- und Gewaltgeschichte des Rechtsradikalismus. Für das Verständnis unserer gegenwärtigen Situation ist es dabei unabdingbar, die in diesem Kontext oft vernachlässigte Geschichte Ostdeutschlands vor und nach 1990 in ihrer ganzen Komplexität einzubeziehen. Denn viereinhalb Jahrzehnte getrennter Entwicklung haben große Unterschiede in der politischen Kultur und Mentalität der beiden deutschen Staaten hervorgebracht, die bis heute durchschlagen.
Kapitel 1 schaut zunächst auf die »alte« Bundesrepublik: auf die diversen Formen der Abwehr der Vergangenheit und auf das früh verbreitete Bedürfnis nach einem »Schlussstrich«, das die Repräsentanten der noch ungeübten, in vielerlei Hinsicht unsicheren zweiten deutschen Demokratie zu moderieren hatten. Hier reicht das Tableau von dem schon vor der Staatsgründung eröffneten Kampf gegen die verhasste Entnazifizierung bis zu den Folgen der antisemitischen »Schmierwelle« 1959/60 und den Verjährungsdebatten der sechziger und siebziger Jahre. Parallel dazu zeigt Kapitel 2, wie die ostdeutschen Kommunisten unter dem Schlagwort der »antifaschistisch-demokratischen Umwälzung« ihre »Lehren« aus der NS-Zeit mit dem Aufbau einer neuen politischen Ordnung verbanden. Sie setzten dabei nicht nur auf Zwang, sondern auch auf das Versprechen »volksdemokratischer« Mitbestimmung. Die Geschichte des »Dritten Reichs« und des Zweiten Weltkriegs war in der DDR allgegenwärtig, allerdings wurde sie ideologisch verkürzt, verfälscht und politisiert. Im Zentrum standen stets der kommunistische Widerstand und der »siegreiche« Kampf der Sowjetunion. Das den Ostdeutschen in Aussicht gestellte sozialistische Mitwirkungsversprechen war eng an diesen instrumentellen Umgang mit der Geschichte gebunden. Das führte dazu, dass sich in der DDR, anders als im Westen, auch auf längere Sicht keine (selbst-)kritische gesellschaftliche Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit entwickeln konnte.
Kapitel 3 führt die Versuche der politischen Sammlung und Mobilisierung im »nationalen Lager« vor Augen, an denen es seit Bestehen der Bundesrepublik nicht mangelte; Deutschnationale wurden davon ebenso angezogen wie Anhänger der »Konservativen Revolution« und alte wie neue Nationalsozialisten. Wie schon in der Weimarer Republik galt die liberale parlamentarische Demokratie in diesen Kreisen als Ergebnis westlicher Fremdherrschaft, gegen die »Widerstand« zu leisten war – außerhalb wie auch innerhalb des verhassten »Systems«, das im Zuge der kurzen Rezession der Jahre 1966/67 einen ersten Aufstieg der NPD erlebte. Kapitel 4 erörtert den Zusammenhang von Wirtschaftskrise und Ausländerfeindlichkeit aus der Perspektive der »Gastarbeiter« in der Bundesrepublik beziehungsweise der »Vertragsarbeiter« in der DDR. Als Arbeiter auf Zeit akzeptiert, wurden sie häufig dann diskriminiert, wenn sie gesellschaftliche Teilhabe forderten. Manifeste Ressentiments und Gewalt gegen Ausländer breiteten sich in der Bundesrepublik aber erst nach dem Anwerbestopp von 1973 und vor allem im Laufe der achtziger Jahre aus, als sich mit den Türken eine als kulturell fremd stigmatisierte Gruppe auf Dauer niederließ. Während das konfliktreiche Zusammenleben in der Bundesrepublik letztlich den Weg zum Einwanderungsland avant la lettre ebnete, weist die Tolerierung der Gewalt gegen Ausländer in der späten DDR auf den Vereinigungsrassismus nach 1990 voraus.
Kapitel 5 blickt in einem bis an die Gegenwart führenden Längsschnitt auf die Veränderungen im Umgang mit der NS-Vergangenheit seit den siebziger Jahren, die oft nur als »rotes Jahrzehnt« verstanden werden, tatsächlich aber auch eine »Hitlerwelle«, neue apologetische Bedürfnisse und einen ins Terroristische drehenden Rechtsradikalismus hervorbrachten. Einerseits machte die Fernsehserie »Holocaust« (1979) die Deutschen betroffen und löste eine lange Phase der intensiven wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen Judenmord aus. Andererseits formierten sich, wie Kapitel 6 zeigt, »Wehrsportgruppen«, aus deren Reihen der Attentäter stammte, der auf dem Münchner Oktoberfest 1980 den blutigsten rechtsterroristischen Anschlag in der Geschichte der »alten« Bundesrepublik verübte. Vor dem Hintergrund einer zwar lange angekündigten, faktisch aber weitgehend ausgebliebenen bürgerlich-konservativen »Tendenzwende« unter Kanzler Kohl feierte Mitte der achtziger Jahre die neue Rechtspartei der Republikaner kurzfristige Erfolge, und im eher akademischen Milieu suchte eine nun entstehende Neue Rechte von der Neuen Linken und der studentischen Protestbewegung zu lernen. Neben der Verachtung für die Linke spricht auch dieser alte Mobilisierungsneid der Rechten aus Jörg Meuthens Satz vom »links-rot-grün verseuchten 68er-Deutschland«.
Kapitel 7 zeigt, wie sich der Ausländerhass in der Transformationskrise nach 1989/90 in ganz Deutschland ausbreitete und zugleich seine Gestalt veränderte. Denn die Dynamik der rassistischen Gewalt lässt sich, auch wenn sie im Osten der Republik regelmäßiger und radikaler wütete, nur aus dem Zusammenspiel west- und ostdeutscher Entwicklungen erklären, die teilweise bis in die achtziger Jahre zurückreichen. Der Vereinigungsrassismus war ein gesamtdeutsches Syndrom. Von den gewalttätigen Anti-Ausländer-Protesten etwa in Rostock-Lichtenhagen führt eine Kontinuitätslinie über zahlreiche politisch motivierte Morde und die Verbrechen des NSU bis in die Gegenwart der rechtsradikalen Strömungen, die Kapitel 8 beleuchtet. Den Zulauf, den Pegida, AfD und Identitäre Bewegung in den letzten Jahren erfahren haben und der zum Teil aus der Mitte der Gesellschaft kommt, kann nur verstehen, wer die Geschichte Ostdeutschlands vor und nach der deutschen Einheit berücksichtigt. Unter dem Eindruck des ökonomischen Kahlschlags und der sozialen und kulturellen Verwerfungen entstand dort ein Klima, in dem globale Erschütterungen wie die Finanzmarktkrise und die Flucht- und Migrationsbewegungen besonders starke Wirkungen entfalteten. Westdeutsche Ostlandreiter – nationalkonservative Strategen, neurechte Theoretiker und rechtsradikale Demagogen, die nach 1990 in die neuen Bundesländer gezogen sind – und einheimische Aktivisten haben es verstanden, diese Situation für den Aufbau einer gesamtdeutschen, vermeintlich bürgerlichen »Sammlungsbewegung« zu nutzen.
So droht Deutschland derzeit von rechts zusammenzuwachsen: in einer neuen nationalistischen Formation, die den entschlossenen Widerspruch all derer verlangt, denen eine liberale Demokratie und eine menschenfreundliche Gesellschaft am Herzen liegen.
KAPITEL 1
»Einmal muss doch Schluss sein«Die Gegenwart der Vergangenheit in der Ära Adenauer
Den ganz großen Eintrag in die Annalen des Freistaats Braunschweig verpasste Stadtoldendorf Anfang Februar 1932, als die Idee verworfen wurde, Hitler dort zum kommissarischen Bürgermeister und auf diesem Weg zum deutschen Staatsbürger zu machen. Einen Weltkrieg und eine Länderneuordnung später, im Herbst 1951, gelang den Ratsherren der nunmehr niedersächsischen Idylle aber doch noch ein kleiner Coup: Im kommunalen Gaswerk übergaben sie in einer nachmittäglichen Zeremonie ein Konvolut mit Angaben zu 600 früheren NSDAP-Mitgliedern dem Feuer. Walter Dach, vormals Entnazifizierungskommissar, inzwischen CDU-Stadtrat, sprach von einem »Akt der Versöhnung und Gerechtigkeit im Geiste unseres Grundgesetzes«, und Bürgermeister Wilhelm Noske, Sozialdemokrat und Geschichtslehrer, pflichtete bei: Seine Stadt ziehe damit als erste in der Bundesrepublik »einen Schlussstrich unter die gesamte Entnazifizierung«.1
Sehr viele solcher Veranstaltungen hat es im Nachkriegsdeutschland wohl nicht gegeben, wobei besagte Aktion noch einen ganz eigenen Beigeschmack besaß insofern, als die Idee dazu bei einem Festessen entstand: im Anschluss an eine Kranzniederlegung zum 50.Gründungstag des städtischen Krankenhauses, mit der man dessen jüdischem Stifter Geheimrat Max Levy gedachte. Aber Formulierungen wie die, mit denen in Stadtoldendorf die Akten in den Ofen wanderten, waren Ende der vierziger, Anfang der fünfziger Jahre überall zu hören. Daraus sprach die oft eigentlich nur noch als Hass zu beschreibende Aversion einer übergroßen Mehrheit der Deutschen gegen das Projekt einer grundlegenden politischen Säuberung, das die zonalen Militärregierungen 1945/46 in Gang gesetzt hatten.
Faktisch handelte es sich um ein gesellschaftliches Großexperiment, das schon zu Beginn lediglich von einer Minderheit der Gegner und Verfolgten des NS-Regimes wirklich begrüßt, unter dem Eindruck wachsender Kritik aus den neu entstandenen Parteien und der Obstruktion der deutschen Verwaltung nach zwei, drei Jahren schrittweise zurückgenommen und schließlich ganz abgebrochen wurde. Wie immer man sein Ergebnis in der Rückschau bewertet – seine Geschichte lässt ahnen, wie lang, wie steinig und mit welchen Schlaglöchern durchsetzt die Strecke bis zu der Einsicht war, die heute wohl immer noch die meisten Deutschen teilen: dass gesellschaftliche Zukunft nicht durch Verleugnung und Verdrängung des Gewesenen gewonnen wird, sondern durch einen kritisch-aufklärerischen Umgang damit.
Der Schock der Niederlage, auch das Erschrecken über die Bilder und Informationen aus den befreiten Konzentrationslagern, mit denen die Alliierten die besiegten Deutschen unmittelbar nach Kriegsende konfrontierten, hatten ihre Wirkung zunächst nicht verfehlt. Als im Herbst 1945 der Internationale Militärgerichtshof in Nürnberg zusammentrat, hielten in der amerikanischen Besatzungszone zwei Drittel der Befragten den Prozess gegen die sogenannten Hauptkriegsverbrecher für »fair«.2 Das änderte sich in dem Maße, in dem den Deutschen klar wurde, dass es den Siegermächten nicht darum ging, die Großen zu hängen, um die Kleinen laufen zu lassen. Je mehr Ermittlungen und Verfahren auch gegen Parteifunktionäre, SS-Leute und Wehrmachtsangehörige aus der zweiten und dritten Reihe begannen, umso lauter wurde das Murren in der post-nationalsozialistischen Volksgemeinschaft.
Vor allem aber stieß man sich daran, dass im Zuge der politischen Säuberung jeder erwachsene Deutsche Rechenschaft ablegen sollte. Der »Fragebogen«, ein zu diesem Zweck ausgegebenes Formular mit 131 Positionen, galt nicht nur Ernst von Salomon als Dokument der Inquisition; mit seiner 1951 unter diesem Titel veröffentlichten Polemik landete der frühere Rechtsterrorist aus den Reihen der Rathenau-Mörder (»Organisation Consul«) einen Bestseller, der die Stimmung in der jungen Bundesrepublik spiegelte. In der stalinistischen DDR gab es solche Gefühle zweifellos auch, nur durften sie öffentlich keinen Ausdruck finden.
Hatten sich zunächst fast überall im Westen Freiwillige gefunden, die, beseelt von der Idee eines Neuanfangs, als Öffentliche Ankläger vor den sogenannten Spruchkammern fungierten, nahm der Wille zum politischen Großreinemachen bald dramatisch ab. Zumal den Insassen der Internierungslager und den aus dem öffentlichen Dienst Entlassenen – ihre Zahl lag zeitweise immerhin in den Hunderttausenden – ging es weniger darum, ihre Gewissen zu erforschen, als vielmehr jene Zeitgenossen ausfindig zu machen, die ihnen die am schönsten exkulpierenden »Persilscheine« schrieben. So wurde aus einem Verfahren, das zwar massenhaft, aber doch jeweils individuell politische Schuld identifizieren und die Belasteten aus wichtigen Ämtern und neu aufzubauenden Behörden heraushalten sollte, tatsächlich die von der zeitgeschichtlichen Forschung später diagnostizierte »Mitläuferfabrik«.3
Aber heißt das, alles Bemühen um einen auch personalpolitischen Neuanfang in Deutschland sei am Ende wirkungslos geblieben, die Entnazifizierung völlig gescheitert? Wer so argumentiert, der verharrt zu sehr in der Wahrnehmung der Zeitgenossen, die auf die fraglos unzähligen bürokratischen Mängel, Unstimmigkeiten und Ungerechtigkeiten des überdies in den einzelnen Ländern und Besatzungszonen recht unterschiedlich gehandhabten Verfahrens fokussiert geblieben ist. Und der übersieht die gerade auch in diesem Handlungsrahmen neu gesetzten demokratiepolitischen Normen und Grenzen, die ihre Wirkung auf Dauer nicht verfehlten. Mit größerem Abstand und einer weiteren Perspektive ergibt sich daher ein anderes Bild.
Dass die säuberungspolitischen Maßnahmen der Alliierten nicht ohne Wirkung waren, zeigte zunächst, gewissermaßen im Umkehrschluss, der rasch einsetzende, hartnäckige und von weiten Teilen der Nachkriegsgesellschaft geführte Kampf dagegen – besonders übrigens vonseiten der Kirchen, die als einzige im »Dritten Reich« vermeintlich integer gebliebene Institutionen eine Zeitlang das große Wort in dieser Sache führten. Doch trotz ihrer lauten Töne und ungeachtet aller Etappensiege kamen weder die Kirchenführer noch Politik und Presse aus ihrer moralischen Defensive heraus. Und obgleich die meisten Entlassungen aus dem öffentlichen Dienst im Laufe der Zeit zurückgenommen und nahezu alle belastenden Entnazifizierungsbescheide nach und nach abgemildert wurden, sodass – neben denen, die ohnehin als »nicht betroffen« galten – tatsächlich ein Heer von harmlos scheinenden »Mitläufern« entstand: Spurlos gingen die Prozeduren an den vormaligen Volksgenossen nicht vorüber, schon gar nicht an denen, die sich einem der mehr als 3,6 Millionen Spruchkammerverfahren hatten unterziehen müssen.
Die Entnazifizierung – als »Denazification« erstes der in Potsdam vereinbarten deutschlandpolitischen »vier Ds« der Siegermächte (neben Demilitarization, Democratization, Decentralization) – hatte den Deutschen zeigen sollen, dass fortan neue Normen galten. Sie war ein Instrument der politisch-moralischen Grenzmarkierung und als solches von nachhaltiger Geltungskraft. Um das zu begreifen, brauchte es nicht einmal die Erfahrung einer teils nur Wochen, mitunter aber auch Monate währenden Internierung; allein die Ungewissheit, wie lange und mit welchem Ausgang man Objekt politischer Überprüfungen war, dürfte vielen Beamten und städtischen Angestellten eine bleibende Erinnerung geworden sein. Für manche wurde daraus vielleicht sogar ein Denkzettel fürs Leben: dass die Selbstberuhigung, »nur meine Pflicht« getan zu haben, nicht als Entschuldigung taugt im Angesicht von offenkundigem Unrecht, mochte es auch »von oben« verordnet gewesen sein.
Selbst das empörte Gerede über den »Kollektivschuldvorwurf«, als den etliche Kritiker schon früh die Entnazifizierung interpretierten, lässt sich als indirektes Eingeständnis lesen, dass den Säuberungsanstrengungen der Alliierten keine ganz unrealistischen Schuldvermutungen zugrunde lagen. In die gleiche Richtung deutete schließlich die Heftigkeit, mit der das Bonner Parlament im Herbst 1950 über die »Liquidation« der Entnazifizierung debattierte, obgleich die Verabschiedung entsprechender Schlussgesetze Ländersache war. Auch wenn die Redner der regierenden Union und der oppositionellen Sozialdemokratie im Bundestag vor den verbalen Ausfällen der rechten Kleinparteien (»nationales Unglück«, »Verbrechen«, »Tumor am deutschen Volkskörper«)4 zurückschreckten – auf ein klares Wort zur Notwendigkeit der stattgehabten Säuberung verstand sich nun niemand mehr. Stattdessen beeilten sich die Vertreter aller Fraktionen, die Erwartungen ihrer Klientel durch Variationen des längst zum Mantra gewordenen Satzes zu bedienen: »Einmal muss doch Schluss sein.«
Wenn es um die Auseinandersetzung mit der NS-Zeit ging, dann waren CDU / CSU und SPD – die einen als neugegründete überkonfessionelle Partei der bürgerlichen Mitte, die anderen als traditionsreiche, zur Mitte strebende Arbeiterpartei – eher getriebene als gestaltende Kräfte. Schon um ihren Status als Volksparteien auszubauen, galt es, den Rechten möglichst wenig Platz zu lassen, die gerade auf diesem Feld mit größter Skrupellosigkeit Kompetenz beanspruchten. Für Adenauer und die Union bedeutete das, die radikalen Ambitionen ihrer kleinen Koalitionspartner, der im Wortsinne reaktionären Deutschen Partei (DP) und des starken rechtsnationalen Flügels der FDP, durch eigene Initiativen in Schach zu halten. Für die SPD ging es darum, ihre Begrenzung auf das klassische Arbeitermilieu zu überwinden und vor allem die tendenziell schon zu Ende der Weimarer Republik an die NS-Bewegung verlorenen jüngeren Arbeiter und späteren Wehrmachtssoldaten durch ostentative Zuwendung zurückzugewinnen. Mittel der Wahl auf diesem Weg war eine gleichsam großkoalitionär ausgestaltete Vergangenheitspolitik, die Generosität gegenüber so gut wie allen bedeutete, die sich nach der »wirren Zeit« als »Entnazifizierungsgeschädigte« oder sonst als Opfer der Besatzungspolitik betrachteten.
Letzteres galt vor allem für jene Deutschen, die in den unmittelbaren Nachkriegsjahren vor den Richtern einer vermeintlichen »Siegerjustiz« gestanden hatten: mehrere Tausend, die von alliierten Militärgerichten, sowie weitere 150, die in den zwölf sogenannten Nürnberger Nachfolgeprozessen der Amerikaner als Kriegs- und NS-Verbrecher verurteilt worden waren. Unter diesen gerade anfangs tatsächlich hart Bestraften, zum Teil auch zum Tode Verurteilten waren Partei- und SS-Führer, Wehrmachtsgeneräle, aber auch hochrangige Ministerialbeamte und Juristen, Industriemanager, KZ-Ärzte, Lagerpersonal und lokale Kriegsfanatiker, die auf dem platten Land abgestürzte feindliche Piloten oder Fallschirmjäger gelyncht hatten. Für deren Begnadigung verwendeten sich zunächst wiederum die Kirchen, bald im Verbund mit einer hochprofessionellen Kriegsverbrecher-Lobby aus SS-Juristen und ehemaligen Nürnberger Verteidigern. Die militante Truppe schürte eine Stimmung, der sich mit Ausnahme der Kommunisten keine der im Bundestag vertretenen Parteien entzog. Mit der haltlosen Behauptung, die von den Besatzungsmächten zugelassenen »Lizenzparteien« täten im Kampf um die in den »Kerkern der Alliierten« einsitzenden »Kriegsverurteilten« nicht genug, trieb ein harter Kern von Experten, die selbst mit einem blauen Auge davongekommen waren – darunter der Ex-Diplomat Ernst Achenbach und der vormalige Heydrich-Stellvertreter im Reichssicherheitshauptamt Werner Best –, Regierung und Parlament mit immer neuen Schlussstrich-Forderungen vor sich her: bis hin zum Entwurf einer »Generalamnestie« für »politische Straftaten«.
Vor diesem Hintergrund wird erklärlich, weshalb der Bundestag glaubte, noch im Dezember 1949 ein erstes großes Zeichen setzen zu müssen. Es kam in Gestalt eines von der Alliierten Hohen Kommission nur unter Bauchschmerzen genehmigten Straffreiheitsgesetzes, das sämtliche vor dem 15. September 1949 begangenen Taten amnestierte, die mit Gefängnis bis zu sechs Monaten beziehungsweise bis zu einem Jahr auf Bewährung geahndet werden konnten. Damit waren auch alle »minderschweren« Straftaten aus der NS-Zeit außer Verfolgung gesetzt – bis hin zu Körperverletzungen mit Todesfolge und Totschlag, etwa im Zusammenhang mit den Pogromen im November 1938. Einer weiteren Öffentlichkeit blieben diese Konsequenzen seinerzeit zwar verborgen, die Justiz jedoch verstand die Amnestie sofort als ein verdecktes Signal gegen übertriebenen Eifer bei der Verfolgung von NS-Verbrechen. Die Folge davon war ein rascher Rückgang der Zahl neu eingeleiteter Verfahren. Als dann im Sommer 1954 eine zweite, nochmals weiter gefasste »Bundesamnestie« verkündet wurde, kam es faktisch zu einem Ahndungsstillstand.
Den überzeugten Demokraten in den Großparteien – erwiesenen NS-Gegnern wie Kurt Schumacher, Konrad Adenauer und ihresgleichen – schwebte gewiss nicht vor, im Zuge der Reintegration der vormaligen NS-Parteigenossen auch deren damalige Gesinnung zu rehabilitieren. So war es zweifellos nicht als nachträgliche Billigung ideologischer Erbötigkeit im »Dritten Reich« gemeint, als im Frühjahr 1951 das sogenannte 131er-Gesetz die bereits weit fortgeschrittene »Wiederverwendung« beziehungsweise Versorgung der 1945 entlassenen Beamten auffallend großzügig regelte. Aber genau an diesem Punkt lag das Problem: Wie ließ sich vermeiden, dass die Weitherzigkeit der jungen Demokratie gegenüber den (in aller Regel noch nicht so alten) einstigen Funktionsträgern der Diktatur missbraucht würde? Wie konnte man jene »Renazifizierung« des Beamtenapparats verhindern, vor der nicht nur ein paar kritische Intellektuelle warnten, sondern immer wieder auch ausländische Beobachter und sogar die drei Alliierten Hohen Kommissare auf dem Petersberg bei Bonn? Die »Flurbereinigung für die Zukunft«, von der Bundestagspräsident Hermann Ehlers nach der fast einstimmigen Annahme des »Gesetzes zur Regelung der Rechtsverhältnisse der unter Artikel 131 des Grundgesetzes fallenden Personen« sprach, war keine risikofreie Hypothek.5
Was bedeutete die Rückkehr der »Ehemaligen«?
Beginnend mit der Studie über das Auswärtige Amt (AA), hat die zeithistorische Forschung in den zurückliegenden eineinhalb Jahrzehnten im Einzelnen herausgearbeitet, wie hoch die zwar nicht bruchlose, aber nach dem Ende der Entnazifizierung weitgehend wiederhergestellte Kontinuität der Funktionseliten in Ministerien, Ämtern und Behörden der jungen Bundesrepublik tatsächlich war. Wer bedenkt, dass bei Kriegsbeginn etwa jeder vierte deutsche Mann der NSDAP angehörte, den wird der zahlenmäßige Nachweis von NS-Belasteten in der Beamtenschaft schwerlich überraschen: kaum irgendwo unter einem Viertel, oft aber eher höher und im Laufe der fünfziger Jahre meist sogar noch ansteigend. Weitaus schwieriger als jede statistische Erhebung gestaltet sich bis heute allerdings die Antwort auf die Frage, was die Präsenz der alten Seilschaften in den Institutionen der neuen Demokratie konkret bedeutete. Um es am Beispiel des 1951 wiederbegründeten und von Kanzler Adenauer erst einmal in Personalunion geführten Auswärtigen Amts zu sagen, dessen höhere Beamtenschaft anfangs zu rund einem Drittel aus vormaligen Parteigenossen bestand: Die Wiederbelebung einer nationalsozialistisch inspirierten Außenpolitik lag nicht in deren Möglichkeiten – nach allem, was wir wissen, aber auch nicht (mehr) in ihrer Absicht.
»Wir stellen Pgs ein, aber keine Nazis«, lautete denn auch die Quintessenz, mit der Wilhelm Haas, der erste Personalchef des Bonner AA, im Januar 1952 vor den Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestags trat.6 Der war nach einer aufsehenerregend kritischen Reportage-Serie der Frankfurter Rundschau (»Ihr naht Euch wieder …«) unvermeidlich geworden. Als Karrierediplomat, der nie in der Partei gewesen, wegen seiner »nichtarischen« Ehefrau 1937 aus dem Auswärtigen Dienst entlassen worden und überhaupt erst 1947 aus Fernost zurückgekehrt war, konnte Haas im Parlament nicht nur fast jeden Zweifel an den »schwankenden Gestalten« unter seinen neu-alten Kollegen zurückweisen, ohne sich dabei selbst ins Zwielicht zu setzen. Ausgestattet mit der Aura des politisch Unverdächtigen, war er darüber hinaus der ideale Apologet eines diplomatischen Korpsgeists, der die würdigen von den unwürdigen Bewerbern gleichsam intuitiv zu trennen wusste – und auf diese Weise einer Vielzahl von »Ehemaligen« den Weg zurück ins Auswärtige Amt ebnete.
Die frühe, am Ende fruchtlose Debatte um die Einstellungspraxis des AA trug ihren Teil dazu bei, dass die Rede von den »Ehemaligen« zu Anfang der fünfziger Jahre rasch an Popularität gewann. Dabei blieb das Thema weder auf den Auswärtigen Dienst noch auf den Bereich von Staat und Politik beschränkt. Auch den Eliten in Wirtschaft und Gesellschaft kam die Praxis sehr entgegen, mit Blick auf einstige Mitgliedschaften und Funktionen in der NSDAP (und bei Bedarf auch in SA, SS und Waffen-SS) nur noch pauschal von »Ehemaligen« zu sprechen. Je weiter die Besatzungsmächte mit ihren säuberungspolitischen Ansprüchen in den Hintergrund traten, desto stärker pochten die Westdeutschen auf Diskretion, desto glatter und scheinbar unverfänglicher wurden ihre Biographien. Selbst harte politische Kontrahenten übten sich nun, anstatt die zweifelhafte Karriere ihres Gegenübers offenzulegen, in taktvoller Apostrophierung – etwa in der Art des Bundeskanzlers, der im AA »wenigstens zunächst an den leitenden Stellen« Leute zu brauchen glaubte, »die von der Geschichte von früher her etwas verstehen«.7 In der Figur des »Ehemaligen«, so könnte man sagen, gewährte sich die post-nationalsozialistische Volksgemeinschaft Pardon.
Der Sozialphilosoph Hermann Lübbe hat diese Praxis schon in den achtziger Jahren als heilsame Selbsttherapie der frühbundesrepublikanischen Gesellschaft gegen die Kritik der Achtundsechziger verteidigt. Was Letztere als »Verdrängung« kritisierten, das beschrieb Lübbe mit der Verve des Zeitgenossen als insgesamt gedeihliches, ja notwendiges »kommunikatives Beschweigen« von »braunen Biographieanteilen« – »unter der politischen Rekonsolidierungsprämisse, daß es, diesseits gewisser Grenzen, politisch weniger wichtig sei, woher einer kommt als wohin er zu gehen willens ist«.8
In der jungen DDR war die Problemkonstellation im Prinzip nicht anders, angesichts der herrschenden Antifaschismus-Doktrin aber doch verschieden. Wie unter Adenauer, wurden die vergangenheitspolitischen Erwartungen der Mehrheit auch unter Ulbricht weitgehend erfüllt. So kam das Gesetz der Provisorischen Volkskammer »über den Erlaß von Sühnemaßnahmen und die Gewährung staatsbürgerlicher Rechte für die ehemaligen Mitglieder und Anhänger der Nazipartei und Offiziere der faschistischen Wehrmacht« im Herbst 1949 sogar noch ein paar Wochen früher zustande als das Straffreiheitsgesetz des Bundestags. Und als sich drei Jahre später hüben wie drüben der Neuaufbau eigener Streitkräfte abzeichnete – de facto dauerte es dann noch bis 1955 –, wetteiferten beide Seiten mit Integrationsgesten und »Ehrenerklärungen« für den deutschen Soldaten.9
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.