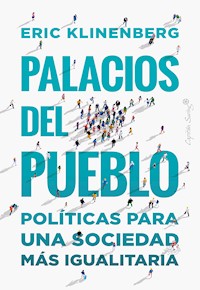24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
2020 als globaler Wendepunkt Eine akribisch recherchierte Untersuchung einer pandemischen Zeit, in der nichts mehr sicher war und alles auf dem Spiel stand: Der renommierte US-Soziologe und Bestsellerautor Eric Klinenberg über ein Jahr, das unser aller Leben auf den Kopf stellte. »Eine packende, tief bewegende Darstellung eines bedeutenden Jahres in der modernen Geschichte.« Siddhartha Mukherjee, Pulitzer-Preisträger und Autor von Der König aller Krankheiten. 2020 wird neben 1914, 1945 und 1968 als eines der folgenreichsten Jahre in die Geschichte eingehen. Eric Klinenbergs Buch ist der erste Versuch, die menschliche Erfahrung dieser schicksalhaften Zeit in ihrer Gesamtheit einzufangen. Im Zentrum von 2020 stehen sieben lebendige Profile von normalen Menschen – darunter eine Grundschulrektorin, ein Bar-Besitzer, ein U-Bahn-Wärter und eine Lokalpolitikerin. Ihre Erfahrungen stehen exemplarisch dafür, wie Menschen auf der ganzen Welt mit der Corona-Pandemie umgegangen sind. Sie erleben Momente von Hoffnung und Angst, sind Zeugen tiefer Tragödien und Verluste und zugleich neuer Solidarität in Krisenzeiten. Gesellschaftsanalyse und faszinierende Weltgeschichte Eric Klinenberg paart diese mikroskopischen Beobachtungen mit datengesättigten Analysen des weltweiten Geschehens: Wir wechseln vom Epizentrum in New York City nach Washington und London, wo politische Führer die Krise viel tödlicher machten, als sie sein musste. Wir werden Zeugen epidemiologischer Schlachten in Wuhan und Peking, sowie der Initiativen von Wissenschaftlern, Bürgern und politischen Entscheidungsträgern in Australien, Japan und Taiwan, die zusammenarbeiteten, um Leben zu retten. Klinenberg gelingt es, auf das Jahr 2020 mit beispielloser Klarheit und Empathie zurückzublicken. Am Ende wurde die Coronavirus-Pandemie zwar von anderen Krisen und Katastrophen überlagert und überholt, aber dennoch: Covid-19 bleibt die Variable, ohne die die Welt nicht mehr erklärt werden kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 803
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Eric Klinenberg
2020 Das Jahr, das die Welt veränderte
Aus dem Englischen von Cornelius Hartz, Karsten Singelmann, Sylvia Bieker, Anke Wagner-Wolff und Henriette Zeltner-Shane
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Vier Jahre nach den ersten Fällen von COVID-19, dem plötzlichen Stillstand der Welt im Lockdown und den erschütternden Bildern aus Bergamo und New York legt der renommierte Soziologe Eric Klinenberg eine Gesamtschau der Corona-Pandemie vor. Meisterhaft verbindet er dabei Feldforschungen aus New York mit Einordnungen des globalen Geschehens. So entsteht ein beeindruckendes Panorama des Epochenjahres 2020.
»Die Geschichte dessen, was 2020 und in den folgenden Pandemiejahren geschah, geht tiefer und hat weitreichendere Folgen, als viele konventionelle Berichte anerkennen. Überall auf der Welt leben die Menschen heute anders als vor der Pandemie. Aber was genau sich wo und wie verändert hat, ist vielfach noch immer nicht ganz klar. Die meisten von uns waren so sehr damit beschäft igt, die Krise zu bewältigen, dass uns kaum Zeit und Raum blieb, uns darüber Gedanken zu machen, was wir erlebten, oder uns zu fragen, warum sich die Dinge so entwickelten, wie sie es taten.« Eric Klinenberg
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Karte
Vorwort: Atmen!
Kapitel 1: »Es war eine Schlacht«
Kapitel 2: Erste Reaktion
Kapitel 3: »Rund um die Uhr«
Kapitel 4: Vertrauen
Kapitel 5: »Nichts mehr zu verlieren«
Kapitel 6: Die Bedeutung von Masken
Kapitel 7: »Meiner Seele ist etwas verloren gegangen«
Kapitel 8: Das Problem mit dem Abstandhalten
Kapitel 9: »Die Brücke«
Kapitel 10: Stadtviertel
Kapitel 11: »Corona war nicht meine größte Sorge«
Kapitel 12: Race
Kapitel 13: »Travels Far«
Kapitel 14: Allein zu Haus
Kapitel 15: Erwachsen werden
Kapitel 16: Amerikanische Anomie
Nachwort
Anhang
Anmerkungen zur Recherche
Dank
Anmerkungen und Quellen
Für Lila, Cyrus und Kate.
Meine Familie, meine schützende Hülle.
© Patrick Spauster
Vorwort
Atmen!
Atmen ist viel mehr als bloß eine Funktion des Körpers, die uns am Leben erhält. Beim Atmen geht es nicht nur darum, dass wir leben, sondern wie und wo wir leben. Wo wir arbeiten. Wo wir essen. Wenn wir die Luft einsaugen, nehmen wir die Welt in uns auf. Wenn wir ausatmen, geben wir etwas zurück. Das Atmen ist unsere grundlegende Chemie, hier beginnen all unsere Verbindungen. Und genau deshalb fand ich Corona so schlimm, so gruselig. Plötzlich hatte ich Angst davor, Luft zu holen, wenn ich vor die Tür ging.«
Benjamin Bier ist Kardiologe und Intensivmediziner in New York City. Anfang 2020 war er 31 Jahre alt und arbeitete am Mount Sinai Hospital, als das, was man mehr als alles andere zum Überleben brauchte, sich plötzlich in etwas verwandelte, das einen umbringen konnte. Im Januar und Februar sprach die gesamte medizinische Fachwelt über das neue Coronavirus, das gerade in China aufgetaucht war und sich bereits in Ländern rund um den Globus ausbreitete. »Einer meiner Kollegen kam aus Italien und hatte Freunde, die in Mailand im Gesundheitswesen arbeiteten. Sie schickten uns SMS mit Berichten aus den dortigen Krankenhäusern. Schrecklich. Die Ärzte sagten: ›So etwas haben wir noch nie erlebt.‹ Dieses mulmige Gefühl in meinem Bauch werde ich nie vergessen.«
Dass COVID-191 nach New York City kam, schien unvermeidlich.Am 1. März wurde der erste bestätigte Fall öffentlich bekannt gegeben. »Ich arbeitete auf der kardiologischen Intensivstation, meinem primären klinischen Schwerpunkt. Anfang März sprach ich mit dem Pflegeteam. Sie sagten: ›Wir werden die erste Anlaufstelle für die Patienten sein. Aus der Intensivstation wird eine COVID-Station werden. Es wird uns hart treffen.‹« Bier bewunderte die Art und Weise, wie die Verantwortlichen im Mount Sinai sich auf den Anstieg der Patientenzahlen in ihrem Haus vorbereiteten. Sie statteten die Krankenzimmer mit besseren Luftfiltersystemen aus. Schafften Schutzausrüstung an. Stellten auf der Intensivstation zusätzliche Betten auf. »Damals dachten wir noch: ›Alles klar, wir sind auf alles vorbereitet.‹ Wir wussten, dass es schlimm werden würde. Aber wir hatten keine Ahnung, wie schlimm.«
So ging es damals allen. Normalerweise wendet man sich mit solch einer Frage an die medizinische Wissenschaft und Forschung. Es gibt richtige Methoden, etwas zu behandeln, und falsche Methoden. Wir möchten, dass unsere Ärzte das eine vom anderen unterscheiden können, dass sie entsprechende Daten haben. Wir wollen Fakten. Bei COVID-19 herrschte jedoch zunächst einmal vor allem eine große Unsicherheit: Wurde das Virus durch Tröpfchen oder Aerosole übertragen? Waren Kinder betroffen? Würde eine Intubation helfen oder schaden? Sonst ganz alltägliche Routinen wurden in diesem Kontext zu folgenschweren Entscheidungen. Biers Freunde fragten ihn, ob sie die Stadt verlassen sollten. Er und seine Frau, bei der vor Kurzem ein seltenes Lymphom behandelt worden war, weshalb ihr Immunsystem immer noch geschwächt war, unterhielten sich darüber, ob sie nicht lieber auch aufs Land flüchten sollte. Sie befürchteten, dass sich das Krankenhaus zu einer Gefahr für Leib und Leben entwickeln würde. Bier war jung und gesund, und wenn er eines konnte, dann Herzen am Schlagen halten. Er würde im Zentrum des Geschehens ausharren und alles mitbekommen, was geschah.
Biers Vorgesetzter wusste von seiner familiären Situation und wollte ihm helfen. Im März bekam er eine Woche Zeit, um sich daheim in Quarantäne zu begeben und seine Frau ins Haus seiner Eltern in Massachusetts zu bringen. Dort würde sie frische Luft und mehr Platz haben, und es war jemand da, der sich um sie kümmerte. Anschließend fuhr Bier zurück nach New York und kehrte an seinen Arbeitsplatz im Krankenhaus zurück. »Ich hatte Angst«, wie er mir erzählte. »Es war eine ganze Weile her, dass sie uns N95-Masken angepasst hatten. Man ging in einen Raum, und sie setzten einem so eine Haube auf und sprühten irgendetwas hinein, um sicherzustellen, dass man es nicht riechen konnte. Im Grunde nahm das nie einer ernst, weil man es nie brauchte. Aber bei COVID wussten wir auf einmal: Okay, das hier ist keine Übung.« Auf der Intensivstation reichte eine Krankenschwester Bier eine neue Maske. »Ich weiß noch, dass ich den Atem anhielt, bevor ich sie aufsetzte, und dann überprüfte, ob sie überall dicht war, wie man es uns beigebracht hatte, weil ich die Luft auf der Intensivstation nicht einatmen wollte. Erst dann wurde mir klar: Das Ding werde ich den Rest des Tages nicht mehr abnehmen. So werde ich arbeiten. So werde ich atmen.«
Aber es war nicht nur der eine Tag, nicht einmal der eine Monat. Der Ausbruch von SARS-CoV-2 wurde zur Corona-Pandemie, und die Corona-Pandemie wurde zu einer permanenten Realität. Bier arbeitete die ganze Zeit über im Krankenhaus, und die Maske wurde, wie er sagte, »mein Schutz vor jeglicher Exposition, das, was dafür sorgte, dass ich okay war«. Natürlich nahm er sie ab, wenn er konnte. »In den ersten Monaten der Pandemie fuhr ich viel durch die Gegend«, erzählte er. »Mein Auto war mein sicherer Ort. Es war erstaunlich. Da war kein Verkehr, niemand auf der Straße. Ich fuhr zum Krankenhaus und fühlte mich einfach frei.« Aber als seine Frau nach dem Abklingen der ersten Welle nach Hause kam, musste er immer noch vorsichtig sein. An den meisten Orten – bei der Arbeit, in Geschäften, eigentlich immer, wenn er sich in der Nähe anderer Menschen aufhielt – behielt er seine eng anliegende, sichere Maske auf. »Es ist schon seltsam«, sagte er, »aber die Maske wurde so etwas wie mein Lebensraum, nur mit Maske fühlte ich mich wohl.«
Ich lernte Bier im Herbst 2021 bei der ersten großen Indoor-Veranstaltung kennen, die er seit Beginn der Pandemie besuchte, einem Jom-Kippur-Gottesdienst in Brooklyn. Jom Kippur ist der höchste Feiertag im jüdischen Kalender, das Versöhnungsfest, an dem Juden um Vergebung bitten und für ihre Sünden büßen. Es ist der Tag des Gedenkens und der Trauer um die Toten. Es ist auch der Tag, an dem das himmlische Buch des Lebens versiegelt wird, der heilige Text, in den Gott die Namen aller Menschen schreibt, die sich mit ihren Taten ein weiteres Jahr auf der Erde verdient haben. Ich kenne nicht viele der Gebete, die wir Juden an diesem Tag sprechen, aber eines, Unetaneh tokef, kann ich seit meiner Kindheit auswendig. Übersetzt heißt der Text: »An Rosch ha-Schana wird es eingeschrieben und an Jom Kippur besiegelt, wie viele vergehen und wie viele geboren werden, wer leben und wer sterben wird, wer zur gekommenen Zeit und wer durch einen vorzeitigen Tod, wer durch Wasser und wer durch Feuer, wer durch Schwert und wer durch wilde Tiere, wer an Hunger und wer an Durst, wer durch Erdbeben und wer durch Pestilenz …« Das Gebet geht noch weiter, aber im Gottesdienst konnte ich mich ab dieser Stelle nicht mehr auf den Text konzentrieren. Stattdessen musste ich an die Millionen Menschen denken, die seit Beginn 2020 an COVID-19 gestorben waren, und an die weiteren Millionen, deren Namen an jenem Tag nicht in das Buch des Lebens eingeschrieben werden würden.
An Millionen Menschen zu denken, bedeutet jedoch, an Statistiken zu denken, und in Wahrheit haben die meisten – ich eingeschlossen – Schwierigkeiten, über den Tod in solchen Größenordnungen zu reflektieren. Stattdessen ertappte ich mich dabei, wie ich mir Gedanken über die Menschen machte, die mir besonders nahestanden. Meine betagten Eltern und Verwandten, um deren Schicksal ich mir Sorgen machte. Den Onkel meiner Frau, der ein paar Monate zuvor an COVID gestorben war, und ihre Mutter, die allein lebte und während der Pandemie ziemlich isoliert war, obwohl sie nur ein paar Straßen von uns entfernt wohnte. Meine Kolleginnen und Kollegen, von denen einige in den ersten Wochen und Monaten der Pandemie ums Leben kamen. Meine Kinder, die die Pandemie in ihrem Leben einschränkte, die in ihren Träumen von Corona heimgesucht wurden und deren Zukunft sich in einer Weise verändern würde, die wir noch gar nicht absehen konnten. Zugleich war mir klar, dass wir großes Glück hatten, zu jenen zu gehören, die Zugang zu einer guten Gesundheitsversorgung hatten und Essen auf dem Tisch; die über ein stabiles Einkommen und Ersparnisse verfügten, die mit Liebe und Unterstützung gesegnet waren. Wer würde leben, wer würde sterben? Ich wusste es nicht. Aber ich wusste, dass es davon abhängen würde, ob und auf welche Weise jemand vor dem Virus geschützt oder ihm ausgesetzt war.1
Trotz seines Jobs hatte Bier einen Weg gefunden, sich und seine Frau sicher durch die Pandemie zu bringen. »Ich fühlte mich immer geschützt, weil ich sozusagen mein Gesicht versiegelte«, sagte er mir. »Ich weiß, dass viele Leute diese Masken ganz furchtbar fanden, aber ich mochte sie, denn damit konnte ich wieder ein Mensch sein.« Aber gegen seine Angst vor der Situation, die das Virus geschaffen hatte, im Krankenhaus, in der Stadt und darüber hinaus, konnte auch die Maske nichts ausrichten. Genau wie das Virus entwickelte sich auch diese Situation weiter. Sie löste neue Krisensituationen aus, führte zu neuen Traumata und stellte alles und jeden auf die Probe, auf ganz unterschiedliche Weise.
Für Bier war das Jahr 2020 nicht nur deshalb so traumatisch, weil er an einem Ort arbeitete, wo er ständig vom Tod umgeben war, sondern weil er das Gefühl hatte, dass seine Welt kleiner geworden war; dass er und seine Familie die Krise überstanden hatten, indem sie sich in einer Kammer eingeschlossen und den Atem angehalten hatten. Bier war nach New York City gezogen, weil es den Duft der großen weiten Welt verströmte – mit den vielen Menschen und dem geschäftigen Treiben, mit Restaurants, Konzerten, Theatern usw. Die Pandemie hatte seine Beziehung zu alldem auf den Kopf gestellt. Sein Leben war jetzt anders. Die grundlegende Chemie stimmte nicht mehr.
Aber es geht nicht nur ums Atmen. Die Geschichte dessen, was 2020 und in den folgenden Pandemiejahren geschah, geht tiefer und hat weitreichendere Folgen, als viele konventionelle Berichte anerkennen. Überall auf der Welt leben die Menschen heute anders als vor der Pandemie. Aber was genau sich wo und wie verändert hat, ist vielfach noch immer nicht ganz klar. Wie Bier waren die meisten von uns so sehr damit beschäftigt, die Krise zu bewältigen, dass uns kaum Zeit und Raum blieb, uns darüber Gedanken zu machen, was wir erlebten, oder uns zu fragen, warum sich die Dinge so entwickelten, wie sie es taten. Viele sind damit überfordert, sich genau daran zu erinnern, was in jenem schicksalhaften Jahr alles geschehen ist. Unsere privaten Gespräche, aber auch der öffentliche Diskurs sind geprägt von dem, was Soziologen als den »Willen, nichts wissen zu wollen« bezeichnen.
Um unsere grundlegende Chemie wieder in Ordnung zu bringen, müssen wir mit diesen Gewohnheiten brechen und uns schwierigen Fragen über das gesellschaftliche Leben der Pandemie stellen, die wir bisher vermieden haben: Warum wurden die Gesichtsmasken an einigen Orten zu einem Objekt, das kulturelle, politische und sogar physische Konflikte auslöste, während sie andernorts allgemein akzeptiert waren und kaum für Kontroversen oder Debatten sorgten? Warum waren manche Gegenden so viel anfälliger für Corona als andere, und warum waren einige, bei denen man davon ausgegangen war, sie würden am meisten leiden, am Ende relativ wenig betroffen? Wieso konnten die Bewohner mancher Länder im Jahr 2020 Vertrauen in ihre Regierung, in die Wissenschaft und in ihre Mitbürger aufbauen, während anderswo das Gegenteil geschah? Welche Rolle spielten ethnischer Hintergrund und sozialer Status in der Pandemie? Was konnten die Mitglieder einer Gemeinschaft tun, um sich gegenseitig dabei zu helfen, zu überleben?
Um all das zu untersuchen und Erkenntnisse für die Zukunft zu gewinnen, müssen wir uns zunächst in das Jahr 2020 zurückbegeben und uns genauer anschauen, was wir damals eigentlich erlebt haben.
Im Januar 2020 unterrichtete ich ein Soziologieseminar an der New York University. Eines der Hauptthemen war die kognitive Herausforderung, mit Gefahren umzugehen, die zwar bedrohlich sind, aber in weiter Ferne liegen. Das menschliche Nervensystem ist darauf ausgelegt, bei einer unmittelbaren Gefahr schnell zu handeln, aber wenn die Bedrohung weiter entfernt scheint, ordnet unser Gehirn die Fakten neu, und das Resultat ist eine To-do-Liste, bei der die Gefahr verdrängt und als Aufgabe definiert wird, mit der man sich später irgendwann beschäftigen kann.
Das ist ein immerwährendes Problem, das bei einer ganzen Reihe von gesellschaftlichen Themen eine Rolle spielt. Man denke nur an den Klimawandel: Egal, wie sehr wir die wachsende Bedrohung durch steigende Temperaturen, den Anstieg des Meeresspiegels und gefährliche Wetterlagen anerkennen, andere Themen – Kriminalität, Wohnungsbau, Bildung, Arbeitslosigkeit, Flüchtlinge, Inflation – erscheinen meistens dringlicher. Der Klimawandel ist beängstigend, aber in der Regel keine Krise, die wir dort erleben, wo die politischen Entscheidungen getroffen werden: im Hier und Jetzt.
Bei der ersten Sitzung meines Seminars präsentierte ich den Studierenden dieses Problem, das ich die »Tragödie der Erkenntnis« nenne. Ich bat alle, die schon von dem neuen Coronavirus gehört hatten, das gerade in China aufgetaucht war, die Hand zu heben. Nur wenige wussten, wovon die Rede war, einer von ihnen war ein Student aus China, der im selben Monat in New York City eingetroffen war. Dann bat ich die Studierenden, die Hand zu heben, falls dieses Virus zu den Dingen gehöre, über die sie sich in ihrem Leben besonders viel Sorgen machten. Alle Hände blieben unten. Einige der Anwesenden lachten.
Ich konnte diese Reaktion nachvollziehen. Ich habe meine ganze Karriere lang Krisen und Katastrophen erforscht, aber diese Krise sah ich nicht kommen. Noch nicht einmal, als sie bereits vor meiner Tür stand.
Am 9. März 2020 sollte ich nach Cleveland fliegen und auf einer großen städtischen Veranstaltung einen Vortrag halten. Seit Monaten hatte ich mich darauf gefreut, in einem überfüllten Theater in der Innenstadt zu sprechen und für Hunderte Leute Bücher zu signieren. Jetzt machte ich mir plötzlich nur noch Sorgen. In der Vorwoche war COVID-19 offiziell in New York City eingetroffen. Täglich wurden neue Fälle gemeldet. Ich schickte eine E-Mail an den Hauptorganisator in Cleveland: »Meinen Sie, wir sollten über die Situation dort sprechen?« Er bot mir an, die Veranstaltung zu verschieben. Aber schließlich entschied ich mich doch, hinzufliegen.
Der Flughafen LaGuardia war leer, mein Flugzeug auch. Niemand trug eine Maske, aber immerhin bot mir die Flugbegleiterin ein Hygienetuch an. Als wir landeten, hatte sich vieles verändert. Die Börse stürzte ab und war drauf und dran, binnen eines Tages fast 8 Prozent an Wert zu verlieren. Ohio meldete die ersten drei bestätigten COVID-Fälle, mit Sicherheit würden Einschränkungen des öffentlichen Lebens folgen. Die Straßen waren leer. »Sie bekommen ein Gratis-Upgrade«, teilte mir die Rezeptionistin des Hotels mit. »Sie sind einer unserer wenigen Gäste.« Mehr als die Hälfte der Leute, die Karten für meinen Vortrag hatten, blieben an dem Abend zu Hause, aber die Stimmung im Theater war dennoch gut. »Sie wissen es vielleicht noch nicht, aber heute war nicht der beste Tag, um mit dem Flugzeug zu fliegen«, verkündete ich. Nervöses Lachen im Saal. »Eine Stimme in mir sagte: ›Steig heute besser nicht in einen Flieger!‹ Aber eine andere Stimme meinte: ›Wenn du das hier verpasst, bereust du es für den Rest deines Lebens.‹« Es war der letzte Abend in jenem Jahr, den ich in der Öffentlichkeit verbringen sollte.
Am nächsten Morgen, dem 10. März, kehrte ich nach New York zurück. Meine Frau war an diesem Tag ebenfalls unterwegs, ihre Mutter hatte bei uns übernachtet und auf die Kinder aufgepasst. Auf dem Rückweg vom Flughafen rief sie mich an: Unser dreizehnjähriger Sohn hätte Fieber. Auf der Lexington Avenue ging ein Passant an mir vorbei, der eine Gasmaske trug. Eine Frau auf der Fifth Avenue trug ein Gesichtsvisier und Handschuhe. Als ich zu Hause ankam, lag mein Sohn auf der Couch, verstört und erschöpft. Meine Schwiegermutter, Mitte siebzig und sich der Gefahr des neuen Virus nur allzu bewusst, wirkte kaum weniger verzweifelt.
»Glaubst du, ich habe Corona?«, fragte mein Sohn.
Wir konnten es nicht herausfinden, denn es gab noch keine Tests. Wie alle waren auch wir auf uns allein gestellt. Was sollten wir tun? Unseren Sohn umarmen und trösten oder ihn isolieren und in seinem Zimmer einsperren? Wie sollten wir miteinander umgehen, uns umeinander kümmern? Würde unser Instinkt, die Nähe des anderen zu suchen, die Situation noch schlimmer machen?
Am nächsten Morgen schloss die Uni ihre Räumlichkeiten und verlegte alle Kurse ins Internet. Als Nächstes war die Schule unserer Kinder dran. Dann der Fußballverein. Gymnastik, Klavierunterricht. Basketballspiele und Geburtstagsfeiern wurden abgesagt. Die Stadt, die angeblich »niemals schläft«, kam zum Stillstand. Wir packten unser Auto, nahmen unsere Kinder und den Hund und fuhren zu einem Haus etwa 80 Kilometer außerhalb von Manhattan.
In der folgenden Nacht stieg bei unserem Sohn das Fieber. Er hatte Kopfschmerzen und Bauchschmerzen. Er war so müde, dass er nicht von der Couch aufstehen konnte. Seine Großmutter fühlte sich nun auch krank. Bald darauf fing meine Frau zu husten an. »Das ist nur die Allergie«, beharrte sie. »Mein PNDS.« Und spürte ich da nicht selbst ein leichtes Kratzen im Hals?
Wir wollten auf keinen Fall ins Krankenhaus gehen; dort waren zu viele COVID-Fälle, das medizinische Personal lief in Mondanzügen herum, lange Schlangen von Kranken warteten darauf, getestet zu werden, und in den Zimmern starben einsam die Patienten. Ein Kinderarzt hätte uns auch nichts genützt, da der nicht auf das Coronavirus testen konnte und nicht wusste, wie man COVID behandelt. Stattdessen tat ich, was ich oft tue, um meine Angst in den Griff zu kriegen und mir Gedanken darüber zu machen, was eigentlich los ist: Ich setzte mich hin und schrieb.
In dem Essay, der dabei entstand und der in der New York Times veröffentlicht wurde, brachte ich meine Befürchtung zum Ausdruck, dass der tiefe Riss, der durch die US-amerikanische Gesellschaft verlief, die Pandemie schlimmer als nötig machen würde. Ich räumte ein, dass Social Distancing unerlässlich schien, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Aber das war definitiv eine plumpe Strategie, die ziemlich kostspielig für das Gesundheitswesen war. Wie wäre es, wenn wir auf die Bedrohung durch Corona nicht mit Distanzierung reagierten, sondern mit Solidarität? Wenn wir unsere gegenseitige Abhängigkeit und unser gemeinsames Schicksal anerkennen und alles tun würden, um uns gegenseitig zu schützen?
Mir war klar, dass dieser Vorschlag ziemlich weit hergeholt war. Zu Beginn des Jahres 2020 waren die USA politisch gespaltener denn je. Die Menschen stritten nicht nur über ihre Meinungen, sondern über grundlegende Tatsachen. Die Nation mochte auf den Idealen Freiheit, Gerechtigkeit und Wohlstand gegründet worden sein, aber in den vergangenen Jahrzehnten war den Amerikanern immer mehr das Gefühl dafür verloren gegangen, dass sie gemeinsame Ziele verfolgten. Das Land war polarisiert, entzweit, ungleich. Überall herrschte Misstrauen – gegenüber der Regierung, den Medien, der Wissenschaft und den eigenen Mitbürgern. Jeder Appell für Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit oder zugunsten des Gemeinwohls würde diese gesellschaftlichen Gräben überwinden müssen. Aber manchmal sind Krisen ja auch Wendepunkte für Staaten und Gesellschaften. Waren die USA in der Lage, eine neue Richtung einzuschlagen? Und wenn nicht: Wie würden wir das Ganze überleben?
Als diese schreckliche Woche schließlich zu Ende ging, hatte ich den Eindruck, als hätte unsere Familie sie relativ unbeschadet überstanden. In Wirklichkeit war das erst der Anfang – die Umwälzungen, die fast jeden Haushalt und jede nationale Regierung dieser Welt erschüttern sollten, hatten gerade erst begonnen. Es dauerte nicht lange, da mussten wir uns mit psychischen Problemen herumschlagen, unsere Kinder auf eine neue Schule schicken, Familienfeiern absagen und fassungslos zusehen, wie unsere Nachbarn verrücktspielten. Für uns alle, so schien es, wurde aus dieser ersten schrecklichen Woche ein Monat. Aus dem Monat ein Jahr. Und so wurde 2020 zu einem Jahr, das in die Weltgeschichte einging und das die Menschheit nie mehr vergessen wird – wie 1492, 1776, 1918, 1939 oder 1968.
Die Ereignisse des Jahres 2020 sollten erheblich mehr Schaden anrichten und weitaus tiefgreifendere Veränderungen bewirken, als sich zu Beginn der Pandemie irgendjemand hätte ausmalen können. Doch wie wir heute wissen, war das Coronavirus nur die Ursache. Die größere Bedrohung ging von uns aus.
Gesellschaften neigen dazu, in Krisenzeiten ihr wahres Wesen zu offenbaren: Wenn es hart auf hart kommt, zeigen wir, wer wir wirklich sind. Was uns lieb und teuer ist. Wie sehr wir einander und unserer Regierung vertrauen. Ob wir eher kooperationsbereit oder konfliktorientiert sind. Wessen Leben besonders viel zählt. Wen wir bereit sind, über die Klinge springen zu lassen.
Man denke nur an den Kontrast zwischen der Reaktion Japans und der Reaktion der USA, als auf zwei Kreuzfahrtschiffen, die von der Reederei Princess Cruises betrieben wurden und dem britisch-amerikanischen Konglomerat Carnival Corporation & PLC gehören, direkt zu Beginn der Pandemie Corona ausbrach. Das eine Kreuzfahrtschiff, die Diamond Princess, war auf dem Ostchinesischen Meer unterwegs, als die Behörden in Hongkong feststellten, dass mindestens einer der 3700 Passagiere und Besatzungsmitglieder COVID hatte. Die andere, die Grand Princess, befand sich mit etwa 3600 Personen in den Gewässern vor Mexiko, als die Behörden erfuhren, dass auch dort an Bord das Virus ausgebrochen war. Die Diamond Princess kehrte in ihren Heimathafen, Yokohama in Japan, zurück, wo die nationale Regierung sofort die Verantwortung übernahm. Die Grand Princess steuerte ihren Heimathafen in der San Francisco Bay an. Doch hier reagierten die Behörden auffallend anders.
Als die Diamond Princess in Yokohama in der Nähe von Tokio anlegte, gingen japanische Beamte an Bord, um die Situation zu beurteilen und Maßnahmen einzuleiten, damit sich das Virus an Bord nicht weiter ausbreitete. Zehn Passagiere wurden positiv getestet, und die Regierung gab bekannt, dass sie eine zweiwöchige Quarantäne verhängte, um Epidemiologen und Medizinern Zeit zu geben, die Situation zu untersuchen. Es war keine leichte Entscheidung: So viele Menschen auf engem Raum festzuhalten, ist immer schwierig und mitunter auch gefährlich. Aber die japanische Regierung machte sich weitaus größere Sorgen über das Risiko, das eine Heimreise möglicherweise infizierter Menschen für eine Ausbreitung des Virus innerhalb des Landes bedeuten würde und dass man sie für die weltweite Ausbreitung des Virus verantwortlich machen würde, wenn sie infizierte Ausländer abreisen ließ. Mangels besserer Optionen beschloss Japan, Vorsicht walten zu lassen, und entschied sich für die Vorgehensweise, die der öffentlichen Gesundheit am zuträglichsten schien.
Japans Vorgehen beim Bewältigen dieser Krise war sicher nicht perfekt. Die erste Phase der Quarantäne verlief chaotisch, die Menschen liefen ständig zwischen Zonen hin und her, die eigentlich isoliert hätten sein sollen. Die strategische Vorgehensweise, wer vom Schiff durfte und wer an Bord bleiben musste, wurde mehrfach geändert, manchmal ohne ausreichende Erklärungen, was die Passagiere und ihre Familien zusätzlich verunsicherte und verwirrte. Die Besatzungsmitglieder wurden zwar mit persönlicher Schutzausrüstung versorgt, waren aber unhygienischen Bedingungen ausgesetzt. Das Gleiche galt für Mitarbeiter des Gesundheitsamts und Pflegekräfte, die sich auf dem Schiff befanden. Mindestens eine Person aus Japan, die nach einem negativen Test von Bord gehen durfte, wurde noch auf der Heimreise per Eisenbahn positiv getestet. Vierzehn Menschen, die sich auf der Diamond Princess infiziert hatten, starben.2
Alles in allem war die Reaktion Japans jedoch ebenso human wie nützlich – für die Bürger Japans, für die ausländischen Passagiere und für den internationalen wissenschaftlichen Austausch. Die japanische Regierung stellte für 712 Passagiere und Besatzungsmitglieder, die sich auf der Diamond Princess mit Corona infiziert hatten, stationäre Versorgung bereit und bot psychologische Unterstützung für all jene an, die auf dem Schiff unter Stress, Angstzuständen und Schlaflosigkeit litten. Beispielsweise ließ sie rund zweitausend iPhones verteilen und WLAN-Router einrichten, um den unter Quarantäne stehenden Personen eine bessere Kommunikation zu ermöglichen. Die Behörden boten jedem, der an einer chronischen Krankheit litt, medizinische Hilfe an. Sie reduzierten drastisch die Ausbreitung des Virus unter den Personen, die an Bord festsaßen, und konnten den Ausbruch eindämmen, bevor er noch schlimmer wurde.3
Darüber hinaus nutzten japanische Wissenschaftler und Beamte die Entwicklungen auf dem und rund um das Kreuzfahrtschiff dazu, ihr Verständnis einer wirksamen Bekämpfung des neuen Virus zu erweitern, womit sie auch Beamten in anderen Ländern halfen, ihrerseits bessere Strategien zu entwickeln.4 Die Beobachtungen der Fachleute auf der Diamond Princess führten beispielsweise zu der Vermutung, dass auch asymptomatische Menschen das Virus weitergeben konnten, was bedeutete, dass es umso wichtiger war, umfassend zu testen und die Bewegungen und das Verhalten positiver Fälle nachzuverfolgen.5 Sie fanden heraus, dass zwischen Menschen, die sich zusammen in Innenräumen aufhielten, ein hohes Übertragungsrisiko bestand, was darauf hindeutete, dass Aerosole bei der Verbreitung der Krankheit eine Rolle spielten und eine verbesserte Luftzirkulation eine wirksame Maßnahme zur Eindämmung des Virus sein könnte. Sie fanden heraus, dass die Gefahr einer schweren Erkrankung bei älteren und vorerkrankten Menschen besonders groß war. Sie fanden heraus, wie schnell sich bei denen, die stationär behandelt werden mussten, die Symptome verschlimmern konnten, was den Krankenhäusern half, sich auf einen Ansturm auf ihre Intensivstationen vorzubereiten. Und sie fanden heraus, wie gefährlich Superspreading-Ereignisse waren, bei denen eine geringe Anzahl infizierter Menschen viele andere in ihrem Umfeld ansteckten. Das galt auch für das Pflegepersonal, das die Bewohner von Pflegeheimen gefährdete, wo in Ländern, die eine solche Verbreitung nicht aktiv verhinderten, bald die Todesraten in die Höhe schnellen würden. All diese Erkenntnisse sollten die Strategie des japanischen Gesundheitswesens für den Rest der Krise prägen, was erklärt, warum Japan während der ersten Phasen der Pandemie eines der sichersten Länder der Welt war – im Jahr 2020 lag die dortige Todesrate nur geringfügig höher als sonst.
Die USA begegneten der Krisensituation auf der Grand Princess deutlich weniger vorausschauend, umsichtig und großzügig. Als die Behörden vom COVID-Ausbruch an Bord erfuhren, gab Vizepräsident Mike Pence eine Pressekonferenz, auf der er erklärte, das Schiff befinde sich derzeit in internationalen Gewässern und sei auf dem Rückweg in die Vereinigten Staaten, und an Bord seien 21 Passagiere und Besatzungsmitglieder positiv auf COVID getestet worden. Dies war den Passagieren auf der Grand Princess völlig neu: Niemand hatte sie bislang über die Situation informiert. Pence versprach, das Schiff werde so schnell wie möglich in einem nicht kommerziellen Hafen anlegen, alle an Bord befindlichen Personen würden getestet und unter Quarantäne gestellt, dann dürften sie von Bord gehen.6
Am selben Tag meldete sich auch Präsident Donald Trump auf einer Pressekonferenz im Hauptquartier der U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zu Wort. Trump sprach sich dagegen aus, an COVID erkrankte Menschen, ob US-Staatsbürger oder Ausländer, von Bord der Grand Princess und auf US-amerikanischen Boden zu lassen. Offenbar sorgte er sich vor allem um die Statistik und wollte verhindern, dass die Zahl der Corona-Fälle im Land stieg. »Ich möchte, dass die Leute [an Bord] bleiben …, damit die Zahlen so bleiben, wie sie sind«, sagte der Präsident. »Ich habe keine Lust, dass sich wegen einem Schiff, für das wir nichts können, die Zahlen verdoppeln.«7
Die nächsten zwei Tage blieb die Grand Princess auf See, und weder die Passagiere noch die Besatzung wussten, wohin sie fahren würden und was bei der Ankunft mit ihnen geschehen würde. Präsident Trump twitterte, die Regierung habe »im Weißen Haus einen perfekt koordinierten und optimierten Plan für unseren Angriff auf das CoronaVirus«.8 Dummerweise verkündeten seine eigenen Kabinettsmitglieder genau das Gegenteil: Im nationalen Fernsehen räumte der Leiter der obersten US-Gesundheitsbehörde ein, die Regierung habe noch überhaupt keinen Plan.
Die Trump-Administration war bereits unter Beschuss geraten, weil sie US-amerikanische Passagiere mit Corona zur Rückführung in dasselbe Flugzeug gesetzt hatte wie negativ getestete. Und sie hatte versäumt, diesen Umstand den Passagieren mitzuteilen, die entsprechend wütend waren, als sie hinterher davon erfuhren. Laut Michael Osterholm, dem Leiter des Center for Infectious Disease Research and Policy der University of Minnesota, war diese Entscheidung »eines der grausamsten Experimente an Menschen, die ich in meiner gesamten Laufbahn erlebt habe«.9
Wie Versuchspersonen eines grausamen Experiments mussten sich auch die Passagiere der Grand Princess vorkommen, die in ihren Kabinen auf das Ende der Quarantäne warteten und keine verlässlichen Informationen erhielten, was um sie herum geschah. Die Regierung erlaubte dem Kreuzfahrtschiff schließlich doch, in Kalifornien anzulegen, aber nicht im wohlhabenden San Francisco, wo es ursprünglich vor Anker gehen sollte, sondern in Oakland, einer Stadt der Schwarzen, der Latinos und der Arbeiter. »Vor allem unter den People of Colour in dieser Stadt herrscht das Gefühl vor, dass immer wieder etwas mit uns geschieht und nicht für uns«, berichtete die Aktivistin Cat Brooks dem Guardian. »So etwas schafft bloß einen Nährboden für Hysterie und Misstrauen.«10
Passagiere, die an Corona erkrankt waren, wurden mit denkbar wenigen Informationen in Hotels oder Militärbasen in Kalifornien, Texas und Georgia in Quarantäne gebracht.11 Auf der Travis Air Force Base weigerten sich mehr als achthundert Personen, sich untersuchen zu lassen. Einige von ihnen prangerten die Regierung dafür an, dass sie in ihr Privatleben eingriff und auf so drastische Weise Kontrolle ausübte. Andere bestanden darauf, dass es ihr gutes Recht sei, nach Hause zurückzukehren. »Sie sind NICHT verpflichtet, sich testen zu lassen. Es ist Ihre Entscheidung«, hieß es in einem Aushang in Travis.12 Obwohl die ersten Ergebnisse derer, die sich testen ließen, viele neue Infektionen ergaben, hinderte die Gesetzeslage die Behörden daran, genau zu beurteilen, wie viele Menschen krank waren und wie viele weiterhin Gefahr liefen, SARS-CoV-2 zu verbreiten.13 Der Vorgang endete im Chaos und führte zu einer Reihe von Gerichtsverfahren.
Wie viele Menschen nach Hause zurückkehrten, während sie noch infektiös waren, und wie es an ihrem Wohnort mit diesen Menschen weiterging, werden wir wohl nie erfahren. Auch werden wir nie wissen, ob die USA, die im Jahr 2020 zu einem der tödlichsten Standorte auf dem Planeten wurden, die Katastrophe hätten abwenden können, wenn die Behörden mit der Krise auf der Grand Princess ähnlich besonnen und konsequent umgegangen wären wie die japanischen Behörden mit der Krise auf ihrem Schwesterschiff. Denn die Unterschiede in der Art und Weise, wie einzelne Länder bei ihrer ersten Begegnung mit dem Virus handelten, insbesondere wie sie versuchten, die Ausbreitung zu stoppen, welche Erkenntnisse sie aus der Situation zogen und welche gesundheitlichen Notfallmaßnahmen sie entwickelten, waren von enormer Tragweite. Sie bestimmten das Schicksal ganzer Bevölkerungen und prägten entscheidend die Art und Weise, wie ihre Bürger den Verlauf der Pandemie in den folgenden Jahren erlebten.
Die Virologie kann uns die speziellen Merkmale des neuen Coronavirus SARS-CoV-2 erklären, die COVID-19 so tödlich machten, und die Wirtschaftswissenschaft kann uns erklären, warum sich einige finanzielle Maßnahmen als so viel wirksamer erwiesen als andere. Soziale Faktoren, von denen einige buchstäblich auf der Straße zum Tragen kamen, andere in Regierungsgebäuden und Vorstandsetagen, spielten eine entscheidende Rolle bei der Frage, wer überlebte und wer starb, wer gut versorgt war und wer hungerte, wer deprimiert und erschöpft war und wer neue Kraft fand. Wir benötigen eine »gesellschaftliche Autopsie«, eine Untersuchung der gesellschaftlichen, politischen und institutionellen Organe, die im Jahr 2020 kollabierten, um die zugrunde liegenden Bedingungen und Traumata zu identifizieren, die diese Muster prägten. Und wir sollten untersuchen, auf welch unterschiedliche Weise ganz normale Menschen die Pandemie erlebt haben.
Das alles bietet dieses Buch, aber darüber hinaus etwas noch viel Wichtigeres. Die Zahl »2020« im Titel bezieht sich natürlich zunächst auf das Jahr der großen Umwälzungen, aber im Englischen bezeichnet der Ausdruck »2020« darüber hinaus die Fähigkeit, besonders klar und deutlich zu sehen.2 In den letzten zwei Jahrzehnten habe ich mich bei meinen Forschungen von dem Gedanken leiten lassen, dass Krisen stets außergewöhnliche Chancen bieten, und zwar nicht nur für Politiker und Unternehmen (deren Interesse daran, Katastrophen für ihre eigenen Zwecke zu instrumentalisieren, inzwischen gut dokumentiert ist), sondern auch für eine Gesellschaft als Ganzes.
Extreme Ereignisse können Gegebenheiten und Verhältnisse sichtbar machen, die immer vorhanden sind, die man sonst aber kaum wahrnimmt. Zur Bewältigung der Traumata, die eine Krise auslöst, müssen wir uns fragen, weshalb wir manche Situationen auf eine bestimmte Weise erleben, und wir müssen uns im Nachhinein eingehend damit beschäftigen, wie wir das Geschehene verarbeitet haben. 2020 war nicht nur das Jahr, in dem Schulen, Restaurants und Geschäfte schlossen, es war auch das Jahr, in dem die Welt einen Riss bekam, der vieles bislang Verborgene ans Tageslicht brachte. Ich möchte mich im Folgenden mit Themen und Erkenntnissen beschäftigen, die so viele von uns verleugnet oder gemieden oder einfach nicht wahrgenommen haben.
So unterschiedlich die Art und Weise war, wie sich COVID in einem Land, einer Region oder einem Stadtviertel ausbreitete, es gab starke gesellschaftliche Kräfte, die jeden Aspekt der Krise beeinflussten, von der Versorgung mit lebenswichtigen Gütern und zuverlässigen Informationen bis hin zur Bereitstellung von medizinischer Versorgung und Pflege. Manche Gegenden waren allen möglichen Gefahren ausgesetzt, andere sahen sich besonders gut gewappnet. Hier und da fanden Menschen zusammen, um füreinander zu sorgen; anderswo griff man zu den Waffen und bereitete sich auf einen Bürgerkrieg vor. New York City mit seinen 8,5 Millionen Einwohnern, die sich auf rund 250 Stadtteile in fünf Bezirken verteilten, erlebte das alles auf einmal, und zwar besonders intensiv: Im März 2020 wurde die Stadt zum globalen Hotspot des Coronavirus, im ganzen Jahr erkrankten und starben dort mehr Menschen an Corona als in irgendeiner anderen Stadt auf der Welt.
Letztendlich erreichte COVID-19 fast jede Stadt und jedes Dorf auf der Erde, und alle erlebten die Seuche auf ihre eigene Art und Weise. Angesichts des Ausmaßes und der Dauer der Pandemie gibt es weltweit wohl keinen einzelnen Ort, an dem man sämtliche Variationen dessen hätte beobachten können, wie mit COVID umgegangen wurde. Doch wenn man eine Stadt nennen müsste, in der es so viele verschiedene Perspektiven und eklatante Unterschiede gab, dass sie eine besonders breite Perspektive ermöglichten, dann war es New York City. In vielerlei Hinsicht war es ein furchtbares Schicksal, dass ich in New York festsaß, als Corona ausbrach. Für meine Forschung war es ein Segen.
Zu Beginn der Pandemie, als in New York City – abgesehen von den Krankenhäusern, die bald am Rande eines Kollapses waren – alles zum Stillstand kam, machte ich mich daran, die Situation in den fünf Bezirken (Brooklyn, Bronx, Manhattan, Queens und Staten Island) zu beobachten. Schnell stellte ich auffällige Unterschiede fest. Ich beschloss, in jedem Bezirk ein ausführliches Interview mit jeweils einer Person zu führen, deren Erfahrungen stellvertretend für größere Muster in der dortigen Gemeinschaft standen (siehe Anmerkungen zur Recherche). Ich sprach mit einer Grundschulleiterin, deren Viertel zu den ersten zählte, die erkannten, welche Bedrohung von dem Virus ausging; einer Beamtin in der Bronx, deren Aufgabe es war, den örtlichen Krankenhäusern zu den benötigten Ressourcen zu verhelfen und die Bürger am Leben zu erhalten; einem Barbesitzer in Staten Island, der große Probleme hatte, über die Runden zu kommen; einem pensionierten Staatsanwalt in Queens, der ein Netzwerk für gegenseitige Hilfe initiierte; einem Ehepaar in Brooklyn mit systemrelevanten Jobs, das jemanden brauchte, der sich um seine kleinen Kinder kümmerte.
Später kamen noch zwei Personen hinzu: das Kind eines Mannes, der im öffentlichen Nahverkehr arbeitete (ein »systemrelevanter Arbeitsplatz«) und der sich in den ersten Wochen der Pandemie bei der Arbeit mit Corona infizierte und starb, und ein Künstler, der sich bei den Black Lives Matter-Protesten engagierte. Beide hatten mit Problemen zu kämpfen, die für das Jahr 2020 von zentraler Bedeutung waren: Wie trauert man um einen Menschen, der sterben musste, weil die Gesellschaft einen kompletten Lockdown ablehnte? Wie setzt man sich mit der rassistischen Gewalt auseinander, die das heutige Leben so viel brutaler macht, als es sein müsste? Diese sieben biografischen Berichte aus verschiedenen Bezirken der Stadt gewähren uns nicht nur Einblicke in Erfahrungen rund um die Pandemie, die weder Statistiken noch Daten bieten können, sondern obendrein etwas, wofür sich solche Erzählungen ganz besonders eignen: Sie zeigen auf, wie Menschen in ihrem Leben einen neuen Sinn fanden, als es für sie und ihre Angehörigen buchstäblich um Leben und Tod ging.
Ich habe aber auch in einem größeren Rahmen geforscht und einige Mysterien rund um die Pandemie unter die Lupe genommen, die nach einer gründlicheren soziologischen Untersuchung verlangten. In den USA hört man zum Beispiel immer wieder, Social Distancing und Isolation seien schuld daran gewesen, dass das Land während der Pandemie so viele Konflikte erlebte, mit besonders krassen Fällen körperlicher Gewalt (wie Totschlag per Auto) und asozialen Verhaltens (wie Auseinandersetzungen in Flugzeugen), die zu einer Verrohung des Alltags in den USA führten. Die Soziologie hat eine Theorie dafür, warum es in Krisenzeiten zu einem Anstieg destruktiven Verhaltens kommt. Émile Durkheim hat den Begriff der »Anomie« geprägt, der einen Zustand fehlender sozialer Normen und Regeln infolge des gesellschaftlichen Zerfalls und des Zusammenbruchs einer gemeinsamen moralischen Ordnung bezeichnet. Die Gesellschaft, so Durkheim, hat einen tiefgreifenden Einfluss auf die individuelle Entwicklung und das kollektive Leben. Sie versorgt uns mit einer Vorstellung davon, was es eigentlich bedeutet, Mensch zu sein; sie legt die Normen, Werte, Überzeugungen und Routinen fest, die uns zu dem machen, was wir sind; sie teilt uns in kulturelle Gruppen und moralische Gemeinschaften ein; sie veranlasst uns, Beziehungen einzugehen, und legt bürgerliche Pflichten fest; sie pflanzt uns unsere Leidenschaften und Interessen ein, aber sie reguliert sie auch, unterdrückt unsere egozentrischen Tendenzen und lenkt uns in Richtung gemeinsamer Ziele. Doch in Zeiten eines besonders rapiden gesellschaftlichen Wandels – aufgrund wirtschaftlicher Umwälzungen, einer Abkehr von der Religion, massenhafter Verstädterung oder einer Seuche – knickt die Gesellschaft ein. Dann kommen uns die gesellschaftlichen Strukturen, die uns normalerweise zusammenhalten, mit einem Mal gar nicht mehr so solide vor. Autoritäten erscheinen unzuverlässig, wir vertrauen unseren Nachbarn nicht mehr. Statt die Nähe anderer zu suchen, verkriechen wir uns zu Hause und vermeiden Interaktionen. Gegenseitige Verpflichtungen werden nicht mehr eingehalten. Wir lassen uns nur noch von unseren privaten Bedürfnissen und Wünschen leiten. Wenn Anomie herrscht, löst Narzissmus die Solidarität ab. Der gesellschaftliche Kitt schwindet.14
Es gibt Gründe genug, den Ausbruch antisozialen Verhaltens in den USA im Jahr 2020 als direkte Folge einer Anomie infolge der Corona-Pandemie zu erklären. Das Problem ist nur: Durkheims Theorie des gesellschaftlichen Zerfalls in Zeiten des Umbruchs erklärt nicht, was in fast allen anderen Ländern der Erde geschah. Auch dort wuchs die allgemeine Angst, als die Pandemie begann. Es gab umfassende Lockdowns. Das gesellschaftliche Miteinander wurde eingeschränkt. Grenzen wurden abgeriegelt. Büros wurden geschlossen. Und trotzdem verzeichnete kein anderes Land als die USA einen Rekordanstieg bei den Tötungsdelikten. Nirgendwo sonst gab es einen Anstieg tödlicher Autounfälle. Und selbstverständlich erlebte auch kein anderes Land einen sprunghaften Anstieg der Waffenverkäufe. Im Jahr 2020 erlebte die ganze Welt einen Umbruch historischen Ausmaßes, verbunden mit einer Vielzahl gesellschaftlicher Probleme. Aber keine Nation erlebte die Pandemie in ähnlicher Weise wie die USA. Woran liegt das?
Was die USA während der Krise zu einem so außergewöhnlichen Nährboden für Aggressionen machte und was anderen Ländern wie Japan half, ihre Bürger im Kampf gegen das Virus zu einen, ist eine Frage, deren Relevanz weit über die Pandemie und das Jahr 2020 hinausgeht. Dass wir nachvollziehen, wie und warum es zu diesen Entwicklungen kam, ist nach der Pandemie wichtiger denn je, denn heute steht zum ersten Mal in der jüngeren Geschichte alles auf dem Spiel. In den kommenden Jahren werden sich Nationen auf der ganzen Welt mit grundlegenden Fragen hinsichtlich ihrer Prinzipien und Ziele auseinandersetzen müssen: Wählen wir die Demokratie oder den Despotismus? Wie lässt sich individuelle Freiheit mit dem Gemeinwohl in Einklang bringen? Was unternehmen wir gegen die immer schlimmer werdende Klimakrise? Wie können wir Rassismus bekämpfen? Werden wir mit der nächsten Bedrohung besonnener umgehen, oder steuern wir unaufhaltsam auf etwas zu, das weitaus katastrophaler ist als das, was wir gerade hinter uns haben?
Wenn uns die Corona-Pandemie eines gelehrt hat, dann dass wir schlauer sein müssen als die Katastrophe; dass wir die Entschlusskraft benötigen, (scheinbar) weit entfernte Bedrohungen, mit denen wir uns konfrontiert sehen, rechtzeitig anzupacken, bevor es zu spät ist.
Kapitel 1
»Es war eine Schlacht«
Zu Beginn des Jahres 2020 machte der Kalender vielen einen Strich durch die Rechnung. In Jahren, in denen der 1. Januar an einem Donnerstag oder Freitag lag, wurden die Schulferien in New York meist noch über das folgende Wochenende ausgedehnt. Ein paar Tage mehr zum Entspannen nach Neujahr. Diesmal fiel der 1. Januar aber auf einen Mittwoch, und das New York City Department of Education beschloss, dass die Weihnachtsferien, die am 24. Dezember begonnen hatten, direkt am 1. Januar enden würden. Am Donnerstag mussten die 150000 Mitarbeiter des größten öffentlichen Schulsystems der USA und die fast 1,1 Millionen New Yorker Schüler, von denen mehr als 100000 obdachlos waren, wieder zur Schule. Aber so ist das halt in manchen Jahren.
May Lee, Schulleiterin der Grundschule P.S. 42 in Chinatown in Manhattan, war nicht gerade begeistert, dass sie direkt nach Neujahr schon wieder ins Büro musste, aber sie wusste, dass es für viele auch Vorteile hatte. Lee war 59 und arbeitete seit über 25 Jahren an der P.S. 42, zunächst als Lehrerin, dann als stellvertretende Schulleiterin und jetzt als Schulleiterin. Früher war sie hier selbst zur Schule gegangen, genau wie ihr Bruder, ihr Ehemann und das jüngste ihrer vier Kinder, ein Mädchen, das sie aus Äthiopien adoptiert haben, weil ihre Familie noch Liebe übrig hatte. Lee ist ein Kind chinesischer Einwanderer und beschreibt sich selbst als »streitlustig und widerborstig«, als »Kämpferin«, die sich »voll und ganz für meine Familien [so bezeichnet sie alle, die Schüler an der P.S. 42 haben] und meine Kinder« einsetzt. Sie hat gewelltes schwarzes Haar, manchmal mit blonden Strähnen, mehrere Piercings und im Nacken das Wort »Grace« (»Gnade«) tätowiert. »Meine Mutter war sehr liberal und sehr aggressiv«, erzählt Lee mit einem breiten New Yorker Dialekt. »Sie hat mir beigebracht, dass ich mir von niemandem etwas gefallen lassen darf. Sie hat mir beigebracht zu kämpfen.«
Als Kind der Lower East Side, einem der am dichtesten besiedelten urbanen Gebiete Nordamerikas, wuchs Lee nur wenige Häuserblocks von dem riesigen Backsteingebäude entfernt auf, bei dem an jedem Schultag rund 550 Schüler fünf Betonstufen hinaufsteigen, durch drei riesige Doppeltüren gehen und sich auf etwa sechzig Klassenzimmer verteilen. Sie wohnt in einem großen Mehrgenerationenhaus in der Forsyth Street, das sie, ihr Mann und die Familie ihres Bruders zusammen mit ihren Eltern 1999 gekauft haben.15 Dort teilen sie alles miteinander: Essen, Platz, Kinderbetreuung, Gefühle … wirklich alles. In Chinatown leben viele Tausend Einwandererfamilien gemeinsam mit ihren Freunden, Kollegen oder Verwandten in kleinen Wohnungen, oft teilen sich mehrere Personen ein Zimmer, Erwachsene, die je nach Schicht im Restaurant oder der Fabrik ein und aus gehen. »In einer einzigen Wohnung wohnen manchmal drei Parteien«, so Lee. »Viele meiner Familien wohnen mit ein, zwei weiteren Familien zusammen, teilen sich eine Küche und ein Badezimmer. Die Welt der Kinder ist das Etagenbett.«
Als Schulleiterin und langjährige Bewohnerin von Chinatown weiß Lee nur zu gut, wie in solchen Familien die Schulferien aussehen. Es fängt nett an: ein schönes Essen, ein Film, ein Videoanruf bei Freunden oder Verwandten in China, ein Ausflug in die Bibliothek oder den Park. Dann kommt der zweite Ferientag. Die Erwachsenen müssen wieder zur Arbeit, die Großeltern brauchen Ruhe. Die Kinder wollen fernsehen, telefonieren oder Videospiele spielen, aber es gibt nicht genug Geräte. Es gibt Streit. In der Wohnung wird es unerträglich laut. Dann muss auch noch der Abwasch erledigt werden, und die Ferien haben gerade erst angefangen. Ende Dezember brauchen alle Urlaub, aber spätestens am 2. Januar haben die Erwachsenen genug vom Gebrüll der Kinder. Zum Glück sorgt die Stadt dafür, dass sie wieder zur Schule müssen.
Insofern bietet die P.S. 42 nicht nur den Familien, die ihre Kinder dort hinschicken, Erleichterung, sondern auch all den Menschen, die mit ihnen zusammenwohnen und nicht mit ihnen verwandt sind. Die Schule ist in erster Linie dazu da, junge Menschen auszubilden, und das gelingt der P.S. 42 so gut, dass sie bei den Leistungstests der Stadt immer ganz oben rangiert, obwohl etwa 60 Prozent der Schüler aus armen Familien kommen und 70 Prozent Eltern haben, die wenig bis gar kein Englisch können. »Aber das ist längst nicht alles, was die Kinder hierherbringt«, erzählte mir Lee. Die meisten Schüler der P.S. 42 sind darauf angewiesen, dass die Schule sie mit Frühstück, Mittagessen und einem Snack nach der Schule versorgt. Hier gibt es kostenlos Musikunterricht, Fußballtraining, man kann lesen, malen, werken, das Internet nutzen. Jahrelang hat Lee dafür gesorgt, dass der YMCA ihren Schülern Schwimmunterricht anbietet – wie sollten sie sonst schwimmen lernen? »Ich tue alles, damit diese Kinder genauso aufwachsen können wie meine eigenen«, so Lee. »Ich mache den Kollegen klar, dass wir Dienst an der Gemeinschaft leisten. Für viele unserer Familien ist der Lehrer die Sonne, der Mond und Gott. Wir müssen uns um sie kümmern, das ist unsere Aufgabe.«
In New York begann das neue Jahr ohne größere Dramen. Für Unruhe sorgte höchstens das Wetter, das viel zu mild für die Jahreszeit war. 18 °C mitten im Januar? Das musste ein schlechtes Omen sein! Aber es brachte mit sich, dass die Straßen voller Menschen waren. Die Spielplätze voller Kinder. Die Restaurants überfüllt. New York City war voller Leben. Doch schon bald hörte Lee von einer ganz anderen, viel schwerer wiegenden Sorge, die ihre Familien umtrieb, von denen mehr als 80 Prozent asiatischer – vor allem chinesischer – Abstammung waren: Deren Verwandte in China berichteten von einem tödlichen neuen Virus, das sich offenbar in Wuhan in der Provinz Hubei ausbreitete. Die dicht bevölkerte Stadt Wuhan mit ihren rund elf Millionen Einwohnern war ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt in China. Das war kein ganz unwichtiges Detail, denn am 10. Januar begann das chinesische Neujahrsfest, das die Chinesen traditionell damit begehen, dass sie verreisen – zu Freunden, Verwandten oder touristischen Zielen im ganzen Land. Laut Berechnungen der Regierung werden während des vierzigtägigen Festes alles in allem etwa drei Milliarden Reisen unternommen, was das chinesische Neujahrsfest zum größten alljährlichen Migrationsereignis der Welt macht. Anfangs, so erinnerte sich Lee, war niemandem so richtig klar, was man von den Geschichten zu halten hatte; was Gerüchte waren und was Fakten. Es gab nicht viele offizielle Nachrichten aus China, und den Aussagen der Regierung konnte man nicht unbedingt trauen. Sie wusste noch genau, wie die chinesische Gesundheitsbehörde im Jahr 2003 den Ausbruch von SARS vertuscht hatte, einer Atemwegserkrankung, die durch ein neuartiges Coronavirus verursacht wurde und an der fast jeder zehnte Erkrankte starb, bei den über Sechzigjährigen sogar mehr als die Hälfte. Damals beharrte die chinesische Regierung monatelang darauf, dass es kaum Fälle gäbe und die Situation »unter Kontrolle« sei. Erst später räumte sie ein, dass es allein in China mehr als fünftausend Fälle gegeben hatte und dass es der Regierung nicht gelungen war, die Ausbreitung des Virus auf andere Länder zu verhindern.16 Als die Wahrheit ans Licht kam, versuchten die nationalen Behörden, ihr Gesicht zu wahren, indem sie den Gesundheitsminister und den Bürgermeister von Beijing entließen, doch das trug wenig dazu bei, Chinas Ruf in der internationalen Gemeinschaft wiederherzustellen, erst recht nicht bei chinesischstämmigen US-Amerikanern in Städten wie New York. Dort nahm man aus dem SARS-Debakel vor allem eine Lektion mit: Wenn du von einem tödlichen Virus erfährst, hör genau hin, was die Regierung sagt, und geh davon aus, dass die Situation viel schlimmer ist, als die Regierung zugibt. Schütze dich und deine Familie. Vertraue niemandem außer deiner Familie und deinen Freunden.
Am 31. Dezember 2019 meldete die chinesische Regierung der Weltgesundheitsorganisation WHO erstmals offiziell eine Lungenentzündung unbekannter Ätiologie und bestätigte mehrere Dutzend Fälle dieser Erkrankung in Wuhan. Heute gehen Wissenschaftler davon aus, dass ein neuartiges Coronavirus ab Oktober oder, was wahrscheinlicher ist, ab November 2019 in China erstmals Menschen infizierte. Im Laufe des Dezembers stieg die Zahl der Patienten, die wegen »grippeähnlicher Symptome« in Krankenhäuser in der Region Wuhan eingeliefert wurden, sprunghaft an.17 Wie wir heute wissen, wurden ab 15. Dezember in der chinesischen Social-Media-App WeChat extrem häufig die chinesischen Wörter für SARS und Lungenentzündung verwendet.18 Im Januar, als auch andere Länder ihre ersten Fälle meldeten, wurden diese Begriffe von einem anderen abgelöst: COVID-19.
Die Entfernung zwischen Wuhan und New York City beträgt gut 12000 Kilometer, aber eine WeChat-Nachricht zwischen Freunden und Verwandten braucht für diese Distanz nur eine Sekunde. May Lee kann sich nicht genau erinnern, ob ihre Familien schon im Dezember darüber sprachen, dass vielleicht SARS oder ein neues Coronavirus ausgebrochen war, aber Ende Januar war die allgemeine Angst spürbar, und im Februar brachte sie bereits den Schulalltag durcheinander. »Meine Familien sind alle auf WeChat«, so Lee. »Tag für Tag erfuhren sie von ihren eigenen Familien, wie sie in China litten, und erhielten eine Menge verrückter Nachrichten. Sie erzählten, wie schlimm die Lage in China sei und dass es hier bei uns genauso schlimm werden würde. Sie wussten Bescheid, und sie deckten sich mit Desinfektionsmittel, Taschentüchern, Masken und Einweghandschuhen ein. Sie bereiteten sich auf den Ernstfall vor! Sie horteten Instantnudeln. Alles, was man sich vorstellen kann. Und sie drängten mich immer wieder, eine Schulversammlung abzuhalten. Sie wollten wissen, was wir zu tun gedachten.«
Lee wollte sich bei der Stadtverwaltung informieren, bei den Behörden des Staates New York, beim Weißen Haus, bei den Medien. Nirgends konnte man ihr weiterhelfen: »Ich weiß noch, dass es immer hieß: ›Na ja, könnte sein, dass das herkommt, aber das kriegen wir schon unter Kontrolle.‹« Ihre Familien kauften den Behörden das nicht ab. Sie würden sicher nicht darauf warten, dass die US-Politik eine Vorstellung entwickelte, wie sie die Lage in den Griff bekommen könnte. »Immer mehr Familien nahmen ihre Kinder aus der Schule«, so Lee. »Zuerst waren es nur meine asiatischen Familien, aber dann wurden auch die anderen unruhig. Einer unserer Lehrer kam von einer Asienreise zurück. Einige unserer Familien saßen dort fest. Und die nichtasiatischen Familien hatten viel weniger Informationen. Die flippten aus!«
Ende Februar fand sich eine Gruppe von Eltern zusammen, die Lee drängten, die P.S. 42 komplett zu schließen. »Sie wussten, was in China vor sich ging, und fragten mich: ›Warum ist die Schule überhaupt noch auf?‹ Ich konnte ihnen nur sagen, dass ich das nicht zu entscheiden hatte, sondern die Schulbehörde.« Als immer mehr Familien ihre Kinder vom Unterricht abmeldeten, machte sich Lee Sorgen um die Anwesenheitsstatistik ihrer Schule. Wie es der Zufall wollte, führte die Stadt gerade an der P.S. 42 ihre alljährliche Qualitätskontrolle durch, für Mitte März war eine persönliche Inspektion vorgesehen. Normalerweise musste sich Lee um die Fehlzeiten ihrer Schüler keine Sorgen machen, doch jetzt braute sich eine veritable Krise zusammen, und zwar nicht nur für die Schule. »Die Fehlzeiten sind in New York City ein sehr wichtiger Faktor, wenn es darum geht, welche Mittelschule man besuchen darf«, berichtete sie mir. Hatten ihre Viertklässler zu viele Fehlstunden, würden die besseren öffentlichen Schulen sie automatisch ablehnen. Um das zu verhindern, musste sie dafür sorgen, dass Eltern ihre Kinder nicht einfach nur zu Hause behielten, sondern sie als krank meldeten. Trotzdem hätte sie der Schulbehörde erklären müssen, warum so viele ihrer Schüler nicht zum Unterricht erschienen.
Anfang März, so Lee, »war mir klar, dass bald Chaos herrschen würde«. Sie war hin- und hergerissen zwischen ihrer Unterstützung der Familien, die Angst hatten, ihre Kinder könnten sich mit COVID anstecken und die Krankheit mit nach Hause bringen, und ihren Anstrengungen, die Schule durch die behördliche Qualitätsprüfung zu steuern. »Einige Kinder waren tatsächlich krank«, erinnerte sie sich. »Die hatten wahrscheinlich COVID, aber niemand wusste es, weil es zu diesem Zeitpunkt noch keine Schnelltests gab.« Es gab Gerüchte, dass auch die Eltern, Tanten und Onkel krank wurden. »Da wurde mir klar, dass wir wahrscheinlich die Schulen schließen würden.« Doch genau zu dem Zeitpunkt sah Lee Bürgermeister Bill de Blasio im Fernsehen. »Er sagte: ›Machen Sie sich keine Sorgen! Gehen Sie ins Theater. Gehen Sie ins Restaurant. Gehen Sie ins Kino.‹« Sie war skeptisch. Restaurant? Kino? Ihre Familien trugen OP-Masken und hamsterten Lebensmittel.
In der Öffentlichkeit sahen sie sich immer mehr Anfeindungen ausgesetzt. Rassistische Ressentiments entluden sich in zum Teil gewalttätigen Übergriffen. Die Leute bekamen Angst vor dem gefährlichen neuen Virus, und immer öfter beschuldigten sie Chinesen und chinesischstämmige Mitbürger, es zu verbreiten. Prominente Konservative, darunter die Moderatoren bekannter rechtsgerichteter Nachrichtensendungen und hochrangige Beamte der Trump-Administration, förderten ganz unverhohlen diese Ressentiments. Am 7. März trat Außenminister Mike Pompeo auf Fox News auf und warnte vor einer diplomatischen Krise im Zusammenhang mit dem »China-Virus«. Am nächsten Tag verkündete der Kongressabgeordnete Paul Gosar, ein für seine rechtsextremen Positionen bekannter Republikaner aus Arizona, dass er sich in Quarantäne begeben werde, da er sich mit dem »Wuhan-Virus« infiziert habe.19 Mitte März setzte Präsident Trump selbst diese Rhetorik ein und widersetzte sich damit den Aufforderungen der Weltgesundheitsorganisation, das Virus nicht mit einem bestimmten Volk oder einem Land in Verbindung zu bringen, was im Jahr 2020 wie bei früheren Viruserkrankungen mit Sicherheit zu Stigmatisierung, Diskriminierung und rassistischen Übergriffen führen würde. Auf Twitter, bei Kundgebungen und auf Pressekonferenzen bezeichnete Trump SARS-CoV-2 routinemäßig als »chinesisches Virus« oder »China-Virus«, und er forderte alle in seinem Umfeld auf, dies ebenfalls zu tun.
»Wir hatten in Chinatown schon immer mit Rassismus zu kämpfen«, so Lee. »Junge Leute kommen hier nachts in die Bars und beleidigen unsere älteren Mitbürger. Gruppen von Obdachlosen rufen antiasiatische Beleidigungen, weil sie das witzig finden.« Manchmal entlud sich der Hass auch in handgreiflichen Auseinandersetzungen. Seit vielen Jahren waren Asiaten in der Lower East Side die Opfer von Messerstechereien und Überfällen, ihre Kinder wurden regelmäßig angepöbelt und beschimpft. Zwar waren Hassverbrechen gegen Asiaten in den ersten beiden Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts drastisch zurückgegangen, wie Daten des FBI belegen,20 doch der März 2020 markierte in New York wie im Rest der USA auch in dieser Hinsicht einen Wendepunkt. Ab dem Moment, da die US-Amerikaner COVID-19 mit Chinesen in Verbindung brachten, stieg die Gewalt gegen die asiatischen Mitbürger sprunghaft an.
Ihre erste Begegnung mit rassistischen Anfeindungen im Zusammenhang mit dem neuen Virus hatte Lee bereits im Februar, als sie auf dem Weg zur Arbeit in einen Zeitschriftenladen in der Mulberry Street ging. »Da bin ich jeden Morgen«, sagte sie mir. »Aber an diesem Tag kommt eine Schwarze Frau, die auf einer Baustelle arbeitet, herein und murmelt: ›Oh, Scheiße, die sind überall.‹ Zuerst verstand ich gar nicht, was sie meinte, aber dann wurde mir klar: Sie meinte mich!« Doch da war die Frau an die Falsche geraten. »Ich verfolgte sie durch den Laden und filmte das mit meinem Handy. Sie konnte mir nicht entkommen. Ich fand den Namen der Baufirma heraus, und denen sagte ich: ›Ich habe ein Video davon, wie ich von einer Ihrer Angestellten verbal attackiert werde. Wenn sie keine Asiaten um sich herum haben will, was tut sie dann in Chinatown? Entweder Sie entfernen sie von der Baustelle, oder ich poste das hier.‹«
Als Lee an diesem Morgen in der P.S. 42 eintraf, wurde ihr klar, dass der Vorfall Implikationen mit sich brachte, die weit über das Verhalten einer Bauarbeiterin oder ihr eigenes Gefühl der Empörung hinausgingen. Sie musste sich Gedanken machen, was dieser Vorfall für die Schulgemeinschaft bedeutete. »Ich berichtete meiner Familie und anderen Schulleitern von dem verbalen Übergriff im Zeitungsladen. Und hier ist mein Dilemma: Wie kann ich draußen auf der Straße meine asiatischen Kinder schützen – und meine nichtasiatischen Kinder, die zufällig mit asiatischen Kindern zusammen unterwegs sind? Wie kann ich in meiner Gemeinde für Sicherheit sorgen?« Zum ersten Mal in ihrer Laufbahn beschloss sie, alle Schulausflüge abzusagen, alles, was beinhaltete, dass die Schüler irgendwo hingefahren werden mussten oder sich allzu weit vom Schulgebäude entfernten. Das war keine leichte Entscheidung, wie Lee erklärt. Gemeinsame Ausflüge und Aktivitäten außerhalb des Schulgeländes waren seit jeher ein wichtiges Element des Miteinanders an der P.S. 42. Aber die Umgebung, selbst dort in der New Yorker Lower East Side, fühlte sich so toxisch an, dass Lee fürchtete, »dass ich die Menschen, die unter meiner Aufsicht stehen, da draußen nicht schützen kann«.
In der zweiten Märzwoche kamen Schulbezirke in anderen Teilen der Vereinigten Staaten ebenfalls zu der Erkenntnis, dass es so nicht weitergehen konnte – nicht wegen der rassistischen Übergriffe, sondern weil sie wussten, dass sich das Virus schnell ausbreitete, und befürchteten, dass Schulen zu Superspreading-Orten der tödlichen Krankheit werden könnten. Im Bundesstaat Washington, wo am 21. Januar der erste COVID-19-Fall in den USA auftrat, stellte der Bezirk Northshore am 5. März für alle 24000 Schüler den Präsenzunterricht ein und stellte auf Online-Unterricht um. Am 12. März ordnete dann auch Seattle, der größte Schulbezirk des Bundesstaats, die Schließung aller öffentlichen Schulen an. Es war keine leichte Entscheidung, denn die Verantwortlichen wussten genau, wie sehr Familien vor Ort von den öffentlichen Schulen abhängig waren und dass deren Schließung Auswirkungen auf alle Familien und auch auf die Wirtschaft der Stadt haben würde. Es ist pervers, dass in einer Stadt, in der der Graben zwischen Arm und Reich ohnehin schon groß war, die Ungleichheit dadurch noch vergrößert wurde. »Wir wissen, dass die Schließung unserer Schulen Auswirkungen auf unsere schwächsten Familien haben wird, und wir sind uns bewusst, dass berufstätige Familien auf die Kohärenz und Vorhersehbarkeit dessen, was unsere Schulen ihnen an Unterstützung und Dienstleistungen bieten, angewiesen sind«, schrieb das Amt für öffentliche Angelegenheiten. Dennoch sei die Schließung »ein wirksames Mittel zur Unterbrechung weiterer Ansteckungen« und daher eine »notwendige Maßnahme«.21
Die New Yorker Behörden wollten von Schulschließungen zunächst nichts wissen, auch dann noch nicht, als die Fallzahlen in der Stadt bereits in die Höhe schnellten. Die größte Leistung von Bill de Blasio als Bürgermeister war die Einführung einer allgemeinen Vorschulbildung in New York City, eine Maßnahme, die nicht nur auf pädagogischen Überlegungen fußte, sondern die ganz konkret die Lebenssituation einkommensschwacher berufstätiger Eltern verbessern sollte. Am 12. März, dem Tag, an dem Seattle die Schließung aller seiner Schulen anordnete, kündigte de Blasio an, für New York City sei das undenkbar: »Wir werden unser Bestes tun, um die Schulen offen zu halten«, erklärte er. »Dort sind unsere Kinder tagsüber in Sicherheit, und viele Eltern haben keine Alternative. Dort bekommen unsere Kinder – viele Kinder ihr Essen. Die Schulen sind der Dreh- und Angelpunkt für viele Leute, die zur Arbeit müssen, und dort sind ihre Kinder gut aufgehoben. Viele haben gar keine andere Wahl.«22
Es dauerte nur ein paar Tage, bis er zurückrudern musste: Am Sonntag, den 15. März, räumte de Blasio ein, dass es zu gefährlich sei, die Schulen offen zu halten – ab dem folgenden Tag würden sie geschlossen bleiben und am 20. April wieder öffnen, vielleicht aber auch erst später. »Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass ich das einmal würde anordnen müssen«, sagte er in einer Pressekonferenz, nach der ein Reporter ihn als »sichtlich niedergeschlagen« beschrieb.23 Die Schulkantinen würden noch einige Tage länger geöffnet bleiben, damit die 700000 Kinder, die auf kostenlose oder subventionierte Mahlzeiten angewiesen seien, diese weiterhin erhielten. Danach, so der Bürgermeister, werde die Stadt »alternative Standorte« für die Essensversorgung einrichten, aber niemand wusste so recht, wo sich diese befinden würden oder wie das Ganze ablaufen sollte.
Und da war noch etwas, wovon niemand wusste, wie und ob es überhaupt funktionieren würde: der Unterricht. Ab dem 23. März sollten alle Schüler online unterrichtet werden. Sie sollten zu Hause vor einer Webcam sitzen, viele von ihnen in überfüllten Wohnungen, wo es chaotisch zuging, und Lehrern lauschen, die ebenfalls zu Hause saßen, viele in ähnlich beengten Verhältnissen und mit eigenen Kindern und anderen Familienmitgliedern in der Wohnung.