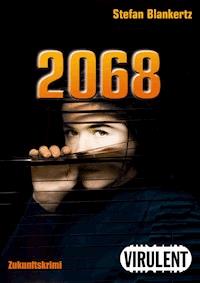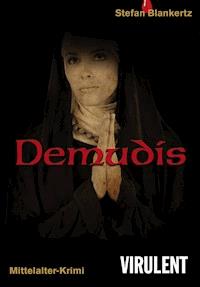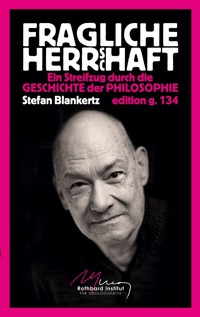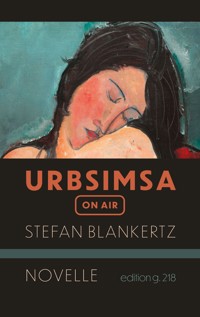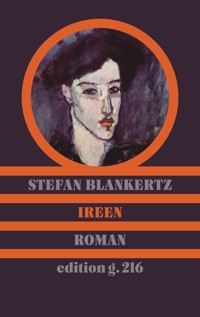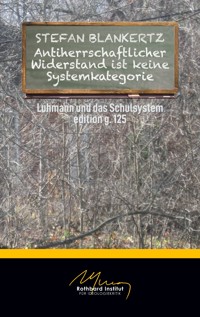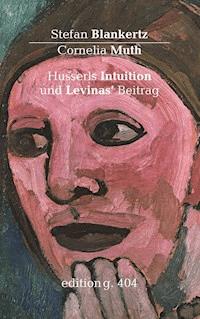Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Virulent
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Zukunftkrimis
- Sprache: Deutsch
Im Namen der Gesundheit kontrollieren die Behörden die Menschen von der Wiege bis zur Bahre. Abweichungen von der Norm duldet man nicht. Erregung, Leidenschaft und Spontaneität werden mit Pillen auf Mittelmaß getrimmt. Penelope, eine junge Studentin, versucht mit ein paar Gleichgesinnten, Widerstand zu leisten. Als ein behinderter junger Mann in einem Pflegeheim stirbt, macht sie den Leiter verantwortlich und greift zur Waffe. Doch wie ist Widerstand in totaler Überwachung möglich? Mehr und mehr entgleitet Penelope die Kontrolle über ihr Handeln. Hilflos muss sie mit ansehen, wie sie zum Spielball fremder Interessen wird. Ein mörderischer Wettlauf gegen die Zeit beginnt, am dessen Ende sie die bittere Wahrheit erfahren muss …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan Blankertz
2077DEUTSCHER HERBST
Ein Zukunftsthriller
IMPRESSUM
Virulent ist ein Imprintwww.facebook.de/virulenz
ABW Wissenschaftsverlag GmbHAltensteinstraße 4214195 BerlinDeutschland
www.abw-verlag.de
© E-Book: 2014 ABW Wissenschaftsverlag GmbH
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom 9. September 1965 in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
ISBN 978-3-86474-091-6
Produced in Germany
E-Book-Produktion: ABW Wissenschaftsverlag mit bookformer, BerlinUmschlaggestaltung: brandnewdesign, HamburgTitelabbildung: istockphoto (korionov)
P110085
Inhalt
Vorbemerkung
1. Das Massaker
2. Kapitel
3. Vielleicht
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Die Auseinandersetzung
9. Kapitel
10. Natürlich
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Das Entsetzen
17. Erklärt
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Die Widersprüche
26. Kapitel
27. Untergründig
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Die Nacht
31. Kapitel
32. Gesprengt
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Der Plan
41. Kapitel
42. Mitgenommen
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Die Falle
51. Euskal
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Die Entscheidung
58. Kapitel
59. Lebewohl
60. Kapitel
61. Kapitel
Kleines Chineutsch-Lexikon
«In der verabsolutierten Praxis reagiert man nur und darum falsch.»Theodor W. Adorno
VORBEMERKUNG
Nach der Großen Chinesischen Wende von 2048 wurden Anglismen ausgemerzt. Stattdessen hielten chinesische Lehnworte Einzug, das sogenannte «Chineutsch». Zum besseren Verständnis finden heutige Leserinnen und Leser im Anhang ein kleines Chineutsch-Lexikon. (Die 2068 entstandene Subkultur der «Schangsen» und «Juschangsen», der Alten und Entmündigten des Widerstandes und ihrer jugendlichen Sympathisanten, belebten die Anglismen allerdings teilweise wieder.)
Das Gerät, das seit den 2050er Jahren sowohl das private als auch das öffentliche Leben beherrscht, ist das «Zwanjang». Es wird wie eine Armbanduhr am Handgelenk getragen oder ist «zipi» (implantiert). Das Zwanjang übernimmt viele wichtige Funktionen:
Es überwacht die «Weischingheit» (Gesundheit) der Person, die es trägt. Bei gesundheitsschädlichem Verhalten wird der Träger gewarnt. Falls er sein Verhalten nicht ändert, bekommt er je nach Schwere «Bing»-Strafpunkte. Diese werden auf einem persönlichen Konto gesammelt. Wer mehr als 250.000 Bing-Strafpunkte erhalten hat, ist «Bingo» und wird entmündigt.
Das Zwanjang ersetzt auch das Bargeld. Alles «Guthaben» (Geld), über das jemand verfügen kann, wird im Zwanjang verwaltet. Bargeld ist verboten. Die Entmündigung geschieht durch Sperrung der Möglichkeit, mit dem Zwanjang zu zahlen. Einer entmündigten Person bleibt dann nichts, als sich an eine der zur Verfügung stehenden Institutionen zu wenden, in der sie versorgt wird. Die Subkultur der «Schangsen» (Alten) hat allerdings einen 2076 für illegal erklärten Bargeldersatz (die sogenannten «Edgars») geschaffen, mit dessen Hilfe manche Waren unter Umgehung des Zwangjans gehandelt werden können.
Mit dem Zwanjang lässt sich darüber hinaus telefonieren («zwanjangnieren»). Wahlen und politische Abstimmungen finden ebenfalls per Zwanjang statt. Schließlich dient das Zwanjang der persönlichen Identifizierung und damit der öffentlichen Sicherheit. Dass mit dem Zwanjang zudem abgehört werden kann, nehmen unter der Hand zwar viele an, wird von offizieller Seite aus jedoch abgestritten.
1. DAS MASSAKER
In den frühen Morgenstunden des 14. Septembers 2077 beendete ein Dröhnen die Ruhe in dem 20.000-Seelen-Städtchen Llodio, oder wie die Basken es schreiben: Laudio.
«Das Geräusch weckte mich; ich habe einen leichten Schlaf, müssen Sie wissen. Die Müllabfuhr konnte es nicht sein, dachte ich; war nicht ihr Tag. Ich sah aus dem Fenster. Wie ein übergroßes schwarzes Insekt senkte sich der Hubschrauber auf die wilde Wiese an der Ostseite von der Calle Goikoplaza. Zuerst meinte ich, dass ich noch träume. Kaum hatten die Kufen des Ungetüms den Boden berührt, quoll eine Handvoll vermummter Personen aus der bereits geöffneten Luke und stürmte über die Straße. Nur die Augen, die Schlitzaugen, waren zu erkennen! Ich weckte meine Frau Edurne, die einen gesegneten Schlaf hat … hatte, und dann unsere Enkeltochter; sie hatte sich gerade erst von ihrem Mann getrennt, einem Verräter, müssen Sie wissen, und wohnte vorübergehend bei uns. Und das, wo sie doch wieder schwanger war! Gott sei Dank, kann ich heute nur sagen, dass ihre beiden Älteren beim Schüleraustausch in China waren. China! Wie unglaublich! Ich fasse es nicht … Was für ein böser Spott, den sich der Allmächtige da mit uns erlaubt!
Wir hörten Schüsse und kauerten uns zusammen. Die Scheiben des Schlafzimmers splitterten. ‹Alle müssen hier raus!›, schrie ich geistesgegenwärtig. Auch verletzte und in Panik geratene Nachbarn liefen kreischend und wild gestikulierend auf die Straße. Die Bewaffneten feuerten weiter. Sie hatten definitiv keine Uniformen an. Wir versuchten, uns in Sicherheit zu bringen. Mit der rechten Hand führte ich meine liebe Frau. Sie sieht … sah nicht mehr gut, müssen Sie wissen, und wir bekamen nie die Einwilligung des ärztlichen Kontrollrates zu einer Operation, die ihr das Augenlicht zurückgegeben hätte. Und jetzt ist es zu spät! Ich darf gar nicht daran denken … Meine Enkelin krallte sich an meiner Schlafanzugjacke fest und tippelte hinter uns her.
Dann tat es einen riesigen Schlag. Wir wurden umgeworfen. Ein Wunder, dass wir uns die alten Knochen nicht brachen! Steine und brennende Balken folgen durch die Luft. Ich war, ohne nachzudenken, in südwestlicher Richtung die Goikoplaza runtergelaufen, und das stellte sich jetzt als unsere Rettung heraus. Wir konnten zur Baumgruppe an der Ecke robben und uns dort so gut es ging verkriechen.
Die Wucht der Explosion hatte mehrere Häuser in der Nachbarschaft abgedeckt. Der Helikopter war durch die Luft geschleudert worden und zerschellte nun auf der Erde. Überall lagen zerfetzte Leichen und trieben den Nervon hinab; Menschen mit abgerissenen Gliedmaßen, unsere Leute ebenso wie Angreifer, brüllten in fürchterlichem Todeskampf. Das war zu viel! Das ist zu viel! Ich halte das im Kopf nicht aus! Ich sehe es wieder vor meinen Augen. Ich sehe das jede Nacht im Traum. Jeden Tag! Überall Blut, grausige Verwüstung. So etwas Fürchterliches habe ich noch nie miterlebt, müssen Sie wissen … Meine Frau wollte einen Schrei loslassen. Das spürte ich, bevor etwas zu hören war. Ich hielt ihr den Mund zu, damit sie den Mördern nicht verriet, wo wir waren, und blickte mich um. Wollte mich überzeugen, dass unsere Enkeltochter unversehrt war. War sie, Gott sei Dank. Was jetzt? Was als Nächstes? Konnte es noch schlimmer kommen? Ja, es konnte. Aber zuerst, da machte es einen ganz guten Eindruck, wenn ich das so sagen darf. Ich hörte Sirenen von Kranken- und Notarztwagen und sah, wie Rettungshubschrauber im Anflug waren. Wenigstens das, beruhigte ich mich. Denn ich wusste ja nicht, was noch kommen würde! Ich versuchte, einen Rettungshubschrauber auf uns aufmerksam zu machen und ihn heranzuwinken, wegen unserer Enkeltochter, ich sorgte mich um das Ungeborene, das sie unter dem Herzen trug. Meine Absicht war, dass man sie wegfliegt, damit ihm nichts geschehen würde. Nur daran konnte ich denken.
Das Rasseln der Ketten überhörte ich zunächst; oder nein, es gab da ein Geräusch, ich wusste aber nicht, was es zu bedeuten hatte, bis ich sah, wie die Panzer die Calle de Nerbión runterrollten. Panzer mit der roten chinesischen Fahne der Besatzer! Auch von unten, der Calle de las 3 Cruces, kamen chinesische Panzer rauf. Sie feuerten unaufhörlich auf die Häusergruppe. Die stand doch schon in Flammen! Zudem ballerten sie wie blöd auf die Hilfsfahrzeuge und drohten den Rettungshubschraubern mit Abschuss, falls die sich nähern würden.
Hinter den Panzern kamen Mannschaftsfahrzeuge. Die schlitzäugigen Soldaten stürmen raus und trieben unsere Leute vor sich her. Die ganze Stadt wimmelte nur so von Bewaffneten. Auch meine Frau, meine Enkelin und ich hatten sie in unserem allzu notdürftigen Unterschlupf schnell aufgespürt. Wenn man das einen ‹Unterschlupf› nennen will, kann. Wir reihten uns in die Unsrigen ein. Jeder mit erhobenen Händen. Viele bettelten um Gnade. Alles nutzlos. Die Schergen jagten uns über die Brücke. Jeder, der überhaupt noch gehen konnte, wurde mit vorgehaltenen Waffen dazu gezwungen, mitzukommen. Um unsere Verletzten und Toten durften wir uns nicht kümmern. Ich beobachtete aber, dass einige Soldaten damit beschäftigt waren, die Verletzten und Toten unter den vermummten Angreifern abzutransportieren.
Schließlich, auf der Freifläche jenseits der A 625, wurden wir wie das Vieh im Kreis herumgeführt, und die Menge kam schließlich zum Stillstand, umringt von Bewachern. Jeden von uns identifizierte man einzeln per Zwanjang. Wer unter 58 Jahre alt war, wurde weggeschickt, Gott sei Dank auch unsere Enkeltochter. Gott sei Dank! Gott sei Dank, ist wenigstens sie mir geblieben, sie und ihr Kind; inzwischen ist es geboren und gesund. Gott sei Dank! Wir Alten wurden, müssen Sie wissen, über viele Stunden ohne Wasser, ohne Nahrung, ohne sanitäre Einrichtungen, ohne ärztliche Versorgung festgehalten. Gegen Abend hörten wir wieder die Unheil verkündenden Peitschenhiebe der Rotoren von Hubschraubern. Zwei Militärhubschrauber trafen ein. Als ich sah, dass uns Schlitzaugen aus den geöffneten Türen der Hubschrauber heraus fröhlich grölend unter Feuer nahmen, packte ich kurzentschlossen meine Frau und lief und lief und lief … lief trotz der Schüsse, die uns folgten. Ich wandte mich in nördliche Richtung auf den Altenspielplatz hin, denn es gab dort wenigstens Gebüsch, von dem ich mir etwas Deckung versprach. Wir waren … waren fast schon … fast schon über die A 625 hinweg, als die Ketten eines Panzers meine Edurne, die ich hinter mir herzog, erfassten und sie … nein ich kann das nicht sagen! … Ich setzte mich an den Straßenrand und vergrub mein Gesicht. Niemand schoss auf mich. Ich glaube, das haben sie extra gemacht. Hätten sie mich doch nur erschlossen … o grausamer, o erbarmungsloser Gott!»
Pelota de Arana, 77, Überlebender
2. KAPITEL
Das Massaker im baskischen Llodio löste weltweites Entsetzen aus. Bislang hatten zwar viele Menschen den vom chinesischen Verbündeten unterstützten Kampf des Vereinigten Alleuropas gegen die Baskische Altenbrigade, die «Euskal Zahartzaroën Brigada» (EZB), ohne Vorbehalte gutgeheißen; nun zeigten sie sich aber doch schockiert. Das chinesische Gesundheitsministerium gab bekannt, dass die feindlichen «Kongbufenzi» geplant hätten, von Llodio aus einen «mörderischen Anschlag» auf Bilbao zu starten - und dort vor allem auf den internationalen, zugegebenermaßen auch militärisch genutzten Flughafen. Als die Sicherheitskräfte ein hochgradig verdächtiges Gebäude hätten durchsuchen wollen, sei aus diesem heraus mit meiguischen Laserwaffen auf sie geschossen worden. Das Feuer der Barbaren habe man erwidert. Die Explosion allerdings sei nicht auf den Beschuss des Häuserkomplexes durch die Sicherheitskräfte zurückzuführen, sondern auf eine gezielte und beabsichtigte Zündung des dort gelagerten Sprengstoffes durch die Kongbufenzi selbst.
Unabhängige Zeugen gab es nicht.
Niemand jedoch vermochte es, die unbestreitbar bereits erfolgte Umstellung von Llodio durch Panzer der regulären chinesischen Armee und das danach veranstaltete Massaker an der älteren Bevölkerung von Llodio anders zu erklären als damit, dass es sich tatsächlich um ein von Anfang an geplantes Vorgehen gehandelt hatte. Das Massaker von Llodio ließ vergessen, dass die Baskische Altenbrigade EZB sich den Namen der «Kongbufenzi», mit dem sie offiziell nur bezeichnet wurde, der terroristischen Barbaren, in den vergangenen Jahren redlich durch grausame Überfälle verdient hatte. Vor dem Massaker vom 14. September 2077 bezeichnete kaum jemand die EZB noch als «Jujitscha», als Guerilla. Selbst der Bewegung der Schangsen und Juschangsen war es in jüngster Zeit immer schwerer gefallen, ihre Solidarität mit der «Euskal Zahartzaroën Brigada» fraglos aufrechtzuerhalten.
Für den Exzess während der - so wörtlich - «ansonsten gerechtfertigen Verfolgung von Kongbufenzi» entschuldigte sich die chinesische Gesundheitsministerin Wang Hong beim baskischen Volk, als sie schon am 16. September zu einem Krisenbesuch in den europäischen Regionen eintraf. Überall, wo sie auftrat, gab es mehr oder weniger große Demonstrationen. In Athen, Madrid, Paris und besonders in Bilbao kam es zu Zusammenstößen mit den Guttuern, bei denen weitere Tote zu beklagen waren. Nur der Besuch in Köln, der Hauptstadt der deutschen Regionen, am 17. September 2077 war vergleichsweise ruhig verlaufen, obwohl (oder gerade weil) die Guttuer alle Schangsen und vor allem Juschangsen, die auf Plakaten die deutsche Gesundheitsministerin als «China-Bitch», als «Hure» der Besatzer bezeichneten, zumindest vorübergehend inhaftierten.
«Wil mussten Llodios Schangsen velnichten», sagte Wang Hong auf der Pressekonferenz in Köln in mühsam einstudierten deutschen Worten, «um euch alle vol den Kongbufenzi und ihlel schiel unstillbalen Moldlust zu letten. Wenn Sie tlaueln wollen, lichtig tlaueln, dann heben Sie sich Ihle Tlänen auf fül die Opfel del Kongbufenzi.»
3. VIELLEICHT
Es war eine Woche nach dem Massaker von Llodio: Dienstag, 21. September 2077. Um 10 Uhr 42 glaubte ich zu sehen, wie das, was ich für die Charaktermaske von Dr. Detlef Magnus hielt, von ihm abfiel. Dr. Magnus war der Geschäftsführer der scheinbar wohlanständigen Versorgungsstelle «Zur Morgenröte» in der Vorgebirgsstraße. Jetzt aber gingen mir die Augen auf. Eine schmierige Charaktermaske hatte, so glaubte ich in diesem Moment zu erkennen, an Dr. Magnus geklebt, als sei sie seine wahre Haut. Seit ich den mickrigen und linkisch unbeholfenen Mann vor fast zehn Jahren zum ersten Mal getroffen hatte, äußerte er mir gegenüber immer wieder Zuspruch für unsere «verdienstvollen» Aktionen gegen das Heim-Elend der entmündigten und alten Schangsen sowie der behinderten Zanfeien. Nichts als Heuchelei. Endlich kam der Hanswurst zum Vorschein, der bewies, dass die privaten Einrichtungen nicht weniger willenlose Handlanger der gnadenlosen Politik des Gesundheitsministeriums waren als die öffentlichen Zanfeidalus. Kraft seiner Funktion als Geschäftsführer verwies Dr. Magnus mich des Zanfeidalus und drohte mir, die Guttuer zu holen, falls ich nicht «unverzüglich freiwillig», wie er sich ausdrückte, «sein Haus verlassen» würde. Ich hatte ihn nicht weniger als einen «Zanfeienhasser» genannt. Und das völlig zu Recht.
Ich schickte mich an, seiner Aufforderung Folge zu leisten. Tränenblind rasselte ich, kaum dass ich durch die schief im verbeulten Metallrahmen hängende wurmstichige Holztür von Dr. Magnus’ kargem Büro trat, auf dem bedrückend fensterlosen und unbeleuchteten Flur mit einem der Ärzte zusammen. Mehr als den weißen Kittel, der in der Düsternis erstrahlte wie ein Fanal, nahm ich nicht bewusst auf. Der Arzt hatte meine lautstarke Auseinandersetzung mit Dr. Magnus offenbar mitbekommen, denn er raunte mir zu: «Sie sind im Recht: Dr. Magnus hat Mark mit Jaowang ‹behandelt›.» Ich lief weiter, überwältigt von rasendem Hass, sodass ich nicht unmittelbar auf diesen alles entscheidenden Hinweis reagierte.
Entspannt saß Donna, die mich netterweise gefahren hatte, in ihrem steinalten Opel und rauchte am hinuntergelassenen Fenster. Nicht, dass ich an sich gegen ihr Rauchen etwas einzuwenden gehabt hätte. Allerdings: Wenn sie so weitermacht, ist für sie bald «Bingo». Ganz egoistisch kalkulierte ich, Donna würde nicht mehr Auto fahren dürfen, wenn sie so viele Bing-Strafpunkte gesammelt hat, dass sie entmündigt werden würde. In den letzten neun Jahren, in denen ich mehr oder weniger bei ihr wohnte, hatte ich mich um eine halbwegs weischinge Lebensführung von Donna bemüht und es tatsächlich erreicht, dass ihre Entmündigung bis auf Weiteres abgewendet werden konnte. Donna war einfach noch viel zu jung für den Bingo-Status einer Entmündigten. Bei den ganzen Anstrengungen, Donna ein Übermaß an Bing-Strafpunkten zu ersparen, hatte ich selbst sogar ein paar meiner eigenen überflüssigen Pfunde abgespeckt, was mir vorher nie gelungen war. Donna lachte mich immer aus, wenn ich mein nun fast andingiges Gewicht verschämt, jedoch auch ein wenig stolz bemerkte. Sie warf mir halb im Spaß, allerdings mit durchaus ernstem Hintergrund vor, dass ich mich auf diese Weise eigenhändig in die rechte Verfahrensweise des Gesundheitsministeriums eingliedern würde. Das war in der Tat das verfluchte System der Selbstanpassung, welches das Gesundheitsministerium mithilfe der Zwanjange und des Bing-Strafpunkte-Kontos bis zur Vollkommenheit ausgebaut hatte. Der Gedanke, Donna sei «zu jung», um zur Schangse zu werden, stellte bereits ein indirektes Zeichen für die erschütternde Tatsache dar, dass der Jugendwahn der rechten Verfahrensweise sogar tief in meinem Bewusstsein wurzelte.
Donna erwartete mich noch nicht zurück und schaute verträumt in die Gegend, ohne etwas wahrzunehmen. Als ich einstieg und die Tür ihrer sich gefährlich dem endgültigen Verwesungszustand nähernden Rostlaube zuschlug, zuckte Donna zusammen. Nachlässig schnippte sie den Zigarettenstummel aus dem hinuntergelassenen Fenster. Das Zwanjang an ihrem Handgelenk gab unbestechlich zur Kenntnis, dafür würde sie einen weiteren Bing-Strafpunkt erhalten.
«Was’n los?», brummte Donna.
Sie hatte mir nicht ins Gesicht geschaut und war also nicht vorgewarnt, wie es mir ging. Ich ließ meine Stirn auf ihre Schulter sinken und begann zu wimmern. Donnas rechte Hand griff mir in die widerspenstigen Haare und streichelte mir zunächst zögernd über den Hinterkopf.
«Mark ist tot», sagte ich leise. «Sie haben ihn umgebracht.»
4. KAPITEL
Mark war mir ans Herz gewachsen wie ein Bruder, obwohl ich als Einzelkind nicht wirklich wissen konnte, wie es ist, Geschwister zu haben. Seit fast zehn Jahren besuchte ich Mark regelmäßig. Das Gefühl der Verbundenheit hatte nicht von Anfang an bestanden. Erst waren die Besuche bei ihm im Zanfeidalu eine mehr oder weniger ziemlich saure Pflicht gewesen. Ich hatte sie von dem Schangser Edgar übernommen, meinem ersten Freund. Edgar war nur zwei Monate, nachdem wir begonnen hatten, uns zu lianen, 2068 während einer Operation gestorben; und es war herausgekommen, dass es sich bei seinem Tod um einen gesundheitspolitisch motivierten Mordanschlag des chinesischen Geheimdienstes auf ein … nein, auf das Symbol des Altenwiderstandes der Schangsen in den deutschen Regionen gehandelt hatte.
Edgar hatte mir die Aufgabe hinterlassen, mich um den lebensuntüchtigen jungen Mann zu kümmern. Bis zu seinem Tod war Edgar selbst regelmäßig bei Mark im Zanfeidalu gewesen. Damals wussten die meisten von Edgars Freunden im «ersten freien Altenkonvent» nichts von Mark und hatten keine Ahnung von dem Drama, das hinter Edgars Engagement für den zanfeien Jungen stand. Als Arzt des katholischen Widerstandes hatte Edgar in den 50er Jahren ein minderjähriges schwangeres Mädchen dabei unterstützt, der von den Gesundheitsbehörden nachdrücklich empfohlenen Abtreibung zu entgehen.
Leider wurde Mark dann schwerstzanfei geboren.
Leider hielt die junge Mutter das nicht aus.
Leider brachte sie sich um.
Das ist lange her. Als diese Geschichte 2068 im Rahmen der Ermittlungen um Edgars Tod ans Tageslicht kam, fürchtete ich anfangs, sie würde unserer Sache schaden. Weit gefehlt! Stattdessen ist Mark seinerseits zum Symbol des neuen katholischen Widerstandes gegen Zanfeienhass und Altenfeindlichkeit geworden. Doch während die anderen Leute aus dem Widerstand nichts als Maulhelden waren, befasste ich mich mit Mark, denn das Andenken von Edgar war und ist mir immer noch heilig. Die regelmäßigen und ausgedehnten Besuche bei Mark stellten praktische Nächstenliebe dar. Nächstenliebe sollte, wie wir alle im Widerstand übereinstimmend forderten, die herrschende «rechte Verfahrensweise» und ihre entmenschlichte, technisch ausgerichtete Rundumversorgung «im Namen der Weischingheit» ablösen.
Marks Familie verfügte sinnfulicherweise über einiges Guthaben, namentlich sein Onkel, der Bingdalu-Arzt Dr. Franz Kurzweil. Er kümmerte sich nicht persönlich um Mark. Das war mir insofern sehr lieb, als Edgar seinerzeit unter der Hand von Dr. Kurzweil gestorben war. Der anfängliche Verdacht, Dr. Kurzweil habe Edgar in einem Anfall später Rache für den Suizid seiner Schwester ermordet, bestätigte sich zwar nicht; einer Begegnung mit diesem Mann wollte ich aber lieber aus dem Wege gehen. Immerhin, nur weil Dr. Kurzweil für Mark zahlte, konnte Mark in der «Morgenröte» untergebracht werden, einer teuren privaten Versorgungsstelle für Zanfeie. Hier war er nicht wie in einem öffentlichen Zanfeidalu des Gesundheitsministeriums mit dem teuflischen Medikament Jaowang tottherapiert worden. Man experimentierte zwar auch in der «Morgenröte» mit allerlei Chemie an Mark herum; daran starb er wenigstens nicht wie schrecklich viele andere in den öffentlichen Zanfeidalus. Davon war ich überzeugt gewesen. War.
Mit der Zeit gewöhnten Mark und ich uns aneinander. Anfangs war ich nicht öfter als höchstens einmal im Monat bei ihm; eines Tages merkte ich, dass mir die Abstände zwischen den Besuchen zu lang erschienen. Überrascht spürte ich Sehnsucht nach Mark, bis ich bald mehrmals die Woche zu ihm ins Zanfeidalu ging. Es dauerte eine Weile, um zu verstehen, wie sehr er sich freute, wenn ich auftauchte. Denn jedes Mal wandte er sich zuerst ab und tat, als beschäftigte er sich mit etwas anderem. Er beschäftigte sich mit etwas. Elisabeth Petzelt, seine im Rahmen ihrer Möglichkeiten menschlich zugewandte Pflegerin, bemerkte einmal, er würde sich «sonst nie mit etwas beschäftigen». Er zog seine Bettdecke glatt. Er stellte eine Vase um. Er versuchte, den Gürtel seiner Hose zu öffnen oder zu schließen, je nachdem, ob er vorher geschlossen oder offen gewesen war. Er betrachtete das Bild seiner Mutter. Oder von Edgar. Beide Bilder standen auf seiner Kommode. Für die simple Erkenntnis, dass dies seine Art war, mir Freude über meine Besuche und über mein Dasein zu zeigen, dazu brauchte ich, abgestumpft von der rechten Verfahrensweise wie wir alle, viel, viel zu lange, bis ich es endlich begriff. Es tat gut zu spüren, dass sich unsere Seelen nicht gänzlich im festen, unentrinnbar erscheinenden Griff des unsichtbaren Feindes befanden.
Seit rund einem Jahr arbeitete Dr. Konfuzius Speer in der «Morgenröte». Trotz seiner jungen Jahre war dieser Arzt alternativen Umgangsformen mit Zanfeien aufgeschlossen. Mit seiner Fürsprache gelang es mir schließlich durchzusetzen, dass Mark hin und wieder übers Wochenende zu mir, zu uns, zu Donna und mir nach Hause kommen konnte. Wie fenbing sich diese Formulierung anhört: «Trotz seiner jungen Jahre.» Dabei war Dr. Speer sechs Jahre älter als ich! Doch ich fühlte mich den alten Schangsen so intensiv verbunden, dass ich in ihren Sprachgebrauch verfiel. Wie dem auch sei, mit Marks resoluter, bis an die Grenzen des Erlaubten kompromissbereiten Pflegerin Elisabeth Petzelt vereinbarte ich, dass ich an diesen Wochenenden ausprobierte, die Dosis von Marks Medikamenten zu reduzieren oder auch die eine oder andere Substanz ganz abzusetzen. «Risiko lohnt sich», hätte Edgar in Umkehrung der herrschenden rechten Verfahrensweise gesagt. Ja, es lohnte sich. Mark wurde lebendiger, aufnahmebereiter, zugleich allerdings gefährlicher, unberechenbarer. Ein aufs andere Mal wurde der Umgang mit ihm zu einer Gradwanderung. Besonders, als er sich mit der zanfeien Patientin Monika anfreundete. Monika war ungefähr im gleichen Alter wie Mark. Es wurde als therapeutischer Durchbruch gewertet, dass die beiden Kontakt miteinander aufnahmen. Zugleich machte es das aber auch schwieriger, Mark zu kontrollieren. Dr. Magnus schlug einmal sogar vor, ihn zu kastrieren. Als ich das Ansinnen vor Empörung zitternd zurückwies, redete der Feigling sich heraus, er habe «das doch nicht ernst gemeint».
Am vorigen Sonntag, der das letzte Mal sein sollte, warf Mark, als ich ihn in die Obhut von Frau Petzelt zurückgab, seine Arme um mich und grunzte etwas. Ich habe darin ein «Danke» verstehen wollen. Dieses Grunzen wird mich mein Leben lang verfolgen.
Am Dienstag, den 21. September 2077 zwanjangnierte man mich aus dem Zanfeidalu «Zur Morgenröte» an und bat mich, mich so schnell wie möglich dort einzufinden, um etwas, den zanfeien Patienten Mark Kurzweil betreffend, zu besprechen. Netterweise hatte Donna direkt angeboten, mich außer der Reihe zu fahren.
5. KAPITEL
«Mark ist tot», stöhnte ich leise, als ich aus dem Zanfeidalu «Zur Morgenröte» zu Donna ins Auto zurückkehrte. «Sie haben ihn umgebracht.»
Donnas linke Hand bewegte sich sanft über meine rechte Backe. Die Hand war angenehm kühl und rau. Die ungewohnte Berührung ließ mich wohlig erschaudern. Ich nahm das ferne Echo eines Verlangens wahr. Meine Härchen richteten sich auf und leisteten der Hand gerade so viel Widerstand, dass das Gefühl der Berührung am stärksten wurde. Zwischen Daumen und Zeigefinger massierte die Hand mir das Ohrläppchen. Die Liebkosung betäubte und schärfte meine Sinne zugleich. Dann glitt die Hand unter den Kragen meines Kwantas in den Nacken. Die Finger pressten sich auf die Nackenwirbel und schoben die Haut - und das nach wie vor reichlich vorhandene Fett darunter - hin und her. Als sich die Hand über die Schulter nach vorne kämpfte, hielt ich die Luft an. Die Finger hoben den Träger meines BHs an und verloren jede Zurückhaltung. Sie kneteten meine rechte Brust. Ich stieß die aufgestaute Luft aus. Meine Brustwarzen wurden hart. Donnas Finger zogen gierig an ihnen. Ich spürte Feuchtigkeit zwischen meinen Schenkeln und schon waren auch die Finger dort. Ich streckte meine Hand aus und suchte mir, reichlich ungelenk, wie es mir schien, den Weg in Donnas Schoß. Ich kam kräftig. Donnas Opel geriet ins Schaukeln. Wäre jemand vorbei gegangen, hätte er womöglich die Guttuer geholt, so viel Lärm machte ich. Ich massierte Donna noch weiter. Als ich den Kopf von ihrer Schulter nahm, sah ich das wundervolle Profil der älteren Frau, klassisch schön wie eine antike Skulptur. Ich dankte Gott dafür, dass Donna meine Freundin geworden war. Hätte ich mir je träumen lassen, mit ihr zu schingschingen? Im Leben nicht! Donna wandte mir ihr Gesicht zu und hauchte: «Ich liane du, Penelope.»
«Ich dich», antwortete ich ebenso leise.
Das Wort «lianen» kam mir noch nicht über die Lippen. Der neue chineutsche Ausdruck hatte sich erst in den letzten Jahren vor allem unter Tongschingsen eingebürgert. Die weltberühmte chinesische Operndiva Ye Zhiqiu hatte sich zu ihrer deutschsprachigen Freundin Beate Pons bekannt und in einem provozierenden Interview auf deutsch gesagt: «Ich liane du, Beate.» Ich hatte Beate Pons 2068 sogar einmal persönlich getroffen, während meiner Ermittlungen zum Tod von Edgar Longhang. Sie war Assistentin von dem erwähnten Dr. Franz Kurzweil, dem Arzt, unter dessen unsinnfulichen Händen Edgar damals gestorben war. Als ich sie bei einem Verhör auf eigene Faust zu Hause aufsuchte, hatte ich mich verwundert gefragt, wie sie sich von ihrem Guthaben als Krankenschwester einen offensichtlich hohen Lebensstandard leisten konnte. Ich wusste noch nichts von Ye Zhiqiu.
Nun war ich auch so eine Tongschingse und würde mich daran gewöhnen müssen, zu sprechen wie sie. Ich war erstaunt, dass weder Donnas noch mein Zwanjang sich meldete. Unsere emotionalen Werte mussten sich überraschenderweise im durch das vorgeblich allwissende Gesundheitsministerium fürsorglich festgelegten Normbereich befinden.
Donna startete den Motor, der sich rüttelte, aufstöhnte und den Wagen zum Wackeln brachte wie ich eben beim Schingschingen. Schweigend fuhren wir in Richtung Florastraße, wo Donna wohnte. Ich versuchte, den Moment des Sinnfus festzuhalten und alle anderen Gedanken auszublenden. Es ließ sich jedoch nicht verhindern, dass ich sofort zweifelte, ob ich es denn richtig gemacht hätte, ob Donna zufrieden mit mir gewesen sein mochte. Sie fragen wollte ich nicht, denn dass hätte den Zauber des Augenblicks vollends zerstört. Wie konnte das überhaupt sein, dass ich so stark gekommen war, obwohl ich morgens eine ziemlich große Dosis Jaocao eingeschmissen hatte? Seit der extremen Enttäuschung zu Beginn meines Studiums hatte ich nicht mehr schingschingt, geschweige denn liant. Trotz unserer Ablehnung von Chemie hatte ich oft nicht anders gekonnt, als die unbotmäßig sich dennoch zeigende Lust mit Jaocao zu bekämpfen, so oft, dass sogar mein Zwanjang am Arm mich warnte, dass es auch bing sei, Sexualität vollständig zu unterdrücken. Ich solle, so wurde mir manches Mal unter Androhung von Bing-Strafpunkten empfohlen, stattdessen Jaosching nehmen und eine der vom Gesundheitsministerium eingerichteten und hygienisch wie psychologisch überwachten Partnerbörse besuchen. Mittelmaß, ja das war es, das allerorten uns beherrschen sollte, das uns terrorisierte und das jedes Fünkchen Leben aus unseren Körpern trieb. Diesem Mittelmaß wohnte eine gewisse paradoxe Dekadenz inne. Beruhigt schloss ich, dass Jaocao nicht wirksam sein konnte, wenn echtes Gefühl in den Körper zurückkehrt. Aber halt, durfte man nach dem Massaker von Llodio überhaupt noch privates Sinnfu genießen?
Die fast spiegelglatten alten Reifen knirschten, die abgenutzten Bremsen quietschten auf, das Auto schlitterte zur Seite und kam dann mit einem Ruck zum Stillstand. Die Zeit war verflogen; und ich hatte nicht einmal an Mark gedacht, den toten Mark, den armen Mark, den unsinnfulichen Mark … Als wir ausstiegen, zogen wir unsere Kwantas zurecht und knöpften verstohlen unsere Hosen zu. Dabei grinsten wir uns selig an.
Mir wurde einiges klar. Donna hatte nicht nur in den Jahren, in denen ich mit ihr zusammenlebte, keinen Mann angefasst, sondern mir gegenüber auch nie erwähnt, etwa jemals verheiratet gewesen zu sein oder auch bloß einen Freund gehabt zu haben. Sie sprach meiner Erinnerung nach nie davon, den Po eines Manns «susching» zu finden. Auch war mir nie aufgefallen, dass sie einem Mann irgendwie suschingsiert hinterher gesehen hätte. Einer Frau? Vielleicht. Darauf hatte ich nun nicht wirklich geachtet. Dass jetzt ihr Blick auf mich gefallen war, war schier unglaublich.
Es gab wenig, was Donna mir je über ihr Leben berichtete hatte. Sie war, soviel ich wusste, bei ihrem Vater aufgewachsen, einem «Kriminalpolizisten», wie das damals in der guten alten Meigu-Zeit hieß. Ihre Mutter war in irgendeiner zweifelhaften «Sekte» verschwunden; als «Sekten» wurden vor der Zwangsvereinigung aller Religionen zum «Gesamtethischen Rat» religiöse Minderheiten bezeichnet, die von ihren Mitgliedern unbedingte Loyalität verlangten. Fast hatte ich den Eindruck, dass es sich bei den «Sekten» um eine Art Vorläufer der rechten Verfahrensweise im Kleinen gehandelt haben musste. Alles, woran sich Donna bezüglich ihrer Mutter erinnerte, war, dass sie an ihrem Bett saß, ihr zeigte, wie man die Hände zum Beten faltete und sprach: «Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein.» Donnas Vater war von der Gläubigkeit seiner Ex-Frau so entnervt, dass er eine extreme Feindlichkeit jedweden spirituellen Erfahrungen gegenüber zur Schau stellte. Eine solche Haltung war mir von meinem eigenen Vater her nicht unbekannt.
Für Donna war, wie sie öfter betonte, nie etwas anderes infrage gekommen, als auch zur «Polizei» zu gehen. Soweit ich wusste, hatte sie vor der Großen Chinesischen Wende in einer Abteilung gearbeitet, die - ohne allzu großen Erfolg - die Einschleusung von Flüchtlingen durch Menschenhändler verhindern sollte, Flüchtlingen, die vor allem aus Afrika in die deutschen Regionen strömten. Als die Wende 2048 über die europäischen Regionen hereinbrach, war es ihr, wie sie mir einmal ein wenig zerknirscht beichtete, scheißegal gewesen, unter wem sie ihrer geliebten Arbeit nachging. So wurde aus der «Kriminalkommissarin» eine Haupt-Guttuerin und dies stellte in ihren Augen damals nichts als eine nebensächliche Namensänderung dar. Allerdings lehnte sie es trotzig ab, als man ihr nahelegte, ihren eigenen Namen «Donna» zu ändern. Obwohl der Name unzweifelhaft romanischer Herkunft ist, wurde er als «meiguisch belastet» angesehen, da er in Meigu so beliebt sei. Weil sie intelligent, energisch und aufopferungsbereit war, wurde sie trotz dieser Unbotmäßigkeit ausgewählt, an einem speziellen Programm zur Ausbildung von Sicherheitskräften in China teilzunehmen, eine große Ehre. Doch ihr übermenschlicher Arbeitseinsatz forderte mit zunehmendem Alter ihren Tribut. Das Rauchen hatte sie sich als einzigen Fluchtpunkt gegen den enormen Druck nicht abgewöhnen lassen, auch wenn sie jährlich dazu aufgefordert wurde, bei einem Entziehungskurs mitzumachen. Ihre Weigerung wurde zwar mit Stirnrunzeln zur Kenntnis genommen, ihre Erfolgsbilanz bei der Fahndung machte sie aber unentbehrlich für die Guttuer. In der Zeit, als ich sie vor neun Jahren kennenlernte, hatte sie schon so viele Bing-Strafpunkte gesammelt, dass die Entmündigung eine real drohende Gefahr für sie darstellte. Das hatte sie nachdenklich gemacht. Und als sie darauf stieß, dass der chinesische Geheimdienst den Begründer der Schangsen-Bewegung Edgar Longhang hatte ermorden lassen, versetzte das ihrem Vertrauen in die rechte Verfahrensweise des Gesundheitsministeriums einen schweren Schlag. So wurde sie bereit; bereit zum Widerstand.
In ihrer Wohnung setzte Donna Kaffee auf, obwohl mein Zwanjang mir jetzt eher zur Beruhigung mit Jaoping als zu Koffein riet. Ich setzte mich an den steinalten Küchentisch mit einer eklig klebrigen, aber angeblich antibakteriellen braunen Oberfläche aus chinesischer Produktion um die Zeit der Wende und wusste nicht, woran ich denken sollte. Donna brachte eine große Tasse, stellte sie vor mich und setzte sich mir gegenüber.
«Darling -«, begann sie.
«Bitte, Donna, sag das nicht», unterbrach ich. «Mao hat mich immer so genannt.» Würde es mir je möglich sein, über Mao Schmidt hinwegzukommen? Er, damals der Geliebte meiner Freundin Ji Martin, hatte mir den Hof gemacht, vor fast zehn Jahren, und ich konnte mir kein größeres Sinnfu vorstellen. Denn ich wusste noch nicht, dass ausgerechnet er meinen Edgar im Auftrag des chinesischen Geheimdienstes getötet hatte. Mich hatte er dann benutzt, um die Bewegung der Schangsen auszuspionieren und so stark aufzuheizen, dass das Gesundheitsministerium Grund genug fand, mit Gewalt gegen uns vorzugehen. Obwohl diese Beschreibung, genau betrachtet, nicht ganz richtig ist. Denn eigentlich war Mao selbst es gewesen, der mich, ein zu der Zeit noch angepasstes naives Huhn, in den Altenwiderstand einführte, wie ich es in meinem Rechenschaftsbericht «2068» dargestellt habe. Das Leben steckt, entgegen der offiziellen preziologischen Lehre des Gesundheitsministeriums, voller Widersprüche. Hätte ich geahnt, dass Donna auf «Kindchen» als Kosename ausweichen würde, hätte ich mich vielleicht dafür entschieden, «Darling» zu akzeptieren.
«Woher weißt du, dass Mark umgebracht wurde?», fragte Donna mit der Stimme der Haupt-Guttuerin, die sie mal gewesen war. Diese Stimme hatte sie in letzter Zeit nicht häufig benutzt. «Ich meine: Dass irgendwer Mark absichtlich getötet hat?»
«Diese heuchlerische Visage von Dr. Magnus!», rief ich angewidert. «Er wollte Mark loswerden, weil er lästig, aufsässig wurde. Und als ich nicht mit mir reden ließ wegen der Entmannung, hat er ihn kurzerhand beseitigt.» Dann erinnerte ich mich: «Und außerdem hat es mir einer der Ärzte bestätigt.»
«Einer der Ärzte?», setzte Donna das Verhör fort. Sie konnte nicht verhindern, dass die einstige Haupt-Guttuerin ab und zu durchschien, obwohl man sie, wie gesagt, schon vor Jahren vom Dienst suspendiert hatte, weil sie während ihrer Ermittlungen um Edgar Longhangs Tod auf die Verwicklung des chinesischen Geheimdienstes gestoßen war und sich nicht bereit zeigte, diese unter den Teppich zu kehren. «Wer?»
«Na ja, dieser Arzt eben», bestätigte ich artig. «Ich glaube der, der sich auch immer so für Mark eingesetzt hat. Dr. Konfuzius Speer. ‹Konfuzius›, andingiger Name, was meinst du?»
Donna erhob sich. Sie fuhr mir mit beiden Händen durch die Haare.
«Kindchen», sagte sie zärtlich. «Ruh dich was aus, während ich gehe und mich mit diesem Dr. Speer in Verbindung setze. Scheiß-chinesischer Vorname übrigens, von wegen andingig. Und sag’ doch bitte nicht immer chineutsch ‹andingig›, sondern sag’ americanisch ‹cool›!»
6. KAPITEL
Ich warf mich aufs Bett und wälzte mich hin und her. Das morsche Holz knarrte verdächtig. Es müssten mal die Schrauben am Gestell angezogen werden, wenn die nicht schon durchgedreht waren. Ich fühlte mich gleichzeitig so pudelwohl und so saubeschissen, dass es schier zum Auswachsen war. Wollte ich tongsching sein? Nicht nur die rechte Verfahrensweise betrachtete gleichgeschlechtliche Verbindungen naserümpfend … offiziell galt ja jede Benachteiligung als verboten, sicherlich; das hieß aber rein gar nichts … sondern auch unter den Juschangsen gab es jede Menge Ablehnung von Tongschingsen und hier besonders unter unseren dogmatischen Verbündeten von der «Unabhängigen Initiative katholischer Schangsen», den sogenannten Uniks. Sie erklärten Tongschingen allen Ernstes zur Dekadenz. Das sollte mir doch egal sein! Die Uniks gingen mir mit ihrer Engstirnigkeit eh schon seit Jahren auf den Wecker. Dass der Sohn der Gesundheitsministerin, Bao Meyers, kaum gerade volljährig geworden, mit seinem Freund Hein Friedrichs zusammengezogen war, bedeutete nur Wasser auf die Mühlen der Uniks: Die gottlose rechte Verfahrensweise, sagten die Uniks, fördere die widernatürliche Homosexualität, die Gott missfalle.
Und was war mit mir? Der Tod von Mark zerriss meine viel zu lange nachwirkende Bindung an Edgar Longhang. Erst jetzt fühlte ich mich wirklich frei und konnte wieder lianen. Was für ein Sinnfu! Eine Frau. Einen Mann zu schingschingen, vermochte ich mir nicht mehr vorzustellen, seitdem mich Mao, der Mörder von Edgar … wie soll ich sagen? «verführt» hat? Ich war blind! Ich würde nie wieder blind sein, redete ich mir ein. Ach, wie ist das Leben, ist das Lianen schön! Das sinnfuliche Gefühl im Bauch, mit dem Zeh die Decke glatt streichen, nichts ist im Weg, es ist schön, mit den Fingern über meine Schenkel zu streichen. Hunger? Ist nicht so wichtig, jetzt. Halte es fest, Penelope, und lass das Sinnfu nie mehr los. Mein Kopf. Bumm. Geht da nicht die Tür? Kommt Donna wieder? In der Nase der süße Duft der Sünde. Im Ohr das Grunzen von Mark zum letzten Abschied. Mein Kopf zerspringt. Mich juckt es im Ohr. Rechts. Soll ich meine Hand vom Schenkel nehmen, um mich zu jucken? Der andere Arm liegt unter mir, ich müsste mich umlegen, ich will mich nicht bewegen. Es juckt so entsetzlich. Schade, jetzt bin ich raus. Wieso kann ich es nicht festhalten? Wieso muss ich wieder grübeln und grübeln und grübeln? Mao, das war die Strafe für die Sünde, dass ich mich wie die hinterletzte türkische Bitch nach Edgars Tod so schnell wieder jemandem zugewandt hatte. Ach was, dass ich mich als junges Ding überhaupt mit dem alten Edgar eingelassen hatte. Ach was, ich war blind, weil ich so sehr hinter dem Schingschingen her war, dass man mich nach Belieben manipulieren konnte. Jeder, der eine Dicke wie mich will, darf ran; jemand wie ich sollte nicht wählerisch sein, wenn es ums Schingschingen geht. Das sagt niemand. Aber jeder weiß es. Ich lese es im Blick. Von Frauen. Von Männern. Von meiner Mutter. Von meinem Vater. Von allen. Und weil ich trotzdem so hinter dem Schingschingen her war, habe ich für diese Sünde von Gott die gerechte Strafe erhalten, sei er nun der Herr oder Allah oder das Schicksal oder was auch immer. Gott! Gott? Wer ist das, verdammt noch mal? Was bildet der sich ein? Nennt sich Jesus oder Allah oder Buddha oder sonst wie, wie soll ich mich da auskennen? Es herrscht in der Religion fast so ein Durcheinander wie in der rechten Verfahrensweise, von der das Gesundheitsministerium immer behauptet, sie sei in jeder Lebenslage eindeutig, und dann kommt nur Murks heraus. Lieber an was anderes denken, bitte, bitte, sofort.
Die ganze zanfeienverachtende Brutalität der fürsorglichen Fassade, welche die rechte Verfahrensweise aufbaute, drückte sich darin aus, dass Mark, obwohl sein Onkel privat für ihn bezahlt und ich ihn zusätzlich betreut hatte, geradezu hingerichtet worden war. Bis in die 68er Jahre hinein noch wurde Jaowang mit dem Werbespruch «grün wie die Hoffnung» vom Gesundheitsministerium offiziell angepriesen. Die tatsächliche Bestimmung des Mittels, «unwertes» und «untüchtiges» Leben kostensparend und geräuschlos zu beseitigen, war versteckt. Jeder, der auf diese Funktion von Jaowang hingewiesen hatte, wurde damals offen als fortschrittsfeindlicher «Volksschädling» und «Gesundheitsgegner» beschimpft. Doch dann kamen Edgar Longhang und mit ihm die Schangsen vom ersten freien Altenkonvent sowie wir studentischen Unterstützer, die Juschangsen. Wir machten Rabatz und gingen auf die Straße. Das Verbot von Jaowang stellte einen der wenigen Erfolge dar, die wir mit unseren Aktionen erzielt hatten - und nun das! Mark Kurzweils Tod war der Beweis, dass Jaowang illegal weiter benutzt wurde, selbst in privaten Versorgungsstellen für Zanfeie wie der «Morgenröte», deren Geschäftsführer auch noch die Dreistigkeit besessen hatte, stets seine Sympathie für die humanen Ziel des Widerstandes der Schangsen gegen die rechte Verfahrensweise und gegen das Gesundheitsministerium vorzutäuschen. Wir hatten die ganze Zeit vermutet, dass die Beseitigung zanfeien und vor allem teuren Lebens mit Jaowang unter der Hand weiterging. Was fehlte, war ein Beweis. Jetzt hatte ich ihn. Gesundheitspolitisch war das durchaus ein Pluspunkt für unsere Bewegung. Was für ein barbarischer Gedankengang …
Als das Zwanjang klingelte, merkte ich, dass ich weggeschlummert sein musste. Ich nahm das Gespräch sofort an, weil ich dachte, es sei Donna. Ich schaute nicht auf den Bildschirm. Die nervtötende Sprachausgabe hatte ich sowieso immer ausgeschaltet. Wenn man nicht aufpasste, wurde man von Zwanjang-Ansagen 24 Stunden rundumbeschallt und fand nie seine Ruhe.
«Hei», meldete ich mich erwartungsvoll.
«Kurzweil», hörte ich von der anderen Seite. Enttäuschung. Donna war es nicht. Schlechter Geschmack im Mund und Kopfschmerzen, wie immer, wenn ich nachmittags schlief, überlagerten meine Empfindungen. Der Chirurg Dr. Franz Kurzweil, der Onkel von Mark, hatte die ganzen Jahre für die Unterbringung des zanfeien Jungen in der «Morgenröte» von seinem Guthaben gezahlt, sich jedoch sonst nicht um ihn geschert. Damals nach Edgars Tod hatte ich ihn, als ich herausfand, dass Edgar unter seinen Händen während eines kleinen Eingriffs gestorben war, fälschlich des Mordes bezichtigt. Seitdem hatte es keinen direkten Kontakt mehr zwischen uns gegeben. Seine Stimme erkannte ich trotzdem sofort. Ich hätte nach Marks Tod mit einem Zwanjangnat von ihm rechnen können. Hatte ich aber nicht. Ich schwieg ein ungemütliches Schweigen.
«Hei Pe …, Pe …», stotterte Dr. Kurzweil. Es war ihm nicht übel zu nehmen, dass er dazu ansetzte, mich mit dem Vornamen anzusprechen. Alle taten das, auch die Journalisten übernahmen diese Angewohnheit von den alten und jungen Mitgliedern unserer Bewegung, sodass kaum jemand überhaupt meinen Nachnamen kannte. «Frau Heiler, Sie wissen es schon?»
«Mark ist tot», bestätigte ich.
«Wir haben es gerade erfahren, dem Gesundheitsministerium sei’s geklagt.» Dr. Kurzweil räusperte sich. «Ich wollte mich bedanken. Bedanken für das, was Sie im Laufe der Jahre alles für Mark getan haben.»
«Nett», sagte ich und fragte mich, ob er das ironisch auffassen würde. Ich fragte mich, ob ich es ironisch gemeint hatte.
«Vielleicht sieht man sich mal», sagte er. «Im Namen der Gesundheit.»