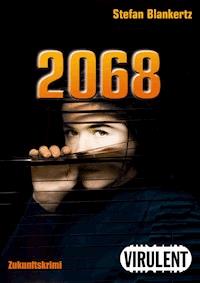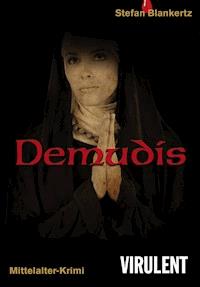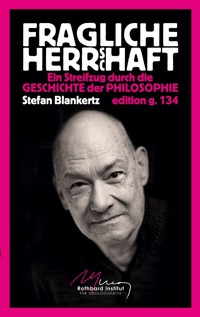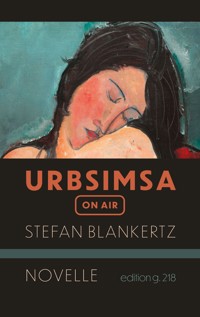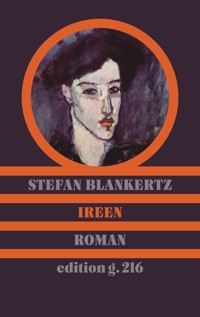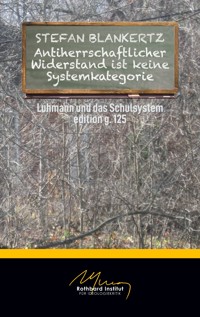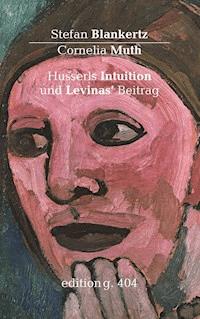Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Mittelalter live miterleben – von junger Liebe bis zur Inkontinenz des greisen Magisters Albertus, von tief empfundener Barmherzigkeit bis zu brutaler Verfolgung Andersgläubiger, vom opulenten Fressgelage bis zum kargen Fastenmahl, von großer Heilkunst bis zu gefährlicher Quacksalberei: Der genau recherchierte und detailliert nachgezeichnete Alltag des Hochmittelalters im 13. Jahrhundert bildet den Hintergrund für Stefan Blankertz' Mittelalterkrimis. El Arab ist der Spitzname für Sultan Ibn Rossah. Er ist arabischer Gelehrter, Arzt, Erzieher und Abenteurer. Seiner Herkunft nach Jude, ist er zum Islam übergetreten, aber verehrt auch herausragende christliche Philosophen. In seinem verzweifelten Kampf um ein "Land der Sonne", in welchem alle Religionen friedlich nebeneinander leben können, verschlägt es ihn bis nach Köln. Dort nehmen die Kriminalfälle ihren Ausgang. El Arab bleibt freilich ein Held zum Anfassen: Er ist keineswegs ohne Fehl und Tadel. Alle Kriminalfälle werfen die Frage nach dem Verhältnis von Toleranz und Recht im Umgang miteinander auf. Eine Frage, die heute nicht weniger wichtig ist als ehedem. BAND 1: Die Konkubine des Erzbischofs Köln, anno 1252. Magdalena, stadtbekannte Heilerin und Konkubine des Kölner Erzbischofs, und ihre Magd werden in einen grausamen Mordfall verwickelt. Ein arabischer Arzt und Gelehrter spielt eine undurchsichtige Rolle, aber anstatt der Aufklärung des Mordes nachzugehen, disputiert er lieber über Medizin, Philosophie und Theologie. Er verbreitet Ideen, aus denen sich sogar ein Aufstand der Bürger gegen den Erzbischof entwickelt. Quer durch die Religionen geht ein Riss zwischen Vernunft und Gewalt, Lebensfreude und Askese – aber der Aufruf zur Toleranz scheint ungehört zu verhallen … "Kirchliche Moral und Scheinmoral werden ebenso diskutiert wie mangelnde Toleranz und fanatisches Scheuklappendenken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 434
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
STEFANBLANKERTZ
Die Konkubine des Erzbischofs
Ein Krimi aus dem MittelalterTeil 1 der El-Arab-Trilogie
Inhalt
Köln im 13. Jahrhundert
Personen
Prolog
Erstes Buch: Die Sünderin
Wir Sünder
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Zweites Buch: Die Heilige
Wir Heiligen
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Drittes Buch: Die Märtyrerin
Wir Märtyrer
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Epilog
Nachwort
Glossar
Impressum
E-Books von Stefan Blankertz
Weitere Mittelalter-Krimis
Urban-Fantasy-Roman
Leseprobe – Die Stumme Sünde
Ein Krimi aus dem Mittelalter Teil 2 der El-Arab-Trilogie
Kapitel I
Kapitel II
Köln im 13. Jahrhundert
PERSONEN
*Albertus .(1193–1280), Magister .(Universitätsprofessor), einziger Philosoph der Geschichte, dem man den Namen »Magnus« beigegeben hat; Dominikaner, Verehrer der arabischen, auf Aristoteles fußenden Philosophie; mutiger Kämpfer für die Freiheit der Kölner Bürger.
Andreas, ein Ratsherr, Junggeselle.
Angela, eine Dirne aus der Schwalbengasse.
Arnold, Wachmann des Erzbischofs.
Averom, lateinischer Name von Sultan Ibn Rossah .(1211–1272); die Magd nennt ihn »El Arab«; Gelehrter, Abenteurer und Arzt; Verehrer der Werke des Mohammedaners Avicenna, des Christen Peter Abaelardus und des Juden Maimonides.
Bueno, Pater .(1173–1252), aufrührerischer Franziskanermönch, entschiedener Feind des Erzbischofs ebenso wie der neuen, vernunftgeleiteten Theologie.
Bonaventura .(1199–1266), Kölner Magister, genannt »der Kleine« .(im Gegensatz zu seinem »großen« *Namensvetter, dem franziskanischen Magister an der Pariser Universität) sowie Oberhaupt der Gegner des neumodischen Aristotelismus.
Chlodwig, Herzog, will sich von seiner Gemahlin Leutsinda scheiden lassen.
Dietrich von der Mühlengasse, Schöffe, Gegner des Erzbischofs.
Eleanore, Hurenwirtin, Gattin des Bauern Michael Mauerkauer.
El Arab siehe Averom.
Francisca, Tochter von Paulina.
Gisbert, genannt »der Langsame«, Diener im Haus der Magdalena von Köln.
Goswin, Wachmann am Hahnentor, Vetter des langsamen Gisbert.
Gottfried, Pater in St. Gereon.
Graf von Jülich, Gegner des Erzbischofs.
Hadwig, ungewöhnlich gebildete Magd von Magdalena, Mutter von Johannes; erzählt die Geschichte.
Hans, ein Ratsherr, genannt »der Fromme«.
Hilger, ein Mönch aus dem Minoritenkloster.
Hufschmied, namenlos, Freund der Familie der Magd, treibt im Nebengeschäft Handel mit seltenen oder verbotenen Büchern.
Ibrahim, Weggefährte von Averom/El Arab.
Ingotrude, Witwe, möchte, dass ihre Tochter Maria Äbtissin wird.
Johann von Wesel, Leibarzt des Erzbischofs.
Johannes von Köln, Sohn der Magd.
*Konrad von Hochstaden .(ca. 1196–1261), ab 1238 Kölner Erzbischof, auch Oberhaupt der Stadt, mit Münzrecht ausgestattet; wichtiger Bündnispartner der »päpstlichen Partei«, die gegen Kaiser Friedrich II. kämpft.
Krohn-Apothekerin, namenlos, eine Freundin der Magdalena von Köln, die es bei den Zutaten manchmal nicht so genau nimmt.
Magdalena von Köln .(1224–1252), Handwerkertochter, Konkubine des Erzbischofs; von ihrer Magd ».(meine) hohe Herrin« genannt; erfolgreiche Heilerin; der Kreis um sie, die »Magdaleninnen«, hält sie für heilig.
Maria, eine unglückliche Mutter.
Martin, Sohn von Angela.
Mauerkauer, Michael, Bauer, Gatte der Hurenwirtin Eleanore.
Overstolz, Heinrich, Kaufmann, Gegner des Erzbischofs.
Paulina, Dirne der Schwalbengasse.
Peppino, Bruder der Magd, zweiter in der Geschwisterfolge.
Peter, Abt des Begardenkonvents .(eine karitative Laienbruderschaft).
Rabbi der jüdischen Gemeinde zu Köln, namenlos.
Rignaldo, Bruder der Magd, Erstgeborener der Geschwister.
Tauber, Georg, Kaufmann, Gegner des Erzbischofs.
Teresa, eine junge Patientin von Magdalena.
*Thomas von Aquin .(1224–1274), Kölner Schüler des Albertus Magnus, später größter scholastischer Philosoph an der Pariser Universität.
Ursula, Gemahlin des Fleischers Peter.
Wilbert, mächtiger Gildemeister und Gegner des Erzbischofs.
*Wilhelm II. von Holland .(1228–1256), 1247 bis 1256 deutscher »Gegenkönig« der päpstlichen Partei .(Erzbischöfe von Mainz, Köln, Trier und Bremen), verächtlicher Beiname: »der Pfaffenkönig«.
*Wilhelm von Dampierre .(gest. 1251), genannt »der Bucklige«, Ehemann der Margaretha von Konstantinopel, Gräfin von Flandern und Hennegan, Feind des .(Gegen-)Königs Wilhelm II. von Holland.
Wilibald, Bader.
Wolfhardt, späterer Ehemann von Hadwig.
Dieses Buch ist ein Roman. Die Handlung ist frei erfunden, wenngleich in einem historischen Umfeld angesiedelt. Historische Personen sind mit einem Stern gekennzeichnet. Die Darstellung ihres Verhaltens und ihres Charakters im Roman entspricht nicht immer der historischen Überlieferung. Der Anhang enthält ein Glossar.
PROLOG
Es war aber der langsame Gisbert, der es uns erzählte. Wie alle anderen, die im Dienste der hohen Herrin standen, lauschte ich seiner unglaublichen Geschichte, deren tiefere Bedeutung mir erst viel später bekannt werden sollte. Ach, hätte ich sogleich erfahren dürfen, um wen es sich bei dem hochgewachsenen Unbekannten aus dem Morgenland handelte!
»Pfaffenkönig Wilhelm«, so berichtete der langsame Gisbert vollmundig, »hat, wie Ihr es kundgetan bekamt, seinen ärgsten Feind niedergerungen, den bei den Seinen wohlgelittenen Grafen von Dampierre, den Buckligen – verehelicht, wie Ihr durchaus wisst, mit der Gräfin Margaretha von Flandern, größte Stütze des jüngst verstorbenen Kaisers. Da Ihr es nicht glauben könnt, wie der zarte Feigling den buckligen Hünen hätte besiegen können, so werde ich es Euch hiermit beweisen. Denn ich vernahm dies von jemandem, der dabei gewesen ist. Doch möchte ich diejenigen unter Euch warnen, die Freunde des Pfaffenkönigs sind und ihn als Helden verehrt sehen wollen: Das, was ich über ihn gehört habe, gereicht ihm keineswegs zur Ehre.
Der Pfaffenkönig war, wie es heißt, mit seinem Gefolge auf dem Wege nach Therouanne, um mit der holden Gräfin Margaretha zu verhandeln. Da stellte sich ihm der bucklige Dampierre in den Weg, stieß Verwünschungen aus und forderte einen ritterlichen Zweikampf, der zu seinen Ungunsten ausgehen sollte. Nun weiß ich aber, dass es sich so nicht zugetragen hat.
Wie denn, fragt Ihr mich. Ich will Eure Geduld nicht auf die Probe stellen und es Euch geradewegs so berichten, wie es mir unter Eid berichtet worden ist.
Dampierre nämlich war schon auf den Tag genau den Monat zuvor einem Haufen morgenländischer Teufel in die Hände gefallen. Gott allein weiß, wie sie sich so weit hinauf in den Norden wagen konnten, und so beschütze er uns davor, dass wir ebenso unter ihnen zu leiden haben werden. Sie misshandelten Dampierre gar fürchterlich, brachen ihm nicht nur die Nase, sondern auch die Arme, so dass der Bedauernswerte gebettelt haben wird, sie mögen ihm auch gleich das Genick brechen. Dies aber taten sie nicht, eingedenk, dass er ein wertvolles Unterpfand sei im Streite der Oberen.
So begab sich einer von ihnen, der sich nämlich auf ein halbwegs gutes Benehmen versteht, ein hochgewachsener Araber, den seine Spießgesellen Sultan zu nennen belieben, zum Pfaffenkönig Wilhelm. Der Bucklige stand ihm nämlich schon lange im Wege bei der Überwindung seines Widersachers, unserem rechtmäßigen König Konrad IV. Gegen einen unermesslichen Schatz aus Gold und Silber übergaben die Ungläubigen den Buckligen. Jedoch nahmen sie ihm nicht das Leben, sondern setzten ihn auf einer Lichtung aus, damit der Pfaffenkönig sein vorgetäuschtes Heldenstück liefern konnte. Dergestalt also fügte es sich, dass diejenigen, die Ihr für fromm haltet, mit den Ungläubigen zusammen einen anderen Christen metzelten, eines weltlichen Zwistes wegen.
Der Pfaffenkönig zog demnach an den mit den Unholden abgesprochenen Ort, um den Buckligen dort auf unwürdige Weise abzuschlachten. Der Unglückliche aber vermochte sich seiner gebrochenen Arme wegen des feigen Angriffs nicht zu erwehren. Der zügellose Hass des Pfaffenkönigs brachte diesen dahin, den verabscheuten Widersacher nicht mit einem Hiebe zu meucheln, sondern ihm weiteres Leid zuzufügen, bevor ihn der Tod erlöste. – Ich möchte nun nicht, dass Ihr meine Treue und Liebe zu unserem ehrwürdigen Vater und Herrn Erzbischof in Zweifel zieht, jedoch wünschte ich, wie Ihr wohl auch, dass er sich nicht beteilige an Dingen, die weder unserer Stadt noch dem Ansehen der glorreichen Kirche Jesu Christi zu dienen vermögen.«
Dies also war, ohne dass ich es ahnen konnte, die erste Ankündigung der Prüfung, die dem Allmächtigen uns aufzuerlegen beliebte.
Gott, unser himmlischer Vater, unterscheidet die Menschen an den Zeichen ihres Herzens, nicht an ihrem Stand oder anderen äußeren Zeichen. Dass er meine Herrin nach besagter Prüfung in der Weise überhöhte, in der es ihm gefiel, mag nur den verwundern, der sich nicht erinnern will, dass die vollkommenste Anerkennung unter allen Menschen der seligen Gottesmutter Maria zuteil wurde.
Die tiefe Frömmigkeit, die die Heilerin Magdalena von Köln uns ins Herz gelegt hat, lässt uns ihre Geschichte für die Nachwelt bewahren – eine Nachwelt, von der ich wünsche, dass sie eher in der Lage sein wird, der hohen Herrin die ihr zweifellos zustehende Ehrerbietung zuteil werden zu lassen. »Eher«, das heißt: eher als die frommen Heuchler, von denen ich in aller Demut annehmen möchte, dass sie auch unseren Bruder Jesus Christus ein weiteres Mal gekreuzigt hätten.
Darum erdreiste ich mich als elende Sünderin, diese Aufzeichnungen zu beginnen, und, so Gott es zulässt, fertigzustellen. Nicht nur mir, sondern auch Gott wäre es wohlgefälliger, wenn höhere Menschen sich dazu berufen gefühlt hätten. Wir aber leben nämlich in der Zeit, in der die Hohen Niedriges tun, und drum müssen die Niedrigen also Hohes tun.
Diejenigen Begebenheiten im Leben der hohen Herrin, die ich offensichtlich nicht selbst bezeugen kann, ergänze ich aus den Zeugnissen von Menschen, deren Ehrenhaftigkeit mich an ihren Worten nicht zweifeln lässt.
Ich verspreche bei meiner heiligsten Jungfrau Maria, dass ich nichts auslassen oder beschönigen werde, auch das nicht, was Magdalena an Sünden begangen hat: Denn ihre Sünden sind ihrem Menschsein geschuldet, das ihr doch nichts von ihrer Heiligkeit zu nehmen vermag.
So spreche ich die Geschichte der seligen Magdalena von Köln, gestorben ihrer Barmherzigkeit wegen, in aller Ehrfurcht vor dem Herrn, meinem geliebten Sohne zur Nachschrift vor, so dass er sie dem höchsten Priester und unserem besonders verbundenen Vater, Herrn und Papst in Rom zur wohlgefälligen Kenntnis bringen und bei ihm in vollendeter Demut um die Heiligung ihrer Person nachsuchen kann.
Niedergeschrieben von P. Johannes OP in Gehorsamkeit und Dankbarkeit gegenüber Hadwig, seiner Mutter, aufbewahrt für die Nachwelt im Jahre der Fleischwerdung des Herrn 1275. Ehre sei Ihm, der einzigartig glücklich ist, und alle Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
ERSTESBUCH:DIESÜNDERIN
WIRSÜNDER
Sünder sind wir von Beginn an, weil wir die Folge der Sünde unserer ersten Eltern in unserer Natur zu tragen haben. Darum, weil doch niemand von uns ohne Sünde ist, darf sich nämlich keiner von uns aufgerufen fühlen, über den anderen zu richten. Dies ist vielmehr allein Aufgabe unseres Herrn. Er aber ist ein gnädiger Richter, denn er ist auch unser Bruder.
Darum bitten wir unseren heiligen Vater in Rom, dass er uns erlauben möge, als unser Hauptgebet zu sprechen:
»Für all jenes, was ich unterließ zu denken, gleichwohl ich es hätte denken sollen.Für all jenes, was ich unterließ zu sagen, gleichwohl ich es hätte sagen sollen.Für all jenes, was ich unterließ zu tun, gleichwohl ich es hätte tun sollen.Für all jenes, was ich gedacht habe, gleichwohl ich hätte unterlassen sollen, es zu denken.Für all jenes, was ich gesagt habe, gleichwohl ich hätte unterlassen sollen, es zu sagen. Für all jenes, was ich getan habe, gleichwohl ich hätte unterlassen sollen, es zu tun: Für all jene Gedanken, Worte und Taten bitten wir durch dich, heilige Magdalena, um Vergebung.«
KAPITELI
»Gott, was auch immer du mir gibst, ist mir zu gering.«
Augustinus
Es begab sich aber am Gedenktag Usuards, zwei Monate, nachdem die hohe Herrin mich im Jahre des Herrn 1252 als Magd zu sich nahm, dass der durch den Volksmund als »Pfaffenkönig« verlästerte Wilhelm II. von Holland gedachte, in seinem treuen Köln Hof zu halten. Seine Unwürden, wie ich den nannte, den alle anderen als »ehrwürdigen Vater und Herrn Erzbischof Konrad von Hochstaden« ansprachen, bot ihm nach alter Sitte Behausung. Das Fest, das dem König zu Ehren gegeben wurde, war so glanzvoll, wie es Köln nicht seinesgleichen gesehen hat. Und so nämlich gebührt es dem Sieger, obwohl vielerorts gezweifelt wurde, dass jemand, der sich kaum im Sattel halten kann, geschweige denn mit dem Schwert umzugehen versteht, es fertig gebracht haben sollte, den kräftigen Grafen Dampierre den Buckligen zu überwinden.
Meine hohe Herrin saß würdevoll neben dem Erzbischofe, dessen Unglück ich in mir trug und das umso größer gewesen wäre, hätte sie mich nicht in ihren Haushalt aufgenommen. .(Möge Gott ihn mehr für seine als mich für meine Sünden strafen.) Auch der König hatte seine Konkubine neben sich sitzen, während die Königin dem Vernehmen nach ihre Aufgaben in Braunschweig erfüllte. Man muss aber wissen, dass seine Unwürden als ein außerordentlich schöner Mann galt, dessen Leibesfülle ebenso Zeichen seines Wohlstandes wie Träger seiner Wohlgeformtheit und seines Wohlgeruches war. Nur durch den gewitzten Putz, den meine Herrin erdacht hatte, ließ es sich vermeiden, dass ihm mehr Zuneigung zuteil wurde als dem König, was freilich nicht sehr schicklich gewesen wäre.
Der scheue König entsprach, obgleich er sich dieses Mal mit Bart zeigte, der ihn männlicher erscheinen ließ, so überhaupt nicht der wuchtigen Gestalt des Ritters, den wir erwarteten, oder der Fülle der Amtswürde, die der Erzbischof ausstrahlte. Eher glich er einem fleischlosen Reh im Winter – und das, obgleich er doch mit viel Brokat umkleidet war. Bei seinem letzten Hofe in Köln war er bartlos gewesen und in Begleitung der Braunschweigerin, die sich aufführte wie seine Mutter. Diese harte Königin mit dem Blick des Habichts, deren unchristliches Benehmen uns noch gut in Erinnerung war, hatte das Gold der Krone auf ihrem Haupt grau erscheinen lassen. Da ihre Interessen dem Vernehmen nach in Braunschweig lagen, entbehrte sie des notwendigen Wohlwollens gegenüber unserem schönen Köln.
Umso erfreuter wurde der König diesmal aufgenommen zusammen mit seiner liebreizenden Konkubine, deren Haut wie Seide glänzte und deren Kopf auch ohne Krone von einem Goldhauche umgeben zu sein schien. Ihr ganz und gar feuerrotes Gewand, dessen morgenländisches Tuch offensichtlich in Florenz genäht worden war, wollte jeder befühlen, der durch seine Nähe zu ihr die Gelegenheit dazu bekam.
Da es um diese Jahreszeit selbst zu so früher Stunde schon dunkel war, wurde der große Festsaal des Erzbischofs, Fürst von Köln, mit sechzig Fackeln erleuchtet, während es zwei mächtige Feuer vollbrachten, die Kälte aus jedem Winkel zu vertreiben. So heiß wurde es, dass meine hohe Herrin gar ins Schwitzen geriet und ich ihr die Stirn tupfte, vorsichtig, um den Aschestaub nicht abzuwischen, mit dem sie ihre Haut stumpf gemacht hatte, damit sie nicht mehr strahle als die Konkubine des Königs. Auch mit Schmuck hatte sie sich zurückgehalten. Ich aber fand, dass Magdalena, obwohl die Konkubine des Königs durchaus, wie gesagt, eine Augenweide war, in ihrer Schlichtheit mehr Schönheit ausstrahlte als je zuvor.
Als der Truchsess den mit teuerstem Rohrzucker gesüßten Hirschen auf den feinsten Silberschalen von ganz Köln auftragen ließ, da traten dann auch die Aachener Spielleute hervor – sie verschlangen Feuer und zerkauten Steine und trieben alle jene derben Possen, an denen sich schon viele kranke Könige gesund gelacht hatten. Schließlich sangen sie beim lieblichen Klange von Doppelflöte und Rebec ein Lied von einem, der auf den Namen Konrad von Würzburg hörte:
Swâ tac erschînen sol zwein liuten,die verborgen inne liebe stunde müezen tragen,dâ mac verswînen wol ein triuten:nie der morgen minnediebe kunde büezen klagen.er lêret ougen weinen trîben;sinnen wil er wünne selten borgen.swer mêret tougen reien wîbenminnen spil, der künne schelten morgen.
Wenn es Morgen dämmern soll den Paaren,verborgen drinnen Liebe machten,erstirbt wohl jedes Liebesschmachten:Klagen kann er ihnen nicht ersparen.Den Augen lehrt er, sich zu trüben.Wonnen gönnt er nicht den Sinnen,Heimlich schöne Weiber minnen,das heißt den Morgen fluchen üben.
Der König kraulte sich geistesabwesend seinen rotgelockten Bart und schien sich nicht angemessen an diesen so herrlich für ihn zubereiteten Speisen und den Spielen zu erfreuen, nämlich weil ihn das schwere Gemüt überfiel, wie wir es nannten. Die heftig pochenden Schmerzen im Kopfe werden, so sagte die hohe Herrin, von einem widerwärtigen Dämon verursacht, der die Menschen, die er befällt, in den Tod durch die eigene Hand treiben will, um ihre Seelen dem Teufel zuzuführen, dem der Dämon dient.
Herzog Chlodwig, der ohne seine Gemahlin Leutsinda gekommen war .(man erzählte sich, die beiden gingen einander aus dem Wege) und der meinte, mehr jugendliche Kraft zu verströmen, als es seinen Jahren angemessen war, brachte Magdalena allerlei schöne Worte entgegen, bis sie ihn unbeeindruckt fragte, ob er denn nicht starke Schmerzen habe. Auf seine verwunderte Gebärde hin erklärte sie ihm, er müsse ihrer Beobachtung nach unter starker Gicht leiden. Er könne sich dagegen schützen, indem er in der Krohn-Apotheke auf der Gravegaze einen nach dem Rezepte der Heilerin Hildegard von Bingen gebackenen Kuchen verzehre, der Goldstaub im Wert von einem Obolus enthalte. Das Gold nämlich speichere die Sonne und dies lindere das Leiden, das der Feuchte und Kälte entspringe. Derart als alter, leidender Mann bloßgestellt, vermied Herzog Chlodwig hinfort die Gesellschaft meiner hohen Herrin.
Tapfer überstand Wilhelm das Fest, fragte dann allerdings den Erzbischof um Rat. Dieser empfahl ihm die Kunst meiner hohen Herrin, die ihn sicherlich zu heilen verstünde; die Aussicht auf Heilung sei sehr groß, da, wie ihm sein Astrologe gesagt habe, die Gestirnung dafür günstig sei. Es wurde also hergerichtet, dass die hohe Herrin in das Gemach des Königs geführt wurde, um ihn vom schweren Gemüt zu heilen.
Wilhelms Gemach, das ganz und gar mit Gold ausgeschlagen und rings von kristallenen, nach Ansicht unseres abergläubischen Erzbischofs Glück bringenden Spiegeln in goldenen Rahmen gesäumt wurde, war angefüllt mit Hochgestellten, deren offensichtlicher Reichtum mich mit tiefer Ehrfurcht erfüllte. Die hohe Herrin aber gebot allen, den Raum zu verlassen, ausgenommen der Konkubine des Königs und seiner Unwürden. Sie wolle sie, wie sie sagte, zu Zeugen haben, damit später bewiesen werden könne, dass sie kein Hexenwerk vollbringe, sondern ehrlichen Herzens heile.
Die beiden Zeugen mussten sich jedoch im hinteren, vom Kerzenschein nicht erreichten Dunkel des Zimmers aufhalten und sollten schwören, dass sie nicht sprechen würden, weder untereinander noch mit dem König. Auch ermahnte die Heilerin den Erzbischof, dass er alles, was der König während der Heilung von sich gebe, geheim halten müsse wie einen Beichtinhalt. Denn, verkündete sie, es sei nämlich Gott, der den König sagen mache, was er gleich sagen werde.
Meine hohe Herrin, nun ganz versunken in ihre Aufgabe als Heilerin, ließ mich den König betten, die mit teurem Damast bezogenen Kissen in seinem Rücken jedoch so ordnen, dass sein Oberkörper viel flacher lag, als es für einen hohen Herrn üblich ist. Sich selbst setzte sie aufrecht an das Kopfende, so dass er sie nicht sehen, sie dagegen ihm ihre anmutige, weiche Hand wärmend auf die Stirn legen konnte. Entspannt lehnte sie an dem Pfosten aus dunklem Holze, der über und über mit Löwenköpfen verziert war. Die Pfosten hielten einen Himmel, der nicht nur genau die Farbe der Nacht hatte, sondern auch naturgetreu die Sterne abbildete. So kann man alles haben und doch, wenn die innere Reinheit fehlt, unglücklich sein wie ein König. Diesen kranken König bat die Heilerin Magdalena alsdann, seine Augen zu schließen und zu schweigen.
Nach einer Weile besinnlicher Ruhe sagte die Heilerin mit betörender Stimme zum König: »Gott, der Allmächtige, hat es zugelassen, dass ein Dämon von dir Besitz ergreift. Auch in ihm schauen wir Gott. Und in ihm müssen wir auch Gott verehren. Darum fragen wir uns, was der Herr mit dem Dämon beabsichtigt. Der Herr beabsichtigt, dich zu prüfen. Aber der Vater will, dass du den Dämon besiegst. Zuerst nun müssen wir den Dämon kennenlernen. Halte deine Augen geschlossen und sage mir, wie er aussieht, der Dämon in dir.« Denn dies war ihre Angewohnheit: Während einer Heilung sprach Magdalena jeden, gleich welchen Standes, als Diener an.
Und mit der Gehorsamkeit des Dieners in der zitternden Stimme, des Königs nicht würdig, antwortete Wilhelm: »Ich sehe ihn nicht, denn du befiehlst mir, die Augen geschlossen zu halten.«
»Anstatt zu schauen, versuchst du zu denken«, sagte die Heilerin, nun durchaus mit Nachdruck. »Schau in dich hinein und vergiss, was du meinst zu können oder nicht zu können.«
»Dunkel ist es. Und es dröhnt.« Die Stimme des Königs senkte sich bei dem Worte »dröhnt«, er zog den Laut in die Länge; dann aber brach seine Stimme ab.
Magdalena ließ sich nicht beirren. »Wilhelm, sage nicht es. Nicht es, sondern er. Er ist dunkel. Der Dämon. Beschreibe ihn.« Ruckartig zog sie ihre Hand von seiner blassen Stirn.
»Nein!«, schrie der Kranke. »Schnee. Kalt. Es ist wunderbar, aber kalt wie eine Glocke. Das Leben dröhnt mir im Schädel, als ob die metallene Glocke zerspringen wollte. Jetzt grinst es höhnisch.«
»Hat er einen Namen?«, fragte die Heilerin, offenbar erleichtert.
»Wie soll ich einen Namen wissen? Es hat keinen Namen, kann sich mir nicht vorstellen.« Der Ton des Kranken war jetzt der eines verurteilten Ketzers.
»Nicht es, mein König, sondern er«, berichtigte die Heilerin beharrlich. »Und ihn kannst du doch fragen. Wird er sich der Frage seines Königs widersetzen?«
»Ihr quält mich, Frau Magdalena. Warum?« Dies war das Bitten und Betteln eines mit Recht Verurteilten.
Die Heilerin legte dem Kranken nun wieder ihre Hand, die ich täglich pflegte, auf die Stirn und sprach sehr leise, aber eindringlich: »Ich bitte dich nicht um meinetwillen, sondern um deinetwillen, Wilhelm: Bitte frage den Dämon nach seinem Namen.«
»Entschuldigt, ich habe gelogen.« Mit dem Geständnisse entspannte sich der König. »Ich kenne ihn. Sein Name ist mir geläufig. Er heißt Ragnar. Ich schäme mich, dass ich nicht stark genug bin, um ihn davon abzuhalten, in mich zu fahren.«
»Du kennst Ragnar gut.« Das Gespräch zwischen der Heilerin und dem König nahm nun das Merkmal einer Unterhaltung unter gleichrangigen Vertrauten an.
»Ja, er kommt immer, wenn ich einen Sieg errungen habe, auf den ich stolz sein kann. Dann kommt Ragnar und lacht. Er lacht mich aus, weil ich überheblich bin und nicht demütig vor Gott.« Der König sagte dies ganz ruhig.
»Ragnar kommt von Gott?«
»Ich weiß es nicht. Ich habe Angst.«
»Hast du Ragnar schon einmal befragt?«
»Befragt?«
»Frage ihn. Sage: Ragnar, wer bist du? Woher kommst du? Und was willst du von mir?«
»Wer ist Ragnar? Woher kommt er? Was will er von mir?«
»Frage ihn. Sprich ihn an. Ich kann dir die Fragen nicht beantworten, nur er.«
»Ragnar, wer bist du? Woher kommst du? Und was willst du um Gottes willen von mir?«
»Was sagt Ragnar?«
Durch eine schrille Stimme, überreizt, wie wir sie vom König nicht kannten, vernahmen wir erschaudernd dies:
»Blut will ich, das Blut deiner Schutzbefohlenen, viel Blut, sehr viel Blut. Und dann werde ich dein Blut nehmen, wenn du uns nicht mehr genug Blut gibst.«
Noch heute sucht mich, besonders des Nachts, diese Stimme bisweilen heim und jagt mir den Schrecken durch Mark und Bein. Die Heilerin aber wich nicht zurück und ließ sich nicht beeindrucken wie wir anderen, sondern sprach ganz ruhig:
»Wilhelm, sage Ragnar, dass du dich nicht zufriedengibst mit Geschwätz. Er muss sich dir offenbaren, sagen, warum er dein Blut will.«
Wieder hörten wir alle, die wir hier versammelt waren, diese schreckliche schrille Stimme, die den ganzen Raum erfüllte und von sehr weit weg zu kommen schien.
»Nie sollst du dich deiner Siege freuen können an der Seite einer kalten Königin, die du dir nicht selbst zur Frau erwählt hast.«
»Ragnar hat dir noch mehr zu sagen, Wilhelm.«
»Dein Schmerz soll sich steigern an der Seite einer schönen Dame, der du nie die Ehre wirst geben können, Königin zu werden, so sehr sie auch die Königin deines Herzens ist.«
»Frage Ragnar, ob er denn ein Abgesandter des Herrn sei«, forderte die Heilerin.
»Gott verachtet dich für deine Sünden, damit bist du dann nämlich das Brot des Teufels, meines Herrn, dem ich diene.«
»Nun ist es genug. Wir wissen, was wir wissen müssen«, sagte die Heilerin etwas lauter und rüttelte den König ein wenig. Der König schlug die Augen auf, und im gleichen Augenblick wurde es taghell im Raume. Wilhelm konnte auf seine Konkubine schauen, die Tränen der Rührung in den Augen hatte, wie alle, die versammelt waren. Der König nämlich blinzelte und sagte in seiner vertrauten Stimme: »Er ist weg. Ragnar, der schwarze Teufel, ist weg und wird nicht wiederkommen.«
In vollem Lichterglanz aber erstrahlte Magdalena, die Heilerin, die sich aufgerichtet hatte. Sie hob die Arme und drehte die Handflächen nach außen. Aus den Wundmalen Christi schlugen Feuerzungen, die jedoch nichts aufzehrten. Zurück blieb ihre versengte Haut, die jedoch wundervoll nach Weihrauch duftete.
Seine Unwürden bekreuzigte sich und sagte: »Es ist ein Wunder geschehen, wie es die Sterne vorausgekündet haben. Ich bezeuge das. Unser hochgeehrter, uns besonders verbundener König, Wilhelm, dessen demütiger Diener zu sein er uns gnädig gestattet, wir glauben, es ist der Wille des Höchsten, dass wir Eure Ehe aufheben im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dem Barmherzigen, der für unsere Sünden gestorben ist, auch die, die wir noch begehen werden. Die Königin ist in Köln ohnehin nicht beliebt. Ihr aber wisst, auf was Ihr verzichtet!«
Meine hohe Herrin beachtete das abergläubische Gerede von seinen Unwürden, dem Erzbischofe und Fürsten von Köln, nicht, sondern befahl mir, dem König und seiner Herzensdame ein heißes Bad zu bereiten. Sie schickte mich zu ihrer Freundin, der Krohn-Apothekerin, jenes Kraut zu holen, welches sie als »verkehrten Dill« bezeichnet. Dies sollte ich dann in das erhitzte Badewasser werfen. Ich tat, wie sie mir befohlen hatte, und die Heiligkeit meiner hohen Herrin wurde uns offenbar.
Am Tage nach diesem Wunder redete die ganze Stadt davon. Ob auf dem Heumarkt, auf dem Neumarkt, auf der Dombaustelle, ob in den Gassen der Hufschmiede, der Zimmerleute, der Tuchmacher oder der Bäckermeister, ob in der Schwalbengasse, der Judengasse oder bei den Ratsherren, überall sagte man, der König sei durch seine Konkubine zum Manne und durch die Konkubine des Erzbischofs zum Helden gemacht worden.
So sprach auch Ursula, die Frau des Fleischhauers Peter, meine hohe Herrin an, als diese zur Non in die Krohn-Apotheke eingetreten war, um ihre Freundin zu besuchen. Die besagte Apotheke befand sich in der Nachbarschaft des Dominikanerklosters, aus dessen Garten diejenige Medizin stammte, die nicht aus fernen Ländern hergeschafft werden musste.
Die Krohn-Apothekerin war eine glühende Anhängerin der Heilerin Hildegard von Bingen und man konnte bei ihr alles bekommen, was diese als Arznei gepriesen hatte, um einen Menschen von Krankheit zu befreien, wenn Gott ihn gesund machen und nicht sterben lassen will: Salbe aus Bärenfett mit Asche vom Weizen- und vom Kornstroh gegen Haarausfall; eine Mischung aus Käsekraut, Salbei und Olivenöl für Umschläge bei Kopfschmerzen; Puder von Kalmus, Fenchel und Muskatnuss gegen Lungenleiden; eine Tinktur aus Wermut, Eisenkraut, Wein und Zucker gegen Zahnschmerzen; verschiedene Fleischspeisen, die getreu der Rezeptur der Heiligen so zubereitet werden, dass deren Genuss entweder der Zeugungsunfähigkeit des Mannes oder der Unfruchtbarkeit der Frau entgegenwirkt; ein Brennnessel-Olivenöl zum Einreiben bei Vergesslichkeit und vieles mehr. Berühmt waren auch ihre nach einem Hildegard-Rezept gebackenen Gicht-Kuchen, die allerdings, so hörte ich, nicht so viel Gold enthielten wie angegeben. Es gab hier auch den »verkehrten Dill«, das Wundermittel gegen die »Sünde der Gefühllosigkeit«, das die Apothekerin besonders an die Badehäuser lieferte.
Ursula, ihrer Geschwätzigkeit wegen weithin gefürchtet, sagte ohne Umschweife: »Ihr habt ein Wunder gewirkt.«
Die hohe Herrin antwortete abweisend: »Wir müssen unsere Kräfte einsetzen, unterschiedslos bei allen Menschen.«
»Und umso besser, je höher der Herr«, schnatterte die Fleischhauer-Frau leichthin weiter. »Doch in diesem Falle, da Ihr den König selbst geheilt habt, ist Euer Verdienst zweifellos am größten.«
»Oder am geringsten. Denn es steht geschrieben: Eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als dass ein Machthaber eingeht ins Himmelreich.« Magdalena ließ keine Anzeichen erkennen, die Unterhaltung fortzusetzen, war aber höflich genug, aufrichtig zu antworten.
»Davon habe ich gehört«, sagte Ursula mit verschwörerisch gesenkter Stimme. »Es gibt Mönche, die die evangelische Armut predigen, Franziskaner oder Dominikaner sind es. Ihre Predigten stützen sich auf diesen Satz aus der heiligen Schrift. Der ehrwürdige Vater und Herr Erzbischof sagt, sie seien Ketzer. Seid Ihr Anhänger von diesen – Leuten?«
Bevor meine Herrin antworten konnte, wurden wir von einem hochgewachsenen Fremden abgelenkt. Der Fremde war ein morgenländisch aussehender Herr mit ebenmäßigen, dunklen Gesichtszügen, eingehüllt in vornehmem Tuche. Sein großer, gebieterischer Mund und das energische Kinn bildeten einen eigenartigen Gegensatz zu der ulkig gebogenen Nase zwischen den spitzbübischen, wie zwei falsche Edelsteine blitzenden Augen. Er sagte, indem er sich mit einer beinahe ungelenk wirkenden Verbeugung meiner hohen Herrin zuwandte: »Meint auch Ihr, dass Franziskaner und Dominikaner sich gleichen?«
»Wer seid Ihr?«
»Das offenbare ich Euch, wenn Ihr mir erst meine Frage beantwortet habt.« Der Versuch, formvollendete Höflichkeit zu wahren, paarte sich im Gebaren dieses Fremden mit einem unbedingten Verlangen nach Gehorsam. Er wirkte auf mich anziehend, aber doch auch gewissermaßen unheimlich und furchterregend, ohne dass ich sagen konnte, warum. Hatte uns der langsame Gisbert nicht vor umhervagabundierenden morgenländischen Teufeln gewarnt? Nicht, dass das vor uns stehende Mannsbild ein Vorbote war! Vielleicht der, von dem der langsame Gisbert gesagt hatte, er verstünde sich auf ein »halbwegs gutes Benehmen«. Das konnte aber nicht sein. Der Fremde hier verstand sich auf ein untadeliges Benehmen. Dahinter allerdings schien sich etwas zu verbergen, meiner Einschätzung nach jedoch eher Spitzbübigkeit als Mordlust.
»Beide predigen evangelische Armut, wenn ich mich recht entsinne. Unser ehrwürdiger Vater und Herr Erzbischof mag sie nicht und hat in Rom beim heiligen Vater eine Beschwerde gegen sie vorgebracht. Der Papst hat sich nicht beeinflussen lassen. Das bewirkt seine Kraft, die Gott ihm gegeben hat, um gerecht zu sein. Wie unterscheidet Ihr sie denn?«
»Die einen, die sich nach dem heiligen Dominikus nennen, sind, je ärmer an substanziellem Reichtume, umso reicher im Geiste. Die anderen«, der Fremde schüttelte sich auf eine übertriebene Weise, die ihn im Gegensatz zu seinem vornehmen Äußeren eher lächerlich erscheinen ließ. »Die anderen, deren Namen ein zweites Mal am heutigen Tage auszusprechen der Leibhaftige mich nicht versuchen kann, sind überdies auch noch arm im Geiste.«
»Diese Frage und Euer Hass auf die eine Seite scheint Euch sehr zu beschäftigen, obgleich Ihr nicht ausseht wie einer der Unsrigen.« Magdalena hatte ihren neckischen Zug um den Mund, den die Männer an ihr so liebten.
Der Fremde schien das jedoch nicht zu bemerken und gab gekränkt zurück: »Mein Fleisch mag dem Orient entstammen, mein Herz aber ist christlich.«
»Nun denn, sagt, wer Ihr seid!«
Erneut verbeugte sich der Fremde, es wirkte auf mich jedoch wieder fast so, als sei es ungeübt. »Mein Name ist Ibn Rossah, oder, wie Ihr Lateiner sagen würdet: Averom. Ich bin Gelehrter und Arzt aus Alexandria, einer Stadt mit christlichem Herzen, wie Ihr wohl wisst. Geschäfte haben mich in Euer schönes Köln geführt. Gerade zur rechten Zeit, wie ich meine, um Eure Kunst zu bewundern.«
»Da Ihr Euch Arzt nennt, könnt Ihr wahrscheinlich viel mehr bewirken als ich mit meinen bescheidenen Kräften.« Im Gegensatze zu des Arabers Steifheit war meine hohe Herrin gelöst und fröhlich wie selten. »Ich würde mich glücklich schätzen, wenn es mir gelänge, mehr von den Schriften Eures berühmten Avicenna zu lesen.«
»Dies ließe sich vielleicht einrichten. Dennoch solltet Ihr, ich bitte Euch um meinetwillen, Eure Fähigkeiten nicht zu niedrig einschätzen, nach dem, was ich gehört habe.«
»Mein Lieber«, buhlte die hohe Herrin, »wollen wir unser Gespräch nicht fortführen bei einem herrlichen Weine, der für beides, Geist und körperliche Substanz, in gleicher Weise sorgt?«
Also gingen sie vorbei an dem Platz, an dem vor drei Jahren mit dem Bau eines neuen, prachtvollen Domes nach nordfranzösischem Vorbilde begonnen worden war .(dessen Plan, wie man erzählt, der Magister Albertus im Traume von der Jungfrau Maria empfangen hatte), in Richtung auf das jüdische Viertel, wo nicht weit vom Rathaus gegenüber der Marspforte die edle Heimstatt meiner hohen Herrin lag.
Das große Portal erlaubte die Einfahrt von Kutschen, da der Erzbischof, der dieses Haus unterhielt, hier im großen Saal seine weniger amtlichen Gelage abhielt und seine hohen Gäste von nah und fern mit allem verköstigte, was es an fleischlichen Genüssen zu bieten gab. Unter dem Aufgang duldete meine hohe Herrin zahlreiche »Hausarme«, die sich, der vielen Feste mit reichen Gästen wegen, über fehlende Almosen nicht zu beklagen hatten.
Während man es sich nun also wohl sein ließ, worauf El Arab, wie ich ihn nennen werde, nicht minder eingeschworen war als meine hohe Herrin, nachdem jener seine Förmlichkeit schneller abgelegt hatte als eine Schlange sich häutet, nahmen sie ihr Gespräch wieder auf, das sie in der Tür der Krohn-Apotheke so unvermittelt begonnen hatten. Sie benahmen sich dabei, als seien sie seit langem vertraut miteinander.
Die hohe Herrin hatte El Arab in ein eher kleines Zimmer geführt, ihren Lieblingsraum, den sie gewöhnlich nur für sich selbst nutzte. Er lag über der Küche und wurde vom Herdfeuer gewärmt. An den Wänden hingen dicke, vornehmlich in hellem Grün gehaltene Teppiche aus weit entfernten Gegenden, die heidnische Bildnisse zeigten. Derjenige, der mich am meisten beunruhigte, aber auch anzog, offenbarte zwei völlig entblößte Körper, die auf eine mir gänzlich unerklärliche Weise ineinander verschlungen waren. Schon dieser morgenländischen Teppiche wegen war der Raum für Fremde üblicherweise nicht zugänglich.
»Wenn Ihr so viel von mir bereits gehört habt, Averom, wisst Ihr bestimmt auch, dass ich in Sünde lebe. Stört Euch das nicht?« Meine Herrin warf ihre kastanienfarbenen Locken nach hinten und lachte, denn sie erwartete keine abschlägige Antwort.
»Wenn es mich stören würde, wäre ich nicht stolz darauf, mich einen Christen nennen zu dürfen.« El Arab nahm einen tiefen Schluck Wein und schaute über den Rand des Kelches, um zu beobachten, wie seine Gastgeberin auf die ungewöhnliche Antwort reagieren würde.
Diese Antwort war für sie doch noch unerwarteter, als es eine Strafpredigt wider die Pfäffinnen gewesen wäre. »Wie soll ich das verstehen?«
»Seid Ihr denn auf eine Disputation über Sittlichkeit versessen?« El Arab beugte sich vor und brachte seinen Kopf nahe an Magdalenas. »Ich bin weit mehr danach begierig, mich von Euch in Eurer Heilkunst unterrichten zu lassen.«
Nun war es an Magdalena, sich zurückzuziehen und förmlich zu werden: »Ihr sagtet, Ihr wäret selbst Arzt, beansprucht demnach einen viel höheren Titel für Euch.«
»Ich bin ganz entfernt davon, mich der unmäßigen Überheblichkeit einiger meiner Brüder anzuschließen und mich über die Heilkunst zu erheben, die Ihr pflegt. Dazu kenne ich zu gut die engen Grenzen, die uns unser allzu spärliches Wissen über die Wechselwirkung der Säfte im Körper setzt. Warum wollt Ihr Euer Wissen nicht mit mir teilen und weist meine Hochschätzung zurück?« Fast wollte ich in seiner Frage eine Spur von Grobheit heraushören.
»Ich fürchte, überheblich zu werden.« Züchtig schlug meine Herrin ihre Augen nieder.
»Dann beginnen wir mit den Grenzen Eures Handwerks.« El Arab wusste nun, wie er in ihre Festung eindringen konnte. »Wo liegen sie? Warum seid Ihr neugierig, mehr von Avicenna zu erfahren?«
»Ich habe gute Erfolge bei allen Arten von Schmerzen«, zählte meine hohe Herrin wie eine folgsame Schülerin auf. »Bei Aussatz dagegen habe ich keine Erfolge. Wir sehen Aussatz als Gottesurteil an.«
»Aber warum sollte Gott uns die Wissenschaft der ärztlichen Kunst gegeben haben, wenn er nicht wollte, dass wir sie zu unserem Nutzen anwenden?« El Arab war der Lehrvater …
»Ist denn nicht gar alles, was geschieht, Gottes Wille? Und ist es dann nicht gerecht? Wenn Gott will, dass einer lebt, lebt er. Wenn es ihm aber gefällt, dass er stirbt, stirbt er. Dürfen wir in diese Gerechtigkeit eingreifen?« … und sie seine folgsame Schülerin.
»Denkt an den seligen Hiob. Es steht geschrieben: Er war ein gottgefälliger Mann, rechtschaffen und untadelig. – Gleichwohl erkrankte er dann an Aussatz.«
»Das wollte ich sagen.« Mir schien, sie habe den Faden der Unterhaltung verloren und gebrauchte eine Floskel, um es nicht zugeben zu müssen.
»Es war doch nicht gerecht, dass der überaus fromme Hiob Aussatz bekam!«, neckte der Lehrvater weiter.
»Herr Averom, wollt Ihr Euch anheischig machen, unseren Gott zu lästern oder die heilige Schrift zu bezweifeln?« War Magdalena empört? Oder spielte sie ein Spiel, das sie durchaus beherrschte?
»Fern liegt es mir, Gott, unseren über alle Maßen gütigen Vater, zu lästern oder seine Schrift anzuzweifeln. Zumal das Buch Hiob, wie Ihr wissen solltet, sogar von den Jüngern Mohammeds anerkannt wird. Wir müssen uns nur recht bemühen, den in der Schrift ausgeführten Willen des höchsten Wesens, das wir bekennen, auch angemessen zu verstehen.«
»Und wie, wenn es gefällt?« So kannte ich meine Herrin, nämlich dass sie die Führung übernahm.
»Weil es gefällt und wahr ist, sagt uns der heilige Hiob dieses: Seine Erkrankung geschieht in der Tat durch die Zulassung Gottes. Aber Gott greift nicht in das Leben der Menschen ein – nicht, weil er es nicht könnte, sondern weil er es nicht will. Die Heuchler, Hiobs Freunde, meinen, sein Unglück sei Gottes Strafe. Hiob aber ist sich keiner Schuld bewusst, weil er ja auch keine Schuld auf sich geladen hat. Er klagt sein Schicksal an, ohne dabei Gott zu lästern. Das gefällt Gott. So lautet der Auftrag an uns Ärzte: die Krankheiten zu heilen, wozu Gott uns die Kraft gibt. Das gefällt Gott.« El Arab war in Erregung geraten und sprach, als stünde er vor einer größeren Menschenmenge.
»Jetzt haben wir doch die Disputation, wo ich gerade bereit war, mich Euch zu öffnen.« Da ich sah, dass sie fröstelte, legte ich meiner hohen Herrin eine kostbare blaue Decke um die Schultern. »Die Heilerin Hildegard hat mich auf das Verfahren gebracht, das ich bei Heilungen anwende.«
»Die Hildegard?« El Arab rümpfte die Nase missbilligend und gab einen fremdländisch klingenden Schnalzlaut von sich. »Ich neige mehr der Vernunftlehre zu, wie sie von den Dominikanern gepflegt wird, Eurem Magister Albertus zum Beispiel.«
»Da Gott Vernunft ist, wie könnte er dann nicht wirken?« Magdalena benutzte für die Wiedergabe der Heilerin Hildegard von Bingen ihre hohe Singstimme.
»Schön formuliert, wer wollte ihr da widersprechen?« El Arab tat sich etwas von dem köstlichen Fenchelhonig in den warmen Wein und schlürfte ihn mit vernehmbarem Genusse. Dann fuhr er fort und fragte: »Nun sagt, wie sie Euch auf Eure Heilmethode gebracht hat.«
»Bei der Bingenerin las ich über die Melancholiker.« Die hohe Herrin lehnte sich im Stuhle zurück und schloss die Augen, um sich auf das Zitat zu konzentrieren. Es gibt Menschen, die in ihrem Sinne traurig, furchtsam und unbeständig sind, weil in ihnen keine rechte Gesundheit und kein Halt ist. Sie meint, man könne die große Traurigkeit heilen, indem man die Gesundheit des Melancholikers wiederherstellt. Darum schloss ich: Wenn durch körperliche Mittel ein seelisches Leiden geheilt werden kann, müsste doch auch ein körperliches Leiden, für das es kein Mittel zu geben scheint, durch Linderung der seelischen Qualen zu kurieren sein.«
El Arabs Antwort schien auch ein Zitat zu sein, aber er konzentrierte sich nicht darauf, sondern tastete mit seinen Augen meine hohe Herrin ab. So versunken betrachtete er ihr liebreizendes Gesicht, glitt hinunter über den Hals bis dorthin, wo unter der Decke sich ihre vollen weiblichen Formen abzeichneten, dass es fast einer körperlichen Berührung gleichkam. »Die Trauer ist ihrem Wesen nach dem natürlichen Streben des Körpers nach Wohlbefinden entgegengesetzt. Da Schlafen oder Baden Wohlbefinden auslöst, mildert das die Trauer. Jede Befriedigung mildert die Trauer. Also lässt sich durch körperliche Heilmittel wie Schlafen oder Baden die Trauer bekämpfen.«
Er erwachte aus seiner Versunkenheit und fragte ganz unschuldig als wissenshungriger Forscher: »Wie kann man diesen Vorgang gleichsam umgekehrt denken?«
»Wenn nach der Lehre des Aristoteles und in Übereinstimmung mit den christlichen Autoritäten die Seele die Form des Körpers ist, ist die Krankheit des Körpers nichts als ein Ausdruck einer Seele, die sich in schlechter, gleichsam verbogener Form befindet. Gebe ich der Seele ihren Einklang wieder, muss der krankhafte Misston aus dem Körper verschwinden.«
Meine Herrin richtete sich in ihrem Stuhle hoch auf, als sie dies sagte, wobei ihr die wärmende Decke von der Schulter glitt, und sie ließ ihre Hände an beiden Seiten ihres Körpers von oben nach unten zu ihren wundervoll ausgeformten Hüften gleiten. Kalt war ihr wohl nicht mehr. »Bleibt die Seele verbogen, wird sie sich, auch wenn ich den einen körperlichen Ausdruck heile, einen anderen körperlichen Ausdruck ihrer Verbogenheit suchen.«
»Dies scheint mir von so bestechender Logik, dass mir kein Einwand einfällt. Wie gehst du nun vor, wenn du zur Heilung schreitest?« El Arab hatte nach einigen Kelchen süßen Weins die Anrede gewechselt, und trotz seiner dunklen Haut konnte ich ihn glühen sehen.
»Die ursprüngliche Seele, mit der Gottes Gnade alle Menschen bei der Geburt ausstattet, macht im Körper jeweils besondere, einzigartige Erfahrungen, so dass am Ende keine Seele einer anderen mehr gleicht. Niemand kann also sagen, wann die Seele eines anderen verbogen oder krank ist. Jeder kann dies nur für sich selbst sagen.« Die hohe Herrin fiel zurück in ihren Stuhl und legte die gefalteten Hände in den Schoß.
»Dieser Schluss ist klar.« El Arab war ungeduldig. »Es scheint mir jedoch daraus zu folgen, dass dann keine Heilung möglich ist: Die Seele des einen ist verbogen, der Heiler kann es jedoch nicht sehen und weiß nicht, wie er sie gleichsam geradebiegen soll.«
»Genau.« Magdalena war nun völlig die Heilerin und ließ sich nicht ablenken. »Darum muss ich den Kranken dazu bringen, in sich hineinzusehen. Er schaut seine eigene Verbogenheit. Sie nenne ich seinen Dämon. Das aber ist das Wunder, das nicht ich, sondern der gütige Vater wirkt: Wer seinen Dämon gewahrt, dem flieht der Dämon aus dem Kopfe. Ich schließe daraus, dass die Dämonen besondere Angst vor ihrer Entdeckung haben.«
»Wie Ragnar, der Dämon des Königs«, warf El Arab gespielt leichthin ein.
»Das weißt du? Der Erzbischof wird, was immer sonst seine Fehler sein mögen, nicht das Beichtgeheimnis verletzen, so weit ist er doch auf sein Seelenheil bedacht!« Meine Herrin war ehrlich und wahrhaftig aufgebracht.
»Nicht der Erzbischof ist Urheber des Geredes, meine Liebe, der König selbst erzählt es.« El Arab war belustigt. »Die ganze Stadt kennt Ragnar. Die kleinen Kinder spielen deine wundersame Heilung auf der Straße nach. Einer muss Ragnar sein. Und der wird durch die Gassen gejagt.«
»Gütiger Himmel, das habe ich nicht gewusst.«
»Du bist nun berühmt. Damit wirst du leben können.«
»Mein Geheimnis habe ich dir also verraten«, beschloss meine hohe Herrin diesen Abschnitt des Gesprächs. »Darum kann ich nun reinen Gewissens auf eine Bemerkung von dir zurückkommen; vielleicht möchtest du sie lieber vergessen machen, sie hat jedoch meine unwürdige Gier entfacht: Du hattest angedeutet, es könnte sich einrichten lassen, dass ich die Schriften des größten aller Ärzte, eures Avicenna, zu Gesicht bekäme. Hast du das ernst gemeint?«
»Durchaus. Für einen kleinen Gefallen wäre ich bereit, meine Abschrift des Kanon von Avicenna herzugeben.«
Nun hatten sie aber genug Wein getrunken, was ihre Gespräche weniger für eine Aufzeichnung geeignet machte. Magdalena schickte nach dem Erzbischof, um ihm Mitteilung zu machen, dass sie dem Herrn Averom, arabischer Arzt christlichen Bekenntnisses aus Alexandria, Behausung bieten wolle. Sie war das seiner Unwürden zwar nicht schuldig, tat dies jedoch stets, wenn sie Besuch hatte, um ihn nicht zu verwirren oder ihm Anlass zum Zorn zu geben.
»Wie anders ist doch unser Herr Jesus«, hatte die hohe Herrin mir einmal anvertraut. »Er ist kein eifersüchtiger Geliebter. Einst beichtete eine Nonne ihrem Abt, der einem Doppelkloster vorstand, dass sie für einen Mönch entbrannt sei, und sie fragte jenen, ob sie nun als Braut Christi versagt habe. Der Abt aber hatte schon die Beichte desselbigen Mönches gehört, der ebenfalls für die nämliche Nonne entbrannt war. So legte der Abt beiden als Buße auf, sich einmal in jedem Mondeslauf zu erkennen, verschwieg jedoch einem jeden, dass der andere dessen Begierde teilte. Auf diese kluge Weise sorgte er dafür, dass seine Schützlinge für den Dienst am Herren nicht verlorengingen und gleichzeitig reinen Gewissens das Feuer ihres Fleisches löschen konnten. Der Herr dankte es dem Abt, indem er die Nonne nicht empfangen ließ, denn das hätte ihn sicherlich in des Teufels Herdfeuer gebracht.«
Zur Komplet aber versammelten sich Menschen unterschiedlichster Stände im verschneiten Hof des Hauses der hohen Herrin, die teils für sich selbst, teils für ihre Verwandten um Heilung baten. Die meisten von ihnen waren Frauen. Man ließ sie ein, und Herzogin Leutsinda, Gemahlin von Herzog Chlodwig, die mutigste unter ihnen, sagte:
»Der Herr hat zugelassen, dass wir oder unsere Angehörigen krank geworden sind. Euch aber, hohe Herrin, hat er die Gabe geschenkt zu heilen, und so bitten wir Euch, das Wort an uns zu richten, um unsere Seelen gesund werden zu lassen.«
Die hohe Herrin breitete die Arme aus und offenbarte dergestalt, dass die Stigmata der Wundmale Christi noch nicht ganz verschwunden waren. Sie sagte:
»Schwestern und Brüder, nicht ich bin es, die heilt, sondern der Herr durch mich. Bittet nicht mich, sondern den Herrn. Und wenn es ihm gefällt, so wird er euch durch mich heilen lassen. Aber auch, wenn ihr nicht geheilt werdet, so bedenkt immer, dass bei Gott nicht das Ende, sondern der Anfang das Ziel ist.«
Sie schwieg eine Weile und fuhr dann fort: »Darum will ich euch dies mit auf euren schweren Weg geben: Die Hirten hatten sich angewöhnt, an einem Tag in der Woche Gott zu danken. Während sie nun opferten und im Gebete vertieft waren, heulten die Wölfe und stahlen ein Lamm. Da murrten die Hirten und sagten: Wie kann es Gott zulassen, dass die Wölfe, während wir durch den Dienst an ihm abgelenkt sind, unsere Herde angreifen? Am nächsten Tag aber wurden zwei neue Lämmer geboren. Und auf diese Weise ging es immer wieder, bis die Hirten gelernt hatten, das Geheul der Wölfe als gutes Zeichen während ihres Gottesdienstes zu erkennen. Ihnen erschien nun kein Gottesdienst mehr vollständig, wenn die Wölfe nicht heulten. Amen.«
Dann hieß sie die Menschen, wieder nach Hause zu gehen, erlaubte ihnen jedoch, wiederzukommen, wann immer sie den Drang danach verspüren sollten. Sie versprach ihnen keine Heilung, aber Zuspruch und Trost.
Da ich durch die bevorstehende Niederkunft geschwächt war, zog ich mich zurück, bevor die hohe Herrin zu Bett gegangen war. Dass ich diesen Augenblick unachtsam war und die hohe Herrin und ihren Gast aus den Augen verlor, sollte sich bald als unverzeihlicher Fehler herausstellen.
Bevor ich nun also in meiner einsamen Gesindekammer einschlief, wandte ich mich wie immer an Gott. Ich wandte mich stets an den Vater, weil es der Vater war, den ich jetzt am nötigsten brauchte. Ich bat ihn um Verzeihung, dass ich für mich selbst bitten wollte: um eine glückliche Geburt für mein Kind. Des Tages war ich für andere da, ununterbrochen, jetzt aber betete ich eigensüchtig für mich und mein Kind. Da ich viel Angst hatte, flehte ich um ein Zeichen, Nacht für Nacht. Nun war ich verzweifelt, weil Gott stumm blieb. Ich warf ihm vor, kein Wort für seine treue Magd zu haben, die zwar Sünderin ist, jedoch sich bemüht, immer und immer bemüht. Während ich mich der Verzweiflung hingab, wuchs in mir ein Feuer, das die Verzweiflung vertrieb; und ich vernahm das Wort: »Fürchte dich nicht.« Sofort hörte ich auf, mich zu fürchten.
Dergestalt also merkte ich, dass nicht Gott mir gegenüber geschwiegen hatte, sondern dass mein Klagen so laut gewesen war, dass ich sein Wort nicht hören konnte. Zu Gott kann jeder Mensch immer sprechen und nie schweigt Gott zu dem, was wir Gott fragen. Wir müssen aber innerlich stille werden, um ihn hören zu können. Wir müssen ihn zu Wort kommen lassen. Das fällt uns schwer. Danke, lieber Vater, dass du mir in dieser Nacht die Stille geschenkt hast, um dein heilendes Wort zu vernehmen.
Ja, in der Natur ist das Ende, das Vergehen und der Tod das Ziel, bei Gott aber ist es der Anfang, die Schöpfung und das ewige Leben.
KAPITELII
»Den Guten wird Lohn und den Bösen Strafe zuteil.«
Augustinus
Zur Prim an dem Tag, der folgte, nachdem El Arab bei meiner hohen Herrin Quartier bezogen hatte, bewegte sich der langsame Gisbert ungewöhnlich schnell und berichtete von seinem grausigen Fund: Vor dem Haupttore stak, aufgespießt auf einem rostigen Schwert, ein abgetrennter, vom Blute triefender Kopf. Eine neugierige Menge an Lumpengesinde, Bubenvolk und Müßiggängern hatte sich trotz der klirrenden, alles durchdringenden Kälte des ach so garstigen Januars schon versammelt.
Die Herrin eilte daraufhin, noch bevor ich ihr etwas Wärmendes überzustreifen vermochte, in ihrem feinen grünen Nachtgewand zum Tor. Auch El Arab wurde Bescheid gegeben. Ich erkannte an dem abgetrennten Kopf sofort die vertrauten Züge des Hufschmieds, einem engen Freunde meiner Brüder, und mir von klein auf bekannt .(und, Gott verzeihe mir diese Sünde, einstmals verhasst). Da wusste ich mich nicht mehr zu beherrschen, schlug die Hände vors Gesicht und begann zu schluchzen – nicht aus Trauer um den Toten, sondern wegen des schrecklichen Anblicks.
Das gemeine Volk bildete einen Kreis um den Kopf. Zunächst hielten sie einen ehrfürchtigen Abstand; je mehr Leute sich aber hinzugesellten, umso enger wurde der Kreis. Man überlegte anhand des Grades, in welchem das Blut getrocknet war, wann wohl der feige Mörder hier sein Zeichen gesetzt habe. Die kecksten unter den Neugierigen begannen, Possen zu reißen. Einer sagte vernehmlich, man solle doch einmal herumfragen, wer in der Nacht seinen Kopf verloren habe – und lachte ungebührlich laut.
Magdalena aber trat mutig näher und entdeckte eine Briefrolle, die sorgsam am gleichen Schwerte befestigt war wie der Kopf, dessen verdutzter Gesichtsausdruck mich nun fast schon wieder belustigte. Als der bereits fertig angekleidete El Arab mit einwandfreier Haltung in der Tür erschien, begann die Menge zu murren.
»Der Fremde war es!«, rief einer, und andere fielen in den Ruf ein. »Schaut nach, ob er Blut an den Händen hat!«
Unbemerkt war ein weiterer Mann zu der Menge gestoßen, ein Mönch, eine alte, vertrocknete Gestalt mit übergroßer buckliger Nase im grauen Gesichte, das die Last des Alters und der Gram zeigte. Wahllos drosch er mit seinem krummen, wurmstichigen Stab auf die Rücken einiger Neugieriger ein.
»Ihr Narren!«, krächzte er wie ein alter Rabe. »Haltet Einkehr. Seht ihr denn nicht, dass dies eine Warnung des Herrn ist an die Sünder? Die Sünder werden den Zorn des Herrn über uns bringen. Der oberste Sünder aber ist der, der so vermessen ist, sich Erzbischof zu nennen. Dieser abgetrennte Kopf hier ist die Mahnung an ihn. Und an euch, auf dass ihr ihm nicht nachfolgt. Kehrt um und betet.« Dieser Mann war niemand anderes als Pater Bueno, ein franziskanischer Minorit.
Als seine Unwürden, der Erzbischof, eintraf, machte ihm die Menge ehrerbietig Platz.
»Schweig still, du Schwätzer!«, wies er im Vorbeigehen Pater Bueno an. Obwohl das keine sehr lustige Bemerkung war, lachten die Leute, und Pater Bueno schwieg. Der Erzbischof erhob seine Stimme und sagte:
»Geht einem ehrenwerten Tagewerk nach, fromme Leute, wir bitten euch. Der Mörder ist uns bereits bekannt und wird seiner gerechten Strafe zugeführt.«
Die Menge begann, sich aufzulösen, und El Arab wandte sich verwundert an seine Unwürden: »Ihr kennt den Mörder bereits?«
Warum fragt er nicht, wer der Tote sei?, dachte ich, vergaß die Frage aber schnell wieder.
Der Erzbischof umarmte El Arab überschwänglich und sagte: »Herr Averom, Ihr seid ganz anders, als ich mir Euch vorgestellt habe.«
Es sah etwas eigenartig aus, als der beleibte Erzbischof den schmalen Arzt so herzte und El Arab wie ein frischer Ast gebogen wurde. »Ihr wart bei mir angemeldet, seid aber gleich an der richtigen Stelle untergekommen.« Der Erzbischof legte nun auch meiner hohen Herrin einen Arm um die Schulter. »Es ist gut, wenn er hier wohnt für die Zeit, die er in Köln verweilen will. Dann hört vielleicht der dreiste Pater Bueno auf, herumzutönen.«
»Ich will Euch gerne behilflich sein, den Ketzer Bueno zum Schweigen zu bringen, ehrwürdiger Vater und Herr Erzbischof«, sagte El Arab so steif, wie ich es jetzt schon von ihm kannte.
»Lasst uns hineingehen«, schlug seine Unwürden vor. Zu den Dienern gewandt sagte er: »Räumt den Unrat hier auf, sonst kommen die Ratten und bringen, wie wir alle wissen, das Unglück mit.«
El Arab drehte sich um: »Kennt Ihr wirklich den Mörder? Sonst würde ich mir die Sache gern etwas näher besehen.«
»Nein, ich kenne ihn natürlich noch nicht. Wie sollte ich auch? Wenn mir der Herr den Namen nicht geflüstert hat. Und das tut er für gewöhnlich nicht.« Die Scherze des Herrn Erzbischof waren nicht jedem verständlich. So setzte er, als er El Arabs verwirrten Gesichtsausdruck sah, nach: »Ich wollte erreichen, dass sich die Leute nicht beunruhigen.«
»Das war klug von Euch. Gleichwohl würde ich den abgetrennten Kopf gerne untersuchen dürfen, wenn es Euch beliebt.«