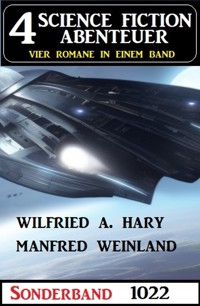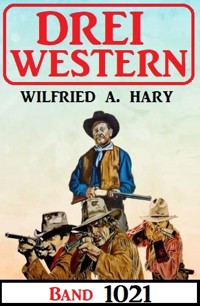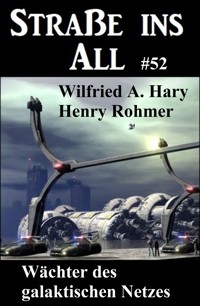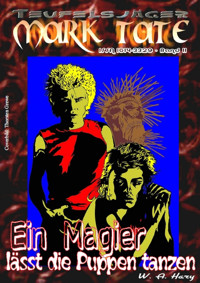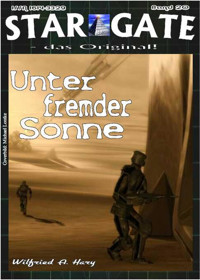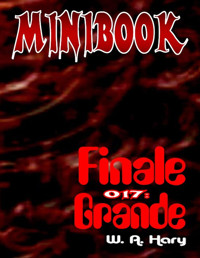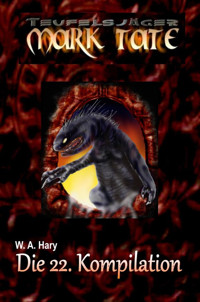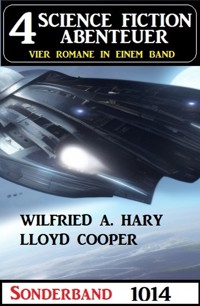
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Vor zweitausend Jahren wurde er entdeckt – von Pruppern in der Pruppergalaxis: Der Planet EG-UL-EG. Und er birgt das Erbe der Dhuuls, die weitere dreitausend Jahre zuvor die Galaxis blutig heimgesucht hatten. Hochrangige Wissenschaftler versuchten, dem Planeten all seine Rätsel zu entreißen, doch sie hatten nur wenig Zeit, denn eine planetare Naturkatastrophe stand kurz bevor. Weitere sechs Jahre mussten verstreichen, ehe die nächsten wissenschaftlichen Teams es wagen können, den Planeten zu betreten. Es hat sich viel verändert inzwischen auf dieser Welt. Nur die Geheimnisse blieben. Aber um die zu entschlüsseln, dafür sind sie schließlich hergekommen... (499) Dieser Band enthält folgende SF-Abenteuer Lennox und das verschwundene Volk (Lloyd Cooper) Nergaards Fluch (Wilfried A. Hary) Wiege der Erkenntnis (Wilfried A. Hary) Genesis (Wilfried A. Hary)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wilfried A. Hary, Lloyd Cooper
4 Science Fiction Abenteuer Sonderband 1014
Inhaltsverzeichnis
4 Science Fiction Abenteuer Sonderband 1014
Copyright
Lennox und das verschwundene Volk
Nergaards Fluch
Wiege der Erkenntnis
Genesis
4 Science Fiction Abenteuer Sonderband 1014
Wilfried A. Hary, Lloyd Cooper
Vor zweitausend Jahren wurde er entdeckt – von Pruppern in der Pruppergalaxis: Der Planet EG-UL-EG. Und er birgt das Erbe der Dhuuls, die weitere dreitausend Jahre zuvor die Galaxis blutig heimgesucht hatten.
Hochrangige Wissenschaftler versuchten, dem Planeten all seine Rätsel zu entreißen, doch sie hatten nur wenig Zeit, denn eine planetare Naturkatastrophe stand kurz bevor.
Weitere sechs Jahre mussten verstreichen, ehe die nächsten wissenschaftlichen Teams es wagen können, den Planeten zu betreten. Es hat sich viel verändert inzwischen auf dieser Welt. Nur die Geheimnisse blieben. Aber um die zu entschlüsseln, dafür sind sie schließlich hergekommen...
Dieser Band enthält folgende SF-Abenteuer
Lennox und das verschwundene Volk (Lloyd Cooper)
Nergaards Fluch (Wilfried A. Hary)
Wiege der Erkenntnis (Wilfried A. Hary)
Genesis (Wilfried A. Hary)
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!Verlags geht es hier:
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Lennox und das verschwundene Volk
Das Zeitalter des Kometen #44
von Lloyd Cooper
Eine kosmische Katastrophe hat die Erde heimgesucht. Die Welt ist nicht mehr so, wie sie einmal war. Die Überlebenden müssen um ihre Existenz kämpfen, bizarre Geschöpfe sind durch die Launen der Evolution entstanden oder von den Sternen gekommen, und das dunkle Zeitalter hat begonnen.
In dieser finsteren Zukunft bricht Timothy Lennox zu einer Odyssee auf …
Auf der Reise nach Kalifornien geraten Lennox und Marrela in einen uralten Pueblo. Hier verschwimmen die Zeiten, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft kreuzen wild durcheinander. Während Lennox in einen fast tödlichen Wahnsinn verfällt, versucht Marrela mit Geistern der Vergangenheit zu kämpfen.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
© dieser Ausgabe 2022 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
1
Der Boden erbebte unter dem Stampfen blutiger Füße. Im Licht der hoch lodernden Feuer erschienen die Schatten an den Wänden langgezogen und grotesk. Trommeln schlugen einen ewig gleichbleibenden Rhythmus, der sich in den Körpern der Tanzenden verselbständigte und zum Takt ihres Herzschlages wurde.
Keiner von ihnen wusste, wie viel Zeit vergangen war, seit der Tanz begonnen hatte. Sie zählten weder die Toten zwischen den Feuern noch die Verletzten, die mit rauer Stimme und Schaum auf den Lippen „Tuakum he“, schrien. Die Tanzenden nahmen den Ruf auf.
„Tuakum he! Tuakum he!“
Wir sind bereit!
2
Äußeres Territorium Seiner Majestät König Karl V. von Spanien 1. Juli 1540
Wenn Ramon Jacob del Estevez die Augen schloss, sah er grüne Olivenhaine, weißgetünchte Bauernhäuser mit roten Dächern und das blaue, funkelnde Meer. In seiner Erinnerung lag seine kastilische Heimat stets unter einer warmen Frühlingssonne, war weder zu heiß noch zu kalt. Das war eine Lüge, soviel war ihm klar, aber in diesen Momenten fand er nur Halt in dem Gedanken, dass es am anderen Ende der Welt einen Ort von solcher Schönheit gab. Hätte er gekonnt, wäre er dort geblieben, aber es gab immer wieder etwas, das ihn aus seinen Tagträumen riss; der Fehltritt eines Pferdes, das Husten eines Mannes oder eine Stimme, die nach seiner Aufmerksamkeit verlangte – „Capitan!“ – so wie jetzt.
Ramon öffnete die Augen, sah die gelbbraunen Farbtöne der Wüste und den blassen blauen Himmel, über den Wolkenschleier in einer trügerischen Hoffnung auf Regen vorbeizogen. Die Trostlosigkeit der Landschaft versetzte ihm einen beinahe körperlich fühlbaren Stich.
Gott verdamme Coronado, dachte er. Gott verdamme Spanien, und Gott verdamme vor allem meine Gier nach Gold und Ruhm.
„Capitan“, brachte sich die Stimme neben ihm wieder in Erinnerung.
Ramon stützte sich auf den hölzernen Sattelknauf seines Pferdes und sah zu dem jüngeren Mann – Alfonso Modeno, wie ihm nach kurzem Zögern einfiel – hinunter. Wie die meisten anderen Fußsoldaten hatte Modeno Helm, Stiefel und Brustpanzer abgelegt und ging barfuß wie ein Bauer durch die sengende Hitze.
„Unser geschätzter Adelantado Coronado würde dich auspeitschen lassen, wenn er dich so sehen könnte“, sagte Ramon.
Modeno deutete eine Verbeugung an. „Deshalb ziehe ich mit Euch im Spähtrupp, Capitan. Da bleibt mir ein blutiger Rücken ebenso erspart wie ein Hitzschlag.“
Ramon drehte sich im Sattel zu den anderen Offizieren um, deren Pferde mit gesenkten Köpfen hinter ihm her trotteten. Zusammen mit den Fußsoldaten bildeten sie eine Truppe von fünfzig Männern, ein Zehntel der gesamten Streitmacht Spaniens in diesem Territorium.
„Ich hoffe, ihr wisst alle noch, wo ihr euer Zeug vergraben habt“, rief er ihnen zu, „sonst müsst ihr nach unserer Rückkehr auf dem Bauch schlafen.“
Einige Soldaten lachten, ein paar andere wirkten plötzlich besorgt. Ramon grinste und wandte sich wieder an Modeno.
„Weshalb wolltest du mich sprechen?“, fragte er.
„Seht Ihr die Felsen dort hinten, Capitan?“
Modeno streckte die Hand aus und zeigte auf etwas, das Roman als verwaschenen braunen Fleck wahrnahm. „Ich glaube, dort liegt ein Dorf.“
Ramon zweifelte nicht an seinen Worten. Modenos Augen waren gut, und es war nicht das erste Mal, dass er etwas entdeckte, das den anderen entging.
„Wie groß ist das Dorf?“
„Ich weiß nicht, Capitan. Sie leben in Höhlen, so wie die anderen. Wenn wir näher herankommen, kann ich die Eingänge zählen.“
Ramon nickte. Die Indianer, denen die Expedition seit dem Aufbruch aus Mexiko begegnete, unterschieden sich von allen anderen, die sie bisher gesehen hatten. Sie bauten nur wenige Häuser sondern lebten in Lehm- und Steinhöhlen, die durch ein Netzwerk von Leitern und Gängen miteinander verbunden waren. Coronado fluchte oft darüber, weil man die Dörfer so schwer anzuzünden konnte, aber Ramon fühlte sich zu ihnen hingezogen. Er hatte sogar begonnen, die merkwürdigen Konstruktionen heimlich aufzuzeichnen, während die anderen Soldaten sie nach verborgenen Reichtümern durchsuchten und die Bewohner abschlachteten.
Ramon schüttelte den Gedanken ab. Fray Antonio, der Priester des Feldzugs, hatte ihm schließlich bei seiner letzten Beichte versichert, dass nur Indianer, die sich zum Christentum bekehren ließen, eine Seele hätten. Wie er die jedoch im Kampf von den Seelenlosen unterscheiden sollte, war ihm noch ein Rätsel.
Er wischte sich den Schweiß aus den Augen und ritt weiter. Die Steilwand, die Modeno ihm gezeigt hatte, kam langsam näher. Sie schien nicht sonderlich hoch zu sein, vielleicht dreißig Fuß, und zog sich über die gesamte Breite der Ebene hin. Jetzt erkannte auch Ramon die dunklen Löcher darin, die treppenartigen Abstufungen und die Leitern, die vom Boden aufragten. Felle trockneten eingespannt in Holzkonstruktionen unter der gleißenden Sonne. Große, schwarz und weiß bemalte Tonkrüge standen am Rand der Wand. Es war niemand zu sehen, aber in der mittäglichen Hitze war das nicht ungewöhnlich. Nur, wer unbedingt musste, hielt sich um diese Zeit im Freien auf.
Ihr erlebt gleich eine böse Überraschung, dachte Ramon mit einem gewissen Bedauern.
Eine Handbewegung brachte den Spähtrupp zum Stehen.
„Zweihundert Wilde“, sagte Modeno neben ihm, „vielleicht zweihundertfünfzig. Das schaffen wir ohne Verstärkung, Capitan.“
Ramon nickte. Eine Faustregel besagte, dass ein Fünftel eines Dorfes kampffähig war. Damit stand es fünfzig zu fünfzig, aber die Bewaffnung der Indianer war schlecht und seinem Trupp weit unterlegen. Ruhig setzte er seinen Helm auf und legte den Brustpanzer an. Das metallische Klirren hinter ihm verriet, dass die anderen Offiziere seinem Beispiel folgten.
„Bogenschützen in die zweite Reihe“, befahl er, „Fußsoldaten davor, Reiter an die Flanken.“
Einen Moment herrschte Chaos, dann hatten die Soldaten Aufstellung genommen. Ramon lenkte den Hengst an ihre Spitze und zog sein Schwert. Seine Sporen berührten zitternde Flanken.
„Angriff!“, schrie Ramon. „Zum Ruhme Spaniens!“
Grölende Rufe waren die Antwort. Er spornte das Pferd zum Trab an, die Augen starr auf das Pueblo gerichtet. Jeden Moment mussten die ersten Krieger mit ihren primitiven Jagdwaffen dort auftauchen. Die Erwartung der kommenden Schlacht beschleunigte seinen Puls und ließ ihn Durst und Hitze vergessen.
Kurz vor der Steilwand zügelte Ramon den Hengst. Staubwolken strichen über ihn hinweg, als der Rest des Spähtrupps zum Stehen kam. Die Eingänge des Pueblos gähnten ihm dunkel und leer entgegen.
Was ist hier los?, fragte er sich. Wieso kommen sie nicht heraus?
„Ist wohl niemand zuhause, Capitan“, sagte Modeno mit einem nervös klingenden Lachen. „Vielleicht haben sie uns aus der Ferne bemerkt und sind geflohen.“
Ramon zeigte auf die großen Tonkrüge. „Und wovon wollen sie auf der Flucht leben, wenn sie Mehl und Wasser zurückgelassen haben? Es ist alles noch hier.“
Nicht nur die Krüge mit Maismehl waren unangetastet. Auch die Stapel mit Feuerholz und die langen Streifen Dörrfleisch, die wie Wäsche an Leinen hingen, ließen nicht auf Menschen schließen, die in aller Hast ihr Hab und Gut zusammengepackt hatten und geflohen waren.
Er setzte den Helm ab und schüttelte den Schweiß aus seinen Haaren. „Nimm dir zehn Mann mit Schwertern und durchsucht das Pueblo. Sie müssen hier noch irgendwo sein.“
Ächzend stieg er von seinem Pferd ab, während Modeno und neun andere auf die Leitern zuliefen. Auch einige andere Soldaten sahen sich neugierig um. Sie stocherten mit ihren Schwertern in den Krügen herum oder erkundeten vorsichtig die Höhlen auf der untersten Ebene.
Ramon ließ sie gewähren. Er wusste, wie schlecht der Sold einfacher Soldaten war. Wer die Feldzüge nicht zum Plündern nutzte, hatte kaum etwas vorzuweisen, wenn er nach jahrelangem Dienst endlich nach Hause kam.
Die Schatten fielen bereits lang über den Sand, als Modeno in einem Eingang auftauchte.
„Es ist nichts zu sehen, Capitan“, rief er. „Aber die Höhlen gehen tief in den Berg hinein. Sollen wir weiter suchen?“
Ramon sah sich nach seinen Offizieren um, wollte ihren Rat einholen, doch sie waren nirgends zu sehen.
Sie sind wohl auch in das Pueblo gegangen, dachte er.
„Ja“, rief er dann Modeno zu. „Sucht weiter. Die Indianer müssen Spuren hinterlassen haben.“
Der Soldat nickte und verschwand wieder in der Steilwand. Ramon griff in seine Satteltasche, um seine Zeichnungen herauszunehmen, zögerte jedoch, als eine leichte Brise den Geruch frisch gepflückter Oliven mit sich brachte.
Er zog seine Hand leer heraus und setzte sich auf einen Stein. Tief atmete er den vertrauten Geruch ein, schmeckte das Salz des Meeres auf seiner Zunge.
„Nur einen Moment“, murmelte er, „einen Moment in der Heimat, dann kehre ich hierhin zurück …“
Ramon schloss die Augen. Seine Reise in die Dunkelheit begann.
3
August, 1540
Adelantado Francisco Vásquez de Coronado fluchte seit drei Wochen fast ununterbrochen, sehr zum Leidwesen seines Priesters, Fray Antonio, der in einer Franziskanerkutte schwitzend neben ihm ritt.
„Bei der schwarzen Madonna“, sagte Coronado. „Wie sollen wir die sieben goldenen Städte finden, wenn unsere gottverdammten Spähtrupps noch nicht einmal in der Lage sind, zurück zum Basislager zu finden?“
Fray Antonio warf einen kurzen Seitenblick auf das hagere, sonnenverbrannte Gesicht seines Kommandanten. Hunger und Ehrgeiz hatten ihn vorzeitig altern lassen, so dass er wie ein Mann von fast fünfzig Jahren wirkte, obwohl er nicht älter als vierzig sein konnte.
Er will so sein wie Cortés, dachte er. Spanien und die neue Welt sollen ihm zu Füßen liegen.
Seit Monaten waren sie bereits auf der Suche nach den sieben goldenen Städten, von denen einige Indianer einem schiffbrüchigen spanischen Edelmann berichtet hatten. Unglaubliche Reichtümer warteten dort angeblich auf ihren Entdecker, aber Antonio glaubte nicht an die Existenz dieser Städte – zumindest nicht hier, in der menschenleeren Ödnis der Wüste.
Antonio drehte den Kopf, als ein Offizier, dessen Name ihm nicht einfiel, zu Coronado aufschloss.
„Herr“, sagte der ältere Mann. „Ich würde den Fußsoldaten gerne erlauben, die Brustpanzer abzulegen. Bei dieser Hitze …“
Coronado ließ ihn nicht ausreden. „Nein. Wir sind die Armee des spanischen Königs. Wir werden nicht wie Vagabunden durch dieses Land ziehen.“
„Ja, Herr.“
Antonio presste die Lippen zusammen. Seit dem Verschwinden des Spähtrupps war die Stimmung unter den Soldaten schlechter als je zuvor. Einige vermuteten Ramon del Estevez sei mit seinen Leuten desertiert, um sie der Schinderei ihres Feldherrn zu entziehen.
Vielleicht hatten sie sogar Recht.
„Fray, seht Ihr das?“, riss Coronado ihn aus seinen Gedanken.
Antonio folgte seiner ausgestreckten Hand mit dem Blick und sah zwischen den Felsen etwas in der Sonne blinken.
„Ist das ein Brustpanzer?“, fragte er überrascht.
Coronado spornte sein Pferd an. „Wenn ja, ziehe ich dem Träger persönlich die Haut vom Leib. Das ist Eigentum der Krone.“
Nur Minuten später stoppten sie neben dem Brustpanzer, der halb vergraben aus dem Sand ragte. Coronado fluchte und sah sich um.
„Da hinten ist ein Pueblo“, rief er. Antonio kniff die Augen zusammen, um die Höhlenansammlung in der Steilwand besser erkennen zu können, während Coronado nach seinem Fernrohr griff.
Das Murmeln der Soldaten, die erste Spekulationen ausgetauscht hatten, wurde leiser und verstummte. Eine plötzliche Spannung lag über der Truppe, als jedem bewusst wurde, dass das Rätsel des verschwundenen Spähtrupps kurz vor seiner Klärung stand.
Coronado senkte das Fernrohr und reichte es wortlos an Antonio weiter. Der setzte es an sein Auge. Der runde Ausschnitt der Steilwand sprang ihm förmlich entgegen. Er sah tiefe dunkle Eingänge, gestapelte Tonkrüge und den aufgeblähten Körper eines toten Pferdes.
Erschrocken zuckte er zusammen. Neben dem Pferd lagen einige Helme und Brustpanzer, zwischen denen das Bein eines Soldaten hervorragte. Der Rest seines Körpers war mit Sand bedeckt. Raubvögel flatterten um ihn herum. Ein zweiter Soldat lag nackt und von dunklen Geiern umgeben auf einem Dach des Pueblos.
Antonio setzte das Fernrohr ab und bekreuzigte sich. „Was ist hier nur geschehen?“, flüsterte er.
Jemand kicherte.
Antonio fuhr herum, sah, wie Coronado nach seinem Schwert griff und erstarrte.
„Madre Dios …“
Er wusste nicht, wieso ihnen die Gestalt bis zu diesem Moment entgangen war, vermutete nur, dass es an ihrer reglosen Haltung lag und an dem braunen Sand, der ihren Körper fast mit dem Fels verschmelzen ließ. Sie drehte ihnen den Rücken zu.
Coronado sprang von seinem Pferd.
„Wer bist du?“, schrie er. „Dreh dich um.“
Die Gestalt reagierte nicht, kicherte nur leise weiter. Sie kam Antonio bekannt vor.
Coronado überwand die Distanz zu ihr mit drei langen Schritten. Er hob sein Schwert mit der rechten Hand, packte die Gestalt mit der linken an der Schulter und riss sie herum.
Antonio warf nur einen Blick auf das zerstörte Gesicht von Ramon del Estevez, dann wandte er sich ab und schluckte mühsam bittere Galle herunter. Estevez musste bereits seit Tagen dort sitzen, wenn nicht seit Wochen. Seine Haut war von Brandblasen bedeckt, sein Körper bis auf die Knochen abgemagert. Seine Augen, die blicklos in die Sonne starrten, wurden von einem trüben Film bedeckt.
Ein schmales Wasserrinnsal versickerte vor ihm in einer Felsspalte und war wohl das einzige, was ihn in dieser Zeit am Leben erhalten hatte. Antonio bezweifelte, dass das ein Segen Gottes war, denn Estevez hatte offensichtlich den Verstand verloren. Er kicherte, sabberte und reagierte nicht auf die gebrüllten Fragen der Offiziere.
Nach einer Weile drehte sich Coronado um und sah Antonio an. Unter der Sonnenbräune war sein Gesicht bleich.
„Ich habe heute fünfzig Mann verloren, Fray. Betet für sie.“
Antonio nickte. „Das werde ich.“
Er beobachtete, wie zwei Soldaten Estevez zum Lazarettwagen führten, dann richtete er seinen Blick wieder auf das Pueblo vor ihnen in der Steilwand.
„Wir drehen um und ziehen nach Westen“, hörte er Coronado zu seiner Überraschung befehlen. „Hier oben gibt es keine goldenen Städte.“
Antonio sah ihn an. „Ihr wollt nicht nachsehen, was im Pueblo geschehen ist?“
Coronado spielte nervös mit den Zügeln seines Pferdes. „Das muss ich nicht, Fray. Dort ist etwas Schreckliches geschehen, etwas Böses, das die Körper und Seelen dieser Männer zerschmettert hat. Fünfhundert Schwerter können nichts dagegen ausrichten, auch fünftausend nicht.“
Sein Blick wirkte plötzlich gehetzt. „Ich spüre, wie es nach mir ruft, Fray. Wenn ich ihm nachgebe, werden wir alle sterben.“
Er gab seinem Pferd die Sporen und setzte sich an die Spitze des Trosses, der rasch nach Westen schwenkte.
Antonio blieb einen Moment zurück. Seine Hand griff nach dem Holzkreuz vor seiner Brust.
Was ruft nach ihm?, dachte er. Was ist das für ein Ort?
Er bekreuzigte sich, dann wandte er sein Pferd ab und ritt nach Westen, ohne sich noch einmal umzudrehen.
4
New Mexico, Gegenwart
Timothy Lennox wischte sich den Schweiß von der Stirn.
„Ganz ruhig“, sagte er. „Und jetzt zieh das Lenkrad langsam auf dich zu …“
Der Gleiter schwang plötzlich wie eine Schaukel nach oben.
„Hey, langsam!“
Marrela warf ihm einen kurzen nervösen Blick zu und schloss die Hände so fest um das Steuer, dass ihre Knöchel weiß hervortraten.
„Schrei mich nicht an, Tinnox. Ich versuche zu beten.“
Tim legte ihr beruhigend eine Hand auf den Arm. „Du sollst nicht beten, du sollst fliegen. Stell dir einfach vor, du sitzt auf einer Androne, nur ohne den furchtbaren Gestank. Das Lenkrad ist dein Zügel, die Pedale unter deinen Füßen ersetzen den Kniedruck, okay?“
Marrela nickte verkrampft. Tim wusste, dass er seine Gefährtin mit der Aufgabe überforderte, denn sie lebte in einer Welt ohne Maschinen, in der die meisten Menschen vor einem solchen Fluggerät geflohen wären und an das Werk böser Geister geglaubt hätten.
Sie hatte keine Ahnung von den Gesetzen der Thermik oder von der Funktion der Magnetstrahlen, die den Gleiter auf immerhin fünfzehn Meter Höhe hoben und ihn bis zu achtzig Stundenkilometer schnell sein ließen. Und doch hatte sie sich auf eine Flugstunde eingelassen, auch wenn es Tim fast vier Tage gekostet hatte, sie davon zu überzeugen.
Unter normalen Umständen hätte er vielleicht nicht so sehr darauf beharrt, aber die inzwischen drei Wochen zurückliegenden Ereignisse hatten seinen instinktiven Glauben an die eigene Unverwundbarkeit gehörig ins Wanken gebracht.
Er war bei der Flucht vor einem Rudel Mutanten in eine Felsspalte gestürzt und hatte sich das Bein gebrochen. In seiner Zeit wäre das nicht mehr als ein schmerzhafter Unfall gewesen, aber hier in der fast menschenleeren Wildnis hätte ihn dieser Unfall das Leben kosten können. Tim schauderte bei dem Gedanken, was ohne die Menschen, die in einem nahegelegenen Tal lebten, mit ihm geschehen wäre. Sie hatten ihn versorgt – sehr gut sogar – und er hoffte, dass er ihnen im Gegenzug geholfen hatte, ein neues Leben zu beginnen, denn ihre Gemeinschaft war in einem Jahrhunderte alten Rollenspiel erstarrt.
Tim spürte einen Ruck, als der Gleiter in ein Luftloch geriet. Aus den Augenwinkeln sah er, dass Marrela aus eigenem Antrieb gegensteuerte und den Höhenverlust ausglich. Sie schien ein Gefühl für die Maschine zu bekommen.
„Bei meiner ersten Flugstunde habe ich mich wesentlich dümmer angestellt“, log er. „Du machst das richtig gut.“
Marrela wagte nur einen kurzen Seitenblick, bevor sie sich wieder auf die Steuerung konzentrierte. Ihr Gesichtsausdruck war angespannt, ihre Lippen bewegten sich stumm.
„Betest du?“, fragte Tim.
„Ja.“
Ihre Antwort versetzte ihm einen Stich, nicht etwa, weil er Marrela in eine Lage gebracht hatte, in der sie aus lauter Todesangst Hilfe bei den Göttern suchte, sondern weil sie sich für ihn darauf eingelassen hatte – nur für ihn.
„Marrela, ich weiß, dass es hart für dich ist, und ich würde dich nicht darum bitten, wenn es nicht unbedingt nötig wäre, dass du diesen Gleiter beherrschst. Unser Leben …“
„Es geht mir nicht um das Fliegen“, unterbrach sie ihn. „Das ist schwer, aber kein Grund, die Götter anzurufen. Achte lieber auf das, was sich unter uns befindet.“
Tim runzelte die Stirn und warf einen Blick aus dem Cockpit. In den letzten Stunden hatte sich die Landschaft, die zehn Meter tiefer vorbeiglitt, verändert. Die braungelben Farben der Wüste waren dunklem Vulkangestein gewichen, durch das sich Lavaströme wie Adern zogen. Nur noch vereinzelt sah man die Canyons und Wüstenebenen, die so typisch für diesen Teil New Mexicos gewesen waren.
„Ein bisschen trostlos“, sagte Tim, „aber solange wir die Landung in einer von diesen Lavapfützen vermeiden, nicht sonderlich gefährlich. Was macht dir solche Sorgen?“
Marrela sah weiter geradeaus, als sie antwortete: „Du musst lernen, die Götter besser zu verstehen und nicht über sie zu lachen, Tinnox. Die Landschaft unter uns ist von Orguudoos Zorn gezeichnet. Wenn immer du Lava siehst, weißt du, dass ein Einstieg zu seinem Reich nicht weit und seine Macht an diesem Ort groß ist.“
Orguudoo, dachte Tim. Er war eine Mischung aus Satan und Totengott und lebte nach dem Glauben der Wandernden Völker tief unter der Erde. In den Top 10 der beliebtesten Götter suchte man ihn vergeblich.
„Orguudoo ist ein Gott der Erde“, sagte er betont ernsthaft, um zu beweisen, dass er zumindest etwas über die Götter gelernt hatte. „In der Luft sind wir sicher.“
„Eben nicht. Jeder Andronenreiter weiß, dass Orguudoo vor Zorn erbebt, wenn Menschen es wagen, den Boden zu verlassen. Deshalb tragen sie ja Schutzamulette.“
„Und da wir keine haben, musst du beten, um uns vor seinem Zorn zu schützen.“
Marrela nickte, sichtlich erleichtert, dass er das Problem endlich begriffen hatte.
„Ich hoffe“, fügte sie hinzu, „dass wir dieses Gebiet bald hinter uns lassen. Es ist sehr anstrengend, zu fliegen und zu beten.“
Tim verkniff sich ein Grinsen. Er dachte daran, dass Marrela in ihrem Leben noch keinen Lichtschalter gesehen hatte, sich aber in dieser Situation weniger Sorgen über den Absturz einer ihr völlig fremden Maschine machte, als über den Zorn eines imaginären Gottes. Nur sagen konnte er ihr das natürlich nicht.
„Wir …“
… kriegen das schon hin, wollte er antworten, aber etwas, das sich am Horizont aus der flimmernden Hitze der Vulkanlandschaft schob, ließ ihn abbrechen. Einen Augenblick lang glaubte er an eine Luftspiegelung, doch dann wurde das Bild klarer, bis es so real war wie die Landschaft unter dem Gleiter.
Es war eine Felswand, die machtvoll und unerwartet vor ihnen aufragte und sich, wie die in Stein gemeißelte Treppenstufe eines Riesen, schier endlos am Horizont entlang zog. Sie musste mehr als dreißig Meter hoch sein und Hunderte von Meilen lang.
Dreißig Meter, dachte Tim. Mit einem richtigen Flugzeug wäre das nur ein Hüpfer, aber diese Kiste schafft noch nicht einmal die Hälfte. Shit …
Ein Teil von ihm fragte sich, wie diese Felswand entstanden war, denn zu seiner Zeit hatte es sie noch nicht gegeben, soviel war sicher. Sie musste das Ergebnis einer furchtbaren Naturkatastrophe sein, bei der ein Teil der Landschaft sich wie eine Falte über den Rest geworfen hatte.
„Es wird schwierig werden, die Wand zu umfliegen“, riss ihn Marrelas Stimme aus seinen Gedanken. „Unsere Vorräte sind aufgebraucht, und hier gibt es kaum Wild.“
Die Rollenspieler hatten ihnen zwar Dörrfleisch und Mehl mitgegeben, aber nach einer Woche war fast nichts mehr davon übrig, und die Jagdaussichten in der lebensfeindlichen Vulkanlandschaft standen mehr als schlecht.
„Du hast Recht“, sagte Tim. „Wir haben keine Ahnung, wie lang die Wand ist. Wir könnten verhungern, bevor wir das Ende erreichen.“
„Dann lass uns zurückfliegen und einen großen Bogen nach Süden schlagen. Dort können wir unsere Vorräte aufbessern.“
Und Orguudoo aus dem Weg gehen, fügte Tim lautlos hinzu. Ihm war klar, dass Marrela nicht länger in der Nähe der Vulkane bleiben wollte, aber wenn er ihrem Vorschlag folgte, verloren sie mehrere Wochen auf dem Weg nach Kalifornien.
„Wie wär's damit?“, sagte er. „Wir sehen uns die Wand erst mal an. Vielleicht finden wir ja einen Weg, um den Gleiter auf die andere Seite zu bringen. Und wenn nicht, fliegen wir zurück. Okay?“
Marrela schwieg einige Minuten, dann sah sie ihm zum ersten Mal seit Beginn ihrer Unterhaltung länger in die Augen.
„Wenn wir landen, Tinnox, wird Orguudoo uns vielleicht nicht mehr gehen lassen. Wir müssen sehr vorsichtig sein.“
Tim lag eine leichtfertig optimistische Bemerkung auf den Lippen, aber bevor er sie aussprechen konnte, fiel sein Blick auf die größer werdende Felswand.
„Ein Pueblo“, sagte er überrascht. „Marrela, dort leben Menschen.“
Eine innere Stimme flüsterte ihm zu: Menschen, die Orguudoo nicht gehen lässt …
Tim schüttelte den Gedanken ab.
5
Marrela sprang aus dem Gleiter und atmete auf, als sie den warmen Wüstenboden unter den Fußsohlen spürte. Das Fliegen in einer Maschine machte ihr zwar keine Angst mehr, aber auf der Erde fühlte sie sich immer noch sicherer – selbst wenn sie nicht weit von Orguudoos Reich entfernt war.
Sie hatte einen Landepunkt gefunden, der von den Vulkanausbrüchen verschont geblieben war und unmittelbar vor der kleinen Schlucht lag, hinter der sich die Wand aus Fels und Erde erhob.
Marrela drehte sich um zu Tinnox, der auf der anderen Seite ausstieg und auf den Rand der Schlucht zuhinkte. Seine Verletzungen heilten viel schneller, als sie vermutet hatte. Sogar die Krücken benötigte er mittlerweile kaum noch. Sie musste sich eingestehen, dass die medizinischen Kenntnisse der Rollenspieler – die sie immer noch für verrückt hielt – denen ihres Volkes weit überlegen waren. Selbst Tinnox schien überrascht über die schnellen Fortschritte zu sein, dabei stammte er aus einer Welt, die einst voller Wunder gewesen war.
„Sieh dir das an“, sagte er. „Dieses Pueblo muss Jahrhunderte alt sein.“
Marrela trat neben ihn, den Kopf in den Nacken gelegt. Hoch über ihr verlor die Steilwand ihre natürliche Schroffheit und zeigte deutliche Spuren menschlicher Bearbeitung. Bauten aus Lehm und Stein klebten wie Vogelnester in der Wand. Leitern verbanden dunkle Eingänge miteinander, ragten von den Dächern hinauf zu den nächsten Ebenen, die schließlich kurz unterhalb des Rands endeten. Es war eine verwirrende Ansammlung von Gebäuden und Gängen, die einer Ordnung zu folgen schienen, die Marrela nicht verstand. Trotzdem hatte sie bereits nach dem ersten Blick großen Respekt vor einem Volk, das solche Leistungen vollbringen konnte.
Tinnox zeigte auf die unterste Ebene des Dorfs, die mehr als einen Speerwurf vom Boden entfernt war.
„Das war wohl früher das Erdgeschoss. Eine Katastrophe, vielleicht ein gewaltiges Erdbeben, hat die Wand nach oben geschoben, mitsamt dem Pueblo.“
Marrela runzelte die Stirn. „Und die Leitern sind stehen geblieben?“
„Das ist nicht sehr wahrscheinlich“, gab Tinnox nachdenklich zu. „Aber wenn die Bewohner noch nach der Katastrophe hier waren, warum haben sie keinen Weg nach unten gebaut?“
„Damit sie sich besser vor ihren Feinden schützen konnten?“, sagte sie ohne wirkliches Interesse. Die Rätsel der Vergangenheit schienen Tinnox immer wieder aufs Neue zu faszinieren. Marrela ahnte, dass er durch ihre Lösung eine Verbindung zu seiner alten Welt suchte und vielleicht auch eine Erklärung für sein eigenes Überleben.
Dabei hat das keinen Einfluss auf unser Leben, dachte sie. Wir bringen uns nur unnötig in Gefahr.
Von der Reise nach Kalifornien hielt sie ebenfalls wenig, aber das verschwieg sie Tinnox. Ein Teil von ihr verstand sein Bedürfnis, die Stadt wiederzusehen, in der er aufgewachsen war, auch wenn sie nicht wusste, was er dort zu finden hoffte. Ein anderer Teil fragte sich jedoch, wie es danach weitergehen sollte. Würde er endlich mit der Vergangenheit abschließen können und aufhören, sich wie ein Fremder in ihrer Welt zu fühlen?
Tuakum he
Marrela zuckte zusammen.
„Was hast du gesagt?“, fragte sie mit einer Stimme, die in ihren eigenen Ohren müde und fremd klang.
Tinnox sah sie sichtlich irritiert an. „Ich habe vorgeschlagen, zum Pueblo hinaufzusteigen und nachzusehen, ob wir dort etwas Nützliches finden können. Die Wand ist so zerklüftet, dass der Weg kein Problem sein sollte.“
Er wartete ihre Antwort nicht ab, sondern hinkte zurück zum Gleiter. „Lass uns ein Lager am Boden der Schlucht aufschlagen. Dort können wir die Nacht verbringen.“
Marrela öffnete den Mund, war für einen Moment damit beschäftigt, all die Argumente, die gegen diese Idee sprachen, zu sortieren.
„Tinnox“, sagte sie dann, „was ist mit den Vorräten? Wir haben fast nichts mehr zu essen und hier gibt es keine Nahrung … und wie willst du mit einem gebrochenen Bein zu diesem Dorf klettern? Hast du darüber nachgedacht?“
„Natürlich“, gab er aus dem Gleiter zurück, den Blick auf die Höhlen im Fels gerichtet. „Das Bein ist fast verheilt, und bis morgen werden wir auch nicht verhungern.“
Er grinste unerwartet. „Komm schon, es geht doch nur um eine Nacht. Morgen früh kehren wir um und schlagen den Bogen nach Süden. Einverstanden?“
Marrela wusste, dass sie dem nichts entgegenzusetzen hatte. Eine Nacht und das Versprechen, danach aus Orguudoos Gegenwart zu flüchten – mehr konnte sie nicht verlangen.
„Einverstanden.“
Tuakum he
6
Tim schob sich über eine letzte Felskuppe und blieb erschöpft auf dem warmen Stein liegen. Er bemerkte Marrela, die auf ihr Schwert gestützt vor ihm stand und den Kopf schüttelte.
„Warum musst du unbedingt selbst auf diese Felsen klettern?“, fragte sie vorwurfsvoll. „Ich hätte dir berichten können, was es hier oben gibt.“
Tim richtete sich auf und ergriff ihre ausgestreckte Hand. „Du hast mir zwei Wochen lang alles berichtet. Es wird Zeit, dass ich mir die Dinge wieder selbst ansehe.“
„Du solltest die Götter darum bitten, dir Geduld zu schenken, Tinnox.“
Er ließ sich von Marrela auf die Füße ziehen und hob die Schultern.
„Vielleicht sollte ich das, aber …“
Tim brach ab, als er zum ersten Mal einen Blick auf das Pueblo warf. Er stand am Eingang einer scheinbar natürlich entstandenen Höhle, deren Wände mit bunten Zeichnungen bedeckt waren. Schlangenlinien, Punkte und dunkle Figuren mit überlangen Gliedmaßen lösten sich in einer strikten Reihenfolge ab. An anderen Stellen waren abstrakte Symbole direkt in den Stein gemeißelt worden. Zahlreiche Leitern ragten aus Löchern bis zum Boden, und im hinteren Teil der Höhle zweigten Gänge ab, die sich in der Dunkelheit verloren.
Wie der Eingang eines riesigen Termitenhügels, dachte Tim. Das ist kein Dorf, sondern eine ganze Stadt.
Er drehte sich um und hinkte zu einer Reihe von kunstvoll bemalten Tonkrügen, die in der Nähe des Eingangs standen. Vorsichtig nahm er einen Deckel ab und bemerkte beinahe unterbewusst, dass sich kein Staub darauf befand.
Marrela trat neben ihn.
„Ist das Mehl?“, fragte sie mit einem Blick auf das trockene weiße Pulver, das den Krug bis zum Rand füllte.
„Ich weiß nicht.“
Tim bedeckte seine Handfläche mit dem weißen Pulver und roch misstrauisch daran. Er zögerte einen Moment, dann berührte er es mit der Zungenspitze, bereit, das Pulver sofort wieder auszuspucken.
„Das ist tatsächlich Mehl“, sagte er überrascht. „Hier leben Menschen.“
Instinktiv griff er nach seiner Waffe, während Marrela sich langsam im Kreis drehte. Erst jetzt fiel ihm auf, wie still es an diesem Ort war. Selbst das ferne Grollen der Vulkane reichte nicht bis in die Höhle hinein. Wenn sich die Dorfbewohner wirklich vor ihnen verbargen, dann hatten sie sich tief in das Pueblo zurückgezogen.
Können Hunderte von Menschen so still sein?, dachte Tim. Aus den Augenwinkeln sah er, wie Marrela ihr Schwert an die Wand lehnte, sich auf den Boden setzte und die Beine anzog. Ihr Gesicht nahm einen entspannten Ausdruck an, dann schloss sie die Augen.
Sie versucht zu lauschen, erkannte er. Sie wird die Gedanken der Dorfbewohner wahrnehmen, wenn sie noch hier sind.
Marrelas telepathische Fähigkeiten waren ihm längst nicht mehr so unheimlich wie zu Beginn ihrer Beziehung. Er hatte sich daran gewöhnt und sie als Vorteil schätzen gelernt – wenn man einmal von den wenigen Gelegenheiten absah, wo er so bei einer Lüge ertappt worden war.
Einige Minuten verstrichen, dann öffnete Marrela die Augen. „Wir sind allein. Es ist niemand hier.“
„Bist du sicher?“
„Ja.“
Sie stand auf nahm das Schwert wieder in die Hand.
„Was ist ein Pueblo?“, fragte sie übergangslos.
Tim riss sich von den Spekulationen los, die ihm durch den Kopf schossen.
„Das spanische Wort für Dorf“, sagte er. „Die Spanier … das war ein Volk aus Euree … nannten so die Ureinwohner, die sie in diesem Teil des Kontinents fanden. Sie lebten in solchen Felsdörfern, und die Spanier glaubten, dass sie große Mengen Gold besaßen.“
„Haben sie gegeneinander gekämpft?“
„O ja, die Stämme kämpften zuerst gegen die Spanier, dann gegen die Franzosen, die Engländer, die Mexikaner und schließlich gegen die Amerikaner.“
Indianische Stammesnamen, die er längst vergessen geglaubt hatte, drängten in sein Bewusstsein zurück. Navajo, Zuni, Apachen, Hopi … Tausende waren in den ungleichen Kämpfen gestorben.
„Wer hat gewonnen?“
Marrelas Frage klang ebenso naiv wie berechtigt. Tim sah sie an und lächelte bedauernd.
„Meine Vorfahren“, sagte er, „kamen über dieses Land wie Alxanatan über die Erde. Sie hinterließen Tod und Zerstörung.“
Er betrachtete die Zeichnungen an der Wand. „Aber die Stämme haben sich gerächt mit dem Bau von Casinos, dem Verkauf von zollfreien Zigaretten und der Vier-Stunden-Fassung von Der mit dem Wolf tanzt.“
Tim lachte, als er Marrelas verwirrten Gesichtsausdruck sah. „Mach dir keine Gedanken darüber, das ist über fünfhundert Jahre her. Wir sollten uns eher mit der Frage beschäftigen, was mit dem Stamm passiert ist, der hier gelebt hat.“
Er ging in die Hocke und strich mit den Fingerspitzen über ein eingeritztes Symbol, das wie ein Mensch mit Antilopenhörnern aussah. Ein wenig betroffen musste er sich eingestehen, dass sein Wissen über die Ureinwohner – oder eingeborene Amerikaner, wie man sie zu seiner Zeit politisch korrekt genannt hatte – dem der meisten Südkalifornier entsprach. Er wusste, dass es sie gab, aber die Kultur der Stämme war ihm immer fremd geblieben.
Trotzdem ahnte er, dass sich hinter dem verlassenen Pueblo und den seltsamen Symbolen ein Geheimnis verbarg, das nur darauf wartete, gelüftet zu werden.
Tim spürte Marrelas Hand auf seiner Schulter.
„Lass uns zurück zum Gleiter gehen“, sagte sie. „Es wird bald dunkel.“
Er nickte abwesend, während sein Blick nach Übereinstimmungen zwischen dem eingeritzten Symbol und den Wandmalereien suchte.
„Geh schon vor. Ich sehe mich noch ein wenig um.“
Es überraschte ihn, dass Marrela nicht widersprach. Sie ließ nur die Hand von seiner Schulter gleiten, dann hörte er, wie sich ihre Schritte entfernten.
Tim blieb zurück, allein.
„Tuakum he“, murmelte er.
7
Marrela konnte sich kaum noch auf den Beinen halten, als sie endlich den Gleiter erreichte. Tim hatte so darauf gedrängt, die Höhlen zu besuchen, dass sie noch nicht einmal Feuerholz gesammelt hatten. Bestimmt gab es in der Nähe einige abgestorbene Bäume, aber Marrela fand nicht die Kraft, einen Gedanken daran zu verschwenden. Zu schwer lastete die Müdigkeit auf ihr.
Mit einer Hand hielt sich Marrela an der Tragfläche des Gleiters fest, mit der anderen griff sie hinein und zog einige Felle heraus, die ihr und Tim als Decken dienten. Sie machte sich nicht die Mühe, sie auf dem Boden auszubreiten, sondern wickelte nur ihren Körper darin ein, bevor sie zusammensackte.
Und wieder hochschreckte.
Es war Nacht, eine sternenklare, kalte Dunkelheit, in der sich die Umrisse der Felsen schwarz vor dem Himmel abzeichneten.
Marrela tastete instinktiv den Boden neben sich ab, fand jedoch nur Sand. Tinnox schien nicht bei ihr zu sein.
Sie setzte sich auf. Die Müdigkeit war aus ihrem Körper verschwunden, obwohl sie nicht länger als drei oder vier Stunden geschlafen haben konnte. Die Felle fühlten sich klamm an, als hätte sie im Traum geschwitzt.
Etwas hat mich geweckt, dachte Marrela und stand auf. Eine Welle des Schwindels und der Orientierungslosigkeit schwappte über ihren Geist, als sie begriff, dass sie nicht mehr wusste, wo sie war.
Die Schlucht, in der sie gelegen hatte, war verschwunden. Stattdessen stand Marrela auf einer Ebene, die unter dem funkelnden Sternenhimmel endlos erschien.
Verwirrt drehte sie sich um, sah den Gleiter und keine zehn Schritte davon entfernt den Höhleneingang, zu dem sie und Tinnox hinaufgeklettert waren. Jetzt lag er fast ebenerdig, mit einer Leiter, die bis auf den Boden ragte.
„Ich träume“, sagte Marrela leise.
Die Erkenntnis gab ihr Sicherheit. Sie legte die Felle ab und ging auf die Leiter zu. Das Holz der Sprossen fühlte sich rau unter ihren Fingern an, als sie es berührte – rau und wirklich.
Marrela bemerkte rötlichen Feuerschein, der aus der Höhle drang und über ihrem Kopf waberte. Sie hörte Stimmen, verstand jedoch die Worte nicht, die gesprochen wurden. Langsam stieg sie die Leiter empor.
Nach nur drei Sprossen konnte Marrela über den Rand der Felsen hinwegsehen. Ein Lagerfeuer brannte in der Mitte der großen Höhle und erweckte die Wandmalereien mit seinem flackernden Schein zum Leben. Männer, Frauen und Kinder saßen auf Fellen zusammen und tunkten Fladenbrote in Holzschüsseln, die voller dunkler Fleischstücke waren. Ihre Haare waren lang und schwarz, die Haut braun, wie von der Sonne verbrannt. Die meisten Männer trugen Zöpfe, in die Vogelfedern und mit Türkisen bestückte Lederbänder eingewoben waren. Einige bedeckten ihren Körper nur mit einem Lendenschurz, während andere in bunt bestickte Roben gehüllt waren.
Marrela duckte sich unwillkürlich, als ein alter, fast völlig ergrauter Mann umständlich vom Feuer aufstand und zum Eingang ging. Er kam direkt auf sie zu.
Es ist nur ein Traum, dachte Marrela. Die Götter zeigen mir, wie die Stämme hier gelebt haben. Es macht nichts, wenn man mich entdeckt.
Mit diesem Gedanken richtete sie sich auf und trat vor die Höhle.
„Ich komme in Frieden“, sagte sie, aber der alte Mann sah noch nicht einmal zur Seite, als er leise vor sich hinmurmelnd an ihr vorbeiging. Auch die anderen Menschen ignorierten sie, aßen und redeten ungestört weiter.
Marrela fühlte sich wie ein Geist. Unschlüssig machte sie einige Schritte in die Höhle hinein, spürte die Wärme des Feuers auf ihrer Haut und roch unbekannte Gewürze, auf die ihr Magen mit eindeutigem Knurren reagierte.
Sie ging an den Feuern vorbei und näherte sich einer Gruppe von Männern, die mit nackten Oberkörper neben einer Leiter standen und sangen. Ihre Arme und Beine waren bemalt, in den Haaren steckten Vogelfedern. In ihrer Mitte hockte ein Wesen, das Marrela im ersten Moment für einen Dämon hielt, aber nach einem weiteren Blick als Mann erkannte, der das Geweih eines Tieres auf dem Kopf trug und in ein Fell gehüllt war. Während Marrela um die Gruppe herumging, richtete er sich auf, und sie sah, dass er eine Schale in der Hand hielt. Sie blieb stehen, beobachtete, wie er den Daumen hineintunkte und die Brust eines Mannes mit Farbe bestrich.
Ein Schamane, erkannte Marrela, die in Sorbans Horde ähnliche Rituale erlebt hatte und selbst schützende Farbstreifen auf den Körper trug. Er bereitet die Krieger für die Jagd oder einen Kampf vor.
Neugierig näherte sie sich den Männern. Der Schamane brachte die letzten Symbole an, dann neigte er den Kopf und tauchte die Spitzen des Geweihs in die Schale. Sie glänzten feucht und dunkel, als er sie wieder herauszog.
Der Gesang verstummte. Die Krieger wandten sich ab und gingen zu den Feuern, während der Schamane Fell und Geweih ablegte. Überrascht bemerkte Marrela, dass er für eine so verantwortungsvolle Position im Stamm noch sehr jung war. Sie schätzte ihn auf knapp dreißig Winter.
Der Schamane hockte sich auf den Boden, zögerte und richtete seinen Blick direkt auf Marrela.
„Geh weg“, sagte er.
8
Marrela öffnete die Augen und blinzelte in das helle Licht der Mittagssonne. Das Fell, unter dem sie lag, war schweißnass. Mit einer Hand warf sie es zur Seite und setzte sich auf. Erleichtert bemerkte sie, dass die Felswände zu beiden Seiten wieder aufragten; sie war zurück in ihrer eigenen Welt.
Wieso haben die Götter mir das gezeigt?, fragte sie sich. War es eine Warnung, diesen Ort schnell zu verlassen?
„Du hast lange geschlafen.“
Marrela zuckte erschrocken zusammen und drehte den Kopf. Tinnox saß hinter ihr auf einem Felsen, das linke Bein ausgestreckt. Die Krücken lagen neben ihm.
„Geht es deinem Bein schlechter?“, fragte sie besorgt.
„Nein, ich habe es nur zu viel bewegt. Dieses Pueblo … es …“
Er schüttelte den Kopf, ohne den Satz zu beenden. „Ich habe versucht dich zu wecken“, sagte er stattdessen, „aber du wurdest einfach nicht wach.“
Marrela dachte an ihren Traum und sah unwillkürlich hinauf zu dem Punkt der Felswand, hinter dem sich der Höhleneingang verbarg.
„Wir sollten diesen Ort verlassen. Es gibt hier Geister, die sich von uns gestört fühlen.“
Sie stand auf. „Aber zuerst werde ich auf die Jagd gehen. Wir brauchen Fleisch für die Reise.“
„Hier willst du jagen?“ Tinnox klang skeptisch. „Ich glaube nicht, dass du irgendwas finden wirst.“
Marrela wandte den Blick von der Felswand und sah für einen Lidschlag das Bild des Schamanen mit seinem Geweih vor sich.
„Ich werde etwas finden“, sagte sie. „Das habe ich im Traum gesehen.“
Sie achtete nicht auf Tinnox' Antwort, sondern ging auf die nächste Biegung der Schlucht zu. Er verweigerte den Göttern den nötigen Respekt und glaubte nicht an die Macht von Visionen und Träumen. Sie machte ihm das nicht zum Vorwurf, bedauerte nur, dass er die Welt so unvollkommen wahrnahm und keinen Zugang zu den Geheimnissen des Geistes hatte. Sogar ihrer Frage nach den Göttern seiner Zeit war er ausgewichen, als wäre sie ihm unangenehm.
Marrela blieb stehen und betrachtete einen abgestorbenen Baum. Die Rinde war intakt und es gab auch sonst kein Anzeichen, dass sich ein größeres Tier daran gerieben hatte. Trotzdem war sie sicher, dass sie auf Beute stoßen würde. Schließlich hatte sie in ihrer Vision Vorbereitungen für eine Jagd gesehen.
Sie setzte sich auf den sandigen Boden. Vielleicht war es besser, nicht ziellos zu jagen, sondern sich Klarheit mit einem neuen Traum zu verschaffen.
Marrela schloss die Augen …
9
… und sah das Tier direkt vor sich. Es war etwas kleiner als ein Deer, hatte hellbraunes Fell und ein breites Geweih, das zu beiden Seiten der aufgerichteten Ohren vom Kopf abstand. Vollkommen ruhig verharrte es neben einem Felsen und starrte hinaus auf die endlos erscheinende Ebene.
Es bemerkt mich nicht, dachte Marrela und stand auf. Die Flanken des Tiers zitterten leicht, als der Wüstenwind heißen Sand aufwirbelte.
Einem Impuls folgend streckte Marrela die Hand aus. Ihre Fingerspitzen berührten das warme weiche Fell, strichen sanft darüber.
Im gleichen Moment brach das Tier zusammen. Sein Kopf schlug mit einem berstenden Geräusch gegen den Felsen; Blut spritzte aus zwei Wunden, in denen hölzerne Speere steckten.
Marrela fuhr herum und bemerkte eine Gruppe von Kriegern, die sich im Laufschritt dem erlegten Tier näherten. Sie erkannte die Männer, die in der Nacht zuvor vom Schamanen bemalt worden waren. Jetzt beugten sie sich über das Tier, banden ihm die Hufe zusammen und zogen einen Stock hindurch, um es besser tragen zu können. Dabei unterhielten sie sich in einer guttural klingenden Sprache, die Marrela fremd war. Sie dachte an den Schamanen, der Geh weg zu ihr gesagt hatte und fragte sich, weshalb sie ihn verstanden hatte.
Zwei Krieger nahmen das Tier zwischen sich und folgten den anderen auf dem Weg zurück zum Dorf. Die grünen, von Bewässerungsgräben durchzogenen Felder, die sie dabei passierten, hoben sich wie Fremdkörper aus der gelbbraunen Landschaft ab.
„Ich bringe die Beute zu ihnen“, sagte eine Stimme hinter ihr. „Mein Ruf lockt sie an.“
Marrela drehte den Kopf, ahnte bereits, wer mit ihr sprach, noch bevor sie den Schamanen auf dem Boden hocken sah. Er legte eine Hand in das rasch versickernde Blut des toten Tiers und strich damit über seine Stirn.
Dann sah er Marrela aus dunklen Augen an. „Wieso bist du zurückgekommen?“
Sie hob die Schultern. „Weil es mir wichtig erschien. Was ist das für ein Ort?“
Der Schamane stand auf und ging langsam auf die grünen Felder zu. Marrela folgte ihm, unschlüssig darüber, was die Vision zu bedeuten hatte.
„Du bist durch das Sipapu gekommen“, sagte der Schamane schließlich, als sie das Dorf fast erreicht hatten. „Weißt du, was das ist?“
„Nein.“
„Sie weiß es nicht und doch hat sie den Weg gefunden. Wie kann das sein?“ Er klang, als spreche er mit einer anderen, unsichtbaren Person, und Marrela ertappte sich bei dem Gedanken, dass er wahnsinnig sein könnte. Man erzählte sich, dass Göttersprecher und Schamanen häufiger als andere Menschen unter einem verwirrten Geist litten, weil sie zu viel sahen und zu wenig verstanden.
„Vielleicht“, sagte sie, „kenne ich das Sipapu unter einem anderen Namen.“
Der Schamane warf ihr einen beinahe mitleidigen Blick zu. „Es gibt nur diesen einen Namen, so wie es nur diesen einen Ort gibt. Du bist ein Yiet'zu, du weißt nichts von diesen Dingen.“
Sein Blick blieb an den Symbolen auf ihrem Körper hängen. Er zog die Augenbrauen zusammen, so als irritiere ihn, was er sah.
„Was ist ein Yiet'zu?“, fragte Marrela.
Der Schamane lächelte. „Ein Ungeheuer mit weißer Haut und Waffen aus Eisen. Die Prophezeiungen sprachen von vielen Yiet'zu, die wie Heuschrecken über uns kommen würden, aber das liegt lange zurück.“
„Ich bin kein Yiet'zu. Ich bin ein Mensch.“
„Wenn das stimmt“, sagte der Schamane, „warum reist du dann mit einem Ungeheuer?“
Der Gedanke versetzte Marrela einen Stich. Sie öffnete die Augen.
10
„Tinnox!“
Marrela sprang auf. Die Felswände, die sich zu beiden Seiten aufrichteten, schienen sie erdrücken zu wollen. Sie wusste nicht, weshalb sie plötzlich voller Panik war, ahnte nur, dass sie die Schlucht schnellstens verlassen musste, bevor das, was mit ihr geschah, endgültig die Kontrolle übernahm.
Atemlos erreichte Marrela das Lager. Es war später Nachmittag, und die Schatten der Felsen fielen lang über den Gleiter und die ausgebreiteten Felle.
Tinnox war nirgendwo zu sehen. Mit einem Blick bemerkte Marrela, dass sein Wasserschlauch und zwei Felle verschwunden waren. Sie sah hinauf zur Felswand, zu dem Punkt, hinter dem sich der Höhleneingang verbarg.
„Tinnox!“