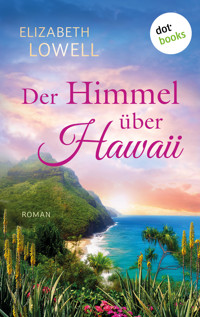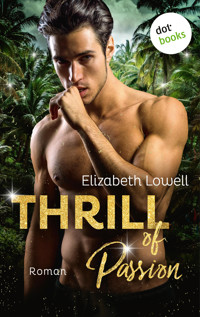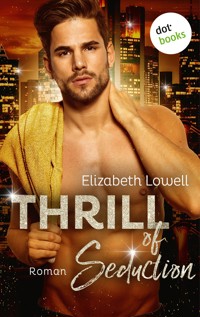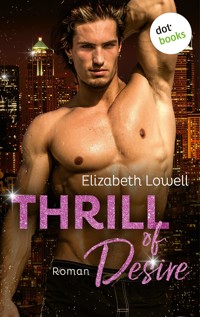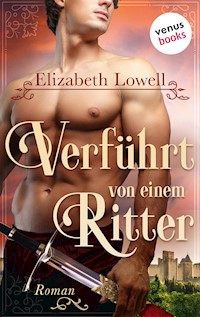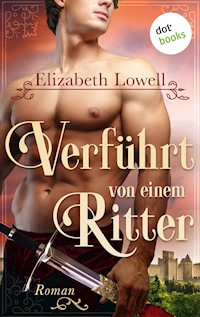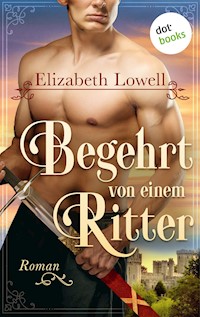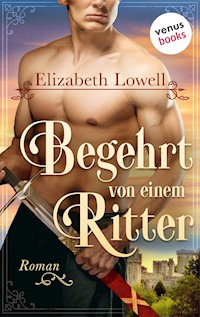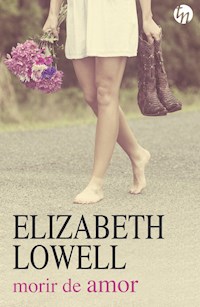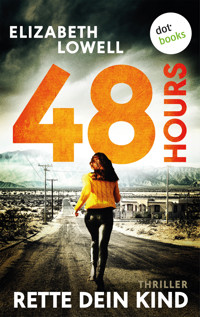
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In den Fängen der mexikanischen Mafia: Der packende Thriller »48 Hours – Rette dein Kind« von Elizabeth Lowell als eBook bei dotbooks. »Kommen Sie sofort nach Mexiko – sonst stirbt Ihr Sohn.« Worte, die jede Mutter in Panik versetzen würden – auch die Richterin Grace Silva: Ihr Exmann Ted hat sich die falschen Leute zu Feinden gemacht. Nun ist ihr Sohn Lane als Geisel in ihren Händen. Genau 48 Stunden bleiben Grace, um die Forderungen eines mexikanischen Gangsterbosses zu erfüllen, bevor er sein Urteil vollstreckt. Ihr bleibt nichts anderes übrig, als sich an den Entführungsspezialisten Joe Faroe zu wenden – ausgerechnet den Mann, mit dem sie eine dunkle Vergangenheit verbindet. Wird er ihr helfen, Lane zu retten? In diesem Moment höchster Not muss Grace sich eingestehen, dass ihr Herz insgeheim noch immer für Joe schlägt – doch ihre Liebe könnte sie und Lane in tödliche Gefahr bringen ... »Brillant mischt Lowell Gefahr, Täuschung und Verlangen zu einer fesselnden Geschichte.« Booklist Jetzt als eBook kaufen und genießen: »48 Hours – Rette dein Kind« von Elizabeth Lowell, der fesselnde Thriller mit einer Prise romantischem Prickeln für Fans der Bestsellerautorinnen Lisa Jackson und J. D. Robb. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 580
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
»Kommen Sie sofort nach Mexiko – sonst stirbt Ihr Sohn.« Worte, die jede Mutter in Panik versetzen würden – auch die Richterin Grace Silva: Ihr Exmann Ted hat sich die falschen Leute zu Feinden gemacht. Nun ist ihr Sohn Lane als Geisel in ihren Händen. Genau 48 Stunden bleiben Grace, um die Forderungen eines mexikanischen Gangsterbosses zu erfüllen, bevor er sein Urteil vollstreckt. Ihr bleibt nichts anderes übrig, als sich an den Entführungsspezialisten Joe Faroe zu wenden – ausgerechnet den Mann, mit dem sie eine dunkle Vergangenheit verbindet. Wird er ihr helfen, Lane zu retten? In diesem Moment höchster Not muss Grace sich eingestehen, dass ihr Herz insgeheim noch immer für Joe schlägt – doch ihre Liebe könnte sie und Lane in tödliche Gefahr bringen ...
»Brillant mischt Lowell Gefahr, Täuschung und Verlangen zu einer fesselnden Geschichte.« Booklist
Über die Autorin:
Elizabeth Lowell ist das Pseudonym der preisgekrönten amerikanischen Bestsellerautorin Ann Maxwell, unter dem sie zahlreiche ebenso spannende wie romantische Romane verfasste. Sie wurde mehrfach mit dem Romantic Times Award ausgezeichnet und stand bereits mit mehr als 30 Romanen auf der New York Times Bestsellerliste.
Elizabeth Lowell veröffentlichte bei dotbooks bereits ihre historischen Liebesromane »Begehrt von einem Ritter«, »Verführt von einem Ritter« und »Geküsst von einem Ritter« sowie ihren Thriller »48 Hours – Rette dein Kind« Außerdem veröffentlichte sie ihre Romantic-Suspense-Romane »Dangerous Games – Dunkles Verlangen«, »Dangerous Games – Tödliche Gier« und die Donovan-Saga mit den Bänden »Thrill of Desire«, »Thrill of Seduction«, »Thrill of Passion« und »Thrill of Temptation«.
Die Website der Autorin: elizabethlowell.com
***
eBook-Neuausgabe Dezember 2023
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 2006 unter dem Originaltitel »The Wrong Hostage« bei HarperCollins Publishers, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 2007 unter dem Titel »Vergib mir meine Sünden« bei Knaur.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 2006 Two of a kind, Inc.
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2007 bei Knaur Taschenbuch. Ein Unternehmen der Droemerschen Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Cryptographer, Jeom.ac
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-98690-886-7
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »48 Hours« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Elizabeth Lowell
48 Hours – Rette dein Kind
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Gisela Sturm
dotbooks.
Für all die Männer und Frauen, deren Mitwirkung an diesem Roman anonym ist und bleiben wird.
Prolog
Im Norden von Ensenada, Mexiko
August, Samstagmorgen
Lane Franklin sagte sich, dass es keinen Grund für ihn gab auszuflippen.
Die meisten anderen Fünfzehnjährigen wären total aus dem Häuschen, wenn sie den Sommer in Ensenada verbringen könnten. Baden, Bräute, Bier. Das Leben könnte nicht schöner sein.
Nicht dass die All Saints School direkt auf Ensenadas Amüsiermeile lag. Trotz der drückenden Sommerhitze liefen keine arschwackelnden Tangamädchen über den schönen, streng privaten Strand des Internats. Aber sein Cottage war super, und es gab ein gigantisches Fußballfeld, und bei offenem Fenster konnte er die Meeresbrandung von der Westseite des Campus rauschen hören.
Mit ihren verstreut liegenden Vier-Zimmer-Cottages, den Apartments für die Lehrer, einem Wohnheim für die weniger begüterten Schüler und einer kleinen Bibliothek mit einem gemütlichen Aufenthaltsraum sah die All Saints School wie ein luxuriöses Ferienparadies aus.
Was sie aber nicht war.
Die All Saints School war ein kirchliches Internat für verzogene Kinder, denen man dort beibrachte, Regeln zu befolgen, gerade zu sitzen, fleißig zu lernen und sich anständig zu benehmen.
Gääähn!
Ich hab’s mir selbst eingebrockt. Was ich getan hab, war kriminell.
Obwohl ihm das damals nicht gleich so klar war.
Seine Finger hatten nur mal kurz die Tasten seines nagelneuen Computers berührt, und schon waren aus seinen Sechsen im zentralen Schulcomputer Zweier geworden. Es war schon blöd genug, sich dabei erwischen zu lassen, aber das Schlimmste war, dass sein Vater plötzlich entschied, es sei höchste Zeit, Lane auf eine internationale Schule zu schicken, wo man ihm Disziplin beibringen würde.
Wenigstens hatten sie ihn nicht dabei ertappt, wie er sich in einen Militärcomputer eingehackt hatte, oder in diese Bank, und in weitere fünf oder sechs heilige Kühe. Als er dann erst einmal drin war, hatte er nichts anderes getan, als sich tierisch gefreut, ungeschoren davongekommen zu sein.
Und danach hatte er diese geniale Idee gehabt, seine Schulnoten zu frisieren, um seiner Mutter den Kummer wegen der vielen Vierer und Sechser zu ersparen.
Alles Bingo.
Ich bin jetzt sechs Monate hier. Da schaff ich die zwei jetzt auch noch.
Selbst wenn seine Mitbewohner vor drei Wochen geschlossen ausgezogen waren. Er hatte endlich Ruhe und brauchte den Computer nicht mehr zu verstecken.
Selbst wenn die Schule vor ein paar Wochen diese Schläger in das Fußballteam aufgenommen hatte. Selbst wenn die Typen nicht wie sechzehn, sondern wie sechsundzwanzig aussahen. Und ihn genau beobachteten, sobald er mitspielte. Er war schneller und um einiges intelligenter als sie.
Lane blickte auf seine Uhr. Bis zum Fußballtraining hatte er ein paar Stunden Zeit. Bis dahin würde er noch seine Schulaufgaben machen. Und hinterher würde er sich ein paar Spiele auf dem Computer reinziehen, den seine Mutter vor ein paar Wochen direkt unter den Augen des total spießigen Rektors reingeschmuggelt hatte.
Er wusste noch immer nicht, warum er keinen Computer mehr haben durfte. Er hatte doch gar nichts angestellt, und plötzlich durfte er weder das Telefon noch den Computer in der Bibliothek benutzen. Nur noch Briefe schreiben. Die Schneckenpost, das war das Allerletzte.
Zumindest brauchte Lane sich keine Sorgen zu machen, dass jemand seinen illegalen Computer entdeckte. Jeder Schüler musste seine Unterkunft und seine Kleidung selbst sauber halten, und manche von ihnen spülten sogar Geschirr für die gesamte Schule.
Klar, eine Internetverbindung wäre super, aber wenn er nicht ins Schulsekretariat einbrechen wollte ...
Schlag’s dir aus dem Kopf.
Gib Dad nicht noch eine Chance, Mom zu überzeugen, mich noch länger hierzulassen. Mein Betragen ist seit vier Monaten tadellos.
Seit seine Mitbewohner weg waren, hatte er niemanden zum Reden, aber das war schon okay. Er war es gewohnt, allein zu sein. Als er in die All Saints School kam, war sein Spanisch so dürftig, dass er sich schlechte Noten einhandelte, sobald er nur den Mund aufmachte. Manche Kids sprachen Englisch, manche Chinesisch, Japanisch oder Französisch, aber hauptsächlich wurde Spanisch gesprochen, in allen möglichen regionalen Varianten, die er allmählich auseinanderhalten konnte. Er hatte immer ein Talent für Sprachen gehabt, es mangelte ihm nur an Interesse.
Aber jetzt gab es einen guten Grund, eine zu lernen, er sprach um einiges fließender, als seine Umgebung es ihm zugetraut hätte. Allerdings wurde seine Stimmung nicht gerade besser durch das, was ihm zu Ohren kam.
Seit drei Wochen war alles nur noch ätzend. Sein Telefon ging nicht mehr. Er hatte es gemeldet, um es reparieren zu lassen, aber nichts geschah. Als er sich an eine Lehrerin wandte, um eventuell von ihrem Telefon aus zu Hause anzurufen, reagierte sie so abweisend, als ob er ihr angeboten hätte, mit ihm Sex auf dem Schreibtisch zu haben.
An jenem Tag waren diese beiden Arschlöcher auf dem Fußballplatz herumstolziert und hatten ihn angeglotzt, um ihm wortlos mitzuteilen, dass er ganz oben auf ihrer Abschussliste stand.
Irgendetwas war vor drei Wochen geschehen.
Lane wusste nicht was und konnte sich keinen Reim darauf machen. Er wusste nur, dass er jetzt nicht mehr wie ein Schüler behandelt wurde.
Vielmehr wie ein Gefangener.
Ja und? Ich habe mich doch seit einundzwanzig Tagen gegen diese beiden pendejos behauptet. Ich lerne fleißig. Mein Zimmer ist tadellos sauber. Die Lehrer mögen mich. Jedenfalls mochten sie mich noch vor drei Wochen.
Wenn Mom mich besucht, kann ich sie ja mal ganz nebenbei fragen, ob Dad seine Meinung geändert hat und ich nach Hause kann, für eine Woche. Vielleicht ein paar Tage.
Oder wenigstens einen Tag.
Oder ein paar Stunden.
Und wenn ich erst mal auf der anderen Seite der Grenze bin, komme ich nicht zurück. Und wenn ich auf der Straße leben muss.
Lane lauschte auf die unbarmherzige Brandung und wollte nicht hören, was ihm die Wellen zuraunten: eingesperrt ... eingesperrt ... eingesperrt.
Trotzdem war dieser monotone Flüstergesang besser als die Stimmen der beiden Brutalos, die ihn stolpern ließen und mit Ellbogen und Fußtritten traktierten: Jetzt haben wir dich, pato. Du bist so gut wie tot. Wir schleichen uns zu dir ins Zimmer, schneiden dir die Eier ab und stopfen dir damit das Maul.
Lane blendete das Geräusch der Wellen und der Stimmen in seinem Kopf aus.
Ich bin kein Gefangener.
Ich habe keine Angst.
Kapitel 1
Südkalifornien
La Jolla
Samstagmorgen
Das Telefon klingelte viermal, bevor Richterin Grace Silva von ihren Gerichtsakten aufblickte.
Ted vielleicht.
Endlich.
Es war schon viele Jahre her, dass sie ihren Ehemann, oder besser gesagt, ihren frischgebackenen Exmann nicht nur als den Vater ihres Kindes betrachtet hatte. Und wenn sie das Scheitern ihrer Ehe insgeheim bedauerte, nun ja, damit musste sie leben. Sie hatte sich mächtig ins Zeug gelegt, um ihre Scheidung, wie man es von erwachsenen Menschen erwartet, mit allen juristischen Konsequenzen möglichst zivilisiert durchzuziehen.
Für Lane.
Aber sie hatte es wirklich satt, zu jeder Tages- und Nachtzeit für Theodore Franklin den Anrufbeantworter zu spielen. Dass er das Strandhaus, in dem sie zusammen gelebt hatten, als feste Wohnadresse behielt, hieß doch nicht, dass er noch mit ihr zusammen war.
»Hallo«, meldete sich Grace.
»Ah, señora«, hörte sie eine männliche Stimme. »Hier ist Carlos Calderón. Ich hätte gerne mit Ihrem Gatten gesprochen.«
Grace hielt es nicht für nötig, ihn darauf hinzuweisen, dass Franklin nur noch ihr Exmann war. Wenn Ted ihm nicht so nahestand, um Calderón etwas von der Scheidung zu erzählen, dann war es wohl nicht an ihr, ihn darüber aufzuklären.
»Ted ist nicht da«, erwiderte sie kurz. Und er ist seit drei Wochen nicht hier gewesen, was du verdammt noch mal längst kapiert haben müsstest, da du täglich hier anrufst oder anrufen lässt. »Haben Sie es schon in seinem Büro in Wilshire versucht, auf seinem Handy oder in seiner Wohnung in Malibu?« Oder bei seiner beknackten Freundin?
»Sí, ja, schon öfters.«
»Kann ich Ihnen vielleicht helfen?«
Grace erwartete die Antwort, die sie seit drei Wochen jedes Mal gehört hatte: ein höfliches Nein danke.
Stattdessen erwiderte Calderón seufzend: »Richterin Silva, ich muss Sie leider bitten, sofort nach Ensenada zu kommen.«
Ihre Finger spannten sich fester um den Hörer. In ihrer Funktion als Richterin war es an ihr, Befehle zu erteilen, aber nicht, sie auszuführen. »Warum?«
»Es geht um Ihren Sohn, Lane.«
»Was ist passiert?«, fragte sie rasch. »Macht er Schwierigkeiten? Es lief doch so gut ...«
»Das ist nichts, was man am Telefon besprechen kann. Ich erwarte, dass Sie in zwei Stunden hier sind.«
»Was ist los?«, wollte sie wissen.
»Bis dann, Richterin Silva.«
»Einen Moment«, sagte sie. »Geben Sie mir vier Stunden. Ich weiß doch nicht, wie lange ich an der Grenze warten muss.«
»Drei Stunden.«
Dann hatte er aufgelegt.
Kapitel 2
US-mexikanische Grenze
Samstagmittag
Grace erreichte die Grenze kurz vor Ablauf der Frist. Das Verkehrsaufkommen war viel größer gewesen als sonst, und sechs Blechkolonnen hatten sich im Stop-and-go über die Fernstraße Richtung Süden gewälzt. Das hatte immerhin den Vorteil, dass die mexikanischen Zollbeamten die Fahrzeuge so schnell wie möglich durchwinkten. Sie mochten Amerikaner noch so hassen, ihre amerikanischen Dollars liebten sie umso mehr. Die Grenzbeamten stoppten nur Autos, wenn Frauen darin saßen, bei denen es sich lohnte, genauer hinzusehen.
Grace fuhr auf den Beamten zu, der hinter seiner zweihundert Dollar teuren Ray-Ban schon fast eingeschlafen war. Gerade wollte er den dunkelgrünen Mercedes-Geländewagen mit einer geübt lässigen Geste durchwinken, als er durch das geöffnete Fenster die Frau hinter dem Steuer erblickte. Er neigte den Oberkörper vor und gab mit erhobener Hand das Stoppzeichen.
Einem Cabrio in der Nebenspur, drei Fahrzeuge vor Grace, war es ebenso ergangen. Darin hatten zwei blonde Kalifornierinnen gesessen, die sich offensichtlich auf ihre kleine Spritztour nach Mexiko gefreut hatten.
»Guten Morgen, señorita«, sagte er mit einem schon fast anzüglichen Lächeln. Seine Worte waren höflich, doch sein Blick blieb auf ihre Brüste gerichtet. »Wo wollen Sie denn hin, in meinem schönen Mexiko?«
Grace spürte, wie die Wut in ihr hochkochte, ein willkommenes Ventil für ihre Angst um Lane, die ihr wie eine Faust im Nacken saß. Bereits als Teenager hatten ihr diese Scheißmachos derart zugesetzt, dass ihr Bedarf für den Rest des Lebens mehr als gedeckt war. Am liebsten hätte sie diesem großspurigen Zampano die Leviten gelesen, aber im Grunde war er es nicht wert, dass sie ihre kostbare Zeit vergeudete.
Ihre Großmutter Marta hatte sie gelehrt, wann sie zu kämpfen hatte und wann sie sich fügen musste.
Ich muss Sie bitten, sofort nach Ensenada zu kommen.
»Ensenada«, stieß Grace zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor.
Sie überreichte ihm ihren Reisepass. Auf der Deckelinnenseite befand sich eine laminierte Ausweiskarte des mexikanischen Justizministeriums. Die mexikanische Regierung stellte solche Ausweise als Gefälligkeit für US-amerikanische Richter und andere Staatsbeamte aus.
Die buschigen, schwarzen Brauen des Zollinspektors quollen über den Rand seiner Sonnenbrille. Er gab ihr den Pass zurück und winkte sie durch. »Entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten, licenciada«, sagte er hastig. »Bienvenido.«
Mit einem Knopfdruck schloss Grace ihr Fenster und ließ die Grenze hinter sich. Manchmal wusste sie selbst nicht mehr, was sie schlimmer fand: Mexiko, wo sich die Männer den Frauen überlegen fühlten und überall damit prahlten, oder die Vereinigten Staaten, wo sich die Männer dasselbe anmaßten, aber manche so schlau waren, es für sich zu behalten.
Das Problem männlicher Selbstüberschätzung der Latinos war ihr nicht fremd. Sie hatte eine mexikanische Großmutter mütterlicherseits – dank der gescheiterten Rebellion der Magonista auf Baja California von 1911 – sowie einen Urgroßvater und einen Großvater mexikanischer Abstammung väterlicherseits. Außer Indianern und echten Mexikanern gab es in ihrem Familienstammbaum noch ein paar Verästelungen, die bis nach Schottland und Norwegen reichten. Sie hatte einen irisch-mexikanischen Vater, eine kasachisch-mexikanische Mutter und obendrein eine echte kasachische Großmutter, die nach einer gescheiterten Stammesrevolte im Zuge der kommunistischen Eroberung der asiatischen Steppen die Flucht angetreten hatte.
Obwohl sie offiziell als Latina geführt wurde, betrachtete sich Grace als Musterbeispiel einer ethnisch gemischten Amerikanerin.
Mit dreizehn Jahren war sie zu ihrer kasachischen Großmutter nach Santa Ana in Tijuana gezogen, aber richtig wohl gefühlt hatte Grace sich in dieser Stadt eigentlich nie. Vielleicht gefiel ihr Tijuana gerade deshalb nicht, weil sie dort ihre Jugend verbracht hatte. Wie auch immer. Sie dachte nicht mehr daran und wollte nicht zurückschauen. Auch das hatte Marta ihr beigebracht.
Auf der La Revo, der traditionellen Hauptstraße von Tijuana, wimmelte es nur so von Sexshops, Girlie-Bars und Hotels, die nicht nur als Bordelle dienten, sondern auch als Zwischenlager für illegale Migranten, die sich auf dem Weg Richtung Norden ins Gelobte Land befanden. Eine Frau ohne Begleitung auf der La Revo wurde als Freiwild betrachtet, und deshalb entschloss sich Grace, das Viertel weiträumig zu umfahren und die Abzweigung über Otay Mesa zu nehmen.
Der Umweg kostete sie Zeit, die sie nicht hatte, sich aber gezwungenermaßen nehmen musste. Noch ein Opfer, das ihr als Frau in Mexiko, im Reich der Machos, abverlangt wurde.
An der Kreuzung von Otay fuhr sie auf die Avenue des Sechzehnten September durch die Zona Río mit all ihren Banken und internationalen Bankhäusern, noblen Vergnügungsstätten, noch mehr Banken und reihenweise ausländischen Modeboutiquen, die einen saudischen Ölscheich in den Bankrott treiben konnten.
Grace schenkte der luxuriösen Shoppingmeile fast noch weniger Beachtung als dem Grenzbeamten. Das kurze, frostige Telefongespräch ging ihr nicht aus dem Kopf.
Es geht um Ihren Sohn, Lane.
Sie nahm die gebührenpflichtige Autobahn Richtung Süden nach Ensenada und gab Gas. Der starke Motor summte vergnügt. Die Klimaanlage vertrieb die stickige, schwüle Luft.
Aber ihre quälenden Gedanken ließen sich nicht abstellen.
In ihrer Handtasche klingelte das Mobiltelefon. Sie zog es heraus, warf einen Blick auf das Display und fuhr an den Straßenrand. Sie wollte nicht gleichzeitig fahren und ein schwieriges Gespräch mit einem amerikanischen Senator führen.
Sie drückte die Empfangstaste und versuchte, munter zu klingen. »Einen wunderschönen Nachmittag, Chad, oder ist es bei Ihnen schon Abend?«
Senator Chadwick Chandler klang überrascht. »Ach ja, natürlich, diese neumodische Sache mit der Rufnummernübertragung. Ich vergesse ständig, dass Sie ein Handy auf dem letzten Stand der Technik haben. Ich dachte schon, Sie könnten hellsehen.«
»Kann ich auch«, sagte sie mit einem möglichst beiläufigen Tonfall. »Deshalb weiß ich, dass Sie letzte Woche meine Anrufe verschmäht haben, alle fünf.«
Chandler lachte leise. An sich war es ein einnehmendes Lachen. Aber über die Handyverbindung klang es, als hätte er sich an der Olive seines zweiten Martinis verschluckt.
»Wie käme ich denn dazu, meine Lieblingsbezirksrichterin abzuwimmeln«, entgegnete er. »Im Gegensatz zu euch Goldkindern in Kalifornien mit euren Gestüten und eurer goldenen Surferbräune müssen wir armen Schlucker uns hier in der Hauptstadt mit zusätzlichen Nachtschichten über Wasser halten.«
»Meine Hautfarbe ist genetisch bedingt. Surfen war ich seit zwanzig Jahren nicht mehr. Und was das Gestüt angeht, das war Teds Idee. Er dachte, es würde sich gut machen als Kulisse für die Spendenaktionen, die er für Leute wie Sie organisieren muss.«
Grace erschrak über ihren gereizten Ton. Vielleicht war das der Grund dafür, dass Calderón sie persönlich sehen wollte. Der locker-flockige Plauderton am Telefon lag ihr nicht. Ganz zu schweigen davon, dass sie in ihrer Position sowieso keine Zeit dafür hatte.
»Ted und Sie geben mir viel Unterstützung«, sagte der Senator, »und es ist mir immer ein Anliegen, mich dafür erkenntlich zu zeigen, auch wenn es manchmal ein paar Tage dauert, bevor ich zurückrufe. Was kann ich für Sie tun?«
»Ich wollte von Ihnen wissen, ob es Schwierigkeiten mit meinem Ernennungsverfahren gibt.«
»Gut Ding will Weile haben.«
»Das weiß ich«, antwortete sie vorsichtig. »Aber diese Ernennung für das Bundesberufungsgericht war ja eigentlich nicht meine Idee. Sie wurde mir nahegelegt. Und jetzt wird das Verfahren seit über zwei Monaten an irgendeiner Stelle blockiert, und ich weiß nicht mehr, wie ich meine Arbeit planen soll. Wenn aus meiner Ernennung nichts werden sollte, würde ich es gern jetzt erfahren, damit ich endlich meine unerledigten Fälle bearbeiten kann, anstatt mit tausend Dingen gleichzeitig herumzujonglieren und mich ständig zu fragen, ob ich meinen Eignungstest für dieses Amt bestehen werde.«
Am anderen Ende der Leitung seufzte der Senator lautlos und betrachtete den öligen Bodensatz seines Martinis. Er hätte sich lieber mit Ted auseinandergesetzt als mit der Wildkatze, die Ted geheiratet hatte, um dann herauszufinden, dass er nicht mit ihr fertig wurde.
»Ihre Berufung an ein Bezirksgericht hat drei Monate gedauert«, sagte der Senator. »Ein Ernennungsverfahren beim Bundesberufungsgericht wird noch gründlicher geprüft.«
Grace konzentrierte sich mehr auf den Tonfall als auf die Stimme des Senators. Sie blickte auf ihre Uhr. Noch drei Minuten, auf keinen Fall mehr. »Lassen Sie uns zum Kern der Sache kommen. Sie weichen mir aus, woraus ich schließe, dass etwas nicht stimmt.«
»Nein, keineswegs. Es ist nur so, dass wir auf diesem Niveau den persönlichen Background der Kandidaten noch viel genauer unter die Lupe nehmen, weil auch die Politiker ein Wort mitzureden haben. Ich erwarte nach wie vor, dass Ihre Ernennung zur jüngsten, um nicht zu sagen attraktivsten Richterin an einem Bundesgericht die Zustimmung des Weißen Hauses und der Senatoren finden wird.«
»Hören Sie damit auf.«
Chandler klang überrascht. »Womit denn?«
»Mit dieser herablassenden Art. Ich hatte gerade das Vergnügen mit einem lüsternen mexikanischen Grenzbeamten. Noch so ein Kompliment heute, und ich raste aus.«
Grace zuckte erneut zusammen, als sie sich reden hörte. Sie kannte Chad Chandler seit zehn Jahren. Nach den Maßstäben, die man an einen Politiker anlegte, galt er in jeder Hinsicht als Gentleman.
»Entschuldigung«, sagte sie hastig. »Ich bin momentan völlig durcheinander und möchte einfach nur verstehen, warum sich mein Ernennungsverfahren so lange hinzieht. Hat das etwas mit der Scheidung zu tun?«
»Ach herrje, nein. Wir leben im einundzwanzigsten Jahrhundert.«
Tiefes Schweigen.
Der Senator nippte abermals an seinem Martini.
Grace sah erneut auf ihre Uhr. »Aber wenn alles in Ordnung ist, warum geht es dann nicht weiter? Sie wissen genauso gut wie ich, dass meine Vergangenheit bis hin zu meinen Urgroßeltern durchleuchtet wurde. Da gibt es eigentlich nichts mehr zu erforschen.«
Er schwieg.
Dann ein senatorisches Seufzen.
»Nun«, begann er widerstrebend. »Es gibt da noch einen Punkt, für den sich ein paar Leute am Ende der Pennsylvania Avenue interessieren.«
»Und der wäre?«
»Ihr Sohn. Wie geht es Lane?«
Grace’ Körper durchfuhr ein Übelkeit erregender Schock, als hätte sie einen Stromschlag bekommen.
»Lane geht es gut.« Sie versuchte, mit fester Stimme zu sprechen und ihre panische Angst hinter einer Maske aus Professionalität zu verbergen. »Was soll diese Frage? Was hat Lane damit zu tun?«
»Als ich von seinen Drogenproblemen hörte, machte ich mir Sorgen, und ein paar Leute im Weißen Haus auch. Sie wissen ja, wie heikel solche Dinge sind.«
Grace hörte die Worte wie durch einen akustischen Filter, ab- und anschwellenden Töne, bis nur noch der reine, sinnentleerte Klang übrig war. DrogenPROBleme?
DRogenproBLEME.
»Ich ...«, stammelte sie.
»Es ist wichtig«, fiel Chandler ihr ins Wort. »Wir hatten in der letzten Sitzungsperiode eine ähnliche Situation. Die Tochter eines Kandidaten hatte ein Kokainproblem, das von der Opposition dazu benutzt wurde, dem Kandidaten Befangenheit im Umgang mit Drogenabhängigen zu unterstellen. Die Aufregung hat sich bald wieder gelegt, aber es hätte anders ausgehen können.«
Grace musste schlucken.
»Keiner wünscht sich derlei Komplikationen, wenn es um das Berufungsgericht geht«, sagte der Senator. »Wir haben derzeit zu schwache Regierungsmehrheiten, die sich von einer Stunde zur nächsten verschieben können. Sie werden sicher Verständnis dafür haben, dass wir vorsichtig sein müssen.«
Ihr Mercedes vibrierte im Fahrtwind eines Sattelzuges, der wie eine Rakete an ihr vorbeidonnerte.
»Aber Lane hat überhaupt kein Drogenproblem«, sagte sie.
Der Senator zögerte, seufzte und nippte an seinem Glas. »Hey, so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Das kommt in den besten Familien vor, und niemand sagt, dass Ihre Ernennung dadurch in Frage gestellt wird. Das Weiße Haus möchte nur gegen unangenehme Überraschungen gefeit sein.«
»Dafür haben Sie mir jetzt aber eine bereitet«, sagte sie.
»Wer hat Sie überhaupt auf die Idee gebracht, dass Lane Drogen nehmen könnte?«
»Niemand. Es ist doch offensichtlich.«
»Weil er ein Teenager ist und in La Jolla wohnt?«
»Nein, weil er gerade unten in Ensenada in einer Entzugsklinik ist«, entgegnete der Senator.
»All Saints School ist eine private Oberschule am Meer, nördlich von Ensenada. Sie gehört zu den besten internationalen Privatschulen, wo man die Schüler auf das College vorbereitet. Sie ist eine Einrichtung der römisch-katholischen Kirche für Kinder der besten Familien von Tijuana, aber auch reiche Familien aus Südamerika, Europa und Asien schicken ihre Kinder dorthin. Von einer Entzugsklinik für Junkies kann keine Rede sein.«
»Grace, ich wollte Ihnen bestimmt nicht zu nahetreten. Das war absolut nicht meine Absicht.«
»Kein Problem, solange jeder weiß, dass wir Lane nicht in der All Saints School angemeldet haben, weil er ein drogenfreies Umfeld brauchte. Bitte erzählen Sie Ihren Informanten, wer immer sie sein mögen, die Wahrheit über Lanes Schule.«
Ein langes Schweigen, noch ein Schluck, ein weiterer Seufzer. Schließlich räusperte sich der Senator. »Komisch. Ich weiß nicht mehr, wer es mir gesagt hat. Wahrscheinlich war es nur so ein vager Eindruck.«
Obwohl es sich anfühlte, als würde man ihr den Boden unter den Füßen wegziehen, sprach Grace mit gleichmäßiger Stimme. »Nun, da Sie mich seit Monaten nicht nach Lane gefragt haben und niemand in D.C. meinen Sohn tatsächlich kennt, wird es wohl Ted gewesen sein, der Ihnen das eingeredet hat.«
»Jetzt, wo Sie es sagen ...«
»Wann haben Sie mit Ted gesprochen?«
»Vor zwei Wochen.«
»Haben Sie ihn gesehen?« Grace spürte selbst, dass sie mit unangemessener Schärfe sprach, konnte es aber nicht ändern.
»Er war ein paar Stunden in D.C., für ein informelles Treffen. Er kam auf einen Sprung auf dem Capitol Hill vorbei, um mir hallo zu sagen.«
Sie atmete langsam aus. Es gab jemanden, der Ted vor zwei Wochen gesehen hatte. Das war immerhin ein Fortschritt.
»Hat er gesagt, wohin er wollte?«, fragte sie.
»Nein.«
»Wissen Sie, wo er jetzt ist?«
»Nein. Sie scheinen sich Sorgen zu machen.«
»Ich habe seit mehr als drei Wochen weder Ted gesehen noch von ihm gehört«, sagte sie. »Ich hoffte, Sie könnten mir sagen, wo ich ihn finde.«
»Ist etwas passiert? Ich meine, zwischen Ihnen beiden? Ich dachte, Sie hätten sich in gutem Einvernehmen getrennt.«
»Das stimmt. Aber ich hatte die Hoffnung, dass ...« Ted sich mal um Lane kümmern würde, als Vater, den er so dringend braucht. Dass Ted ihn einmal die Woche oder wenigstens alle zwei Wochen mal anrufen würde.
Als der nächste Truck vorbeidonnerte, quollen dichte Rußschwaden aus dem Auspuff in die extrem schwüle Luft.
»Macht nichts«, sagte Grace. »Aber wenn Sie etwas von Ted hören sollten, sagen Sie ihm bitte, dass er sich bei mir melden soll. Ich bin es satt, seine Telefonzentrale zu spielen. Es gibt eine Menge Leute, die wütend auf mich sind, weil sie ihn nicht erreichen.«
Der Senator hüstelte. »Ich verstehe. Machen Sie’s gut, Grace. Das Berufungsgericht braucht Frauen wie Sie.«
»Männer auch«, entgegnete sie, allerdings lachend. »Bis bald, Chad. Und vielen Dank.«
Sie setzte auf die Fahrspur hinüber, eine Staubwolke hinter sich aufwirbelnd, und fragte sich, ob Calderón wohl mit ihr über Drogen sprechen wollte.
Kapitel 3
Tijuana, Mexiko
August, Samstag, 12:12 Uhr
Joe Faroe kam gerade durch die vordere Eingangstür vom Tijuana Tuck & Roll und hatte etwas dabei, ungefähr sechzig Zentimeter lang, das wie eine leicht geschwungene, abstrakte Eichenholzschnitzerei aussah. Die Werkstatt, in der das Teil angefertigt worden war, befand sich schon seit über vierzig Jahren an dieser Stelle. Sie war noch ein Relikt aus der Zeit, als Gringo-Surfer und Geschwindigkeitsfreaks auf der Suche nach einer billigen Autowerkstatt die Grenze nach Mexiko überquerten.
Jetzt produzierte sie die besten Schmuggelverstecke der Stadt, deren Wirtschaft auf dem Handel mit geschmuggelten Waren basierte.
Der Output der Firma Tijuana Tuck & Roll war sozusagen ein offenes Geheimnis, und ganz Mexiko profitierte davon. Rings um die Produktionsstätte zog sich ein stabiler Maschendrahtzaun, der oben durch einen spiraligen, lebensgefährlichen Bandstacheldraht derart gesichert war, dass er einen Mann zerfetzen konnte.
Joe Faroe wusste Bescheid über diese Art von Stacheldraht, ebenso wie er über das wahre Geschäft der Autowerkstatt im Bilde war.
Alles schon gehabt.
Damit war er durch.
Nichts Neues.
Faroe blickte über die Straße. Der Mann stand immer noch da, immer noch in den Schatten eines Hauseingangs gelehnt.
Er wandte den Blick ab, als Faroe zu ihm hinübersah, rührte sich aber nicht vom Fleck.
Ein Polizist, dachte Faroe.
Die Lederjacke und der beträchtliche Bauchumfang von dem Kerl waren verräterisch. Manche Polizisten hatten ein gutes Leben.
Okay, ist das nun ein mexikanischer Bulle oder ein amerikanischer, der über die Grenze gekommen ist, um das neueste Schmugglernest auszuheben?
Will er jemanden festnehmen oder ein Haus durchsuchen? Faroe zog das Maschendrahttor hinter sich zu und betrachtete unverwandt den Polizisten, dessen Lederjacke fast so teuer sein musste wie seine eigene.
Der Kerl behandelte ihn wie Luft.
Faroe starrte ihn beharrlich an.
Bis der Polizist wie beiläufig zu ihm hinübernickte. Ein alter Hase. Er wusste, dass er ertappt worden war.
»Schönen Tag noch«, rief Faroe über die Straße.
Der Polizist zuckte mit den Schultern und drehte sich weg, um eine Zigarette anzuzünden.
Faroe schlenderte über den holperigen, tückischen Bürgersteig in Richtung der La Revo.
Er hatte in Chula Vista geparkt und La Línea, die Grenze, zu Fuß überquert. Jetzt brauchte er ein Taxi, um zum US-Kontrollpunkt zurückzufahren. Es gab einen Taxistand an der Ecke La Revo und Calle Cinco.
Der Polizist legte eine Rauchpause ein und führte ein Gespräch am Handy oder über ein Funkgerät. Faroe konnte es nicht genau ausmachen, und es war ihm sowieso egal. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten hatte er eine blütenweiße Weste.
Die Ausdünstungen undichter Abwasserrohre, vermischt mit den Gerüchen krebsfleischgefüllter Tacos, schwängerten die Luft. Auf den dreckigen, aufgeplatzten Bürgersteigen drängten sich buckelige, bettelnde indios zwischen Souvenirständen und einer zeitlosen Ansammlung von Prostituierten, Taschendieben und gewöhnlichen Passanten. Händler boten lederne Boxen feil, bunt bemaltes Kinderspielzeug aus Holz oder T-Shirts, die alle irdischen Paradiese von Drogen bis hin zum Analsex zelebrierten. Die schäbigen Geschäfte hatten nur ein dürftiges Warenangebot. Vor den Bars lockten Plakate mit Lapdance. An der nächsten Tür verschleuderten falsche Apotheker in weißen Kitteln Viagra und Krebsmedikamente zu Sonderpreisen.
Die Touristenmeile der Avenida Constitución, die sich noch einen Anstrich von Anständigkeit zu geben versuchte, stank nach üblen Machenschaften, dubiosen Amüsements und stumpfsinnigem Laster. Billige Rauchwaren, billiger Schnaps, billiger Sex. Alles, was die Saubermänner aus San Diego verbannt hatten, war ein paar Meilen weiter nach Süden gezogen, um sich in Tijuana zu sammeln.
Faroe passierte den Häuserblock, in dem sich früher das berüchtigte Blue Fox befunden hatte. Auf Schritt und Tritt wurde er von Türstehern angesprochen.
»Hey, Mister, Lust auf ’ne Pussi? Ein bisschen Spaß? Schööööne Mädels, hereinspaziert!«
Ein dünner Mann mit einem noch dünneren, schwarzen Lippenbart hatte seine Verkaufsnummer mit einer Klangeinlage versehen, indem er ein Stück von seiner Wange zwischen Daumen und Zeigefinger zusammenquetschte und sie ruckartig hin- und herbewegte und damit unmissverständliche Schmatztöne erzeugte.
Faroe kannte seit seinem fünfzehnten Lebensjahr das ganze Programm der Aufreißer. Erst hatte er über ihre unanständigen Tricks gegrinst. Später ließen sie ihn gleichgültig. Jetzt ekelten sie ihn an.
Er wusste nicht, was besser war.
Er stoppte ein gelbes Taxi und stieg mit seinem Paket hinten ein. Der Fahrer suchte sofort seinen Blick im Rückspiegel und setzte ein breites Grinsen auf.
»Ich habe alles, was Sie wollen, señor. Mädchen gefällig? Ich bring Sie da hin, wo es saubere gibt.«
»La Línea«, sagte Faroe. »Durch die Zona Río.«
Als der Fahrer Faroes Blick im Spiegel auffing, zog er es vor, den Mund zu halten, und fuhr los in Richtung Norden.
Drei Minuten später hatte das Taxi den Trubel der schäbigen Altstadt hinter sich gelassen. Faroe sah hinaus auf die breiten Boulevards des internationalen Viertels. Als er zum ersten Mal nach Tijuana gekommen war, war der Fluss hier noch ein offener Abwasserkanal gewesen, der sich durch eine sumpfige Landschaft zog. Sein Inhalt wurde gleichmäßig aufgeteilt: Der eine Teil verblieb auf der Südseite der Grenze, und der andere ergoss sich durch den Río Tía Juana bei Imperial Beach, USA, in den Ozean.
Auch jetzt führte der Fluss noch Abwasser, allerdings mit dem Unterschied, dass er in diesem Abschnitt unterirdisch verlief. Oben hatte man Straßen angelegt, wie zum Beispiel den Paseo de los Héroes, dessen luxuriöse Shoppingmeile es mit jeder anderen rund um den Globus aufnehmen konnte.
Geschäfte. Diskotheken. Nachtclubs. Restaurants.
Banken.
Banken zuhauf.
Ihre Bürotürme waren bescheiden im Vergleich zu denen in San Diego, aber gemessen an den herkömmlichen ein- und zweistöckigen Häusern von Tijuana wirkten die Banken wie neue, strahlende Giganten. Hier lag ein Mekka des Geldes.
Da sieht man mal, wie sich eine Stadt entwickelt, die jedes Jahr dreißig Milliarden Dollar an ausländischem Einkommen einfährt, dachte Faroe. Nur schade, dass der größte Teil dieses Milliardengeschäftes mit Drogenabhängigen aus dem Ghetto und lateinamerikanischen Junkies nördlich der Grenze gemacht wird.
Aber das war nicht mehr sein Problem. Zum Teufel mit Steele und St. Kilda Consulting, er hatte die Schnauze gestrichen voll von dieser chaotischen, verlogenen Welt mit ihrer Schwarzweißmalerei, die sein ganzes Erwachsenendasein bestimmt hatte.
Sucht euch einen anderen Trottel, der seinen Arsch für eine Welt aufreißt, die gar nicht gerettet werden will, ihr könnt mich alle mal.
Nichtsdestotrotz bedauerte Faroe immer noch die armen Einwohner von Tijuana, die zum großen Spiel um das schnelle Geld nicht zugelassen waren. Während sie sich für das Allernotwendigste abstrampeln mussten, bereicherten sich die anderen an den unerschöpflichen Quellen der Schmuggelwirtschaft.
Es tut mir leid, und es ist traurig, aber ich kann absolut nichts dagegen machen. Meine Lanze ist gebrochen, und die gute, alte Rosinante steht auf der Weide.
Wenn Steele das nicht verstehen will, soll er mich gernhaben.
Der Taxifahrer setzte Faroe im Randbereich der neutralen Zone ab, die als Eingangshafen bezeichnet wurde. Auch hier wieder eine Straße mit unzähligen Apotheken und Souvenirständen. Einen Häuserblock südlich der physikalischen Grenze wichen die Geschäfte der langen Front der Reisebüros, die mit ihren Passagen nach Los Angeles und Central Valley, Wenatchee, Burlington und Spokane lockten, mehr als zweitausend Kilometer entfernt. Kansas, Chicago, New York, Colorado, die Baumwollfelder der Südstaaten – um die Frischfleischquoten zu erfüllen, priesen die Straßenhändler alle Destinationen an, wo billige Arbeitskräfte gesucht wurden.
Faroe ging an der langen Warteschlange vor dem Schalter der Einwanderungsbehörde vorbei. Dann stieß er wie selbstverständlich die Schwingtüren zu der hörsaalgroßen Abfertigungshalle auf.
Letzter Stopp vor dem Betreten US-amerikanischen Bodens.
Ein Zollinspektor in blauem Hemd und mit einer Waffe an der Seite nahm Faroes Gepäckstück ins Visier und zeigte auf den Scanner.
Faroe stellte es aufs Band und wartete. Ein zweiter Inspektor starrte auf den Monitor, wo der Inhalt der durchlaufenden Gepäckstücke abgebildet wurde.
Faroe ging automatisch durch den Metalldetektor und überlegte sich, aus rein beruflichem Interesse, was nun kommen würde. Er war zwar nicht mehr im Geschäft, aber doch sehr gespannt, wie sich sein geheimer Reisesafe in der Praxis bewähren würde.
Der Mann am Scanner stoppte das Fließband und bedachte das frisch ausgesägte Holzteil mit einem langen, prüfenden Blick. Im gespenstischen Röntgenblau erschienen die Umrisse eines Innenfachs.
Der Inspektor, mit dem Namen Davison auf seinem Schild, setzte das Band zurück und ließ das Holzstück nochmals durchlaufen. Ein langer Blick, dann drückte er mit dem Ellbogen auf eine Taste.
Faroe sah aus dem Augenwinkel zwei weitere Blauhemden auf den Scanner zugehen.
»Gehört das Ihnen, Sir?«, fragte der Mann am Scanner ruhig.
»Ja.«
Faroe spürte, dass ihn jemand am Ellbogen berührte, und er hörte eine neutrale Stimme: »Kommen Sie bitte mit.«
Einer der gerade angekommenen Kontrolleure stand so nah, dass er Faroe den Rückweg nach Mexiko versperrte. Der andere verstellte ihm den Durchgang in die Vereinigten Staaten. Beide Männer hatten ihre freie Hand an ihrer Dienstpistole.
»Alles klar«, sagte Faroe zu dem Kontrolleur, der ihn am Arm berührte. »Soll ich das tragen?«
»Nicht nötig. Das übernehmen wir.«
Ein Beamter schnappte sich das Paket vom Fließband und ging voran. Faroe folgte und achtete darauf, dass seine Hände sichtbar blieben. Offenbar hatte das offizielle Durchleuchtungsgerät eines der Fächer entdeckt. Im Grunde interessierte Faroe nur eins: Hatte es auch das andere erkannt?
Die Tür war mit der Aufschrift ›Zollaufsicht‹ versehen. Dahinter befand sich ein Befragungsraum mit einem Tisch aus Staatseigentum und zwei schäbigen Stühlen mit hohen Rückenlehnen. Die beiden Eskorten brachten Faroe bis an die Tür und vergewisserten sich, dass er hineinging. Dann kehrten sie auf ihre Posten zurück.
Der Oberinspektor, den sein Namensschild als Jervis auswies, legte das Paket auf den Tisch und bedachte Faroe mit einem kühlen Blick. »Sie wirken erstaunlich ruhig für jemanden, der so tief in der Scheiße sitzt wie Sie.«
Im Verlauf seiner Karriere hatte Faroe schon viele Grenzübergänge gesehen und kannte die Regeln. Zollinspektoren müssen versuchen, die Körpersprache ihres Gegenübers zu deuten. Aber weder Faroes Gesichtsausdruck, der Puls an seinem Hals, seine Augen noch die Hände oder seine Körperhaltung halfen dem Inspektor auf die Sprünge.
»Ich habe ein reines Gewissen«, sagte Faroe, »und deshalb kann ich gelassen sein. Sie haben selbst gesehen, dass nichts in dem Fach drin war.«
Jervis deutete auf das Paket und sah sich Faroes Reisepass an. »Wollen Sie es sich nicht noch mal überlegen, bevor Sie noch mehr Ärger bekommen, Mr. Faroe?«
»Da gibt es nichts zu überlegen. Das kann ich mit gutem Gewissen sagen.«
»Dann leeren Sie mal Ihre Taschen hier auf den Tisch aus. Und jetzt stellen Sie sich drüben an die Wand, Arme nach oben, Hände flach an die Wand, Beine auseinander. Kapiert?«
Faroe hätte Widerspruch erheben können, ließ es aber bleiben. Jervis wurde für eine Achtstundenschicht bezahlt. Es lag in seinem eigenen Ermessen, ob er sie ausschließlich für Faroe opferte oder auf die nächsten hundert Leute in der Warteschlange verteilte.
»Ja, klar.« Faroe leerte seine Taschen, nahm die geforderte Stellung ein und ließ sich dann gründlich und professionell abtasten. »Immer schön mit der Ruhe, ich hab nichts versteckt.«
»Ich bin ein alter Mann, Mr. Faroe. Ich weiß schon, was ich tue.« Jervis strich ihm noch über die Waden und Fußgelenke auf der Suche nach Messerklingen, bevor er sich aufrichtete.
»Gehen Sie jetzt wieder an den Tisch, und stecken Sie Ihre Sachen ein.«
Faroe ging zum Tisch zurück, wo sich seine Schlüssel, sein Geld, der Reisepass und das Paket befanden. Während er die Gegenstände in seinen Taschen verstaute, riss Jervis die Verpackung aus Zeitungspapier auf, bis sich das sechzig Zentimeter lange Holzteil in seiner schlichten Schönheit vor ihm offenbarte. Jervis schüttelte es kräftig durch. Nichts zu hören.
Jervis grunzte. »Auf dem Scanner war ein Innenfach zu sehen. Wir können so was nicht leiden. Das wird mächtig Ärger geben, Mister.«
»Nur wenn sich die Vorschriften geändert haben, seit ich meinen Dienst beim Zoll quittiert habe«, sagte Faroe. »Das Fach ist schließlich leer.«
»Es ist ein Schmuggelversteck. Geben Sie es zu.«
»Es ist genau das, was auf der Zolldeklaration angegeben ist: ein Schmuckkasten. Ein schönes Objekt aus Holz für die Ehefrau, die ihre Ringe darin aufbewahrt.«
Jervis sah ihn prüfend an. »Und Sie haben wirklich selber mal beim Zoll gearbeitet? Wo? Hier?«
»Ja.« Faroe zuckte die Achseln. »Aber das ist schon viele Jahre her.«
Jervis inspizierte das Holz aus der Nähe. Fast eine volle Minute verstrich, bis er auf eine Ecke deutete.
»Da«, sagte er. »Ich kann den Übergang zum Deckel sehen, aber nur sehr schwach. Schöne Arbeit.«
Faroe juckte es überhaupt nicht, dass der Inspektor die Umrisse des Innenfachs entdeckt hatte. Er würde das Ganze in den Kielraum seines Schiffs einsetzen, genau dort, wo in diesem Moment sinnigerweise eine längliche Öffnung von sechzig Zentimetern klaffte. Faroe würde das Holz noch einer Behandlung unterziehen, und selbst für jemanden, der davon wusste, wäre es verdammt schwierig, das Versteck hinterher im Kielraum wiederzufinden.
»Schmuckschatulle, hm?« Der Inspektor strich mit seinen empfindsamen Fingerspitzen noch einmal behutsam über das Holz, um den Verschluss zu finden. »Der Verschluss müsste an dieser Stelle sein.«
»Ach ja?«
Jervis betastete ein rundes, zweieinhalb Zentimeter breites Astloch, den einzigen Makel in dem ansonsten feinkörnigen Eichenholz. Nichts. »Hm.«
»Ist doch egal«, meinte Faroe. »Sie haben es doch schon durchleuchtet. Es ist nichts drin.«
Jervis zog die Luft durch die Vorderzähne ein. »Ich könnte es konfiszieren und ins Feuer werfen.«
»Keine gute Idee. Ich hab da mal etwas von einer illegalen Beschlagnahme gehört.«
Es folgte ein längeres Schweigen, wobei der Inspektor, auf den Absätzen seiner Lederstiefel wippend, Faroes Körpersprache studierte.
»Verschwinden Sie«, sagte Jervis schließlich und wies mit dem Kopf zu der Tür nach Amerika. »Aber wenn ich Ihre Personalien hier in den Computer eingebe, können Sie sich den Proktologen sparen, weil wir Ihnen dann genau diese Körperhöhle durchputzen, jedes Mal, wenn Sie irgendeine Grenze überqueren.«
Faroe nickte. »Wünsche einen schönen Tag, die Herren.« Er nahm das Holz und verließ den Raum. Mit langen Schritten eilte er zu seinem Wagen und fuhr dann zur Oceanside Federal Bank, wo er einen Termin mit seinem Tresorfach hatte. Sollte Steele seinen Exangestellten demnächst wieder einmal mit einem Satz wie »du bist der Einzige, der das kann« ködern wollen, wäre besagter ehemaliger Angestellter mit einigen millionenschweren, lupenreinen Diamanten im Schiffskiel längst über alle Meere, vorausgesetzt seine Glückssträhne hielt an.
Faroe hatte sich seinen Ruhestand hart erarbeitet. Und er wollte ihn genießen.
Verflucht, er hatte es gründlich satt, die Menschheit vor ihrer eigenen Blödheit zu retten.
Kapitel 4
All Saints School
Samstag, 12:20 Uhr
Die unerwartete Kontrolle durch verschwitzte federales, die mit vorgehaltenen automatischen Waffen auf der gebührenpflichtigen Autobahn in die Fahrzeuge spähten, hatte Grace bereits zehn Angstminuten gekostet. Jetzt sah sie sich auf der gut instandgehaltenen Schotterstraße, die nach All Saints führte, mit dem nächsten Sicherheitscheck konfrontiert.
Ein glattrasierter junger Mann, in Levis und weitgeschnittenem Baumwollguayabera, blockierte die Straße. Eine schwarze Maschinenpistole hing an einem langen Schulterhalfter aus Leder quer über seinem Hemd. Die Ellbogen auf die Waffe gestützt, sah er ihrem Geländewagen entgegen. Abgesehen von seinem legeren Freizeithemd war er äußerlich nicht von den mürrischen, schwitzenden Männern auf der Autobahn zu unterscheiden.
Und er hatte mit Sicherheit die gleiche Waffe wie sie.
Grace hasste Waffen. Sie besaß selbst eine, sie konnte damit umgehen, und trotzdem war sie ihr verhasst, und ebenso hasste sie, was sie damit assoziierte: dass die Gesetze allein nicht immer und überall den Schutz ihrer Bürger gewährleisten konnten.
Außer dem Bewaffneten in der Straßenmitte sah sie am Straßenrand einen schwarzen Chevrolet Suburban mit dunkel getönten Scheiben stehen. Die Wagentüren standen auf beiden Seiten weit offen. Innen saßen zwei weitere Wachtposten. Der eine trug Levis und ein T-Shirt, der andere einen schwarzen Anzug mit einem weißen Hemd und einer Krawatte.
Beide Männer hielten Sturmgewehre quer über ihre Oberschenkel.
Mit einem mulmigen Gefühl hielt Grace den Wagen an, ließ das Fenster herunter und reichte ihren Pass hinaus. »Ich möchte meinen Sohn besuchen.«
Der Wachtposten riss die Augen auf, als er ihren Reisepass studierte. Seine rechte Hand wanderte an den Verschluss seiner Maschinenpistole. Sein Zeigefinger krümmte sich um den Abzug. Dann wandte er sich zu den Männern im Suburban um und stieß einen Pfiff aus. Daraufhin griff der Anzugträger nach einem Funkgerät und begann zu sprechen. Grace wartete, ohne sich etwas anmerken zu lassen. Auch Richter brauchten ein Pokerface.
Insgeheim war sie aber äußerst beunruhigt.
Das ist nichts, was man am Telefon besprechen kann.
»Alle Fenster öffnen, por favor«, sagte der Posten von draußen zu ihr.
Obwohl er sie in höflichem Ton angesprochen hatte, war es nicht als Bitte gemeint.
Grace betätigte ein paar Knöpfe, bis Ensenadas schwülheiße Luft das Wageninnere ausfüllte. Der Monsun hüllte die Sonne in einen metallgrauen, feuchten Nebelschleier, und die Temperatur lag um die achtunddreißig Grad.
Deshalb schwitze ich so. Wegen der Hitze.
Aber es war kalter Schweiß.
Der junge Wachtposten umkreiste den Mercedes und blickte prüfend durch die offenen Fenster, um sich zu vergewissern, dass der Kofferraum leer war.
Der Anzugträger sprach immer noch in sein Funkgerät. Grace konnte zwar nichts hören, aber so, wie er immer wieder zu ihr hersah, konnte sich das Gespräch nur um sie drehen.
Der Wachtposten mit der Maschinenpistole hatte seine Durchsuchung beendet und blickte über die Schulter. Der Mann im Suburban lauschte in den Hörer und nickte.
»Sie können weiterfahren, señora, aber fahren Sie direkt zum Fußballfeld«, befahl der Wachtposten.
»Warum? Ist irgendetwas ...?«
»Zum Fußballfeld«, wiederholte er und winkte sie ungeduldig durch. Der Finger seiner rechten Hand war noch immer um den Abzug gekrümmt.
Die unterschwellige Drohung bewirkte bei Grace, dass ihre Angst in Wut umschlug. Gerade wollte sie dem Wachmann seine ungehobelten Manieren vorhalten, als ihr Blick an der Waffe vorbei zum Saum seines weiten Hemdes wanderte, das sich ein Stück über den Hosenbund verschoben hatte.
Darunter sah sie etwas aufblitzen. Ein Abzeichen an seinem Ledergürtel. Sie erkannte es wieder. Es stammte von der gleichen Behörde, die ihr ihren mexikanischen Ausweis ausgestellt hatte – das heißt, vom mexikanischen Justizministerium.
»Sind Sie von der Bundespolizei?«, fragte sie rasch.
Der Wachtposten folgte ihrem Blick. Hastig zog er das Hemd über das Abzeichen.
»Weiter«, sagte er feindselig. »Andale. Ahora. Los!«
Als Grace nicht reagierte, hielt er ihr die Waffe vors Gesicht. So dicht, dass sie direkt in die schwarze Mündung blickte.
Sie gab Gas.
Durch das abrupte Anfahren wirbelten die schweren Reifen des Geländewagens eine dichte Splitt- und Staubwolke auf. Der Wachtposten machte einen Satz nach hinten und schrie etwas, was Grace geflissentlich überhörte.
Sie wollte so schnell wie möglich zu Lane, um ihn in die Arme zu nehmen und herauszufinden, was da eigentlich vorging.
Kaum eine Minute später hatte sie den Fußballplatz erreicht. Er lag am äußersten Rand des Campus, zwischen der Schulverwaltung und den zum Meer abfallenden Sandhängen. Eine große, ausgelassene Zuschauermenge hatte sich am Spielfeldrand der gepflegten Grünanlage versammelt und begleitete das Spielgeschehen mit Johlen und Pfiffen.
Grace fuhr auf einen freien Platz hinter einem der Tore und stellte den Motor ab. Unruhig und ängstlich suchte sie das Feld nach ihrem Sohn ab.
Da! Gott sei Dank!
In den Augen seiner Mutter stach Lane völlig auf dem Spielfeld heraus. Obwohl er noch keine fünfzehn war, besaß er die Wendigkeit und Schnelligkeit eines Zwanzigjährigen. Seelenruhig dribbelte er mit dem Ball durch zwei Verteidiger, die ihn in die Zange zu nehmen versuchten.
Im letzten Moment sprang er über ihre eingegrätschten Beine und rannte mit dem Ball weiter in Richtung Tor.
Vielleicht war es der Geruch der heißen, feucht-schweren Luft, der das bevorstehende Unwetter ankündigte. Vielleicht war es Lane, so schlank und wendig und voller Vertrauen in seinen Körper. Urplötzlich stieg in Grace eine Erinnerung auf, die sie eigentlich unbedingt vergessen wollte, und sie fühlte sich zurückversetzt in jene paar Tage vor sechzehn Jahren, als sie ihre selbstauferlegte, eiserne Disziplin ein einziges Mal beiseitegeschoben hatte, um mit Joe Faroe ein langes Wochenende zu verbringen, dem einzigen Mann, der ihr das Abenteuer jemals wert erschienen war.
Im Monsunsturm, in rhythmischen Wellen auf die Küste zurasend, über sie hinweg, durch sie hindurch, Faroes großer, schlanker Körper, in perfektem Einklang mit ihrem, in ihr, in ihm, und sie, entfesselt, wollte mehr, gab mehr, nahm mehr ...
Grace schüttelte heftig den Kopf, um die Erinnerung zu verscheuchen. Nach der Heirat mit Ted hatte sie nicht sagen können, wer der Vater des Kindes in ihrem Bauch war – Ted oder Faroe. Aber ihrer Meinung nach hatten die Chancen einer Vaterschaft eher bei Ted gelegen.
Als sie das Baby dann in den Armen hielt, war es ihr egal, wer der Vater war. Zum ersten Mal in ihrem Leben erfuhr sie, was Liebe war. Lanes winzige Hände, die perfekt geformten Fingernägel und die schönen, unschuldigen, nussbraunen Augen waren ihre Welt.
Er war so schnell gewachsen.
Erst war sie dagegen gewesen, dass er Fußball spielte, aber schließlich hatte sie nachgegeben, mit dem Hintergedanken, dass es weitaus weniger gefährlich war als American Football. Und jetzt gefiel es ihr sogar, dass ihr Sohn sich mit anderen kräftigen, jungen Männern messen konnte. Genau wie sein biologischer Vater war Lane zum Sportler geboren.
Lane stieß im Zickzack in den gegnerischen Strafraum vor, wobei der Ball fast mit seinem Körper verschmolz. Dann stürmten plötzlich die Verteidiger von allen Seiten auf ihn ein.
Mein Gott. Sie sind viel größer als Lane. Älter und stärker.
Sein eigenes Team fiel schon zurück, als Lane immer noch weiter vorstieß. Ein Verteidiger, ein rotes, zusammengerolltes Halstuch als Schweißband um den Kopf gebunden, setzte die Blutgrätsche an, und es war offensichtlich, dass er es nicht auf den Ball, sondern auf Lane abgesehen hatte. Lane versuchte, über das Bein des anderen zu springen, kam aber zu Fall, als dieser nachtrat.
Grace hatte die Hand schon an der Wagentür, als die Pfeife des Schiedsrichters gellte. Während sich Lanes Mannschaftskollegen um ihn scharten, zog der Schiedsrichter eine gelbe Karte aus seinen Shorts und zeigte sie dem Foulspieler. Dieser kam schnell wieder auf die Beine und versuchte, Lane mit einem drohenden Blick zum Aufstehen zu bewegen.
Lane stützte sich auf allen vieren ab, schüttelte benommen den Kopf und rappelte sich mühsam wieder auf. Er machte einen Schritt am Schiedsrichter vorbei, um sich auf seinen Gegner zu stürzen. Als er ihm gegenüberstand, war deutlich zu sehen, dass der andere um einiges älter und stämmiger war als Lane. Unter dem roten Stirnband, das die schulterlangen, schwarzen Haare zurückhielt, hatte er die wilden, schönen Gesichtszüge eines mestizo. Er wäre ebenso gut als Krieger wie als Sportler durchgegangen. Er hatte ein ruhiges, kühles Lächeln.
Der Schiedsrichter stellte sich zwischen die beiden Spieler, gestikulierte mit den Armen durch die Luft und redete eindringlich auf sie ein.
Kurz darauf drehte sich Lane um und mischte sich unter sein Team, um den angekündigten Eckstoß abzuwarten. Grace atmete durch. Ihr Sohn hatte ein aufbrausendes Temperament. Das machte ihn mutig, aber nicht immer klug.
Wie Joe Faroe.
Als das Spiel weiterging, klopfte es an die Fensterscheibe auf der Beifahrerseite. Sie sah direkt in das jovial lächelnde braune Gesicht von Carlos Calderón. Mit der unvermeidlichen schwarzen Havanna in seinem grinsenden Mund forderte er sie über Zeichensprache auf, ihm die Tür zu öffnen.
Mehr Männer mit noch mehr Waffen flankierten Calderón, die einen mit geschulterten Langgewehren, die anderen mit Maschinenpistolen, die sie lässig auf den Boden gerichtet in der Hand hielten. Die gleichen unverschämten Blicke, die gleichen unruhigen Augen wie der Wachtposten am Eingangstor.
Und auch die Abzeichen der Bundespolizei?
Aber diese Gedanken behielt Grace für sich. Sie entriegelte die Tür und nahm ihre Handtasche vom Beifahrersitz. Als Calderón die Tür öffnete, wollte sie ihn erst bitten, seine Zigarre draußen zu lassen. Aber sie besann sich eines Besseren und beschloss, Calderón die Ehrerbietige vorzuspielen, die er in Mexiko erwartete. Es fiel ihr nicht leicht, aber es war viel schlimmer mit anzusehen, wie Lane durch diese gemeinen Grätschen und Tritte zum Stürzen gebracht wurde. Sie streckte ihm kühl ihre Hand entgegen, um sich der intimeren mexikanischen Begrüßungszeremonie zu entziehen. »Hallo, Carlos. Wie geht es Ihnen?«
»Schön, Sie zu sehen, Euer Ehren«, erwiderte Carlos in akzentfreiem Englisch.
Mit einem Kopfnicken, das schon fast eine Verbeugung war, schloss sich seine frisch manikürte, weiche Hand um ihre. Er hielt ihre Finger einen Moment länger fest als notwendig. Vielleicht verbarg sich keine Absicht dahinter. Vielleicht wollte er sie nur wortlos daran erinnern, dass er ein mächtiger Mann war.
Er bestimmte die Grenzen der Höflichkeit, nicht sie.
»Ich bin sehr enttäuscht, dass Sie Ted nicht überzeugen konnten, Sie zu begleiten«, sagte Calderón.
Grace entzog ihm ihre Hand. »Ich sagte doch schon, dass Ted verschwunden ist.«
Calderón reagierte mit dem für mexikanische Männer typischen eleganten Achselzucken. Er war auf beiden Seiten der Grenze zu Hause, aber US-Amerikaner von Geburt. Er und Grace hatten sogar die gleiche private Oberschule in Santa Ana besucht. Aber südlich der Grenze gab er sich todo mexicano, so förmlich, wie es ein mexikanischer Geschäftsmann nur sein konnte.
Grace bevorzugte den US-amerikanischen Caldéron.
»Ich bin sehr beschäftigt«, sagte sie in ruhigem Ton. »Ich habe Ted seit längerer Zeit nicht mehr gesprochen. Ich hatte keine Gelegenheit, ihn zu informieren.«
Calderón zog an seiner Zigarre. »Wie schade.«
»Sie sind doch ein sehr bedeutender Klient der Edge City Investments«, sagte Grace. »Warum rufen Sie Ted nicht einfach in der Firma an?«
Anstatt mich unter Druck zu setzen und mir wegen meines Sohnes Angst zu machen?
Aber das sagte sie nicht laut. Ihre kasachische Großmutter war in diesem Punkt sehr klar gewesen: Zeige niemals, dass du Angst hast.
»Oh, dort habe ich es schon häufig probiert«, antwortete Calderón mit einem betrübten Lächeln.
Dicker, blauer Rauch verbreitete sich im Wagen.
Grace setzte ihr Gerichtssaalgesicht auf, jenes Gesicht, dem auch dann nichts anzumerken war, wenn es um sie herum zum Himmel stank.
Calderón schielte zu einer Gruppe von Männern, die hinter seinen Leibwächtern stand. Er zog noch einmal fest an seiner Zigarre. Die glimmende Spitze glühte rot auf.
Sie stellte fest, dass er nervös war.
Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Sie wollte nicht wissen, was es brauchte, um einem reichen und mächtigen Mann wie Calderón Angst zu machen.
»Sie wollten mit mir über Lane sprechen«, sagte sie. »Es ist nicht notwendig, dass Ted dabei ist.«
Dann schaltete sie das Gebläse ein und fuhr alle Fensterscheiben bis zum Anschlag hinunter. Während ihrer Schwangerschaft war ihr vom Zigarrenrauch übel geworden. Und jetzt wurde ihr davon auch nicht besser.
Calderón zog kräftig an seiner Zigarre und blies den Rauch gegen die Windschutzscheibe. »Tut mir leid. Ich habe mich wohl nicht klar genug ausgedrückt. Was das Wohl Ihres Sohnes betrifft, so gibt es da gewisse Aspekte, für die nur Ted die Verantwortung übernehmen kann.«
Grace’ Herz hämmerte. »Dann sprechen Sie bitte Klartext. Warum werde ich von Teds ältestem Freund und wichtigstem Geschäftspartner bedroht?«
Calderón sah sie überrascht an. »Bedroht?«
Sie zeigte auf die bewaffneten Männer. »Sie empfangen mich hier in Begleitung all dieser bewaffneten Männer. Ich habe sie vorher noch nie hier gesehen.«
»Die Wachen? Das ist nur eine Vorsichtsmaßnahme. Es gibt einige schwerreiche Leute, die ihre Söhne auf die All Saints School schicken. Bedauerlicherweise kommt es in Mexiko im Gegensatz zu den USA immer wieder zu Entführungen und anderen Sicherheitsproblemen.«
»Das ist ja alles ganz interessant«, sagte sie ruhig, »aber was hat das mit Ted zu tun?«
Und mit Lane.
»Da es Ted war, der Lane in All Saints angemeldet hat«, erklärte Calderón, »wurde ich von der Schulleitung gebeten, mit Ted Kontakt aufzunehmen.«
»Ich habe das Sorgerecht, gemeinsam mit Ted. Jeder von uns hat das Recht, über Lanes Wohl zu bestimmen.«
»Sorgerecht. Was für ein hübsches Wort, ein juristischer Begriff, der in amerikanischen Gerichtssälen gut ankommen mag. Aber das Rechtssystem bei uns in Mexiko ist nicht ganz dasselbe. Hier gelten andere, realistischere Erwägungen.«
»Wollen Sie damit sagen, dass ich in Mexiko nicht die Interessen meines Sohnes vertreten kann?«
Calderón blies den Rauch aus. »Zurzeit nicht. Das darf nur Ted.«
»Unter diesen Umständen werde ich Lane sofort mit nach Hause nehmen. Und Sie können sich mit Ted ausführlicher über das elterliche Sorgerecht unterhalten, sobald Sie ihn ausfindig gemacht haben.«
»Sie können Lane leider nicht mitnehmen«, entgegnete Calderón, ohne sie dabei anzusehen. »Da Ted die Anmeldepapiere für Lane unterschrieben hat, muss Ted ihn wieder abmelden.« Calderón schenkte ihr ein knappes, nervöses Lächeln. »Sie verstehen also, dass Sie Ted unbedingt finden müssen, nicht wahr?«
Grace spürte, wie ihr der Angstschweiß über das Rückgrat lief. Sie hatte dieses besorgte Lächeln schon früher gesehen, im barrio, bei den jungen vatos, die um die Gunst der Bandenführer buhlten. Plötzlich begriff sie, dass Carlos Calderón, der in Baja California und Mexiko als sehr mächtiger Mann galt, sich als Handlanger eines anderen verdingt hatte.
Der gewalttätig genug war, um Calderón nervös zu machen.
Jesus, Maria und Joseph. Werde ich diesen Dreck von der Gosse überhaupt nie los?
Sie hatte ihr Leben lang versucht, sich aus dem Sumpf zu befreien, ihn zu ignorieren, nicht mehr zurückzuschauen und sich so rasch wie möglich nach oben zu arbeiten, an einen Platz, wo es saubere Luft und sichere Nächte gab und eine attraktive Frau sich nicht an den Arm eines Mannes hängen musste, um an die Schalthebel der Macht zu kommen.
»Carlos.« Grace sprach ganz leise und ruhig, wie eine Richterin in einem Gerichtssaal. »Wollen Sie damit sagen, dass Lane hier festsitzt und nur von Ted befreit werden kann?«
Calderón sah hinüber zum Fußballplatz, wo der Schiedsrichter gerade gepfiffen hatte, um das Spiel zu unterbrechen. Dann blickte er wieder zu Grace, aber ohne ihr in die Augen zu sehen.
»Es tut mir leid«, sagte er. »Ich arbeite normalerweise nicht mit solchen Geschäftsmethoden.«
Er stieg aus und winkte jemandem am Spielfeldrand zu. Zwei Männer lösten sich aus der Zuschauermenge und kamen auf den Mercedes zustolziert.
»Ich bitte Sie«, sagte Carlos beschwörend zu ihr. »Steigen Sie aus und stellen Sie sich neben mich, um ihn zu begrüßen. Es ist nur eine Form des Respekts, das kann eine Richterin doch sicher verstehen?«
Widerstrebend verließ Grace den Wagen und blieb stehen, eine Armlänge von Carlos entfernt. Einer der beiden Ankömmlinge war ein schwarzhaariger Mexikaner in sauberen Jeans mit Bügelfalte, Stiefeln aus Straußenleder und einem frisch gestärkten, weißen Hemd mit Perlmuttknöpfen. Um den Hals trug er eine schwere Goldkette mit einem großen, diamantbesetzten Medaillon.
Das Alter des Mannes war schwer zu schätzen, außer dass er nicht mehr ganz jung war. Allein sein unerschütterliches Machogehabe verriet ihr, dass er nicht unter vierzig sein konnte. Beim Gehen zog er ein Bein etwas nach wie ein ehemaliger Rodeo-Cowboy, er hatte schmale Hüften und Narben von alten Verletzungen. Sein düsteres Gesicht zeigte die harten, stumpfen Züge seiner Vorfahren, die schon lange, bevor das Land der Gewaltherrschaft durch Cortés anheimfiel, in Mexiko gelebt hatten. Der Mann blinzelte in das helle, diesige Sonnenlicht. Sein linker Augapfel war milchigtrüb. Er war nicht größer als Grace.
Die Erkenntnis kam wie ein Schlag. Ich kenne ihn.
Hector Rivas Osuna war der Anführer des mächtigsten und brutalsten Verbrecherclans von Tijuana. Grace hatte sein Gesicht in der Presse gesehen, und sein Steckbrief hing in amerikanischen Postämtern aus.
Kein Wunder, dass Carlos so schwitzt.
Kapitel 5
All Saints School
Samstag, 12:25 Uhr
Der Mann neben Hector war die jüngere, etwas raffiniertere Ausgabe des hartgesottenen Verbrecherkönigs. Er trug ein Seidenhemd, weitgeschnittene, italienische Designerhosen, und seine bloßen Füße steckten in Halbschuhen, die locker ihre tausend Dollar wert waren. Seine Haare waren gestylt und geföhnt. Er war hellhäutiger und körperlich fitter. Eine Fliegersonnenbrille verdeckte seine Augen.
Dennoch sprang die Ähnlichkeit ins Auge, bis hin zu den schmalen Hüften und dem großspurigen Auftreten. Vater und Sohn oder vielleicht Onkel und Neffe.
»Wer ist der Jüngere?«, fragte Grace leise.
»Jaime Rivas Montemayor«, sagte Calderón sehr gedämpft. »Der gesetzliche Erbe der Rivas-Osuna-Gang. Abgekürzt ROG. Sehr brutal. Sehr gefährlich.«
Grace antwortete nicht, aber jetzt begriff sie, weshalb der Bundespolizist sein Abzeichen vor ihr versteckt hatte. Er und seine Kumpel tanzten nach der Pfeife Calderóns und des korruptesten Gangsterbosses von ganz Mexiko. Aus Calderóns Nervosität schlussfolgerte sie, dass auch er von Hector Rivas Osuna abhängig war.
Hector blieb in respektvoller Entfernung stehen und grüßte sie mit einer höflichen Verneigung des Kopfes.
»Euer Ehren.«
Nur ein winziger Anflug von Spott schwang in seiner Stimme mit.
Grace nickte ihm wortlos zu.
»Du hast ihr das mit Sohn gesagt?«, fragte Hector Calderón.
Sein Englisch tendierte stark zum Spanglish, einer ebenso rudimentären wie nützlichen Mischform der beiden Sprachen. Beim Sprechen richtete er sein gesundes Auge auf den Bankier, wobei er den Kopf schief legte, so dass sein blindes Auge unter dem gesenkten Lid sichtbar wurde. Er hatte es eindeutig durch eine Verletzung verloren: Die Narbe zog sich als weiße, gerunzelte, ausgefranste Linie bis unter sein dichtes Haupthaar. Jeder normale Mensch hätte eine Augenklappe getragen, um die Wunde zu verbergen.
Aber Hector war eben kein normaler Mensch.
»Nicht alles, Carnicero«, erwiderte Calderón. »Ich dachte, die Details wären überzeugender, wenn sie aus deinem Mund kommen.«
Carnicero. Der Schlächter.
Grace war überrascht, dass Calderón Hector so unverblümt mit seinem Spitznamen anredete. Sie blickte verstohlen zu dem Neffen hinüber. Er betrachtete seinen Onkel mit angewiderter Miene. Entweder bemerkte Hector es nicht, oder es machte ihm nichts aus.
Hector sah wieder zu Grace, mit dem gleichen abschätzigen Blick wie der mexikanische Zollbeamte, nur dass Hectors Ausdruck vielschichtiger war. Manche traditionellen mexikanischen Männer waren fasziniert von einflussreichen Frauen, solange sich ihr Einfluss nicht südlich des Río Tía Juana erstreckte. Offenbar gehörte Hector auch dazu.
Grace war sich nicht sicher, ob sie das als positiv oder negativ werten sollte.
»Ich weiß, du bist eine sehr einflussreiche Frau, eine Richterin«, sprach er sie an. »Du bist intelligent, also entschuldige meine einfache Sprache. Ich bin ein einfacher Mann. Du erkennst mich?«
Grace nickte.
»Bueno. Tijuana gehört mir«, sagte er ganz ruhig. »Ich mache Gesetze. Ich übe sie aus. Claro?«
Sie nickte wieder.
»Dein Mann hat mein Geld unterschlagen. Mucho dinero.«
Grace riss die Augen weit auf, und ihr Magen verkrampfte sich.
»Er gibt mir das Geld nicht zurück«, sagte Hector. »Ich töte den Sohn, el niño. Ganz einfach.«
Galle stieg bitter in ihrer Speiseröhre hoch. Sie schluckte sie hinunter.
Hector richtete sich aus seiner gebeugten Haltung auf und streckte sich.