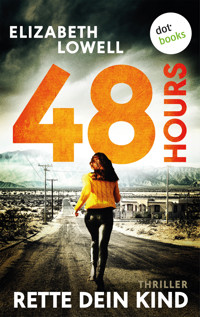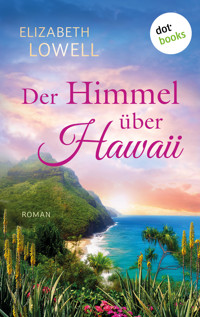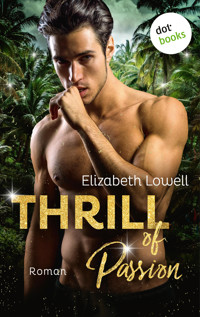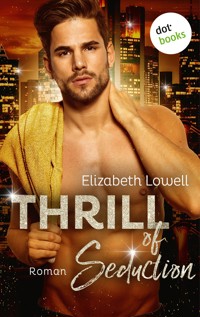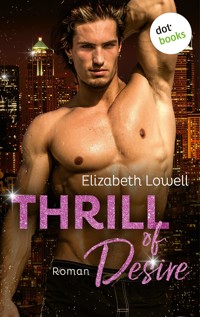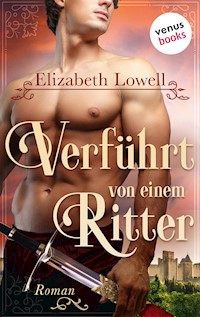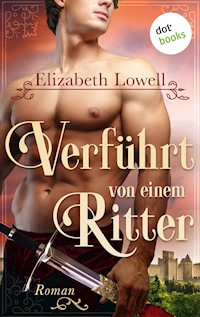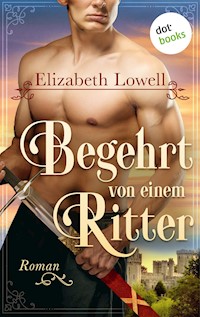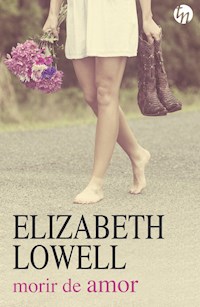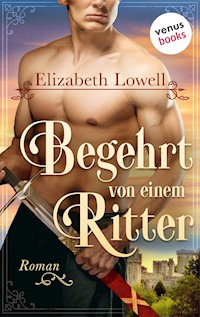
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: venusbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Valiant-Knights
- Sprache: Deutsch
Nur ihre Liebe kann ihn retten: Der bewegende historische Liebesroman »Begehrt von einem Ritter« von Elizabeth Lowell jetzt als eBook bei venusbooks. Schottland im 12. Jahrhundert: Als Belohnung für seine ruhmreichen Taten im Dienste des Königs erhält der Kreuzritter Dominic le Sabre die Burg Blackthorne – und mit ihr auch die Hand der schönen Lady Margaret. Obwohl die Verlobung eine Anordnung des Königs ist, fühlen beide sich vom ersten Treffen an zueinander hingezogen. Doch Margarets Stiefvater verfolgt ganz eigene Pläne: Er will sie mit seinem Bastardsohn Duncan verheiraten, um seine Linie fortzusetzen ... selbst wenn das Krieg auf Blackthorne bedeutet! Wird Margaret ihrem Stiefvater gehorchen, auch wenn das bedeutet, den Mann zu verraten, den sie mehr liebt als alles andere? »Im Reich der Liebe und Romantik ist Elizabeth Lowell die ungekrönte Königin«, sagt die mehrfach ausgezeichnete Erfolgsautorin Amanda Quick. Jetzt als eBook kaufen und genießen: Die Ritter-Romance »Begehrt von einem Ritter« von Bestsellerautorin Elizabeth Lowell ist der erste Band der Valiant-Knights-Saga, der unabhängig von den anderen Bänden gelesen werden kann. Lesen ist sexy: venusbooks – der erotische eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 628
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Schottland im 12. Jahrhundert: Als Belohnung für seine ruhmreichen Taten im Dienste des Königs erhält der Kreuzritter Dominic le Sabre die Burg Blackthorne – und mit ihr auch die Hand der schönen Lady Margaret. Obwohl die Verlobung eine Anordnung des Königs ist, fühlen beide sich vom ersten Treffen an zueinander hingezogen. Doch Margarets Stiefvater verfolgt ganz eigene Pläne: Er will sie mit seinem Bastardsohn Duncan verheiraten, um seine Linie fortzusetzen ... selbst wenn das Krieg auf Blackthorne bedeutet! Wird Margaret ihrem Stiefvater gehorchen, auch wenn das bedeutet, den Mann zu verraten, den sie mehr liebt als alles andere?
»Im Reich der Liebe und Romantik ist Elizabeth Lowell die ungekrönte Königin«, sagt die mehrfach ausgezeichnete Erfolgsautorin Amanda Quick.
Über die Autorin:
Elizabeth Lowell ist das Pseudonym der preisgekrönten amerikanischen Bestsellerautorin Ann Maxwell, unter dem sie zahlreiche ebenso spannende wie romantische Romane verfasste. Sie wurde mehrfach mit dem Romantic Times Award ausgezeichnet und stand bereits mit mehr als 30 Romanen auf der New York Times Bestsellerliste.
Elizabeth Lowell veröffentlichte bei venusbooks bereits »Verführt von einem Ritter« und »Geküsst von einem Ritter«.
Die Website der Autorin: elizabethlowell.com
***
eBook-Neuausgabe Januar 2023
Ein eBook des venusbooks Verlags. venusbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, München.
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1993 unter dem Originaltitel »Untamed« bei Avon Books, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1995 unter dem Titel »Fesseln aus Seide« bei Goldmann.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1993 by Two of a Kind, Inc.
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1995 by Wilhelm Goldmann Verlag, München
Copyright © der Neuausgabe 2023 venusbooks Verlag. venusbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, München.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/michelanbryphoto, FXQuadro, SergeyKlopotov, Malinovskaya Yulia
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-96898-224-3
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des venusbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Begehrt von einem Ritter« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.venusbooks.de
www.facebook.com/venusbooks
www.instagram.com/venusbooks
Elizabeth Lowell
Begehrt von einem Ritter
RomanDie Valiant-Knights-Saga 1
Aus dem Amerikanischen von Elke Bartels
venusbooks
KAPITEL 1
Frühlingzur Zeit der Herrschaft König Henrys I., Nordengland
Das Schmettern eines Kriegshorns schnitt durch die Stille, verkündete die Ankunft des neuen Herrn von Blackthorne Keep. Wie auf Befehl tauchte gleich darauf eine dunkle Silhouette aus den Nebelschwaden auf ... ein Ritter in voller Rüstung, der einen gewaltigen schwarzen Hengst ritt. Pferd und Reiter schienen eins, untrennbar miteinander verbunden, wild vor ungezügelter, maskuliner Kraft, die wie ein Sturm in ihrem Blut rauschte.
»Es heißt, er sei ein Teufel, Mylady«, murmelte die Witwe Eadith.
»Das sagen sie von allen normannischen Rittern«, erklärte Meg ihrer Zofe mit verzweifelter Ruhe. »Trotzdem muß es unter ihnen doch sicher auch Männer von freundlicher, großherziger Wesensart geben.«
Eadith stieß einen Laut aus, der ein verächtliches Schnauben hätte sein können.
»Nein, Mistress. Es ist bezeichnend, daß Euer Bräutigam ein Kettenhemd trägt und ein gefährliches Schlachtroß reitet. Gerüchte gehen um, daß es Krieg geben wird.«
»Es wird keinen Krieg geben«, widersprach Meg energisch.
»Das ist der Grund, weshalb ich heiraten werde – um dem Aderlaß endlich ein Ende zu bereiten.«
»Hoffentlich täuscht Ihr Euch da nicht. Sehr wahrscheinlich wird eher ein Feldzug stattfinden als eine Hochzeit«, verkündete Eadith mit grimmiger Befriedigung. »Tod den normannischen Invasoren!«
»Schweig still«, sagte Meg gedämpft. »Ich will kein Gerede von Krieg und Schlachten mehr hören.«
Eadith preßte die Lippen zusammen, enthielt sich jedoch jeder weiteren Äußerung über dieses Thema.
Meg stand an einem hohen Fenster des Hauptturms der Burg, von einem teilweise geschlossenen Fensterladen vor Blicken geschützt, und suchte den Horizont nach dem Kavallerietrupp ab, der den Krieger begleitet haben mußte, der bald ihr Ehemann würde.
Hinter dem Schlachtroß war jedoch keinerlei Bewegung auszumachen, nur silbrige Nebelschwaden wallten über die Felder. Das Horn war von jemandem geblasen worden, der sich in dem Wald jenseits der Äcker versteckt hielt.
Das Pferd und der in Kettenpanzer steckende Reiter rückten mit jedem Augenblick näher heran, während sie offen und furchtlos auf die Burg zugaloppierten. Kein Faktotum eilte hinter dem Ritter her. Keine Junker tauchten auf, die Schlachtrösser am Zügel führten oder Packpferde, beladen mit den schimmernden Metallwerkzeugen des Krieges.
Gegen jeden Brauch näherte sich Dominic le Sabre der angelsächsischen Burg mit nichts als dem dumpfen Ruf des Kriegshorns zur Begleitung.
»Er ist wahrhaftig der Teufel in Menschengestalt«, sagte Eadith und bekreuzigte sich hastig. »Ich würde ihn niemals heiraten.«
»Ganz richtig. Es ist ja auch meine Hand, die zu vergeben ist, nicht deine.«
»Möge Gott Euch schützen«, murmelte Eadith. »Ich zittere um Euch, Mylady, da Ihr nicht den Verstand habt, um Euch selbst zu zittern!«
»Ich bin die letzte eines uralten, stolzen Geschlechts«, erwiderte Meg mit heiserer Stimme. »Warum sollte eine Tochter von Glendruid vor einem namenlosen normannischen Bastard erzittern?«
Ihren mutigen Worten zum Trotz fühlte Meg einen kalten Schauder den Rücken herunterrieseln. Je näher Dominic le Sabre kam, desto mehr fürchtete sie, ihre Zofe könnte recht behalten.
»Gott sei mit Euch, M'lady, denn der Teufel wird es ganz sicher sein!«
Beim Sprechen bekreuzigte sich Eadith erneut.
Äußerlich gefaßt und ruhig beobachtete Meg, wie der stolze Krieger heranritt. Dies war der Mann, der sie zur Braut fordern würde und obendrein den ausgedehnten Landbesitz, den sie nach dem nahe bevorstehenden Tod ihres Vaters erbte.
Dies war der Köder, der einen berühmten normannischen Ritter von Jerusalem bis in die nördlichen Marschen von König Henrys Reich gelockt hatte. Die Güter ihres Vaters waren schon immer das Lockmittel für die schottischen Lords gewesen, deren Familien um Megs Hand für ihre Söhne gebeten hatten. Aber sowohl William II. als auch Henry I. hatten sich geweigert, Lady Margaret of Blackthorne eine Eheschließung zu gestatten.
Bis jetzt.
Der Ritter auf seinem gewaltigen Hengst kam unaufhaltsam näher, und Meg erkannte, daß ihr zukünftiger Ehemann in mehrfacher Hinsicht außergewöhnlich war, nicht nur, was die fehlende Eskorte betraf.
Wie ein ausgestoßener Ritter trägt er keines Herrn Farben; dennoch ist er ohne Zweifel ein Günstling des englischen Königs. Wenn er mein Ehemann ist, wird er mehr Land kontrollieren als irgend jemand, außer den mächtigsten Baronen des Königs.
Verwirrt betrachtete Meg den normannischen Ritter, der ein großer englischer Lord geworden war. Er ritt unter keinem Banner und trug niemandes Wappen auf seinem tränenförmigen Schild. Sein Helm war aus einem fremdartigen, geschwärzten Metall gefertigt; schwarz war auch das Schlachtroß, das er ritt. Der lange Umhang, der seinen kettenhemdbewehrten Körper umhüllte, war dunkel und prächtig und bauschte sich im Wind, während der Hengst mit kraftvollen Bewegungen über das Feld galoppierte.
So stolz wie Luzifer, alle beide. Und ebenso stark.
Meg beobachtete das Herannahen des finsteren Lords und zwang sich durch bloße Willensanstrengung, keine Angst zu zeigen.
»Er ist ungewöhnlich groß«, bemerkte Eadith.
Meg sagte nichts.
»Wirkt er nicht furchteinflößend auf Euch?« fragte die Zofe.
Der dunkle Ritter sah tatsächlich bedrohlich aus, aber Meg wollte auf keinen Fall, daß sich sämtliche Bediensteten in der Burg die Mäuler darüber zerrissen, wie ihre Herrin bei der Ankunft ihres zukünftigen Ehemannes am ganzen Körper bebte.
»Nein, auf mich wirkt er nicht furchteinflößend«, entgegnete sie fest. »Er sieht aus wie das, was er ist, ein Mann im Kettenhemd, der auf einem Kavalleriepferd reitet. Ein durchaus üblicher Anblick, wie ich meine.«
»Wenn man bedenkt, daß er im einen Moment noch ein Bastard war, und im nächsten Moment ist er einer der Günstlinge des Königs«, sagte Eadith bitter. »Obwohl Das Schwert kein eigenes Land hat, sprechen die Männer von ihm als von einem großen Lord.«
»Lord Dominic, genannt le Sabre, Das Schwert«, murmelte Meg. »Bastard oder Adliger, er hat den Sohn eines mächtigen Barons vor den Sarazenen gerettet. Es heißt, ohne ihn wäre Roberts Kreuzzug katastrophal ausgegangen. Ein kluger König belohnt einen so hervorragenden Krieger.«
»Mit angelsächsischem Land«, gab Eadith bissig zurück.
»Das ist das Vorrecht des Königs.«
»Ihr tut so, als kümmerte es Euch nicht.«
»Für mich zählt nur, daß das Blutvergießen endlich ein Ende hat.«
Hast du Mitleid im Heiligen Land gelernt, Dominic le Sabre? Wird die Hoffnung in meinem Herzen auf Großzügigkeit in deinem treffen?
Oder bist du wie das Kettenhemd, das du trägst – kalt und hart, schimmernd vor kriegerischer Verheißung, statt strahlender Hoffnungen für die Zukunft?
Eadith musterte die feingeschnittenen Züge ihrer Herrin. Nichts in Megs Ausdruck ließ auf die Gedanken schließen, die ihr durch den Kopf gingen. Dann beobachtete die Zofe erneut den normannischen Ritter, der sich den Toren einer Burg näherte, die er durch ein Eheversprechen gewonnen hatte statt in einem ehrenhaften Kampf.
»Es heißt, er kämpfte mit der Kälte von Eis und der Wildheit eines nordischen Barbaren«, sagte Eadith in das Schweigen hinein.
»Bei mir wird ihm das nichts nützen. Ich bin weder aus Eis noch ein Krieger.«
»Glendruid«, flüstere Eadith so leise, daß ihre Herrin es nicht hören konnte.
Meg hatte es jedoch gehört.
»Glaubt Ihr, er weiß es?« fragte Eadith nach einer Weile.
»Was?«
»Daß er niemals Erben von Euch haben wird.«
Megs klare grüne Augen hefteten sich auf das Gesicht der Witwe. Ihr Vater hatte darauf bestanden, daß sie Eadith als persönliche Bedienstete nahm.
»Tauschst du oft Klatsch mit den Dorfbewohnern, Tagelöhnern und Bauern?« erkundigte sich Meg spitz.
»Wird er das denn?« beharrte Eadith. »Wird er Söhne von Euch haben?«
»Was für eine seltsame Frage.« Meg zwang sich zu einem Lächeln. »Bin ich Hellseherin, um das Geschlecht meiner ungeborenen Kinder zu wissen?«
»Man behauptet, Ihr wäret eine Glendruid-Hexe«, erklärte Eadith brüsk.
»Glendruids sind keine Hexen.«
»Die Leute sagen aber etwas anderes.«
»Die Leute sagen viele abstruse Dinge«, gab Meg zurück. »Nach einem Jahr auf Blackthorne Keep solltest du das eigentlich wissen.«
Eadith warf einen Seitenblick auf ihre Herrin. »Die Leute sagen aber auch die Wahrheit.«
»Ach, tatsächlich? Für mich verwandelt sich kein Felsen in ein Blütenmeer, noch beugen sich Bäume herab, um in mein Ohr zu flüstern. Was für ein Unsinn!«
»Ihr habt sehr viel Geschick im Umgang mit Falken und Kräutern«, erwiderte Eadith.
»Ich bin ebensowenig eine Hexe wie du. Komm mir nicht mit solchen Behauptungen. Irgendeine beschränkte Seele könnte sie für wahr halten.«
»Es ist ja auch wahr.« Eadith zuckte die Achseln. »Die einfachen Leute fürchten Eure Mutter, täuscht Euch da nicht.«
Meg verkniff sich eine scharfe Bemerkung. Eadith konnte ausgesprochen lästig sein, wenn es um das Thema Lady Anna ging. Die Geschichten, die sich um Annas Tod rankten, faszinierten die Zofe.
»Meine Mutter ist tot«, sagte Meg fest.
»Das ist nicht das, was die Witwe des Schäfers gesagt hat. Sie hat Lady Annas Geist bei Vollmond draußen bei der heidnischen Grabstätte gesehen.«
»Die gute Frau trinkt zuviel Ale«, gab Meg zurück. »Der Alkohol hat ihren Verstand benebelt. War sie es nicht auch, die geschworen hat, daß Feen auf ihrer Untertasse tanzten und daß Geister das Ale getrunken hätten, das sie als Bezahlung für ein Ferkel schuldig war?«
Eadith öffnete den Mund, um zu sprechen.
Meg bedeutete ihr mit einer brüsken Geste zu schweigen. Sie wollte sich ausschließlich auf den Krieger konzentrieren, der allein auf Blackthorne Keep zuritt.
Dominic le Sabre schien so überzeugt von seinen eigenen Fähigkeiten, daß er seine Eskorte, die in diesem Moment am Horizont aus dem Nebel auftauchte, ein ganzes Stück hinter sich reiten ließ – zu weit entfernt, um ihm irgendeine Hilfe zu sein, falls man ihm einen Hinterhalt gelegt hatte. Dabei war der Gedanke an einen solchen Angriff durchaus nicht abwegig. Die Wut ihres Vaters bei der Nachricht, daß er seine einzige Erbin an einen normannischen Bastard verheiraten mußte, war so groß gewesen, daß Lord Johns Körper fast der Schlag getroffen hätte, einen Körper, der einmal für seine unbezwingbare Stärke berühmt gewesen war.
Doch selbst in der Blüte seiner Jugend und Kraft war Lord John eine ganze Handbreit kleiner gewesen als der normannische Ritter, der jetzt so verächtlich in den Burghof einritt.
Stolzer Krieger, dachte Meg. Aber wenn die Legende wahr sein sollte, müßtest du auch ein ebenso fähiger und potenter Verführer sein, um weibliche Nachkommen mit deiner Glendruid Braut zu zeugen.
Mit scharfen Augen musterte Meg den Mann, der ein Kettenhemd über schwarzem Leder trug, sein Haar unter einem stählernen Helm verborgen, sein Schlachtroß so dunkel und gefährlich wie Satans Träume.
Doch was Söhne betrifft, mein schwarzer Lord ...
Niemals.
Das ist der Fluch von Glendruid. In tausend Jahren ist es noch keinem gelungen, diesen Fluch aufzuheben.
Und bei deinem Anblick fürchte ich, daß er niemals aufgehoben wird.
Als hätte er Megs intensiven Blick auf sich gespürt, zog der Ritter plötzlich hart die Zügel an und brachte seinen Hengst zum Stehen. Das Pferd bäumte sich mit durchdringendem Wiehern auf seiner muskulösen Hinterhand auf und schlug heftig mit den Vorderhufen durch die Luft, als hätte es einen Angreifer vor sich. Wäre der Angreifer ein Fußsoldat gewesen, wäre er unter den scharfen Hufen des Schlachtrosses umgekommen.
Dominic le Sabre ritt das temperamentvolle Tier ohne jede Anstrengung, wobei er keine Sekunde den Blick von dem Fenster hoch oben in dem Hauptturm abwandte, dessen Läden teilweise geöffnet waren. Obwohl er niemanden durch die schmale Öffnung sehen konnte, wußte er, daß Lady Margaret of Blackthorne dort oben stand und beobachtete, wie ihr zukünftiger Ehemann zu der Burg hinaufritt.
Dominic fragte sich, ob sie wie ihr Vater war, der immer noch eine Schlacht kämpfte, die im Jahre 1066 verloren worden war, als William der Eroberer den angelsächsischen Adligen England genommen hatte.
Angelsächsische Lady, wirst du meinen Samen ohne Kampf empfangen? Wirst du mir die Söhne schenken, nach denen ich mich verzehre, wie sich ein durstiger Mann nach Wasser verzehrt?
Ein Ritter löste sich aus Dominics Gefolge und näherte sich in schnellem Galopp. Wieder bäumte sich Dominics Pferd auf und wieherte schrill. Lässig zügelte er sein Schlachtroß, als der Ritter ein paar Schritte von ihm entfernt aus dem Sattel sprang.
Der zweite Ritter trug eine Rüstung und ritt ebenfalls ein edles Tier. Es war ein Verstoß gegen Sitte und gesunden Menschenverstand, ein wertvolles Schlachtroß für eine gewöhnliche Reise zu benutzen, aber niemand war sicher gewesen, ob John of Cumbriland, Lord of Blackthorne Keep, eine Hochzeit oder einen Krieg geplant hatte.
»Beruhige dich, Crusader«, sprach Dominic beschwichtigend auf seinen Hengst ein. »Es gibt keinerlei Anzeichen für Verrat.«
»Noch nicht«, sagte der andere Ritter brüsk, während er neben Dominic trat.
Dominic schaute seinen Bruder an. Simons klare, schwarze Augen sahen alles, und ihnen entging nichts. Simon, genannt der Loyale, war der am höchsten geschätzte Ritter in Dominics Gefolge. Dominic bezweifelte, daß er ohne ihn die Heldentaten der Schlacht hätte vollbringen können, die ihm eine angelsächsische Braut zur Belohung eingebracht hatten, deren Reichtum an Ländereien groß genug war, um den englischen König neidisch zu machen.
Aber nicht habgierig. Die normannischen Könige hatten aus bitterer Erfahrung gelernt, daß die aufsässigen Angelsachsen der nördlichen Marschen zu schwierig waren, als daß man sie mit einem einzigen Schlag hätte besiegen können. Ehen zu stiften war eine bessere Methode zu ihrer Unterwerfung als Kriege.
»Hast du irgend etwas gesehen, was nicht in Ordnung ist?« fragte Dominic.
»Sven hat mich in den Wäldern aufgesucht«, erwiderte Simon.
»Und?«
»Er hat deinen Auftrag ausgeführt.«
»Ein wahrer Ritter«, meinte Dominic sardonisch, denn Svens Auftrag lautete, als heimkehrender Pilger verkleidet nach Blackthorne Keep zu gehen und eine der Hausbediensteten zu verführen.
»Das Frauenzimmer war willig«, sagte Simon achselzuckend.
Dominic knurrte.
»Sven hat herausbekommen, daß sich Duncan of Maxwell in der Burg aufhält«, sagte Simon kurz und bündig.
Dominics Hengst bäumte sich erneut halb auf, als Reaktion auf den Ärger, der in seinem Reiter aufstieg.
»Und die Dame Margaret?« erkundigte er sich kalt.
»Sie ist ebenfalls auf der Burg.«
»Eine Liaison?«
»Niemand hat sie zusammen erwischt.«
Dominic gab einen Grunzlaut von sich. »Das könnte nur bedeuten, daß sie gewitzt sind, nicht tugendhaft. Was ist mit den Vögten? Sind sie auch hier?«
»Nein. Sie sind zusammen mit Duncans Cousin nördlich von hier, auf Carlysle, einem von Lord Johns Gütern. Oder eher, einem von deinen Gütern.«
»Noch gehört es mir nicht. Erst wenn ich die Tochter heirate und der Vater stirbt.«
»Nur noch zwei Tage bis zur Hochzeit. Ich bezweifle, daß John das Festgelage überleben wird, das auf die kirchliche Trauung folgt«, gab Simon zurück.
Dominic wandte sich von seinem Bruder ab und schaute auf Blackthorne Keep, das über dem grünen Hügel aufragte, wo es die Landschaft dominierte. Lord John hatte sich finanziell völlig verausgabt beim Bau der viergeschossigen Burg mit ihren dicken Steinmauern und den massiven Ecktürmen.
Es waren keine Kosten gescheut worden, um den Ort zu einer militärischen Festung zu machen, die fast sicher gegen Angreifer sein würde. In einer Entfernung von dreißig Metern war die Burg von einem halbfertigen Steinwall umgeben. In vollendetem Zustand wäre der Wall doppelt so hoch wie ein Mann zu Pferde gewesen. Aber Stein wich hölzernen Palisaden, deren Schwäche Dominics aufmerksamer Blick in einem einzigen Moment registrierte.
Zumindest hatte John soviel Verstand, einen breiten, tiefen Burggraben zu ziehen, um Angreifer aufzuhalten. Doch auch mit dem Graben ist die Burg zu verletzlich. Ein paar Eimer brennendes Pech gegen die Palisaden, und schon wäre der äußere Wall durchbrochen. Die Burg selbst würde nicht länger halten als die Fähigkeit der Ritter, Durst zu ertragen.
Es sei denn, es gibt einen Brunnen innerhalb der Burg .... Falls nicht, werde ich dem Mangel sofort abhelfen.
Wieder ließ Dominic seinen Blick über das hoch aufragende Steingebäude auf dem Hügel schweifen, der sich bemühte, frühlingshaftes Grün zu zeigen. Ein Torhaus war in die halbfertige äußere Mauer hineingebaut worden. Die Brücke über dem Burggraben war noch hochgezogen.
»Wo ist der Torhüter?« wollte Simon wissen. »Erwarten sie von uns, daß wir unser Lager vor der Burg aufschlagen?«
»Geduld, Bruder«, erwiderte Dominic sardonisch. »John verdient eher unser Mitleid als unseren Zorn.«
»Ich würde ihm lieber meinen Panzerhandschuh in sein angelsächsisches Gesicht schlagen.«
»Vielleicht bekommst du ja die Gelegenheit.«
»Habe ich dein Wort darauf, mein Lehnsherr?« gab Simon zurück.
Dominics Lachen war so hart wie das Metall seines Helms.
»Armer John of Cumbriland«, sagte er. »Sein Vater und sein Großvater konnten die Flut normannischer Invasoren nicht aufhalten. Auch er nicht. Jetzt stirbt er an der Auszehrung und hat nur eine Tochter als Erben. Was für ein bedauernswerter Zustand. Man könnte fast glauben, er wäre verflucht.«
»Das ist er.«
»Was?«
Bevor Simon antworten konnte, verkündete ein gedämpftes Knirschen von Ketten und Zahnrädern, daß die Zugbrücke herabgelassen wurde.
»Ah«, sagte Dominic mit grimmiger Befriedigung. »Unser verdrießlicher Angelsachse hat beschlossen, sich seinen normannischen Peers zu beugen. Sag meinen übrigen Rittern, sie sollen rasch kommen.«
»Auf ihren Schlachtrössern?«
»Ja. Eine kleine Demonstration von Stärke wirkt einschüchternd und könnte uns späteres Blutvergießen ersparen.«
Dominics nüchterne Beurteilung von Taktiken war nichts Neues für Simon. Trotz seines Muts und seiner Fähigkeiten im Kampf war Dominic nicht blutgierig wie einige andere Ritter. Er war eher so kalt wie ein nordischer Winter, wenn er kämpfte. Es war das Geheimnis seines Erfolgs und recht verunsichernd für Ritter, die niemals derartige Disziplin kennengelernt hatten.
Gerade als Simon sein Pferd an den Zügeln in Richtung Wald herumzog, rief Dominic ihm zu. »Was meinst du damit, daß John die Hochzeitsfeiern vielleicht nicht überleben wird?«
»Er ist wesentlich schwerer erkrankt, als wir dachten.«
Schweigen breitete sich aus, gefolgt vom Geräusch einer gepanzerten Faust, die auf einen gepanzerten Schenkel schlug.
»Dann beeil dich, Bruder«, sagte Dominic scharf. »Ich möchte nicht, daß ein Begräbnis meine Hochzeit stört.«
»Ich frage mich, ob Lady Margaret ebenso darauf brennt zu heiraten wie du.«
»Ob sie darauf brennt oder wie ein störrischer Esel die Füße schleifen läßt, wenn sie zum Altar geführt wird, spielt keine Rolle. Bis nächsten Ostern wird mein Erbe geboren sein.«
KAPITEL 2
Allein in ihrem Gemach im vierten Stock der Burg löste Meg die Bänder ihres Überwurfs und warf das abgetragene Kleidungsstück aus rostbrauner Wolle aufs Bett. Ihre bodenlange Tunika flog gleich hinterher. Das Kreuz, das sie um den Hals trug, schimmerte wie flüssiges Silber im Kerzenlicht. Bei jedem Schritt, den sie machte, raschelten getrocknete Binsen, Kräuter und Blumen vom letzten Sommer unter ihren Füßen. In aller Eile zog sie die schlichte Tunika und den Mantel der Tochter eines Bürgerlichen an.
Frauengelächter schallte aus der großen Halle im unteren Stockwerk herauf. Meg hielt den Atem an und flehte innerlich, daß Eadith zu sehr damit beschäftigt war, mit Duncan zu flirten, um sich nach den Bedürfnissen ihrer Herrin zu erkundigen. Eadith’ ständiges Geplapper über Lord Dominics brutale Kraft und kaltes Wesen hatte Megs Nerven angegriffen.
Sie wollte nichts mehr davon hören. Sie wollte ihrem zukünftigen Ehemann noch nicht einmal vorgestellt werden, jedenfalls nicht bis zur morgigen Hochzeit, weil ihr Vater gesagt hatte, er sei zu schwach, um sein Bett zu verlassen. Meg wußte nicht, ob es die Wahrheit war. Sie wußte nur eines: daß sie morgen mit einem Mann vermählt würde, den sie erst gestern zum ersten Mal flüchtig gesehen hatte.
Die Hochzeit wurde zu sehr überstürzt, als daß es Megs Seelenfrieden gutgetan hätte. Die Vision von Dominic le Sabre, wie er auf einem wilden Schlachtroß aus dem Nebel auftauchte, hatte sie selbst im Schlaf verfolgt. Sie verspürte kein Bedürfnis, von Schmerzen gepeinigt unter einem kalten Krieger zu liegen, während er seinen Samen in ihren unfruchtbaren Körper ergoß.
Und sie hegte keinerlei Zweifel, daß es eine unfruchtbare, schmerzhafte Vereinigung sein würde. Dem rauhen Ritter die ersehnten Erben zu versagen, wäre eine kleine Entschädigung für ihr zukünftiges Schicksal, Nacht für Nacht von seinem harten normannischen Schaft gequält zu werden.
Meg erstarrte das Blut in den Adern bei dem Gedanken daran. Seit vielen Jahren wußte sie, was ihre Glendruid-Mutter dazu getrieben hatte, in den Wald zu gehen und niemals zurückzukehren, ihre Tochter Johns strenger Hand zu überlassen. Meg hätte es lieber nicht gewußt, denn es war, als schaute sie in ihre eigene Zukunft.
Vielleicht stimmt die Legende. Vielleicht existiert tatsächlich eine andere, freundlichere Welt jenseits von unserer, und ihr Eingang liegt irgendwo innerhalb des uralten Grabhügels. Vielleicht ist Mutter jetzt dort und spricht mit dem Falken auf ihrem Handgelenk, während ihre große getigerte Katze in ihrem Schoß schläft und warmes Sonnenlicht sie einhüllt ...
Das Lachen einer Frau drang zu Meg herauf und unterbrach ihre düsteren Gedanken. Sie runzelte die Stirn. Das Lachen war neu. Kehlig und schwül wie ein Sommerwind. Es mußte der normannischen Frau gehören, die Meg vom Fenster ihres Raumes aus erspäht hatte. Selbst aus der Ferne hatten das schwarze Haar und die vollen roten Lippen der Frau ausgereicht, um jedem Mann den Kopf zu verdrehen.
Was kümmert es mich, daß Lord Dominics Geliebte eine Schönheit ist? sagte Meg sich ungeduldig. Wichtiger ist, daß ich von hier verschwinde, bevor Eadith kommt, um mir brühwarm die neuesten Geschichten über normannische Brutalität zu servieren. Ob sie wahr sind oder nicht – und das frage ich mich häufig! – Eadith’ Geschichten machen mich nervös.
Mit fliegenden Fingern knüpfte Meg das gestickte Band auf, das durch ihre langen Zöpfe geschlungen war. Ungeduldig flocht sie ihr Haar erneut und befestigte die Enden mit Lederschnüren. Ein einfaches Kopftuch mit einem gedrehten Lederreif vervollständigte ihre Kleidung.
Meg eilte aus dem Raum und lief die steinerne Wendeltreppe zum zweiten Geschoß der Burg hinunter. Bis sie am Fuß der Treppe angekommen war, hatte sich einer ihrer Zöpfe schon wieder halb gelöst. Wie ein Flammenmeer ergoß sich ihr leuchtendes, rotgoldenes Haar über die neutrale graue Wolle ihres kurzen Mantels.
Bedienstete verbeugten sich hastig, als Meg durch den angefügten Vorbau eilte, der den Eingang der Burg schützte. Niemand fand ihre bürgerliche Kleidung seltsam, denn sie hatte sich frei auf dem Anwesen bewegt, seit sie dreizehn gewesen war und der König ihre Vermählung mit Duncan of Maxwell abgelehnt hatte. Mit neunzehn, einem Alter, in dem die meisten Frauen ihres Standes einen Ehemann und eine Handvoll Babys hatten, galt Meg bereits als alte Jungfer, deren Vater alle Hoffnung auf Erben aufgegeben hatte.
Sie nickte dem Diener zu, der ihr die Tür öffnete, und trat aus dem Vorbau auf die steile Steintreppe hinaus, die zu dem kopfsteingepflasterten Hof hinunterführte. Ihre weichen Lederschuhe machten keinerlei Geräusch, als sie die schlüpfrigen Stufen hinabstieg. So trittsicher wie eine Katze glitt sie die Treppe in den offenen Hof hinunter, wo der Wind durch Kornkammer und Küche streifte und die Federn der Gänse und Truthähne zerzauste, die gebündelt an der Wand hingen und aufs Rupfen warteten.
Über ihr war der graue Himmel mit Streifen von blassem Blau durchzogen. Der weißglühende Sonnenball brannte blaß durch Schleier milchigen Nebels. Das Silberlicht des Frühlings verlieh der Landschaft einen zarten Schimmer, und der Anblick hob Megs Stimmung augenblicklich. Aus den Taubenschlägen zu ihrer Linken drang das perlende Gurren von Tauben. Zu ihrer Rechten ertönte der hohe, klagende Schrei eines Geierfalken, der aus dem Stall geholt wurde, um auf einem Holzbalken im Hof angekettet zu werden.
Bevor Meg die beiden Stufen zum Torhaus genommen hatte, kam ein Kater mit drei weißen Pfoten und faszinierenden grünen Augen auf sie zugelaufen, erfreut miauend und den flauschigen Schwanz steil in die Luft gereckt. Meg beugte sich herab und streckte die Arme aus, gerade als das Tier zum Sprung ansetzte, zuversichtlich, daß es in ihren Armen aufgefangen und gehalten würde.
»Guten Morgen, Black Tom«, sagte Meg lächelnd.
Der Kater schnurrte und rieb seinen Kopf an Megs Schulter und Kinn. Seine langen weißen Augenbrauen und Schnurrbarthaare bildeten einen verblüffenden Kontrast zu seinem schwarzen Gesicht.
»Oh, was für ein herrlich weiches Fell du hast! Schöner als die weißen Hermeline auf dem Mantel des Königs, darauf wette ich.«
Black Tom schnurrte zustimmend und blickte seine Herrin unverwandt aus schrägen, grünen Augen an. Meg trug den Kater zum Torhaus, während sie weiterhin ruhig auf ihn einsprach.
»Einen schönen guten Morgen, M'lady«, sagte der Torwächter und erwies ihr respektvoll seine Reverenz.
»Guten Morgen, Harry. Geht es deinem Sohn besser?«
»Ja, dank Gott und Eurer Medizin. Er ist wieder so lebhaft wie ein junges Hündchen und so neugierig wie ein Kätzchen.«
Meg lächelte. »Das ist wundervoll.«
»Werdet Ihr nach dem Falken des Priesters sehen, nachdem Ihr Euch um Eure Kräuter gekümmert habt?«
Smaragdgrüne Augen musterten forschend Harrys Gesicht, als Meg fragte: »Verweigert die kleine Jägerin immer noch das Futter?«
»Ja.«
»Gut, ich werde nach ihr sehen.«
Harry hinkte zu der riesigen Doppeltür, die sich auf den äußeren Burghof öffnete, wenn die Zugbrücke über den Graben heruntergelassen war. In das massive Holz des einen Torflügels war ein kleineres Portal eingelassen. Harry riß das Portal auf, wobei ein Rechteck dunstigen Tageslichts in das dunkle Torhaus hereinfiel. Als Meg hindurchging, beugte sich Harry vor und sagte gedämpft: »Sir Duncan hat nach Euch gefragt.«
Meg wandte sich rasch zu dem Torwächter um. »Ist er krank?«
»Der?« meinte Harry spöttisch. »Der ist so stark wie eine Eiche. Nein, er wollte wissen, ob Ihr vielleicht krank wäret. Ihr seid heute morgen nicht in der Kapelle gewesen.«
»Der gute Duncan. Wie freundlich von ihm, sich nach mir zu erkundigen.«
Harry räusperte sich. Nicht viele Männer hätten Duncan of Maxwell als freundlich und gut bezeichnet. Andererseits war die Herrin eine Glendruid Hexe. Sie hatte etwas an sich, was selbst die wildesten Geschöpfe besänftigte.
»Er war nicht der einzige, dem Eure Abwesenheit aufgefallen ist, wie ich gehört habe«, erklärte Harry. »Der normannische Lord war recht verärgert, Euch nicht zu sehen.«
»Sag Duncan, daß ich wohlauf bin«, erwiderte Meg und eilte durch die Tür.
»Sicherlich werdet Ihr ihn eher sehen als ich.«
Sie schüttelte den Kopf. Flammen schienen in ihrem rotgoldenen Haar zu züngeln, als sie vorwärtsstrebte und über ihre Schulter zurück sprach.
»Mein Vater hat mich gebeten, nach der Andacht nicht an sein Krankenlager zu kommen. Und da Duncan in letzter Zeit kaum von Vaters Seite weicht ...« Sie zuckte die Achseln.
»Was soll ich sagen, wenn Lord Dominic nach Euch fragt?« erkundigte sich Harry und warf seiner Herrin einen Blick zu.
»Wenn er fragt – was ich bezweifle -, sag ihm die Wahrheit. Du hast heute morgen keine gutangezogene Lady die Burg verlassen sehen.«
Der Torhüter betrachtete Megs schlichte Kleidung und lachte. Dann verblaßte sein Lächeln, und er schüttelte traurig den Kopf.
»Ihr seid die Tochter Eurer Mutter, immer von dem Drang getrieben, außerhalb der Steinmauern zu sein. Wie ein Falke war sie, der nach Freiheit verlangt.«
»Jetzt ist sie frei.«
»Ich bete, daß Ihr recht habt, Mistress. Gott möge ihrer armen Seele Ruhe schenken.«
Meg wandte ihren Blick von Harrys weisen, blaßblauen Augen ab. Das Mitleid, das er für sie empfand, stand ihm nur zu deutlich ins Gesicht geschrieben. Sie war eine Glendruid, Tochter einer Glendruid Frau, und wie ihre Mutter würde sie erst im Tode frei sein.
Am anderen Ufer des Fischteichs wartete ein Königsfischer hoffnungsvoll darauf, daß eine Mahlzeit die glatte Oberfläche des Wassers kräuselte. In dem Schilf am Rande des Teichs stand ein Reiher mit gespenstisch schimmerndem grauen Gefieder, bewegungslos wie eine Statue. Raben riefen mit krächzenden Stimmen von den Zinnen des oberen Wehrturms herab. Wie zur Antwort beschimpfte einer der Gärtner seinen Gehilfen, weil er auf eine empfindliche junge Pflanze getreten war.
Einen Moment lang schien es, als hätte sich nichts verändert, als wäre Meg immer noch ein Kind, und ihre Mutter sänge leise von verlorener Liebe, während Old Gwyn Runen auf Megs Unterkleid stickte, wo man sie fühlen, aber nicht sehen konnte ... als wäre kein arroganter normannischer Ritter in die Burg geritten, um eine Ehefrau, Grundbesitz und Erben zu fordern, deren Zukunft niemand voraussagen konnte.
Meg atmete tief ein, sog die saubere Luft in ihre Lungen, schwelgte in ihren frischen, frühlingshaften Düften. Ein kräftiger Windstoß ließ ihre Röcke hochwirbeln. Der kalte Lufthauch an ihren Beinen warnte vor einem unbeständigen Frühling, beeinträchtigt durch die letzten Auswirkungen des langen, harten Winters.
Der Schrei eines wilden Habichts hallte klagend über die Wiese, wo grüne Schößlinge zwischen den letztjährigen Heustoppeln hervorlugten. Ganz in der Nähe flatterte ein Sperber über die Wiese und suchte nach der ersten Mahlzeit des Tages. Noch vor wenigen Tagen hatte das Falkenweibchen des Priesters ganz genauso über dem Feld geschwebt und war dann im Sturzflug auf seine Beute herabgestoßen. Ein wilder Falke von dreifacher Größe hatte es jedoch ebenfalls auf die Beute abgesehen. Bevor der Priester einschreiten konnte, war das prächtige kleine Falkenweibchen schwer verwundet gewesen.
Abrupt machte Meg kehrt und marschierte zum Torhaus zurück. Ihre Setzlinge konnten warten. Der Falke nicht.
Als hätte er sie erwartet, öffnete Harry das Tor, noch bevor sie drei Schritte getan hatte, und ließ sie in den Burghof ein. Als Meg Black Tom auf das feuchte Kopfsteinpflaster setzte, warf er ihr einen Blick grünäugiger Empörung zu.
»Du kannst jetzt nicht mit mir kommen. Ich muß zuerst zu den Volieren«, erklärte sie dem Kater.
Der Kater blinzelte und fing dann an, sich in aller Ruhe zu putzen, als hätte er niemals erwartet, auf einen Streifzug durch die Katzenminze in Megs Kräutergarten mitgenommen zu werden.
Sobald Meg in Sichtweite der hölzernen Ställe kam, die die stattliche Ansammlung von Jagdvögeln von Blackthorne Keep beherbergten, kam der Falkner herbeigeeilt, deutliche Erleichterung auf dem Gesicht.
»Danke, Mistress«, sagte William mit einer Verbeugung. »Ich hatte schon befürchtet, Ihr würdet zu beschäftigt sein mit den Hochzeitsvorbereitungen, um nach dem verletzten Falken zu sehen.«
»Niemals«, erwiderte Meg ruhig. »Unser Leben wäre so viel ärmer ohne die wilden kleinen Geschöpfe. Habt Ihr meinen Handschuh?«
William reichte ihr einen Lederhandschuh, den er vor Jahren für Megs Mutter angefertigt hatte. Zerkratzt und aufgerauht vom langen Gebrauch zeugte das Leder von den rasiermesserscharfen Krallen der Greifvögel.
Meg ging zu dem Käfig, in dem der verwundete Vogel saß. Sie mußte sich bücken, um hineinzugelangen, aber in seinem Inneren konnte sie aufrecht stehen. Nach einem Augenblick gewöhnten sich ihre Augen an das Halbdunkel. Sie entdeckte das Falkenweibchen auf einer Stange im hintersten Winkel des Käfigs.
Als Meg hinüberging und ihm ihren Unterarm als Sitzgelegenheit anbot, verweigerte der Vogel. Meg pfiff leise. Der Falke trat unschlüssig von einem Fuß auf den anderen, bis er sich schließlich mit steifen, mühsamen Bewegungen und einem schleifenden Flügel auf ihren Unterarm locken ließ.
Meg ging zur Tür des Geheges und begutachtete den kleinen Falken in einem Strahl blassen Tageslichts. Augen, die klar hätten sein müssen, blickten trübe. Federn, die in feinen Farbschattierungen von Blaugrau bis hin zu einem gelblichen Braun hätten schimmern müssen, sahen fahl grau aus. Der Griff der Vogelklauen auf dem Handschuh war ohne jede Kraft.
»Ach, du armes Kleines«, flüsterte Meg traurig. »Bald wirst du weit hinauf in einen Himmel entschweben, den kein Mensch je gesehen hat. Gott wird dich von deinen Schmerzen erlösen.«
Behutsam setzte Meg den Falken wieder auf seine Stange. Lange Minuten sprach sie leise und beruhigend auf den Vogel ein. Langsam schlossen sich die trüben Augen. Sobald sie sicher sein konnte, daß den Falken keine Bewegung stören würde, wandte sie sich zum Gehen.
Als Meg aus der Voliere herauskam, stand Dominic le Sabre hinter dem Falkner.
Sie blieb wie angewurzelt stehen, als sie in freudlose graue Augen aufblickte und ein Gesicht mit klaren, strengen, gutgeschnittenen Zügen. Wo andere Männer lange Bärte trugen oder völlig glatt rasiert waren, hatte dieser Krieger seinen schwarzen Bart und Schnurrbart kurz geschoren. Noch hatte er langes, wallendes Haar, um den kantigen Flächen seines Kriegergesichts etwas von ihrer Härte zu nehmen. Sein dichtes schwarzes Haar war kurz geschnitten, um unter einen Schlachthelm zu passen.
Groß, kraftvoll und unbeweglich ragte Dominic le Sabre vor ihr auf und betäubte Megs Sinne für den Zeitraum eines Atemzugs, eines zweiten, eines dritten. Dann – so sicher, wie sie den nahenden Tod des Falken geahnt hatte – spürte sie Dominics unbeugsame Selbstkontrolle, eine eiserne Herrschaft über sich selbst, die kein Gefühl, keine Wärme, keine Schwäche zuließ, nichts außer eiskalter Berechnung hinsichtlich Macht und Nachkommenschaft.
Zuerst dachte Meg, Dominics Selbstkontrolle sei so nahtlos und eisig wie der Winter selbst. Dann fühlte sie den Widerhall gewaltsam unterdrückten Leids tief unter der kalten Zurückhaltung des Kriegers. Die Entdeckung war so unerwartet und ergreifend, als hörte man den süßen Gesang einer Nachtigall mitten in der Nacht.
Großer Gott, was hat dieser Mann ertragen müssen, daß er sich zwingt, nahezu alle menschlichen Emotionen zu unterdrücken?
Unmittelbar auf diesen Gedanken folgte eine andere, beunruhigendere Wahrnehmung. Trotz allem brannte ein wildes, charismatisches, maskulines Feuer in Dominic, das Meg auf einer Ebene ihres Seins berührte, von deren Existenz sie bisher noch nicht einmal gewußt hatte.
Und etwas in ihr erwachte, streckte sich wie ein Tier, reagierte darauf.
Es machte ihr Angst. Ihr, die sich vor nichts fürchtete, noch nicht einmal vor den gefährlichsten Tieren des Waldes.
»Mis-« begann William, verwundert über ihre Reglosigkeit.
Meg fiel ihm ins Wort, bevor er ihre Identität verraten konnte.
»Einen guten Tag, Herr«, sagte sie zu Dominic.
Vor Williams verblüfften Augen erwies Meg Dominic ihre Reverenz und knickste vor ihm, als wäre sie nicht die Burgherrin, sondern nur ein einfaches Frauenzimmer aus dem Dorf.
»Das kleine Falkenweibchen des Priesters wird bald erlöst sein«, sagte sie mit leiser Stimme zu William.
»Ach je«, erwiderte er betrübt. »Der gute Pater wird schmerzlich um sie trauern. Er liebte es, mit ihr auf die Jagd zu gehen. Sagte immer, es täte seiner Seele gut wie nichts anderes, außer einer schönen Messe.«
»Ist einer der Vögel krank?« wollte Dominic wissen.
»Pater Millersons Falke«, erklärte William.
»Eine Krankheit?« fragte Dominic scharf.
William schaute Meg an.
»Nein«, erklärte sie mit rauher Stimme. »Es ist eine Kampfwunde, die ihm ein wilder Habicht zugefügt hat, keine Seuche, die die Greifvogelställe oder Taubenschläge leeren würde.«
Als Meg erneut knickste und sich zum Gehen wandte, hielt Dominic sie auf. »Warte«, sagte er.
Er ertappte sich dabei, daß er äußerst neugierig auf die junge Frau war, die aus der Voliere aufgetaucht war wie eine Flamme aus der Dunkelheit, ihre Augen so grün und strahlend wie Smaragde im hellen Sonnenlicht. Ihre wunderschönen Augen verrieten ihm einiges über ihre Gedanken: Traurigkeit, als sie den sterbenden Vogel zurückgelassen hatte, Überraschung, Dominic bei den Ställen zu sehen, und ... Furcht? Ja, Furcht.
Er flößte ihr Angst ein.
Unter Dominics aufmerksamem Blick verdunkelten sich die Augen des Mädchens plötzlich – etwa so, wie das Meer beim Übergang von Tag zu Nacht die Farbe wechselt. Jetzt ließen ihre Augen nichts mehr von dem erkennen, was ihr durch den Kopf ging.
Was für ein außergewöhnliches Frauenzimmer.
Dominic strich sich nachdenklich über seinen kurz geschnittenen schwarzen Bart, während er Meg forschend betrachtete.
Dieses Haar. Prachtvoll. Gold und Rot und Rostbraun. Es verleiht ihrer Haut einen elfenbeinzarten Schimmer, läßt sie wie feinste Seide aussehen. Ich frage mich, wen ich bezahlen muß, um sie in meinem Bett zu haben. Vater, Bruder, Onkel?
Oder Ehemann ...
Dominic runzelte die Stirn. Die Vorstellung, daß das Frauenzimmer möglicherweise verheiratet war, gefiel ihm gar nicht. Das letzte, was er vorhatte, war, den Normannen-hassenden Vasallen von Blackthorne Keep einen Vorwand zu liefern, um den Handel rückgängig zu machen, den König Henry ihnen aufgezwungen hatte. Die schottischen Barone und die Angehörigen des niederen angelsächsischen Adels mochten vielleicht alle willigen Frauenzimmer des Ortes besteigen, ob sie nun verheiratet waren oder nicht – aber sollte sich ein Normanne erdreisten, eine der einheimischen Frauen gegen den Willen ihres Ehemannes zu berühren, würden die Klagen bis nach London zu hören sein.
Ob das Frauenzimmer verheiratet ist? Das ist die Frage.
Doch statt nach ihrem Familienstand zu fragen, erkundigte sich Dominic nach der Königin der Falken, die König Henrys Geschenk an den neuen Lord gewesen war.
»Ist mein Wanderfalkenweibchen wohlbehalten angekommen?«
»Ja, Herr«, antwortete William schnell.
»Wie ist sie?« wollte Dominic wissen.
Seine Frage war jedoch an das Mädchen gerichtet, nicht an den Falkner.
»Wild«, erwiderte Meg.
Dann lächelte sie, als sie erkannte, daß Dominic sie für das hielt, was sie zu sein schien, ein bürgerliches Mädchen. Erleichterung, Belustigung und Neugier auf den dunklen Ritter brachten Meg dazu, lieber noch etwas zu bleiben, statt zu fliehen, wie es ihr erster Gedanke gewesen war.
»Das Leben strömt durch sie hindurch wie eine Feuersbrunst«, sagte sie. »Sie wird den Mann, der sich die Zeit nimmt, sie zu zähmen, reich entschädigen.«
Ein Stich von Begierde durchzuckte Dominic, verblüffte ihn. Er war kein Jüngling mehr, um beim Lächeln eines Mädchens und seinen doppeldeutigen Worten sofort einen steifen Schaft zu bekommen. Und dennoch war ihm genau das passiert. Hätten nicht die weiten Falten seines seitlich befestigten Umhangs seinen Körper verdeckt, wäre seine heftige Reaktion für alle sichtbar gewesen.
»Bleib bei mir, während ich den Falken besuche«, befahl Dominic.
Seine Stimme drückte eher nacktes Verlangen als eine höfliche Bitte aus. Meg konnte ihre plötzliche Verwirrung und die Unsicherheit, die größer wurde mit jedem Moment, den sie in Dominics potenter Gegenwart war, kaum bezwingen.
Dominic sah das Wechselspiel der Gefühle in Megs Gesicht und war erneut fasziniert. Die meisten Mädchen ihres Standes wären entzückt gewesen über jedes Zeichen von Interesse bei einem hohen Herrn. Dennoch spürte er ganz deutlich, daß sie drauf und dran war, vor ihm wegzulaufen.
»Die ersten Augenblicke eines Mannes mit einem neuen Falken sind kritisch«, erklärte Dominic. »Ich möchte, daß er mich akzeptiert, ohne sich zu verletzen, indem er zu fliehen versucht, wenn gar keine Flucht nötig ist.«
»Oder möglich ist«, murmelte Meg vor sich hin.
»Genau.«
Dominic bemerkte, wie sie ganz leicht die Lippen zusammenpreßte und sich ihre Augen eine Spur weiteten vor Überraschung, daß er ihre Bemerkung gehört hatte. Er konnte so mühelos in den Gesichtern der Menschen lesen, wie ein Bauer die Jahreszeiten oder ein Priester die Bibel deutete.
Das Lächeln, das er Meg schenkte, wäre von den meisten Menschen als ein Zeichen der Beruhigung aufgefaßt worden.
Aber Meg durchschaute Dominics freundliches Lächeln und erkannte die Berechnung dahinter.
»Nur keine Angst«, sagte sie spitz. »Der Falke trägt eine Kappe. Ein Vogel, der nichts sehen kann, fliegt nirgendwohin. Er wartet darauf, daß Ihr ihn zähmt.«
»Werden Sie mir helfen, schöne Falknerin?«
»Ich heiße ... Meg.«
»Lord Dominic le Sabre«, sagte er.
»Das hatte ich mir fast gedacht.«
Wieder lächelte Dominic leicht, genoß die trockenen Bemerkungen des Mädchens.
Meg bemühte sich, sein Lächeln nicht zu erwidern.
Vergeblich. Es war unmöglich, nicht schwach zu werden, denn diesmal war das amüsierte Aufblitzen in seinen Augen echt und keine Berechnung.
Dominics Lächeln wurde noch breiter, als er Megs Antwort in der entspannten Haltung ihres Körpers las. Jetzt war sie nicht mehr drauf und dran, die Flucht zu ergreifen.
»Dann begleitet mich, Jungfer Meg. William wird mitkommen, um Eure Tugend zu wahren. Oder habt Ihr einen Ehemann, der Euch beschützt?«
Der Falkner begann zu husten, als wäre er kurz vorm Ersticken. Meg schlug ihm kräftig auf den Rücken und flehte innerlich, daß er sie nicht verriet. Sie hatte den Verdacht, daß sich ihr zukünftiger Ehemann bei einem Bauernmädchen lockerer und ungezwungener geben würde als bei seiner widerwilligen angelsächsischen Braut.
»So, William. Geht es jetzt wieder, oder soll ich noch etwas klopfen?« Als Meg sich hilfsbereit zu dem Falkner herabbeugte, flüsterte sie ihm zu: »Es reicht, William! Wenn du meine Identität nicht geheimhalten kannst, werde ich ohne dich zu dem Wanderfalken gehen!«
William räusperte sich herzhaft und preßte die Lippen zu einer schmalen Linie zusammen, als würde er nie wieder lächeln. Augenblicklich verzog sich sein Mund zu einem übermütigen Lachen. Er schlug sich hastig die Hand vor den Mund und gab erstickte Laute von sich.
»Ich denke, wir sollten den armen Burschen besser zurücklassen«, sagte Dominic glatt. »Bleib hier, Falkner. Du hustest laut genug, um einen Stein zu erschrecken, von einem Falken, der gerade erst eingetroffen ist und sich noch nicht eingewöhnt hat, ganz zu schweigen.«
Meg warf ihm einen Blick von der Seite zu. Ihr Herz begann zu hämmern, als sie sah, daß Dominic sie beobachtete. In seinen Augen lag eine männliche Berechnung, die nichts mit seiner früheren Selbstkontrolle zu tun hatte. Der Ausdruck seiner Augen war jetzt eher feurig als kalt.
Er wollte mit ihr allein sein.
»Welche Voliere?« fragte er.
»Ich, äh ... dort drüben.«
»Zeigt mir den Weg.«
Megs gesunder Menschenverstand riet ihr, sich zu weigern. Ihre Neugier gewann jedoch die Oberhand. Sie konnte viel über einen Mann lernen aus der Art, wie er mit einem ungezähmten Falken umging.
Vorsichtig führte sie Dominic zu der Voliere, die den neuen Wanderfalken beherbergte. Der Käfig war dreimal so groß wie der des verletzten Falken des Priesters. Eine Öffnung hoch oben in der Wand ließ frische Luft und Licht herein. Das Falkenweibchen konnte jedoch nur die frische Luft genießen, denn es trug eine Kappe über dem Kopf. Die Kappe hatte den Zweck, den Vogel davon abzuhalten, auf der Suche nach Freiheit wie wild gegen die Wände zu fliegen und sich dabei zu verletzten – oder seine Kräfte zu verausgaben, indem er unaufhörlich auf seiner Lederleine herumhackte.
Kleine Glöckchen klingelten an seinen Fußfesseln, als der Falke die Anwesenheit von Menschen spürte und ruhelos auf seiner Sitzstange hin- und hertrippelte. Als Dominic und Meg die Voliere betraten, spreizte der Vogel seine mächtigen Schwingen und drehte den Kopf nach rechts und links, horchte aufmerksam. Trotz der Kappe konnte er gut hören.
Meg pfiff eine komplizierte Melodie aus fünf Noten, eine, die sie nur bei diesem Tier benutzte. Der Falke erkannte den Ruf, beruhigte sich augenblicklich und legte die Flügel an. Das leise Klingeln seiner Glöckchen verstummte.
»Er ist prachtvoll«, sagte Dominic leise.
»Ein Vogel, der eines mächtigen Fürsten würdig ist«, stimmte Meg zu.
»Kommt er schon auf den Arm?«
»Auf meinen, ja. Bei Männern ist er noch mißtrauisch.«
»Klug von ihm«, meinte Dominic. »Im Moment kennt er uns nur als seine Gefangenenwärter, nicht als die Partner bei der Jagd, die wir einmal sein werden.«
Der Wanderfalke bewegte sich unruhig beim Klang von Dominics Stimme. Glöckchen ertönten am Ende der Lederleinen, die von jedem Bein herabliefen. Sein gekrümmter Schnabel öffnete sich, seine Schwingen breiteten sich aus, als wollte er angreifen oder sich verteidigen.
Dominic begann zu pfeifen, ahmte exakt den fünf-Ton-Ruf nach, den Meg benutzt hatte. Verblüfft drehte sie sich zu ihm um und starrte ihn an. Selbst der Falkner hatte Schwierigkeiten, seinen Pfiff wie ihren klingen zu lassen.
Der Falke legte den Kopf schief, orientierte sich an dem vertrauten Ruf. Als er wieder und wieder ertönte, bis er ein beruhigendes, trillerndes Geräusch ergab, rückte der mächtige Greifvogel auf seiner Sitzstange weiter vor, näherte sich langsam der Quelle der Musik. Als ein Lederhandschuh behutsam gegen seine Klauen stupste, kletterte er auf Dominics Handgelenk.
»Berühren Sie ihn, wie Sie es normalerweise tun würden«, sagte Dominic gedämpft.
Meg würde sehr dicht neben Dominic stehen müssen, um den Falken so zu berühren, wie sie es gewöhnlich tat. Sie zögerte, hin- und hergerissen zwischen Mißtrauen und Neugier, wie es wohl wäre, innerhalb der Reichweite dieses Mannes zu stehen, so wie es der Falke tat, seinen Duft einzuatmen, das sanfte Geräusch seines Atems zu hören.
Glöckchen klingelten, zeigten die wachsende Unruhe des Vogels an.
»Nun machen Sie schon«, murmelte Dominic. »Ihr Schweigen macht ihn nervös.«
Mit ruhiger Stimme lobte Meg die Kraft und die Schönheit des stolzen Tieres, während sie behutsam mit den Fingerspitzen über den Kopf des Falken, seine Brust und Beine strich und ihm dabei die ganze Zeit leicht ins Gesicht blies.
»Du bist wirklich der schönste Falke im ganzen Königreich«, sagte Meg sanft. »Deine Flügel sind so geschwind wie der Sturm, deine Klauen schlagen wie der Blitz zu, und dein Mut ist gewaltiger als der Donner, der über das Land hinwegrollt. Du wirst niemals deine Beute verfehlen. Der Tod, den du bringst, wird schnell und sicher sein.«
Die vorübergehende Blindheit durch die Kappe hatte die übrigen Sinne des Falken geschärft. Umgeben von dem Duft, der Berührung und den Geräuschen, die ihn seit seiner Ankunft in der fremden Voliere getröstet hatten, beruhigte er sich wieder, ohne in seiner Wachsamkeit nachzulassen, vollkommen auf die Frau konzentriert, die ihn so behutsam liebkoste und zu ihm sprach.
Meg drehte sich zu Dominic um, eine stumme Frage in den Augen. Die Antwort kam, als er den Falken zu streicheln begann, wie sie es getan hatte – ihm mit sanften und dennoch sicheren Bewegungen über Kopf, Brust und Schwingen strich. Ohne jede Eile, als hätte er keine weiteren Pflichten, als den wunderschönen Falken zu beruhigen, streichelte Dominic ihn und pfiff dabei ununterbrochen Megs fünf-Ton-Melodie.
Fasziniert schaute Meg zu. Als der Vogel bei dem fremden Atem, der ihn einhüllte, erneut nervös wurde, zeigte Dominic keinerlei Ungeduld. Lange Minuten verstrichen, während er das Ritual von vorne begann und den Falken berührte, wie Meg es getan hatte. Langsam beruhigte sich der Vogel und akzeptierte ihn.
Erst dann sprach Dominic auf den Wanderfalken ein, lobte seinen kühn geschwungenen Schnabel und die stolze Kurve seines Kopfes. Glöckchen klingelten, als sich der Falke nervös bewegte, verstört vom Klang der fremden Stimme. Wieder zeigte sich Dominic geduldig. Er begann ganz einfach wieder von vorn, wiederholte das beruhigende Ritual wieder und wieder, bis der Falke seine Berührung, seine Stimme, seinen Atem akzeptierte.
Meg stieß einen tiefen Seufzer aus. Erfreut lächelnd schaute sie zu, wie Dominic sich weiter bemühte, den Falken zu zähmen. Dominic hatte eine behutsame Hand, leicht und dennoch fest. Selbst als er den Vogel ans Licht hob, um ihn besser sehen zu können, akzeptierte ihn das Tier ohne Anzeichen von Unruhe.
»Ihr geht sehr sanft mit ihm um«, sagte Meg leise.
»Falken reagieren am besten auf sanfte Behandlung.«
»Und wenn sie am besten auf Schläge reagieren würden?«
»Würde ich sie schlagen«, murmelte er nüchtern.
Schweigen breitete sich aus, während Meg erneut über das bestürzende Ausmaß von Dominics Selbstkontrolle nachdachte. Hätte sie nicht den Schmerz gespürt, der so tief in seinem Inneren verborgen war, hätte sie ihn für einen absolut gefühlskalten Mann gehalten.
»Noch einmal, Meg«, flüsterte Dominic. »Laßt mich sehen, wie Eure Hände ihn besänftigen.«
Aber diesmal war es nicht der Wanderfalke auf seinem Handgelenk, den Dominic gespannt beobachtete. Es waren Megs anmutige Hände, ihre leicht geöffneten Lippen, ihre vollen Brüste, die sich unter ihrem offenen Mantel hoben und senkten. Seine Nasenflügel bebten leicht, als er den würzigen Duft einatmete, der von Megs Körper aufstieg wie Hitze von einer Kerzenflamme.
Verlangen wallte heiß und mächtig in ihm auf, machte Dominic unsicher. Ein Krieger, der sich selbst nicht völlig unter Kontrolle hatte, machte Fehler. Fatale Fehler.
Mit der Leichtigkeit jahrelanger Erfahrung zügelte er seine Ungeduld, das Frauenzimmer gleich hier und jetzt zu nehmen. Zwar konnte er die heftige Reaktion seines Körpers nicht unterdrücken, aber er konnte mit seiner Erregung umgehen.
»Es könnte die Gefangenschaft wert sein, so zärtlich berührt zu werden«, sagte Dominic nach einer Weile. »Liebkost Ihr Eure Liebhaber auch mit Eurem Atem und Euren Fingerspitzen, Jungfer Meg?«
Verwirrt drehte sie sich zu ihm um. Er stand ganz dicht neben ihr und blickte sie mit der Intensität eines Falken an. Im Dämmerlicht der Voliere glänzten seine Augen wie Quecksilber.
»Ich ... ich weiß nichts von solchen Dingen«, erwiderte Meg.
»Ist Euer Ehemann so wenig großzügig?«
»Ich bin nicht verheiratet.«
»Ausgezeichnet«, sagte Dominic und blies erneut behutsam in das Gesicht des Falken. »Ich würde nur ungern das trennen, was mit Gottes Segen zusammengefügt wurde, dennoch möchte ich Euch zu meiner Geliebten machen. Habt Ihr einen Vater oder einen Onkel, an den ich den Preis für Euch bezahlen kann?«
Kerzengerade aufgerichtet und mit trotzig vorgerecktem Kinn erwiderte Meg kalt: »Ihr übernehmt Euch, Herr.«
Der unverkennbare Zorn in ihrer Stimme amüsierte ihn.
»Wie das?« fragte er.
»Ihr werdet Euch morgen vermählen!«
»Ach, das.«
Dominic wandte sich lange genug ab, um den Wanderfalken wieder auf seine Stange zu setzen.
»Eine Ehe dient dazu, Erben zu bekommen«, erklärte er.
Ohne Vorwarnung drehte Dominic sich um und zog Meg in seine Arme, um ihre Reaktion auf eine direkte Annäherung zu testen. Als er den Kopf herabbeugte, als wollte er sie küssen, fühlte er die Zurückweisung in ihrem steifen Körper und sah sie in dem grimmigen Funkeln ihrer Augen. Das Frauenzimmer war so stolz und unnahbar wie jener Wanderfalke.
Und wie ein Jagdvogel würde man sie eher mit List, statt mit Gewalt nehmen müssen, um das gewünschte Resultat zu erzielen.
Allmächtiger, warum kann es kein williges Frauenzimmer sein, das meinen Schaft erregt?
Aber sie war nicht willig. Noch nicht.
Mit einem stummen Fluch, weil er gezwungen war, die langatmige Prozedur körperlicher Verführung bei einem schlichten Bauernmädchen anzuwenden, hob Dominic Megs Kinn zu sich hoch. Wenn sie so kalt wie ihre Stimme sein sollte, war eine Verführung unmöglich, aber auch das galt es herauszufinden.
»Kleiner Falke«, sagte er weich. »Die Ehe hat doch nichts mit dem hier zu tun.«
Die Sinnlichkeit seiner Zunge, als er Megs Unterlippe zärtlich nachzeichnete, kam völlig unerwartet für sie. Sie stand unbeweglich da, während seltsame Empfindungen ihren Körper erschauern ließen, ihr das Gefühl gaben, so zerbrechlich wie eine Flamme, so wertvoll wie ein Traum zu sein, der Wahrheit wird.
Wie kann ein so rücksichtsloser Mann so sanft mit mir sein? fragte sie sich verwundert.
In Megs Innerem – so tief verborgen wie Dominics Schrei der Qual – hob Glendruid ihr von Sorgen gezeichnetes Haupt. Vielleicht war es jetzt endlich soweit ... vielleicht würde das Warten jetzt, nach tausend Jahren, endlich ein Ende haben ...
Dann sah Meg die kalte Geduld in Dominics Augen und erinnerte sich, was er über den Falken gesagt hatte: Wenn Schläge den Vogel Vertrauen gelehrt hätten, hätte er ihn geschlagen.
Er benutzt Zärtlichkeit, um etwas bei mir zu erreichen, so sicher, wie er sie bei dem Wanderfalken benutzt hat. Aber Glendruid-Augen sehen schärfer, als selbst ein Falke zu sehen vermag!
Meg wand sich so hastig aus Dominics Griff, daß der Falke die Flügel spreizte und einen verängstigten Schrei ausstieß.
»Ruhig«, sagte Dominic. »Ihr erschreckt meinen Falken.«
Obwohl er gedämpft sprach, war der eisige Befehl in seiner Stimme so unmißverständlich wie die klingelnden Glöckchen an den Fußfesseln des Falken.
»Beruhigt ihn«, sagte Dominic.
»Beruhigt ihn selbst«, gab Meg leise zurück. »Er ist Euer Gefangener. Ich, Sir, bin es nicht.«
KAPITEL 3
Simon stand in der offenen Tür des Baderaums im vierten Stock der Burg und beobachtete seinen älteren Bruder argwöhnisch. Dominic war ausgesprochen übellaunig gewesen, seit er am Morgen die Volieren aufgesucht hatte. Die Entdeckung, daß seine zukünftige Ehefrau bis zu den morgigen Hochzeitsfeierlichkeiten nicht das Brot mit ihm brechen wollte, hatte nicht dazu beigetragen, Dominics Stimmung zu bessern.
»Die Frauenunterkünfte!« sagte er voller Empörung.
Die Fäuste in die Hüften gestemmt, den schwarzen Umhang zurückgeschlagen, schaute Dominic sich in dem nackten Steinraum um. Aus dem Abfluß, der sich in den Burggraben entleerte, zog es kalt herauf. Wandbehänge und hölzerne Paravents, die die Kälte etwas gemildert hätten, fehlten völlig. Die Badewanne war eher passend für die Größe einer Frau als die eines Mannes.
Wenigstens das Wasser war heiß. Es verbreitete einen warmen Nebel in dem eisigen Raum.
»Warum im Namen aller Engel des Jüngsten Gerichts würde ein Mann das einzige Bad – so wie es nun mal ist – in das Frauenquartier legen?« fragte Dominic aufgebracht.
»Lord John ist niemals über Cumbriland hinausgekommen«, erwiderte Simon ruhig. »Er hatte niemals Gelegenheit, die sarazenische Lebensweise kennenzulernen und zu genießen. Wahrscheinlich denkt er, baden würde seiner Männlichkeit schaden.«
»Um Himmels willen, hat der Mann nur dazu getaugt, überall in der Gegend Bastarde zu zeugen, während seine Ehefrau noch lebte?«
Simon hielt klugerweise den Mund.
»Der Burgwall ist mehr Holz als Stein«, schimpfte Dominic, »das sogenannte Waffenlager ist ein rostiger Schrank, die Felder sind kaum gepflügt, die Zisternen sind löchrig wie Siebe, die Weiden sind bis auf den Felsen kahlgefressen, die Fischteiche enthalten mehr Unkraut als Wasser, in den Taubenschlägen herrscht ein heilloses Durcheinander, und es gibt noch nicht mal einen Kaninchenstall, um im Winter Fleisch auf den Tisch zu bringen!«
»Die Gärten sind in ausgezeichnetem Zustand«, erklärte Simon.
Dominic grunzte.
»Und die Volieren sind sauber«, fuhr Simon fort.
Die Volieren zu erwähnen war ein Fehler. Ein harter, grimmiger Zug bildete sich um Dominics Mund.
»Gott möge einen faulen Lord in der Hölle schmoren lassen!« schimpfte er. »So viel zu besitzen und es so verkommen zu lassen!«
Simon warf einen Seitenblick auf Dominics Junker, der ausgesprochen unglücklich dreinschaute. Simon konnte es dem Jungen nicht verübeln. Nur wenige Männer hatten Dominic bei einem Wutausbruch erlebt. Keiner hatte die Erfahrung genossen.
»Ist alles bereit für das Bad deines Herrn?« fragte Simon.
Der Junker nickte hastig.
»Dann kümmere dich um das Abendessen deines Herrn. Ein Humpen Ale vielleicht. Oder besser gleich mehrere. Kaltes Fleisch, Käse. Hat die Küche schon einen anständigen Pudding zustande gebracht?«
»Das weiß ich nicht, Sir.«
»Dann finde es heraus.«
»Und wenn du schon mal dabei bist«, warf Dominic ein, »kannst du auch gleich feststellen, wo sich meine Verlobte versteckt!«
Der Junge verließ den Raum mit ungebührlicher Eile und vergaß, den Vorhang wieder hinter sich zuzuziehen.
»Beim Kampf gegen die Türken hat er weniger Furcht gezeigt«, meinte Simon, während er den Vorhang zuzog, um den kalten Luftzug aus dem Korridor abzuhalten. »Du ängstigst das Kind.«
Der Laut, den Dominic von sich gab, war mehr ein Knurren als eine Antwort.
»Ist dein Falke krank?«
»Nein.«
»Waren die Volieren in schlechtem Zustand?«
»Nein.«
»Soll ich eine Zofe holen, die dich beim Baden bedient?«
»Zum Teufel, nein!« rief Dominic. »Ich brauche keine bleichgesichtigen Weiber, die über meine Narben jammern.«
Als Simon erneut sprach, war seine Stimme so eisig wie die seines älteren Bruders.
»Vielleicht möchtest du dann lieber etwas mit Schwert und Schild üben?« schlug er verbindlich vor. »Ich werde dir mit Freuden zur Verfügung stehen.«
Dominic fuhr zu seinem Bruder herum und musterte ihn mit abschätzendem Blick.
Einen angespannten Moment lang dachte Simon, er würde den Kampf bekommen, den er vorgeschlagen hatte.
Dominic stieß einen abgrundtiefen Seufzer aus.
»Du klingst gereizt, Simon.«
»Ich folge nur deinem Beispiel.«
»Aha. Ich verstehe.« Um Dominics Mundwinkel zuckte es belustigt. »Würdest du mich beim Baden bedienen, Bruder? In dieser Burg traue ich niemandem sonst hinter meinem Rücken.«
»Genau das wollte ich vorschlagen. Mir gefällt es auch nicht, daß dich deine Verlobte meidet und dein Gastgeber zu krank ist, um dich auf angemessene Weise zu begrüßen.«
»Hmmm.« Dominic nickte grimmig. Er hakte die große Nadel auf, die seinen Umhang an Ort und Stelle hielt, und schleuderte das pelzverbrämte Kleidungsstück zu dem auf Böcken stehenden Tisch nahe der Tür.
Der Umhang fiel auf die Kiste, die Simon mitgebracht hatte, und ließ die Kerzenflammen in ihren Haltern unruhig flackern. Ein Topf halbflüssiger Seife stand ebenfalls auf dem Tisch.
Simon hob den Deckel und schnüffelte daran.
»Gewürze. Und eine Spur von Rosen, glaube ich.« Er schaute Dominic ausdruckslos an, versuchte, seine Belustigung nicht zu zeigen.
»Der Himmel bewahre mich«, sagte Dominic ohne Zorn. »Ich werde wie der Harem eines Sultans riechen.«
Simons schwarze Augen blitzten. Er schmunzelte hinter seinem blonden Bart, hütete sich jedoch, laut herauszulachen.
Mit raschen Bewegungen legte Dominic seine restliche Kleidung ab, begrub die kleine Kiste endgültig unter einem Berg von Kleidern. In dem flackernden Licht der Kerzen schimmerte die lange Narbe, die diagonal über seinen muskulösen Arm und Brustkorb verlief, wie Perlmutt.
Dominic stieg in die Wanne und setzte sich, wobei das Wasser fast über den Rand schwappte. Er stieß einen Laut des Wohlbehagens aus, als das warme Wasser um sein Kinn plätscherte und den Schmerz linderte, den seine alte Verletzung ihm immer dann bereitete, wenn er besonders müde war.
»Seife?« fragte Simon ausdruckslos.
Dominic streckte wortlos eine Hand aus. Ein dicker Klacks Seife landete auf seiner Handfläche. Ein Duft, der fast vertraut schien, stieg in seine Nase auf. Mit gerunzelten Brauen versuchte er sich zu erinnern, wo er diesen Duft schon einmal gerochen hatte, während er die Seife auf seinem Haar und Bart zu verteilen begann.
»Und jetzt«, sagte er durch den dicken Schaum, »erklär mir mal diesen Quatsch, daß der Lord of Blackthorne Keep angeblich verflucht ist.«
»Seine Ehefrau war eine Hexe.«
»Das gleiche könnte man von vielen Ehefrauen behaupten.«
Simon lachte kurz. »Schon, aber Lady Anna war eine Glendruid.«
Dominics Hände hielten einen Moment mit Haarewaschen inne. »Glendruid ...?«
»Sie sind ein keltischer Clan«, erklärte Simon. »Eine Art von Matriarchat, soweit ich in Erfahrung gebracht habe.«
»Zum Teufel, was für eine Dummheit«, murmelte Dominic.
Damit tauchte er vollständig unter Wasser und spülte den duftenden Seifenschaum ab. Augenblicke später richtete er sich mit einer solchen Vehemenz wieder auf, daß das Wasser nach allen Richtungen spritzte. Fluchend sprang Simon zur Seite.
»Sprich weiter«, drängte Dominic.
Simon schüttelte mit einer Hand das Wasser von seiner Tunika und klatschte mit der anderen so heftig Seife auf Dominics ausgestreckte Hand, daß dieser ihn scharf anblickte.
»Ein Mann, der eine Glendruid zur Ehefrau nimmt, wird fruchtbare Felder haben«, fuhr Simon fort, »üppige Weiden, Mutterschafe, die zwei oder gleich drei Lämmer auf einmal werfen, fleißige und gehorsame Vasallen, reich bestückte Fischteiche, und ...«
»Und einen Schwanz wie eine Lanze und ewiges Leben«, unterbrach Dominic ihn, des Aberglaubens überdrüssig.
»Oh, hat Sven schon mit dir gesprochen?«
Dominic warf seinem jüngeren Bruder einen glitzernden grauen Blick zu.
Simon grinste breit, und seine schwarzen Augen funkelten amüsiert.
»Und wo ist dieser gottverlassene Ort der Glendruid?« fragte Dominic trocken. »Im Süden, wo die Kelten Amok laufen?«
»Das behaupten einige.« Simon zuckte die Achseln. »Andere sagen, er läge im Norden. Wieder andere sagen, im Osten.«
»Oder im Westen? Im Meer vielleicht?«
»Sie sind Menschen, keine Fische«, gab Simon zurück.
»Ah, das ist eine Erleichterung! Es wäre wirklich mühsam, mit der Tochter einer Flunder zu schlafen. Ein Mann wüßte ja gar nicht, wie er das Geschöpf packen sollte. Oder genauer gesagt: wo.«
Lachend hielt Simon seinem Bruder ein großes Handtuch hin. Als Dominic aus der Wanne aufstand, rann Wasser in Kaskaden von seinem kraftvollen Körper herab, bildete Pfützen zu seinen Füßen, bis es den Abfluß erreichte und lautlos in den Burggraben hinunterfloß.
»Dieser Glendruid-Unsinn wird spätestens in einem Jahr aufhören«, sagte Dominic energisch. »Wenn mein Sohn geboren ist.«
Simon lächelte leicht. Er kannte die Entschlossenheit seines Bruders, eine Dynastie zu gründen, nur zu gut. Simon selbst verfolgte das gleiche Ziel.
»Bis dein Erbe auf der Welt ist, solltest du besser darauf achten, was du in der Öffentlichkeit über die Legende der Glendruid sagst«, riet Simon. »Es ist ein Aberglaube, an dem die Einheimischen beharrlich festhalten.«