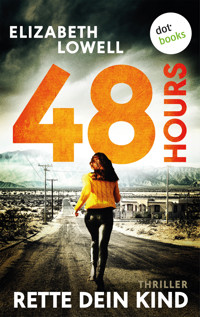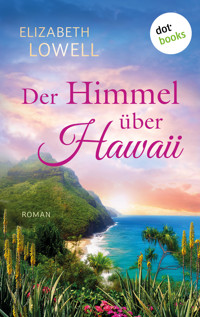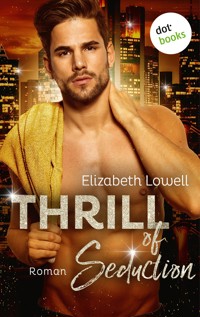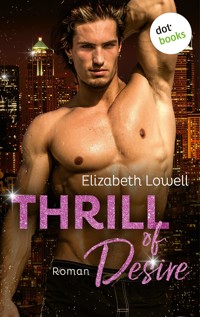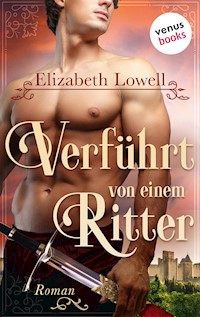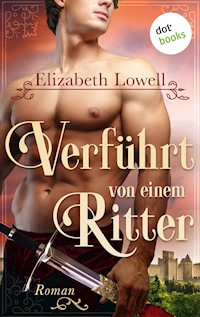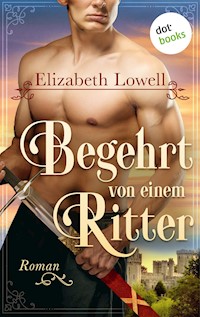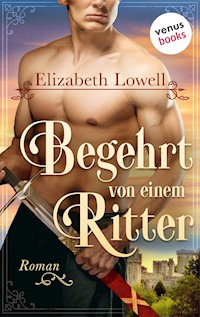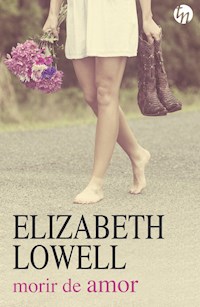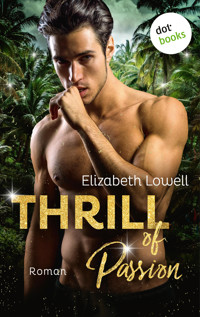
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Donavan-Saga
- Sprache: Deutsch
Er konnte sie nie vergessen: Der romantische Spannungsroman »Thrill of Passion« von Elizabeth Lowell jetzt als eBook bei dotbooks. Als er vor vielen Jahren in eine tödliche Falle geriet, lernte der Edelsteinexperte Archer Donovan auf die harte Weise, dass er nur seiner Familie trauen kann. Doch nun bittet seine Jugendliebe Hannah McGarry ihn in einer verzweifelten Situation um Hilfe: Ihr Mann Len ist unter rätselhaften Umständen gestorben – und sein Lebenswerk verschwunden, die einzigartige »Black Trinity«-Perlenkette. Auf einen Schlag sind alle die dunklen Erinnerungen, die Archer so sorgsam verdrängt hatte, wieder da, und er muss an den Ort zurückkehren, den er nie wieder sehen wollte: die Perlenbucht an der Nordküste Australiens. Während dort die verbotene Leidenschaft zwischen ihm und Hannah erneut aufflackert, werden Lens Feinde aktiv, die überall lauern – und bereit sind, über Leichen zu gehen ... »Ich würde jedes Buch kaufen, auf dem der Name Elizabeth Lowell steht!« New-York-Times-Bestsellerautorin Amanda Quick Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Romantic-Suspense Roman »Thrill of Passion« ist der dritte Band von Elizabeth Lowells Donovan-Saga, der unabhängig von den anderen gelesen werden kann und Fans von Lisa Jackson begeistern wird. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 665
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Als er vor vielen Jahren in eine tödliche Falle geriet, lernte der Edelsteinexperte Archer Donovan auf die harte Weise, dass er nur seiner Familie trauen kann. Doch nun bittet seine Jugendliebe Hannah McGarry ihn in einer verzweifelten Situation um Hilfe: Ihr Mann Len ist unter rätselhaften Umständen gestorben – und sein Lebenswerk verschwunden, die einzigartige »Black Trinity«-Perlenkette. Auf einen Schlag sind alle die dunklen Erinnerungen, die Archer so sorgsam verdrängt hatte, wieder da, und er muss an den Ort zurückkehren, den er nie wieder sehen wollte: die Perlenbucht an der Nordküste Australiens. Während dort die verbotene Leidenschaft zwischen ihm und Hannah erneut aufflackert, werden Lens Feinde aktiv, die überall lauern – und bereit sind, über Leichen zu gehen ...
Über die Autorin:
Elizabeth Lowell ist das Pseudonym der preisgekrönten amerikanischen Bestsellerautorin Ann Maxwell, unter dem sie zahlreiche ebenso spannende wie romantische Romane verfasste. Sie wurde mehrfach mit dem Romantic Times Award ausgezeichnet und stand bereits mit mehr als 30 Romanen auf der New York Times Bestsellerliste.
Elizabeth Lowell veröffentlichte bei dotbooks bereits ihre historischen Liebesromane »Begehrt von einem Ritter«, »Verführt von einem Ritter« und »Geküsst von einem Ritter« sowie ihren Thriller »48 Hours – Rette dein Kind« Außerdem veröffentlichte sie ihre Romantic-Suspense-Romane »Dangerous Games – Dunkles Verlangen«, »Dangerous Games – Tödliche Gier« und die Donovan-Saga mit den Bänden »Thrill of Temptation«, »Thrill of Desire«, »Thrill of Passion« und»Thrill of Seduction«.
Die Website der Autorin: elizabethlowell.com
***
eBook-Neuausgabe Oktober 2023
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1999 unter dem Originaltitel »Pearl Cove« bei Avon Books Inc., New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 2000 unter dem Titel »Perlenbucht« im Goldmann Verlag.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1999
by Two of a Kind, Inc.
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2000
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,in der Verlagsgruppe Bertelsmann GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Dmitrieva Katerina, Bananen, ArtOfPhotos, Niko Schaefer
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-849-2
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Thrill of Passion« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Elizabeth Lowell
Thrill of Passion
Roman - Die Donovan-Saga 3
Aus dem Amerikanischen von Elke Iheukumere
dotbooks.
Irrtümer – wie Strohhalme schweben sie auf der Oberfläche. Wer nach Perlen suchen will, muss hinuntertauchen.
JOHN DRYDEN
Dies sind Perlen und waren seine Augen.
SHAKESPEARE
Prolog
Broome, Australien
November
Der Himmel über der südlichen See sah wüst aus. Es gab keinen Horizont mehr, keinen Mittelpunkt, keine Grenzen für den aufziehenden Sturm. Hitze lag über dem Land wie ein unsichtbarer brennender Schatten der Sonne.
Feuchtigkeit hatte sich auf der nackten Brust des Mannes gebildet, als er die Tür zu der Halle aufschloss, in der die Perlen sortiert wurden. Drinnen gab er einen Code auf der Tastatur ein und schloss die Stahltür hinter sich wieder ab. Auch wenn er unter dem Vorwand einer spontanen Sicherheitsüberprüfung die Sortierer hinausgeschickt hatte, würde es sehr schnell mörderisch heiß hier drin werden. In einem Gebäude mit einem Metalldach hielt die Frische nicht lange an, nachdem man die Klimaanlage abgestellt hatte; doch genau das hatte er als Erstes getan, nachdem der Code eingegeben war.
Er schwitzte nicht gern. Aber solange die Klimaanlage lief, konnte er nicht hören, wenn die Tür geöffnet wurde oder sich Schritte hinter seinem Rücken näherten. Deshalb drückte er auf einen anderen Knopf und gab sich mit den Ventilatoren an der Decke zufrieden. Über ihm drehten sich die metallenen Scheiben wie langsame Mixer in der drückenden Luft. Zwar hätte er die Fenster mit den stählernen Läden davor öffnen können, um Licht und Luft in die Halle zu lassen, doch auch das tat er nicht. Das Letzte, was er nämlich wollte, war, von einem seiner eifrigen Angestellten bespitzelt zu werden.
Sie alle würden brennend gern wissen, wo er seinen Vorrat an prachtvollen Perlen aufbewahrte.
Automatisch wischte er sich mit einem Baumwollhandtuch den Schweiß von seinem Gesicht, den Armen und den Händen. Erst dann näherte er sich den Sortiertischen. Unter den Lampen, die Licht in vollem Spektrum auf die Tische warfen, lagen leuchtende Meeresjuwele in ordentlichen Reihen und einladenden Haufen. Die Perlen baten förmlich darum, berührt zu werden, gestreichelt, genossen, liebkost.
Angebetet.
Aber nicht von schwitzenden Händen. Perlen waren hochempfindliche Kleinodien. Die Öle und Säuren des menschlichen Schweißes zerstörten die dünnen, glatten Lagen, die die gefangene Auster so geduldig und ohne jeden Verstand geschaffen hatte, um eine innere Wunde zu verdecken. Sorgloser Umgang trübte den sagenhaften Glanz der Perlen, er schwächte die zarten Bänder der Lichtreflexe, die gleich unter der glatten Oberfläche, gerade außer Reichweite, tanzten. Wie ein Traum. Wie ein Wunder.
Gerade außer Reichweite. Immer.
Aber der Mensch versuchte sie zu erreichen. Immer.
Seit viertausend Jahre vor Christus sammelte, schätzte, verehrte und bestaunte der Mensch die glänzenden Wunder aus dem Meer. Geboren vom Donner, geschaffen im Nebel, erfüllt von Mondlicht, Tränen der Götter ... alle Erklärungen für den Ursprung der Perlen glänzten im Schimmer des alles überragenden Wunders der Perle selbst.
Ob sie nun barbarisch waren oder zivilisiert, wild oder ästhetisch – nur wenige Kulturen waren gefeit gewesen gegen die Verlockungen der Perle. Sie war das perfekteste aller Juwelen, brauchte weder geschnitten noch geschliffen zu werden, sie brauchte nichts anderes als die Anerkennung des Menschen. Und Gier. Perlen, von denen man glaubte, dass sie sowohl das Fleischliche als auch das Erhabene verkörperten, schmückten die Altäre von Venus und die Reliquien von Heiligen. Aufgelöst in Wein, heilten Perlen die Krankheiten des Fleisches. Begraben mit den Toten priesen Perlen den Wohlstand der Lebenden. Getragen von Königen, Priestern, Kaisern, Sultanen und Hexenmeistern, waren Perlen ein Zeichen absoluter Macht.
Wer immer Perlen besaß, besaß vor allem Magie.
Magie war überall um ihn herum, Tabletts und Haufen von glänzenden Wundern, bedeutungsschwer mit allen Möglichkeiten. Die Kluft zwischen der modernen Rationalität und der Ehrfurcht der Steinzeit war genauso kaum wahrnehmbar wie die Schicht aus Perlmutt, die über den leuchtenden Juwelen lag.
Sicher war inmitten all dieser Wunder noch ein weiteres Wunder möglich ...
Langsam schob er sich an dem jungfräulichen Weiß, dem herrlichen Glanz und dem Pfauenschwarz der Südseeperlen vorbei, die Sortierer mit wachem Blick nach Größen, Farben und dem Grad der Perfektion zusammengestellt hatten. Keine der Perlen auf den Tischen interessierte ihn. Er war derjenige gewesen, der die erste Auswahl getroffen hatte bei der Ernte: als er zwei Jahre Arbeit abgeschöpft hatte, nahm er nur die Besten. Wenn ein Mann den Göttern – oder den Teufeln – ein Opfer brachte, würde nur das Beste taugen.
Als er sich auf die Doppeltür aus Stahl zubewegte, die am Ende des Flachbaus vom Boden bis zur Decke reichte, folgte ihm das Geräusch harten Gummis auf dem Fliesenboden, wo auch immer er sich hinbegab. Er hörte es genauso wenig, wie ein Mann das leise Geräusch seiner Schuhe auf dem Boden hört.
Auch wenn diese zweite Tür nirgendwo hinführte, so war sie doch mit einem weiteren Kombinationsschloss versehen; hinter ihrem Stahl lag ein Schatz, wie es keinen zweiten auf der Welt gab. Er öffnete das Schloss und schob die Türen weit auf. Die Schließfächer in dem Tresor waren tief, sie schützten Tablett um Tablett mit Perlen, die Reichtümer anderer Jahre, anderer Ernten. Jedes Schließfach besaß einen kräftigen Stahlgriff und einen Verschluss der Art, wie man ihn in einem Safe der weniger technisierten Art fand. Das tropische Klima war für moderne Elektronik die Hölle. Hinter den Türen der Schließfächer lagen Tablett um Tablett mit Perlen, genug Reichtum, um selbst einen Heiligen erblassen zu lassen.
Auch wenn er wusste, dass er allein war, konnte er dem Drang nicht widerstehen, noch einmal über seine Schulter zu sehen. Und wieder entdeckte er nichts als den langen Schatten seines eigenen Misstrauens. Erneut wandte er sich dem Tresor zu.
Jetzt kam der schwierige Teil. Jeder wusste, dass er nicht mehr ohne Hilfe auf seinen Beinen stehen konnte; deshalb konnte er auch nicht höher reichen als bis zum Kopf eines sitzenden Mannes. Niemand würde glauben, dass er ganz allein bis an die höchsten Schließfächer zu gelangen vermochte.
Wenn sie in der Dunkelheit nach seinem Perlenversteck suchten, würden sie immer unten suchen, niemals so weit oben.
Mit einem grimmigen Lächeln wischte er sich noch einmal die Hände ab, griff nach oben und packte den höchsten Griff, den er erreichen konnte. Seine Beine waren vielleicht nicht mehr wert als Pfeifenstiele, doch seine Arme und Schultern besaßen starke Muskeln. Er zog sich mit einigen einarmigen Klimmzügen an der drei Meter hohen Wand aus Schließfächern hoch. Einmal glitt seine Hand aus, weil sie schweißfeucht war. Noch ehe er sich fangen konnte, klirrte und scharrte der eigenartige Ring aus rostfreiem Stahl, den er an seinem rechten Zeigefinger trug, über die Wand. Die feinen Kratzer gingen unter in den vielen anderen – schweigende Zeugen für die vielen Male, an denen er seinen ganz persönlichen Berg erklommen hatte.
Schwer atmend packte er den Griff des obersten mittleren Schließfaches mit einer Hand und stellte mit der anderen die Kombination ein. Irgendwo im Hintergrund öffnete sich ein Riegel in der Wand. Klick. Klick. Und dann noch einmal ein endgültiger Klick.
Schnell ließ er sich an den Schließfächern hinunter, bis er seine Arme von seinem Gewicht befreien konnte. Dann packte er aufs Geratewohl zwei Griffe und zog daran.
Die Vorderseite der gesamten Schließfächer bewegte sich. Langsam, mit der Anmut eines Elefanten, öffnete sich die dicke Stahlplatte auf versteckten Drehzapfen. Die unteren Schließfächer waren nicht ganz so tief, wie sie von vorn ausgesehen hatten. Hinter ihnen, in den Tresor selbst eingearbeitet, lag eine Reihe schmaler, flacher, verschlossener Schubladen. Er steckte die spitzen Stahlkanten seines Austernringes in die Löcher vorn an der linken Schublade, drehte den Ring und zog dann vorsichtig.
Die Schublade öffnete sich.
Zum ersten Mal zögerte er. Schnell warf er einen Blick über seine Schulter und vergewisserte sich, dass er immer noch allein war; dann zog er eine lange, flache Juwelenschachtel aus der Schublade. Mit der Ehrfurcht eines Priesters, der die Heilige Kommunion zelebriert, öffnete er die Schachtel.
Die Black Trinity glänzte auf dem Samt in der Farbe der Abenddämmerung.
Obwohl er sie schon so oft gesehen hatte, so bewirkte doch die dreireihige Kette aus unaufgereihten Perlen, dass sein Herz sich zusammenzog und sein Atem schneller ging. Die Perlen waren nicht durchbohrt, sie waren unberührt und so natürlich wie an dem Tag, an dem er sie vorsichtig aus ihrem kühlen, glitschigen Leib befreit hatte, und ihnen glichen keine anderen auf der Welt.
Jede Perle stammte aus einer genetisch einmaligen Art von Austern der Perlenbucht. Das Resultat war eine schwarze Perle mit einem unvergleichlichen Glanz, die sich sehr von den bekannten Juwelen aus Tahiti unterschied. Diese Art aus den besonderen Austern der Perlenbucht ähnelte genauso einem schwarzen Opal wie einer Perle.
Allein dieser Umstand hätte die dreifache Kette schon gefährlich wertvoll gemacht. Doch die Black Trinity war ebenso wertvoll wie selten. Jede Reihe der Kette bestand aus Perlen der gleichen Größe. Die kürzeste der Ketten war aus zwölf Millimeter großen Perlen zusammengestellt. Die zweite, größere Reihe bestand aus vierzehn Millimeter großen Perlen. Die dritte und längste war eine Kette aus unvergleichlichen sechzehn Millimeter großen Juwelen. Jede Perle war rund. Keine hatte einen sichtbaren Makel. Die Farben der einzelnen Perlen in jeder Kette passten hervorragend zueinander, und das hob den Wert des Gesamtobjekts ins Unermessliche.
Doch war es nicht der Reichtum, der den Mann dazu gebracht hatte, Stück um Stück an der Stahlwand emporzuklettern. Und auch die Schönheit spornte ihn nicht an. Wie ein mittelalterlicher Alchimist oder ein elender Büßer wurde er getrieben von der Hoffnung auf Verwandlung. Ein Wunder. Etwas unaussprechlich Wertvolles, das den gewöhnlichen Schund des Lebens ersetzte.
Er öffnete Schublade um Schublade, betrachtete die seltsam leuchtenden schwarzen Perlen darin, verglich sie mit der Black Trinity und ging dann weiter, zur nächsten und nächsten, bis keine mehr übrig war.
Mit gerunzelter Stirn blickte er von der schimmernden Black Trinity zur letzten Schublade der einzigartigen Sammlung aus der Perlenbucht, die in sich die Farben der Mitternacht und des Regenbogens vereinten. Ganz gleich, wie genau er sie auch betrachtete, keine Perle aus der neuen Ernte passte besser oder perfekter zu den Perlen des dreireihigen Schmucks als die, die er bereits dafür ausgewählt hatte.
Ein Schauder lief durch seinen Körper, eine Panik, die dunkler war als die dunkelste der Perlen. Die Black Trinity war komplett.
Nein! Bessere Augen sind nötig, das ist alles. Ihre Augen, sie sei verdammt! Verdammt zur Hölle für ihre kräftigen Beine und ihre unnatürlich guten Augen!
Seit sieben Jahren hatte er sie beinahe genauso gebraucht, wie er sie hasste. Er würde die neue Ernte zu ihr bringen und mit wilder Impotenz zusehen müssen, wie ihre lästerlichen Finger seine geheiligten Gebete berührten.
Draußen schlug der Sturm mit der Wucht eines wilden Tieres zu, dessen Leib ein Kessel heißen Wassers war, so groß wie das Meer. Die Lichter wurden schwächer und leuchteten dann wieder auf, dann wurden sie wieder schwächer. Es war noch früh für die wütenden Monsunstürme – doch auf dem Friedhof in Broome lagen viele Männer, die außerhalb der Sturmsaison ertrunken waren bei ihrer Suche nach den Wundern des Salzwassers.
Schließlich streikten die Leitungen, und die Halle lag in der Dunkelheit. Langsam hörten die Ventilatoren auf, sich zu drehen. Es gab keine Zeitdifferenz für die Alarmanlage an der Haupteingangstür. Sie ging sofort im gleichen Augenblick aus, als die Lichter erloschen. Das elektronische Schloss an der Außentür schnappte automatisch zu. Falls er es nicht von innen mechanisch öffnete, konnte niemand in seine Halle gelangen.
Kurz bevor der Regen wie Gewehrschüsse auf das Dach aus Metall krachte und sogar den Donner übertönte, der die Erde beben ließ, hörte er ein Geräusch von Metall auf Metall. Er wusste, dass es ein Meißel war, mit dem jemand an den Scharnieren der Eingangstür hantierte; er wusste es, denn es war genau das, was er auch getan hätte.
Jemand war dort draußen und versuchte, die Barrieren zur Black Trinity zu durchbrechen.
Er arbeitete schnell, rein gefühlsmäßig legte er in der Dunkelheit die Juwelierschachtel zurück, schloss die Tabletts mit den weniger wertvollen und dennoch unbezahlbaren Regenbogen-Perlen wieder ein. In seiner Eile riss er eines der Tabletts aus der Halterung. Einmalige schwarze Regenbogen-Perlen sprangen in alle Richtungen davon. Zeit hatte er nicht, sie zu suchen, denn er würde sich wie eine Schlange über den Fußboden bewegen müssen. Er fluchte heftig, dann schob er das leere Tablett in die Schublade zurück, drückte die schwere Stahlplatte wieder an ihren Platz und schloss die obersten Schließfächer – diejenigen, an die er ja eigentlich gar nicht heranreichen konnte.
Die restlichen Schließfächer schloss er nicht. Stattdessen begann er, Perlen aus den unteren Schließfächern auf den Boden der Halle zu werfen. Als die mittlere Reihe der Schließfächer leer war, ging er über zur unteren Reihe. Er leerte all die Tabletts, warf die Perlen wie Bälle in alle Richtungen.
Nachdem er die Fächer geleert hatte, ließ er sie offen, wie Zungen standen sie aus dem glatten Gesicht des Tresors hervor. Und er schloss auch den Tresor nicht. Wer auch immer es war, der sich gewaltsam den Weg in die Halle zu bahnen versuchte – er sollte glauben, dass der Schatz der Perlenbucht ausgebreitet zu seinen Füßen lag.
Als er fertig war, griff er nach einem Stück weggeworfener Austernschale, zog sich in die tiefste Dunkelheit zurück, die er finden konnte, und bearbeitete die Schale, bis er ein scharfes Stück hatte, das so lang war wie seine Hand. Dann tat er das Einzige, was ein Mann in einem Rollstuhl tun konnte.
Er wartete.
Wie Sandkörner im Inneren der Auster,
Wie Perlen, die aus diesen Körnern entstehen;
Jedoch noch immer wartend in unerträglicher Geduld – Jedoch noch immer glaubend, wenn auch beinahe voller Unglauben.
ZHOU LIANGPEI
Kapitel 1
Seattle, Washington
November
Archer Donovan war nicht leicht zu überraschen. Dieses Überbleibsel stammte von seiner früheren Arbeit, wo überraschte Männer oft am Ende tot waren. Doch bei dem einzigartigen Glanz der tränenförmigen schwarzen Perle, die Teddy Yamagata in der Hand hielt, erwischte es Archer doch. Er war schockiert. Seit sieben Jahren hatte er keine schwarze Perle mehr gesehen, die eine solche Farbe aufwies.
Diese ganz besondere Perle hatte damals ein Toter in seiner Hand gehalten. Oder jedenfalls ein beinahe Toter. Archer hatte sich einen Weg durch den Aufstand gekämpft, gerade noch rechtzeitig genug, um seinen Halbbruder aus dem Debakel herauszuholen und ihn ins Krankenhaus zu bringen, an einen anderen, sichereren Ort.
Vor langer Zeit, weit weg, in einem anderen Land. Dem Himmel sei Dank!
Archer hatte alles getan, was in seiner Macht stand, um diesen Teil seiner Vergangenheit zu vergessen. Noch Jahre später bemühte er sich darum. Aber er hatte auf die harte Tour lernen müssen, dass, ganz gleich, wie entschlossen er auch sein früheres Leben als verdeckter Ermittler tilgen wollte – es doch die unangenehme Eigenschaft besaß, sich wieder hervorzudrängen und Schatten auf sein augenblickliches ziviles Leben zu werfen. Der Beweis dafür glänzte in der Hand des führenden Perlensammlers und Händlers von Hawaii.
Teddy war jetzt nicht in Hawaii. Er war nach Seattle geflogen, mit einer Kiste voller besonderer Perlen, die er Archer zeigen wollte, einschließlich dieser aufregenden schwarzen Perle.
»Ungewöhnliche Farbe«, sagte Archer mit neutraler Stimme.
Teddy betrachtete durch die dicken, getönten Gläser seiner Brille den Mann, der manchmal sein Konkurrent im Perlenhandel war, ab und zu sein Kunde und ein unwahrscheinlich zuverlässiger Schätzer. Wenn Archer besonders an dieser tränenförmigen Perle interessiert war, so zeigte sich doch kein Anzeichen davon in seinem Gesicht. Genauso gut hätte er ein Bild von Teddys Enkelkindern betrachten können.
»Sie müssen ein ganz fabelhafter Pokerspieler sein«, meinte Teddy.
»Spielen wir denn Poker?«
»Auf alle Fälle haben Sie Ihr Spielergesicht aufgesetzt. Wenigstens glaube ich das. Schwer zu sagen, unter dem ganzen Pelz!«
Abwesend rieb Archer sich mit der Hand über die Wange. Vor einigen Monaten hatte er aufgehört, sich zu rasieren. Er war sich noch immer nicht sicher, warum er das getan hatte. An einem Morgen hatte er nur seinen Rasierapparat in die Hand genommen, hatte darauf geblickt, als sei es ein Überbleibsel der spanischen Inquisition und hatte die Rasierklinge in den Abfalleimer geworfen. Die Tatsache, dass an diesem Tag genau sechs Jahre vergangen waren, seit er aufgehört hatte, für Onkel Sam zu arbeiten, hatte vielleicht etwas damit zu tun. Wie auch immer, sein Bart war gewachsen und bildete jetzt die Fortsetzung seines kurzen schwarzen Haars.
Und wenn es zwischen den schwarzen Haaren auch ein paar graue gab, nun ja. Leichen alterten nicht. Nur die Lebenden konnten das.
»Muss ziemlich heiß sein, wenn Sie nach Tahiti fahren«, meinte Teddy.
»Dort ist es immer heiß.«
»Ich meinte den Bart.«
»Den habe ich noch nie nach Tahiti geschleppt.«
Teddy gab die Feinheiten auf und versuchte es auf direktem Wege. »Was halten Sie von der Perle?«
»Südsee, vielleicht vierzehn Millimeter, tränenförmig, makellose Oberfläche, feiner Glanz.«
»Fein?«, rief Teddy. Seine schwarzen Augen verschwanden fast hinter den Lachfältchen. »Sie ist verdammt sensationell, und das wissen Sie auch! Sie ist wie ... wie ...«
»Wie ein geschmolzener Regenbogen unter schwarzem Eis.«
Teddys dünne schwarze Augenbrauen hoben sich, und er stieß zu. »Sie gefällt Ihnen doch!«
Archer zuckte mit den Schultern. »Eine Menge Perlen gefallen mir. Das ist eine meiner Schwächen.«
»Höchstens in meinen Träumen sind Sie schwach. Was ist die Perle wert?«
»Was auch immer Sie dafür bekommen können ...« Der Blick aus Archers kühlen, grau-grünen Augen erstickte den sofortigen Protest von Teddy. »Was wollen Sie eigentlich wirklich wissen?«
»Was das verdammte Ding wert ist«, sagte er verärgert. »Sie sind der beste, ehrlichste Schätzer, wenn es um Perlen geht, den ich kenne.«
»Woher haben Sie dieses schöne Stück?«
»Von einem Mann, der sie von einer Frau hat, die sie von einem Mann in Kowloon hat, der sie angeblich von jemandem in Tahiti bekommen hat. Seit sechs Monaten suche ich schon nach diesem Mann.« Teddy schüttelte heftig den Kopf. »Er ist nicht da. Aber wenn Sie die Perle kaufen, werde ich Ihnen die Namen nennen.«
»Gibt es noch mehr davon?«
»Ich hatte gehofft, dass Sie mir das sagen können.«
»Immerhin wäre es vorstellbar.«
Archer warf einen Blick auf die Weltraumuhr aus rostfreiem Stahl, die sein Vater aus Deutschland mitgebracht hatte und die er in dem Eingangsraum der Serie von Suiten platziert hatte, in denen sich die Familie Donovan in der Stadtmitte von Seattle immer zeitweise aufhielt.
Zwei Uhr in Seattle. Mittwoch Nachmittag. Herbst, der langsam in den Winter überging.
Wo die schwarze Perle herkam, war es früher Morgen. Donnerstag. Frühling, der langsam in den Sommer überging.
Was ist schiefgelaufen, Len? fragte Archer insgeheim. Warum verkaufst du nach sieben Jahren deine einzigartigen Juwelen aus der Perlenbucht?
Er warf noch einen Blick auf das strahlende schwarze Juwel, doch es gab ihm keine Antwort, bis auf die, die er bereits wusste – vor sieben Jahren hatte sein Halbbruder, Len McGarry, sein Leben als verdeckter Ermittler mit viel zu vielen zwielichtigen Geschäften vermischt. Dabei war er beinahe umgekommen – und jedenfalls zum Krüppel geworden.
Archer gehörte zu den drei Menschen auf der Welt, die wussten, dass Len das Geheimnis entdeckt hatte, wie man in den Seeaustern Australiens außergewöhnliche schwarze Perlen züchten konnte. Doch Len hatte sich geweigert, eine von den Tausenden und Abertausenden schwarzen Juwelen zu verkaufen, die die Perlenbucht in den letzten sieben Jahren produziert hatte.
Und trotzdem lag nun eine solche Kostbarkeit vor ihm: ein wunderschöner schwarzer Geist aus der Vergangenheit.
Ein Teil von Archer, der Teil, der sich störrisch weigerte, sich der nackten Realität zu beugen, flüsterte ihm zu, dass Teddys Perle vielleicht bewies, etwas sei glatt gelaufen und nicht falsch. Vielleicht heilte Lens Geist langsam, wenn es auch sein Körper nicht mehr schaffte. Vielleicht begann er zu begreifen, dass er noch immer der gleiche Mann war, ungeachtet dessen, wie viele herrliche Südseeperlen er auch hortete.
Zusammen mit den Gedanken an Len kamen unerfreuliche Erinnerungen an Hannah McGarry, Lens einst unschuldige, doch immer verführerische Frau. Verführerisch wenigstens in Archers Augen. Zu verführerisch sogar. Er hatte sie in zehn Jahren nur zweimal gesehen. Doch an jeden einzelnen Moment konnte er sich mit peinigender Deutlichkeit erinnern.
Sie war wie die schwarze Perle, einzigartig! Und genau wie die Perle hatte sie nicht die leiseste Ahnung von ihrer Schönheit, von ihrem Wert.
Als er aufgetaucht war, mit ihrem zerschmetterten, blutenden Mann in seinen Armen und ihr gesagt hatte, dass sie genau zwei Minuten Zeit hätte zum Packen, war sie weder in Ohnmacht gefallen, noch hatte sie versucht, ihm zu widersprechen. Sie hatte einfach ein paar Decken ergriffen, Medikamente und ihre Handtasche. Es hatte nicht einmal neunzig Sekunden gedauert. Ihr Flug aus der Hölle nahm wesentlich mehr Zeit in Anspruch. Archers Blut floß auf das Kontrollpult des kleinen Flugzeugs, und er sah doppelt wegen der Gehirnerschütterung, die er sich eingehandelt hatte, als er sich den Weg zu Len freikämpfte.
Hannah hatte die ganze Zeit über kein Wort gesagt. Sie saß auf dem Sitz des Kopiloten und wischte ihm das Blut aus den Augen; dabei achtete sie nicht auf das Blut auf ihrer Unterlippe, wo sie sich selbst gebissen hatte, um nicht vor Angst laut aufzuschreien.
Automatisch verbannte Archer Hannah McGarry aus seinen Gedanken. Er war kein Mann, der sich nach etwas sehnte, was er niemals haben konnte. Hannah war verheiratet. Für Archer war eine Ehe – eine Familie – eines der wenigen Dinge, die in der modernen Welt noch eine Bedeutung hatten. Sehr altmodisch von ihm, in der Tat starrsinnig – aber so war er nun einmal. Das einundzwanzigste Jahrhundert bot Raum genug für alle, selbst für altmodische und rückständige Menschen.
»Also glauben Sie nicht, dass es eine Perle aus Tahiti ist?«, fragte Archer beinahe träge.
»Wieso sagen Sie das?«
»Sie stellen Fragen in Seattle und nicht in Tahiti. Entweder sind Sie dort nicht weitergekommen, oder Sie wissen bereits, woher die Perle stammt, und testen mich, ob ich es auch weiß.«
Teddy seufzte. »Wenn ich wüsste, woher sie stammt und wie ich mehr davon bekommen könnte, dann würde ich meine Zeit nicht damit verschwenden, mich mit Ihnen zu unterhalten. Ich bin hier, weil ich es leid bin, mit dem Kopf an die Wand zu rennen. Und was Tahiti betrifft: Keiner der Lieferanten und Perlenfarmer, mit denen ich gesprochen habe, hat zugegeben, diese Perle oder eine ähnliche schon einmal gesehen zu haben. Jemals. Und das ist kein Schmuckstück, das ein Mann je vergisst.«
Einzigartig, faszinierend, niemals gab es zwei identische. Wie Hannah McGarry. Der Gedanke kam und verschwand wieder aus Archers Kopf, mit der gleichen Geschwindigkeit, wie die Farben unter der Oberfläche von Teddys erstaunlicher schwarzer Perle wechselten.
»Was verlangen Sie dafür?«, fragte Archer und war genauso überrascht wie Teddy von seiner Frage.
»Was würden Sie mir dafür geben?«
»Nicht so viel, wie Sie haben wollen. Die Farbe der Perle passt nicht mit anderen zusammen – also fallen die üblichen Schmuckstücke schon weg. Vielleicht könnte eine meiner Schwestern – sehr wahrscheinlich Faith – eine interessante Fassung dafür entwerfen als Brosche oder Anhänger; doch dann läge der wahre Wert in der Kunst und der Bearbeitung und nicht in der Perle. Ich würde Faith dafür bezahlen und nicht Sie.«
Teddy widersprach nicht. Auch wenn der Mensch sie kultiviert hatte, so wurden Perlen doch nicht mechanisch hergestellt: Man brauchte noch immer eine Auster, um eine Perle zu produzieren. Und da eine Perle ein natürliches, organisches Produkt war, passten nur sehr wenige Perlen wirklich zusammen, um in einem Schmuckstück vereint zu werden. Perlen für eine Halskette aufzufädeln war genauso, als wolle man tausend Rothaarige zusammenbringen, um daraus neunzehn gleich aussehende zu finden. Wenn man erst einmal hinter die oberflächliche Ähnlichkeit sah, so lagen die Unterschiede schreiend auf der Hand.
»Man könnte sie zu einem Ring verarbeiten«, meinte Teddy nach einem Augenblick.
»Das könnte man sicher – aber nicht viele Menschen würden Tausende von Dollars ausgeben für einen Ring, dessen unersetzlicher Mittelpunkt durch die nachlässige Handbewegung einer Frau ruiniert werden könnte. Oder die eines Mannes ...«
Der Hawaiianer brummte.
»Ihre Perle ist groß«, sprach Archer weiter, »doch bei weitem nicht groß genug, um Sammler oder sogar Museen zu interessieren. Sie besitzen bereits schwarze Perlen, die doppelt so groß sind. Runde schwarze Perlen.«
»Aber der schimmernde Glanz«, protestierte Teddy. »Und haben Sie je eine Perle gesehen, die auch nur die Hälfte dieser Farben besitzt? Sie changiert wie ein schwarzer Opal!«
Archer hatte einmal eine Perle gesehen, die diejenige von Teddy in den Schatten stellte; doch alles, was er sagte, war: »Ja, der Glanz ist wunderschön. Für jemanden, der ungewöhnliche Perlen sammelt ...«
»Wie Sie«, unterbrach Teddy ihn.
»... wäre diese hier vielleicht dreitausend amerikanische Dollar wert.«
»Drei? Wohl eher zwanzig!«
»Versuchen Sie es! Ich würde nicht mehr als fünf dafür bezahlen.«
»Das soll wohl ein Witz sein! Sie ist mindestens fünfzehn wert, und das wissen Sie ganz genau.«
Archer warf einen Blick auf seine Uhr. Er hatte noch ein paar Stunden Zeit, ehe er seiner Schwester Faith helfen musste, ihren kleinen Laden am Pioneer Square zu schließen. Auch wenn er von außen nicht viel hermachte, so besaß doch dieser Laden ein Inventar von mehreren Millionen Dollar an internationalen Schmuckstücken und einzigartigen Juwelen. Normalerweise begleitete einer der Wachmänner von Donovan International Faith und ihre Ware von und zu den Tresoren von Donovan. Heute war Archer an der Reihe. In der Vergangenheit hatte ihr nutzloser Freund Tony, mit dem sie zusammenlebte, sie begleitet und bewacht; doch zur großen Erleichterung der Donovans hatte Faith sich vor kurzem den Feenstaub aus den Augen gewischt und ihn rausgeworfen.
»Was haben Sie mir sonst noch zu zeigen?«, fragte Archer.
Teddy sah den großen Amerikaner an, maß den stahlharten Blick seiner grau-grünen Augen und legte mit einem Seufzer die Perle zurück in das kleine, mit Samt ausgeschlagene Kästchen. »Ich hoffe immer noch auf ein freies Mittagessen.«
Archer lächelte. »Das ist ein Teil Ihres Charmes, Teddy. Das und Ihre relative Ehrlichkeit.«
»Relativ!«, rief er. »Relativ, verglichen mit was?«
»Wenn ich die Antwort darauf wüsste, dann wären Sie wirklich vollkommen ehrlich.«
Der kleine, untersetzte Mann runzelte die Stirn. Es war nicht das erste Mal, dass er es nicht schaffte, den altmodischen Windungen der Gedankengänge seines Gegenübers zu folgen.
»Hungrig?«, fragte Archer.
Teddy tätschelte mit der flachen Hand seinen Bauch. Auch wenn er nicht gerade schlank war, so bestand sein Bauch doch eher aus Muskeln als aus Fett. »Ich bin immer hungrig.«
»Bringen Sie Ihren Aktenkoffer mit in die Küche. Ich werde Ihnen ein Sandwich machen. Und während Sie essen, sehe ich mir Ihre andere Ware an.«
»Danke.«
»Nichts zu danken. Das Essen werde ich Ihnen abziehen von dem Preis dessen, was ich Ihnen abkaufe. Falls ich etwas kaufe.«
Lachend folgte Teddy Archer durch das Wohnzimmer in die große, zitronengelbe Küche der Eigentumswohnung. Das Eckfenster bot einen Ausblick auf Seattles Hafenviertel. Draußen in der Elliot Bay warteten riesige Containerschiffe aus allen Ecken des Pazifiks darauf, von den Kränen entladen zu werden, die wie riesige orangefarbene Insekten an den Docks entlangkrochen. Fähren bahnten sich ihren Weg hindurch zwischen riesigen Handelsschiffen, sie hinterließen einen weißen Streifen Bugwasser. Herangetrieben von dem frischen Wind segelten niedrig hängende Wolken am Himmel und schickten Schleier von Regen über das bleigraue Wasser.
»Schöne Aussicht«, meinte Teddy. »Aber sind Sie den ewigen Regen nicht leid?«
»Sie sollten ihn als einen Wassergraben betrachten, der die Stadt schützt.«
Teddy blinzelte, er öffnete den Mund, um etwas zu sagen, schloss ihn dann aber wieder. Dann schüttelte er den Kopf und lachte.
Archter wartete, bis Teddy sich in den Alkoven gezwängt hatte, in dem der Eßtisch stand, mit einer Flasche Bier in der einen und einem Käsesandwich in der anderen Hand, ehe er die Unterhaltung zurückbrachte auf die letzten Reisen des Perlenhändlers.
Weil Teddy irgendwo unterwegs eine von Lens schwarzen Schönheiten gefunden hatte ...
»Hatte Sam Chang irgendwelche besonderen Perlen zu verkaufen?«, fragte Archer.
Teddy gab ein unterdrücktes Grunzen von sich, er schluckte, dann sagte er: »Dieser Hundesohn! Er besitzt zwei Drittel der Perlenfarmen Tahitis und benimmt sich, als würde er bei jeder Ernte seinen erstgeborenen Sohn verkaufen. Und genauso setzt er auch den Preis für seine Ware fest.«
»Die goldene Regel«, meinte Archer und öffnete eine Flasche des örtlichen Gebräus. »Er hat das Gold, er macht die Regeln.«
»Japan wird ihm den Hintern aufreißen. Er bedrängt ihr Verkaufsmonopol viel zu hart. Großartiger Käse – was ist es für einer?«
»Gorgonzola mit Pesto. Wie geht es denn den kleineren Perlenfarmern?«
Mit hochgezogenen Augenbrauen blickte Teddy auf das Sandwich. »Nichts hat sich verändert. Sie stehen immer noch Schlange, wie Kühe beim Melken.«
»Überraschend. Die Aussies sind noch widerspenstiger als die Amerikaner.«
»Oh, es gibt einige, die durchhalten«, meinte Teddy und winkte mit den Überresten seines Sandwiches ab. »Aber sie werden bis auf die Knochen ausgepresst von dem Konsortium. Ihre Lizenzen werden beschnitten, man gibt ihnen die Publikationen der neuesten Forschungsergebnisse der Regierung erst, wenn ihre Konkurrenten sie schon lange haben; ihre Perlen findet man unmöglich platziert bei den Auktionen. Und so weiter.«
»Wer ist ihr Anführer?«, fragte Archer, obwohl er das ganz genau wusste. Genauso, wie er weit besser als Teddy darüber Bescheid wusste, wer im internationalen Perlenhandel was tat und womit und mit wem. Aber ein Mann, der aufhörte, Fragen zu stellen, erfuhr niemals etwas Neues.
»Len McGarry«, sagte Teddy und verspeiste den letzten Bissen seines Sandwiches. »Ich muss Ihnen sagen, dieser Mann ist ein gemeiner Bastard. Was auch immer für ein Grund ihn in den Rollstuhl gebracht und ihm vielleicht die Eier abgeschnitten hat – er ist dadurch auf keinen Fall ein besserer Mensch geworden.«
Einen Augenblick lang sah Archer wieder das schreckliche Bild vor sich, wie Len zerbrochen, blutig und vollkommen bewegungslos im Gang des kleinen Flugzeuges gelegen hatte. Die Erinnerung daran konnte Archer noch immer aus tiefstem Schlaf aufwecken – schweißgebadet hörte er in der Stille, wie Len vor Schmerzen wimmerte. Doch einige der Geräusche kamen dann jeweils von ihm selbst.
»Die Gerüchte besagen, dass er auf der Ausbeute der Perlen aus den letzten fünf Jahren sitzt«, verkündete Teddy nun. »Von seiner eigenen Farm und vielleicht sogar einigen der Perlenfarmer aus Tahiti, heimlich, still und leise.«
Auch Archer hatte davon gehört. Er glaubte wenigstens einen Teil davon. In den letzten fünf Jahren waren die Bilanzen der Perlenbucht gesunken wie ein Stein in ruhigem Wasser. Entweder hatten die Austern aufgehört, ordentliche Perlen zu produzieren oder Len hielt sie zurück. Als Miteigentümer hätte Archer das eigentlich etwas ausmachen müssen. Aber nein! Was auch immer Len aus den Ruinen seiner Träume herausquetschte, sein stiller Partner gab sich damit zufrieden. Geld war das geringste Problem, das er mit seinem Halbbruder hatte.
»Man hört immer wieder von Gerüchten von geheimen Verbindungen unter den Perlenfarmern«, meinte Archer.
»Manchmal stimmt das auch.«
»Manchmal.« Er öffnete Teddys Aktenkoffer und warf einen schnellen, umfassenden Blick über den Inhalt. Keine Stücke aus der Perlenbucht waren darunter. Doch er würde Teddy nicht mit leeren Händen ziehen lassen. Der Hawaiianer war eine viel zu gute Quelle für den neuesten Klatsch. Selbst eine direkte Falschinformation – intelligent durchgeführt – konnte so erleuchtend sein wie eine beschworene Version der Wahrheit.
Auf jeden Fall hatte Archer vor, die schwarze Regenbogenperle zu kaufen. Doch wollte er Teddy nicht reich machen damit.
»Sie hatten viel zu tun«, meinte Archer.
Das Interesse in seiner Stimme war Balsam auf die Perlenhändler-Seele von Teddy. Er lächelte und beugte sich vor. »Also, was sehen Sie, das Ihnen gefällt?«
»Die orangefarbene Perle. Die aus einer vietnamesischen Muschel.«
Teddy sah ihn überrascht an, dann lachte er reumütig. »Verdammt. Ich hatte gehofft, Sie auch dafür blechen zu lassen.«
»Auch?«
»Wie für die schwarze Perle.«
Archer sah sich die Perle an, nachtschwarz und dennoch irisierend in allen Farben des Regenbogens. »Nichts lässt sich mit dieser Perle vergleichen.«
Es war die Art von Juwel, für die Männer einen Mord begingen.
Weißt du vielleicht, wie der arme, formlose Wicht – Die Auster – ihren flachen, vom Mondlicht erhellten Kelch schmückt?
Wo die Schale ihn drückt oder der Seesand reibt,
Legt er wunderschönen Glanz auf diesen Kummer.
SIR EDWIN ARNOLD
Kapitel 2
Broome, Australien
November
Das Sonnenlicht hämmerte auf das Land. Sogar der Indische Ozean lag flach unter dem Gewicht der Sommersonne. Das Wasser war eine schimmernde, türkisfarbene Stille, unbewegt von Wind, Lufthauch, von irgendeiner Brise in der Luft. Nichts rührte sich, nur der Schweiß rann schweigend über die Haut.
Hannah McGarry bemerkte die brutale Hitze gar nicht und auch nicht ihre verschwitzte Haut oder das Gewicht des chinesischen Kindes, das sie in ihren Armen hielt. Len McGarry war tot. Opfer eines Zyklons.
Niemanden sonst aus der Perlenbucht hatte es getroffen, auch wenn einige Männer verletzt worden waren von herumfliegenden Trümmern. Qing Lu Yin hatte es am schlimmsten getroffen: tiefe Wunden, eine hässliche Platzwunde an seinem Kinn, ein blaues Auge. Aber er bestand darauf, trotzdem zu arbeiten. Genau wie der Rest der Männer. Sie wussten, dass die Perlenbucht ihnen den Lebensunterhalt garantierte.
Trotz der zerstörten Flöße und der Sortierhalle waren nur wenige der Hütten beschädigt worden. Keines der Kinder hatte auch nur einen Kratzer davongetragen. Dafür war sie dankbar.
Sie rückte das Kind auf ihrer Hüfte zurecht und ignorierte den leisen Schmerz in ihrer Lunge und das lauwarme Salzwasser, das aus ihrem kurzen Haar rann – ein Anzeichen dafür, dass sie erst vor kurzem auf den Boden der flachen Bucht getaucht war. Tauchen war harte Arbeit, aber sie liebte es. Eingehüllt in dem schimmernden, durchsichtigen Wasser, war sie frei.
Jetzt tauchte sie nicht. Sie war nicht frei, sondern gefangen im Sonnenlicht, bemüht, sich ihre Gedanken äußerlich nicht anmerken zu lassen. Hannah konnte es sich nicht leisten, Angst zu zeigen, Ängstlichkeit – irgendwelche der heftigen Gefühle, die gleich unter der brüchigen Oberfläche ihrer Selbstkontrolle lagen.
»Traurig?«, fragte das vierjährige Kind.
Entsetzliche Angst, waren die Worte, die ihr in den Sinn kamen; doch sie lächelte in das wunderschöne, unschuldige Gesicht des Kleinen, als wäre alles in Ordnung. »Ich habe nur nachgedacht, Liebling.«
»Nach-gedacht«, wiederholte der kleine Junge vorsichtig.
»Gut«, lobte Hannah ihn automatisch. Von den sieben Kindern der Arbeiter, denen sie Englischunterricht gab, war Sun Hui der Begabteste. »Der Sturm hat viele Dinge zerstört – kaputtgemacht.«
Hui nickte ernst.
Aus der Richtung der Hütten der Arbeiter kam ein Wortschwall auf Chinesisch. Hui wandte sich um. »Ma-ma«, sagte er.
»Okay, Liebling.« Sie gab ihm einen Kuss auf seine goldene Wange und erhielt auch einen Kuss von ihm. Zögernd stellte sie das lebhafte Kerlchen auf den Boden. Von all den Enttäuschungen, die ihr ihre Ehe gebracht hatte, war der Mangel an Kindern die Schmerzlichste. »Lauf. Vorsichtig! Es liegt eine Menge Schutt herum, von dem Sturm!«
»Schutt. Sturm. Ja!«
Hannahs dunkelblaue Augen zogen sich zusammen, als sie Hui nachsah, wie er in einer der Hütten verschwand. Erst dann wandte sie sich um und betrachtete die Ruinen, die einmal die Perlenbucht gewesen waren. Zerbrochene Dinge machten Hoffnung, man konnte sie reparieren. Es gab eine Menge hier, was im Augenblick repariert werden musste.
Die Pfähle einer Anlegestelle ragten aus dem Sand wie abgebrochene Zähne. Flöße, die einmal Tausende und Abertausende von Perlenaustern in allen Stadien des Wachstums geschützt hatten, waren an entfernte Strände gespült worden oder in Tiefen gesunken, in die kein Auge blicken konnte. Boote für die Ernte und die Behandlung der Austern lagen auf dem Meeresgrund.
Doch der Schaden beschränkte sich nicht auf die schwimmende Ausrüstung der Perlenbucht. Zerstört von dem heftigen Wind lag die wichtigste Sortierhalle schief neben dem Weg zum Haus. Das Metalldach hatte Löcher und war krumm und verbogen. Verdreht, zusammengedrückt und nutzlos schützten die verbliebenen Stahlläden der Fenster eine Ruine. Der Flachbau selbst hing schief, dort, wo der Untergrund von den heftigen Wellen unterspült worden war.
Selbst Lens »zyklonsicherer« Perlentresor hatte der Wildheit des Sturmes nicht widerstehen können. Die wütenden Fäuste des Windes hatten auf das Metall eingeschlagen, bis etwas geborsten war, so dass die Perlen in alle Richtungen davonflogen. Und es hatte jemanden gegeben, der sie alle aufsammelte. Oder vielleicht hatten auch viele Hände nach dem schimmernden Reichtum gegriffen. Hannah wusste es nicht, durfte es gar nicht wissen. Oder wenigstens musste sie so tun.
Len war tot. Doch nicht aufgrund eines Unfalls.
Wer auch immer ihren Mann umgebracht hatte, konnte sie genauso gut umbringen. Wahrscheinlich noch einfacher. Selbst in einem Rollstuhl wäre Len gefährlich gewesen. Er kannte viel zu viele Möglichkeiten, andere zu liquidieren. Das war es, was er am besten konnte. Zerstören.
Doch das bedeutete nicht, dass er es verdient hatte, zu sterben.
Verdient.
Fair.
Hannahs Mund verzog sich zu einem bitteren Lächeln. Sie hatte nicht gewusst, wie viel von dem Missionarskind noch in ihrem neunundzwanzigjährigen Verstand übrig geblieben war. In der Welt ging es nun mal drunter und drüber – und auch sie konnte sterben, wenn sie dem falschen Menschen vertraute.
Oder auch nicht.
Fair hatte damit nichts zu tun. Überleben war das Einzige, was zählte. Sein oder Nichtsein stand für Hannah nicht zur Debatte. Ihr ging es um das Weiterleben.
Len hatte sein Schach mit zu vielen gefährlichen Menschen gespielt. Er hatte Millionen von Dollar gewonnen. Und dann sein Leben verloren ...
»Chérie?«
Cocos sanfte, ein wenig raue Stimme drang in Hannahs Grübeleien. Wie immer, so war die wunderschöne Frau aus Tahiti auch jetzt am Rande des Geschehens; sie beobachtete, hörte zu und wartete, auf was auch immer sie warten mochte. Hannah wusste es nicht. Es war ihr auch gleichgültig. Len hatte Cocos unheimliche Geschicklichkeit zu schätzen gewusst. Wenn Cocos zarte Hände sich ans Werk machten, so überlebten die Tiere in jeder Muschel. Ohne dieses Innenleben starb die Auster.
»Ja?«, sagte Hannah. Sie wandte sich dem Geräusch zu und vertraute darauf, dass nichts ihrer düsteren Träume sich in ihrem Gesicht widerspiegelte. Das Leben mit Len hatte sie gelehrt, alles zu verbergen, ganz besonders Furcht. Es war ein absolutes Gesetz. Nicht leicht. Nur brutal einfach.
»Du kommen rein, ja?«, sagte Coco lässig. »Du nicht geboren, unter dieser Sonne zu stehen am Mittag.«
»Ist das überhaupt jemand?«
»Meine Mama.« Cocos Lächeln blitzte heller als jede Perle auf der tiefbraunen Haut, ein Erbe ihrer halb-polynesischen Mutter. »Mein Papa nicht. Die Sonne haben ihn schließlich verbrannt.« Sie streckte ihre Hände der Sonne entgegen. »Sonne wird mir nichts tun. Ich bin dafür geboren. Meine Halbschwester auch.«
Hannah hätte über Cocos Selbstvertrauen gelächelt; doch sie fürchtete, dass ihr Lächeln mehr und mehr wie das von Len geworden war: eine wilde Warnung an die Welt, Abstand zu halten. Dabei war es nicht so, dass sie Colette Dupres mit ihrer glatten Haut und der katzenartigen Anmut verletzen würde oder könnte. Selbst Lens düsterste Stimmungen hatten die Tahitianerin nicht beeindruckt. Sie hatte ganz einfach gelacht und war weggegangen; dabei hatte sie ihm auf Augenhöhe stets den Anblick auf den schönsten Hintern in West-Australien geboten.
»Ian kommen bald«, sagte Coco und beobachtete die andere Frau aufmerksam, um herauszufinden, wie sie auf die Erwähnung von Ian Changs Namen reagierte. Doch es gab keine Reaktion. Sie deutete auf die Taucherflossen, Maske und Schnorchel, die vor Hannahs Füßen lagen. »Du sollen duschen und ein hübsches Kleid für ihn anziehen, ja? Du sehen aus wie Taucher nach zwölf Stunden unter Wasser.«
»In meinem Fall war es nur eine Stunde, und wirklich getaucht habe ich auch nicht.«
»Etwas gefunden?«
»Was gibt es da noch zu finden?«, antwortete Hannah und wehrte so die Frage ab. »Noch mehr Wracks und Ruinen!«
»Ist schlimm, aber nicht so schlimm, wie aussieht.«
Es ist noch viel schlimmer. Doch diese Worte sprach Hannah nicht laut aus. Sie wollte Coco vertrauen, wollte glauben, dass ihre wunderschönen braunen Hände nicht unter denen waren, die die gestohlenen Perlen eingesammelt hatten.
Hannahs Mund presste sich zu einer schmalen Linie zusammen, als sie über ihre eigenen dummen Gedanken nachdachte. So viel von dem Kind steckte immer noch in ihr. Sie hoffte – und das war nach wie vor dumm.
Es könnte ihr Tod sein.
»Selbst wenn schlimm«, fügte Coco mit einem lässigen Schulterzucken hinzu, »Ian wird alles für dich wieder machen.«
»Warum sollte er das tun?«
Cocos Lachen war genauso sexy wie ihre Stimme. »Du wissen, warum.«
»Er ist schon seit Jahren darüber weggekommen, jetzt will er mich nicht mehr haben.«
»Kleines weißes Kind«, sagte Coco, sie lächelte und klang viel älter als ihre siebenunddreißig Jahre. »Männer kommen nie über Frau weg, die nicht haben. Jetzt dein Mann tot. Du nicht verheiratet.«
»Ian aber.«
»Was?«
»Verheiratet«, sagte Hannah knapp.
»Seine Frau ... ihr ist egal.«
»Mir aber nicht. Ich bin von christlichen Missionaren großgezogen worden. Eine Ehe ist wichtig.«
»Oui. Len hat manchmal geredet, wenn er trinken«, sagte Coco; sie gähnte und reckte sich zu ihrer vollen Größe, so dass ihre Augen beinahe auf gleicher Höhe mit denen vor Hannah waren, die einen Meter zweiundsiebzig maß. »Deine ... man sagt? Ehre?«
Hannah verzog das Gesicht.
»Oui, Ehre«, meinte Coco. »Er lächeln darüber. Manchmal er sogar lachen.«
»Ich weiß.«
Der Gedanke an den unschuldigen, sexuell reifen Teenager, der sie einmal gewesen war, ließ Hannah nicht länger vor Scham zusammenzucken. Sie hatte aus dem Regenwald von Brasilien herausgewollt – und es auch geschafft. Das war das Ende eines Lebens gewesen. Der Beginn eines anderen ... nicht das Leben, das sie erwartet hatte! Es hatte keinerlei Überraschungen gegeben; sie war schmerzlich naiv gewesen, was ihre Erwartungen anbelangte. Das Leben nahm seinen Lauf, und die Lebenden folgten ihm.
Eine Wolke von rotem Staub auf der Straße, die zu der Perlenbucht führte, kündigte die Ankunft von Ian Chang an. Die achtundfünfzig Zentimeter Regen, die der Zyklon gebracht hatte, waren längst ins Meer abgeflossen. Die gnadenlosen Sommer in West-Australien saugten schnell alle Flüssigkeit aus dem Boden und hinterließen das Phänomen des roten Staubes in einer feuchten Wüste.
Changs Auto verschwand in den struppigen Mangroven, die den leuchtend weißen Sand an einer der Gezeitenbuchten begrenzten. Die Buchten hielten während des Monsuns das frische Wasser und füllten sich das ganze Jahr über bei jeder hohen Flut mit Salzwasser. Das Land war so flach, dass diese Buchten sich meilenweit ins Land hineinschoben. Genau wie das Salzwasser. Selbst ohne die Hilfe von Stürmen schwankten die Gezeiten in Broome auf ihrem Höhepunkt um zehneinhalb Meter. Das war großartig, um die Austern zu versorgen, und es bedeutete die Hölle für alles, was versuchte, den Strand zu erobern. Felsen, Lehm und Sand waren die Regel. Nur Palmen und die undurchdringlichen Mangroven überlebten den Angriff der Gezeiten.
Und der Mensch natürlich; dieser schlaue, anpassungsfähige, tödliche Primat.
Broome und seine umliegenden Gebiete bildeten das Zuhause für eine rassisch gemischte Bevölkerung, die so hart war wie die Mangroven. Es handelte sich um Überlebenskünstler, die sich an ihrem eigenen Überleben erfreuten. Sie waren die ein wenig Verrückten und die vollkommen Wahnsinnigen. Trunksüchtige und Antialkoholiker, Keusche und Satyre, Heilige und Anbeter des Satans. In Broome hatten nur Außenseiter Platz.
Chang passte genau in dieses Schema. Er war äußerst intelligent, äußerst ehrgeizig, äußerst reich. Seine Familie besaß mehr Geld als einige der Länder der Dritten Welt zusammen. Er kam auf Hannah zu, mit dem Selbstvertrauen eines Mannes, der von anderen Männern respektiert und von vielen Frauen begehrt wird. Er trug die Uniform des Outbacks – Sonnenbrille, Shorts und Sandalen. Da sein Besuch nicht formeller Natur war, hatte er sich nicht die Mühe gemacht, ein Oberteil anzuziehen.
»Hannah, Liebling, für diese Sonne bist du noch immer zu blass«, begrüßte Chang sie.
Er nahm ihre Hände und beugte sich vor, um sie zu küssen. Sie entzog sich seinem Griff mit der Anmut der langen Übung. Sie hatte nichts gegen Chang. In den letzten sieben Jahren hatte sie ganz einfach die Übung verloren, berührt zu werden. Wenn sie sich entschied, diese Gewohnheit wieder aufzunehmen, dann sicher nicht mit einem verheirateten Mann.
Weil Hannah Chang gar nicht sehen wollte – weil sie eigentlich überhaupt niemanden sehen wollte –, musste sie sich darauf konzentrieren, höflich zu lächeln. »Tag, Ian. Es war wirklich nicht nötig, in dieser Hitze den ganzen Weg von Broome hier heraus zu fahren. Du hättest genauso gut anrufen können.«
»Die Telefonleitungen sind weiterhin unterbrochen.«
»Dann solltest du beim nächsten Mal meine Handynummer anrufen. Oder über Funk. Das funktioniert beides per Batterie.«
»Ich wollte nach dir sehen«, meinte Chang. »Du hast mehr als nur den Stromanschluss verloren in dem Zyklon. Du hast einen Ehemann verloren und den größten Teil der Perlenbucht.«
Angst beschlich Hannah, und ihre Füße wurden trotz der brennenden Sonne eisig kalt. Chang wusste noch nicht einmal die Hälfte. »Mir ist klar, was ich verloren habe.«
»Trauerst du um den Mann oder um die Perlenfarm?«
Insgeheim beobachtete Hannah Chang aus Augen, die von einem so tiefen Blau waren wie die See im Dämmerlicht, dunkel und leuchtend zugleich. Der Kontrast zwischen ihren indigoblauen Augen und ihrem sonnengebleichten braunen Haar faszinierte ihn, genau wie ihr schlanker und dennoch eigenartig üppiger Körper. Er wollte so gern glauben, dass sie den String-Bikini nur trug, um ihn zu verführen – doch er wusste es besser. Offensichtlich hatte sie geschnorchelt. Wahrscheinlich hatte sie sich nicht einmal mehr daran erinnert, dass er zu Besuch kommen wollte.
Ärger stieg in ihm auf. »Nun?«
»Bist du deshalb den ganzen Weg hier heraus gekommen?«, fragte Hannah mit ausdrucksloser Stimme. »Nur um nachzuforschen, ob mir mehr an der Perlenbucht liegt als an meinem Ehemann?«
»Versuche nicht, mir zu erzählen, dass du und Len einander sehr nahe gestanden habt. Ich weiß es besser. Len war eine Schlange. Das Einzige, was ihm nahe stand, war seine eigene Haut – und die hat er einmal im Jahr gewechselt, nur um zu beweisen, dass er das konnte.« Chang warf Coco einen Blick zu. »Lass uns allein.«
Coco sah ihn an. Dann wandte sie sich ab; sie ging langsam genug, um ihn wissen zu lassen, dass sie auf niemandes Befehl hin sprang, auch nicht, wenn er einer der reichsten Männer Australiens war.
»Nein«, sagte Hannah.
Coco blieb stehen.
»Wir wollten gerade ins Haus gehen und Tee trinken«, wandte sich Hannah an Chang. »Du kannst gern mitkommen.«
»Aber wir müssen uns allein unterhalten.«
»Ich habe keine Geheimnisse vor Coco oder sonst jemandem.«
»Das ist eine Familienangelegenheit der Changs.«
Hannahs dunkelbraune Brauen zogen sich hoch. Sie kannte Chang gut genug, um zu wissen, dass die Geschäfte der Familie vollkommen getrennt waren von seinen persönlichen Gelüsten.
»Also gut«, gab sie nach. »Coco, würdest du bitte anrufen und dich erkundigen, ob Smithe & Sons die Lieferung von Baumaterial beschleunigen kann? Ganz besonders die Sammelbehälter für den Laich.«
»Sie wollen Geld.«
»Das werden sie bekommen«, versicherte Hannah ihr mit einer Gewissheit, die vollkommen unbegründet war. Die Black Trinity war verschwunden.
Chang wollte widersprechen, doch dann tat er es nicht. Hannah würde schon sehr bald herausfinden, dass es ihre Mittel bei weitem überschritt, die Perlenbucht wieder aufzubauen. Jetzt, wo Len tot war, wer würde ihr da noch Geld leihen? Wenn jemand das versuchte, so würden die Aussies dazwischentreten. Und die Regierung Australiens würde sich nicht mit der Familie Chang anlegen. Wenigstens noch nicht. Jeder tat eifrig so, als sei er ein Partner in der Entwicklung der Vermögenswerte des Pacific Rim.
Automatisch griff Chang nach Hannahs Arm, um sie zum Haus zu führen. Sein Ärger wurde noch größer, als er feststellte, dass sie bereits weitergegangen war – mit diesen lässigen, geschmeidigen Bewegungen, die ihn immer wieder erregten.
Coco sah seinen Gesichtsausdruck, sie lachte und fragte ihn auf Französisch: »Hast du geglaubt, es würde so einfach sein?«
»Ruf Smithe an!« Auch Chang sprach Französisch, selbst wenn seine Stimme so leise war, dass Hannah ihn nicht hören konnte. »Ich werde der Eigentümer der Perlenbucht sein, noch ehe er seine Rechnung schickt.«
»Die Aussies – denen wird das nicht gefallen.«
»Sie können mich mal!«
»Mmm, klingt lustig!« Sie reckte sich noch einmal, drückte den Rücken durch und presste ihre Brüste gegen den dünnen Stoff ihres Bikini-Oberteils. Auf dem Höhepunkt der Dehnung wusste sie, dass sie Changs volle Aufmerksamkeit besaß. Lächelnd fuhr sie mit ihren Fingerspitzen leicht über seinen nackten Oberkörper. »Kannst du mich heute Abend auch mal?«
»Nein. Aber du.«
»Die übliche Zeit?«
»Ich habe eine Konferenzschaltung mit den Staaten. Wir werden erst nach Mitternacht fertig sein.«
»Du wirst fertig sein, zwei Minuten nachdem ich mein Gesicht in deinen Schoß lege.«
»Möchtest du wetten?«
Die Erwartung ließ einen heißen Schauer durch Cocos Körper laufen. Nichts machte sie so sehr an wie eine sexuelle Herausforderung. Männer waren normalerweise viel zu einfach zu haben. Ein Blick auf ihren Hintern genügte, und ihnen wurden die Hände feucht. »Wann fängt dann deine Konferenzschaltung an?«
»Zehn Uhr.«
»Ich werde fünf Minuten später dort sein. Was bekomme ich, wenn ich gewinne?«
»Eine schwarze Perle.«
»Und was bekomme ich, wenn ich nicht gewinne?«
»Du wirst gebumst.«
Cocos neckendes, selbstsicheres Lachen hörte man bis zum Haus.
Als Hannah das Lachen der sexy, heißblütigen Frau hörte, lächelte sie. Sie hatte sich schon oft gewünscht, mehr so zu sein wie Coco, die sich vollkommen wohl fühlte in ihrem Körper, in ihrem Geist und ihrem Sex. Doch so war sie nicht und auch noch nie gewesen. Außerdem bezweifelte sie, je so zu werden. Einige Dinge aus ihrer Missionars-Erziehung gingen bis in die Knochen.
Coco war in einer Kultur aufgewachsen, die zum Teil aus im Ausland lebenden Franzosen bestand, zum Teil aus Polynesiern und die zu hundert Prozent sinnlich war. Hannahs Eltern hätten Coco eine Dirne genannt. Hannah nannte sie nicht so. Coco war ganz einfach eine körperbetonte Frau, die aß, wenn sie hungrig war, die schlief, wenn sie müde war, und die Sex hatte, wenn ihr jemand gefiel, dem sie auch gefiel. Wenn Coco auch eine leidenschaftliche Verführerin war – nun ja, es gab sowieso nicht viele Heilige in West-Australien.
Als Hannah bei Changs Auto ankam, zögerte sie nicht, daran vorbeizugehen. Selbst in dieser gnadenlosen Hitze machte es ihr nichts aus, den halben Kilometer von der Gezeitenlinie bis zum Haus zu Fuß zurückzulegen. Natürlich würde sie keinen Geschwindigkeitsrekord aufstellen. Das wollte sie auch gar nicht. Sie wollte ganz einfach vermeiden, eingeschlossen zu sein von vier Wänden. Seit Lens Tod hatte sie Platzangst.
Eingeschlossen in der Sortierhalle. Wartend. Gefangen.
Die brennende Sonne auf ihrer Haut war ihr beinahe willkommen. Sie war heiß, hell, glühend – all das, was der Tod nicht war.
Chang holte Hannah auf der halben Strecke zum Haus ein, wo der Fahrweg den Pfad kreuzte. Der Staub, den der Mercedes mit dem Vierradantrieb aufgewirbelt hatte, legte sich über Hannah wie ein schlechter Ruf.
»Steig ein, Liebling«, rief Chang durch das offene Fenster der Beifahrerseite. »Auch wenn ich liebend gern deinen wunderschönen Hintern bis zum Haus vor mir beobachten würde, so habe ich doch Termine in Broome.«
Statt den Griff der Beifahrertür zu betätigen, stand Hannah am Rande der Straße und betrachtete ihn mit einem abweisenden Blick aus ihren indigoblauen Augen. »Liebling? Wunderschöner Hintern?« Ihre Stimme klang neutral, sie war so ohne jegliches Gefühl wie der Blick aus ihren Augen. »Du hast mir gesagt, es ginge hier um Familienangelegenheiten.«
»Du kannst dein Nonnengehabe jetzt ablegen, denn du bist keine verheiratete Frau mehr. Vergnügen und Geschäft, das beste aus beiden Welten. Es wird dir gefallen. Dafür werde ich schon sorgen.«
Die Ungeduld und die Verärgerung in seiner Stimme machten Hannah wütend, obwohl sie sich das weder an ihrer Körperhaltung, ihren Augen oder ihrer Stimme anmerken ließ. »Geschäfte, Ian. Das ist alles. Nur Geschäfte.«
Chang sagte etwas Unanständiges auf Chinesisch, dann beugte er sich vor und öffnete die Beifahrertür. »Steig ein, Schwester McGarry.«
»Ich werde die Lederbezüge nass machen.«
»Du hast genug Stoff hinten drauf.«
Nach einem langen, kühlen Blick stieg Hannah ein und schloss die Wagentür.
»Also, das hat doch gar nicht wehgetan, oder?«, fragte er knapp. »Ich werde nicht auf dich losgehen, wenn es das ist, wovor du dich fürchtest.«
»Du bist verheiratet.« Hannahs Stimme blieb ausdruckslos.
»Meine Frau lebt in Kuala Lumpur.«
»Es ist mir gleich, und wenn sie auf dem Jupiter lebt. Ich bin nicht zu haben für einen verheirateten Geliebten. Das ist nicht persönlich, Ian. Aber so bin ich nun einmal. Und das wird sich auch nicht ändern. Ich weiß deine Freundschaft zu schätzen – aber nicht genug, um jedes Mal, wenn wir miteinander reden, die gleiche Unterhaltung führen zu müssen. Also, ändere bitte das Thema!«
»Verflixte Nonne«, murmelte Chang leise vor sich hin.
»Jawohl!«
Keiner von beiden sprach mehr, bis sie im Schatten der Veranda standen. Der Sturm hatte am Haus nur wenig Schaden angerichtet: zerbrochene Fenster, abgerissene Fliegengitter, eine Ecke des Dachs war weggerissen worden, Pflanzen hatte der Wind entwurzelt oder zerfetzt. Es waren kleine Dinge – verglichen mit dem Tod.
»Wer hat die Fenster ausgewechselt?«, fragte Chang.
»Christians Schwager ist Glaser. Und Christian hat all die Fliegengitter repariert. Die Veranda sah schrecklich aus.«
Changs volle Lippen pressten sich zusammen. Ihm gefiel es nicht, dass der sexy, schlaue, junge Aussie in der Perlenbucht herumhing – auch wenn er mit einer Blondine zusammenlebte, von der die meisten Männer nur träumen konnten. »Warum hast du mich nicht angerufen?«, fragte er jetzt. »Ich hätte Arbeiter geschickt.«
»Danke, aber Christian war hier, als der Sturm losbrach.«
»Ich nehme an, er hat auch das Dach repariert.«
»Das hat Tom gemacht. Seit er mit dem Tauchen aufgehört hat, macht er sich als Mann für alle Arten von Arbeiten nützlich.«
Chang versuchte, sich den gebeugten alten Japaner vorzustellen, wie er die Leiter hinaufgeklettert war und das Wellblechdach festgenagelt hatte. Er schüttelte den Kopf. »Nakamori ist für eine solche Arbeit viel zu alt.«
»Mit seinen sechzig Jahren?« Hannah erwähnte nicht, dass Chang dreiundfünfzig war. Und Len war fünfundvierzig gewesen. Zu jung zum Sterben.
»Ein sechzigjähriger ehemaliger Taucher ist ein alter Mann.« Chang warf einen Blick auf seine Uhr. »Ich habe zehn Minuten Zeit. Höchstens fünfzehn.«
»Tee? Bier? Wasser?«
»Nichts.«
Hannah spülte ihre Tauchausrüstung ab, legte sie in einen Korb auf der Veranda und winkte Chang zu den Korbstühlen gegenüber. Sie setzte sich auf ihren Lieblingsplatz, einen Hängestuhl, der an einem Bolzen in der Decke befestigt war. Das luftige Geflecht des Stuhles ließ den leichten Wind um sie wehen, wann immer sie sich mit dem Fuß vom Boden abstieß und den Stuhl in Schwingungen brachte. Die neuen Fliegengitter der Veranda leuchteten in der Sonne und ließen die Welt dahinter verträumt und unwirklich aussehen.
»Also gut, Ian. Was möchte die Familie Chang von mir?«
»Wir sind bereit, die Schulden der Perlenbucht zu übernehmen.«
»Hat das einen besonderen Grund?«
»Den üblichen.«
»Und der wäre?«
»Geschäfte«, erklärte Chang knapp.
»Verstehe. Und was habe ich von diesen Geschäften?«
»Einen Partner, der die Perlenbucht wieder aufbauen kann.«
»Partner!« Hannah stieß sich mit einem Zeh vom Boden ab und schaukelte leicht. Wenn Chang wusste, dass sie bereits einen Partner hatte, ließ er sich das jedenfalls nicht anmerken. Sie fragte sich, ob ihn das wohl mehr oder weniger zu Lens Mörder machte.
»Ich gebe dir fünfzig Prozent der Perlenbucht, und du übernimmst dafür alle Schulden – hattest du dir das so vorgestellt?«, fragte sie.
»Fünfundsiebzig Prozent.«
Der Hängestuhl hielt in der Bewegung inne. »Wir sollen fünfundsiebzig Prozent abtreten?«
»Ein ›Wir‹ gibt es nicht mehr. Len ist tot. Die Perlenbucht, das bist nur du, Schwester McGarry.«
»Ich werde über das Angebot deiner Familie nachdenken.«
»Lass dir dafür nicht zu lange Zeit.«
»Stellst du mir denn ein Ultimatum?«
Abrupt stand Chang auf. »Heilige Jungfrau Maria, du kannst doch nicht wirklich so naiv sein!«
Eine Zeit lang hörte man nur das leise Knarren des Hängestuhls an der Decke, während Hannah hin und her schwang – hin und her.
»Ich denke, ich bin wirklich naiv«, sagte sie nach einer Weile. »Erkläre es mir.«
»Glaubst du wahrhaftig, Len ist durch den Zyklon umgekommen?«
Alle Muskeln in ihrem Körper spannten sich an. Sie wollte aufstehen, schreien, weglaufen. Da es aber dumm wäre, all diese Dinge zu tun, tat sie gar nichts.
»Ich könnte Lens Freunde an einem Finger aufzählen«, erklärte Chang geradeheraus. »Aber ich habe nicht genügend Hände, um all seine Feinde aufzuzählen. Und ich spreche nicht nur von seiner charmanten Persönlichkeit. Ich spreche von Perlen und davon, Intrigen zu spinnen. Er hat es sich mit zu vielen der großen Spieler versaut.«
»Wie?«
»Verschwende nicht meine Zeit! Du bist seine Frau.«
»Jawohl. Seine Frau. Nicht seine Geschäftspartnerin. Ich führe das Haus, zahle die Löhne aus, ich ziehe die Miete ein von den Arbeitern, die hier wohnen; ich bestelle die Ausrüstung für die Farm und habe das letzte Wort, wenn im Herbst die Farben der Perlen zusammengestellt werden. Das ist alles.«
»Und was ist mit den schwarzen Perlen?«
»Was soll damit sein? Die so genannten ›großen Spieler‹, die du erwähnt hast, wissen, wie man die silberlippige Auster dazu bringen kann, schwarz getönte Perlen zu produzieren oder Perlen in Goldton oder einem rosafarbenen Ton oder alles drei in der gleichen Auster. Die Mitglieder des Südsee-Konsortiums haben diese Zuchttechnik entwickelt. Und sie haben sie für sich behalten. Mit der Perlenbucht hat das gar nichts zu tun.«
»Ich rede nicht von den normalen schwarzen Perlen. Ich rede von den Regenbogen-Perlen.«
Hannah erstarrte, wie Eis auf einem Herbstsee floß es durch ihre Adern. Auch wenn eigentlich niemand etwas von diesen außergewöhnlichen Perlen hatte erfahren sollen, war doch offensichtlich etwas durchgesickert. Gerüchte gediehen wie Termiten in der Leere von West-Australien. Doch hatte noch niemand diese besonderen Perlen wirklich gesehen, bis auf Len und sie selbst. Und seinen Mörder. Len war gestorben, weil er das Geheimnis kannte, solch außergewöhnliche schwarze Perlen zu produzieren. Die Menschen nahmen an, dass sie dieses Geheimnis auch kannte. Aber das war ein Irrtum.