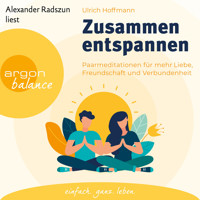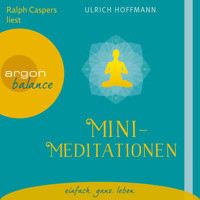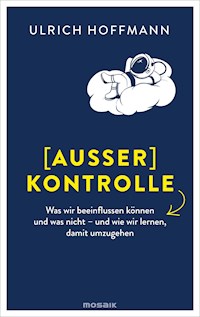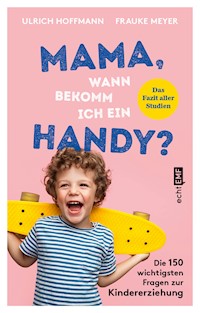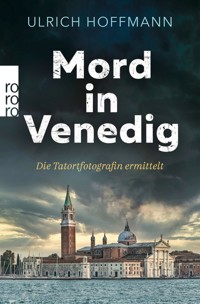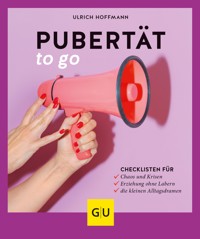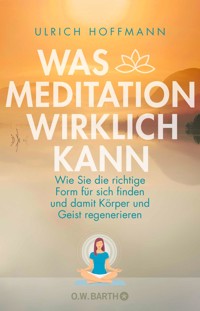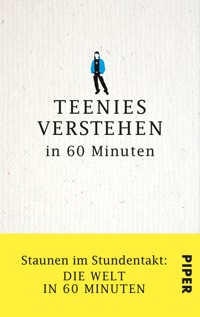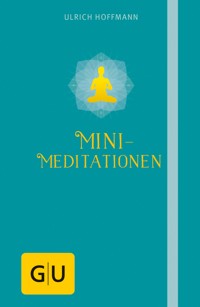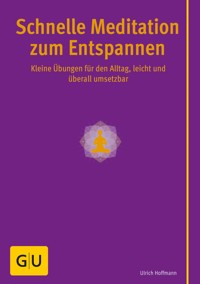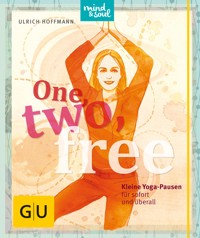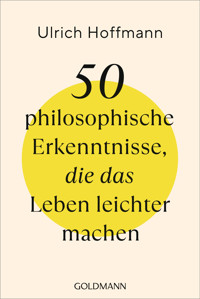
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Leichter leben
Philosoph und Meditationslehrer Ulrich Hoffmann stellt 50 wissenschaftlich belastbare, gut erforschte und kritisch kommentierte Erkenntnisse aus tausenden Jahren Philosophiegeschichte vor – die das Leben tatsächlich ganz konkret leichter oder einfacher machen.
Es handelt sich dabei um philosophische Statements von Denkerinnen und Denkern aus der fernen und jüngeren Vergangenheit sowie um aktuelle, gegenwartsrelevante Aussagen von zeitgenössischen Philosoph*innen. Beispiele: „Der Glückliche lebt in einer anderen Welt als der Unglückliche.“ (Ludwig Wittgenstein), „Ein Sandkorn ist kein Haufen.“ (Eubulides), „Kinder schulden ihren Eltern gar nichts.“ (Barbara Bleisch). Auf wenigen Seiten wird jeweils der Inhalt dargestellt, die Begründung nachvollzogen und die Anwendbarkeit erläutert.
Diese Betrachtungen können dabei helfen, die Welt und unsere Erfahrungen in ihr besser zu verstehen. Die Erkenntnisse ermöglichen es uns, tiefer über unsere Werte, Ziele und Beziehungen nachzudenken und bewusst unser Handeln und Entscheidungen zu wählen. Sie können dabei helfen, uns von Ängsten und Zweifeln zu befreien. Sie leisten einen Beitrag dazu, uns selbst und andere besser zu verstehen. So können wir uns leichter und bewusster auf die Welt um uns herum einlassen und eigenverantwortlich den für uns richtigen Weg finden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 224
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Buch
Philosophie für den Alltag: Diese 50 wissenschaftlich belastbaren, gut erforschten und kritisch kommentierten Erkenntnisse aus tausenden Jahren Philosophiegeschichte machen das Leben tatsächlich ganz konkret leichter oder einfacher. Ulrich Hoffmann präsentiert und erläutert sie in einer unterhaltsamen und geistreichen Verbindung von Tiefe und Anwendbarkeit.
Autor
Ulrich Hoffmann studierte Philosophie und ist zertifizierter Coach sowie Meditations- und Yogalehrer. Er ist Deutschlands erster klimaneutraler Autor (ClimatePartner, TeamClimate). Der mehrfache Bestsellerautor ist verheiratet und hat drei Kinder. Mehr zum Autor unter www.ulrichhoffmann.de
Außerdem von Ulrich Hoffmann im Programm
Pause
Außer Kontrolle
auch als E-Book erhältlich
Ulrich Hoffmann
50 philosophische Erkenntnisse, die das Leben leichter machen
Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall aufgrund der schlechten Quellenlage bedauerlicherweise einmal nicht möglich gewesen sein, werden wir begründete Ansprüche selbstverständlich erfüllen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Originalausgabe Mai 2024
Copyright © 2024: Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Copyright © 2024: Ulrich Hoffmann
Dieses Buch wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München.
Redaktion: Eckard Schuster
Umschlag: Uno Werbeagentur, München
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
CH · IH
ISBN 978-3-641-31661-7V001
www.goldmann-verlag.de
INHALT
VORWORT
1. »Der Zweck des Lebens ist, glücklich zu sein.« (Epikur)
2. »Ändere dein Leben heute. Verlasse dich nicht auf die Zukunft. Handle jetzt, ohne zu zögern.« (Simone de Beauvoir)
3. »Die Welt des Glücklichen ist eine andere als die des Unglücklichen.« (Ludwig Wittgenstein)
4. »Die Herausforderung im Leben besteht nicht so sehr darin, das Spiel möglichst zu gewinnen. Die Herausforderung besteht darin herauszukriegen, welches Spiel wir spielen.« (Kwame Anthony Appiah)
5. »Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit.« (Friedrich Engels)
6. »Habe keine Angst vor dem Leben. Glaube daran, dass das Leben lebenswert ist, und dein Glaube wird helfen, Tatsachen zu schaffen.« (William James)
7. »Nur als soziales Wesen kann ich beginnen, mich selbst zu verstehen.« (Georg Wilhelm Friedrich Hegel)
8. »Vertrauen ist die Bereitschaft, den Mut zu haben, das Risiko einzugehen, dem anderen eine gute Absicht zu unterstellen.« (Niklas Luhmann)
9. »Wir leben in der besten aller möglichen Welten.« (Gottfried Wilhelm Leibniz)
10. »Ein Sandkorn ist kein Haufen.« (Eubulides)
11. »Das Glück deines Lebens hängt ab von der Beschaffenheit deiner Gedanken.« (Marcus Aurelius)
12. »Das Spiel ist Zerreißen der Präsenz.« (Jacques Derrida)
13. »Ich denke, also bin ich.« (René Descartes)
14. »Sollen impliziert Können.« (Immanuel Kant)
15. »Sag dir zuerst, was du sein willst, und dann tu, was du tun musst.« (Epiktet)
16. »Es gibt kein richtiges Leben im falschen.« (Theodor W. Adorno)
17. »Verstehen kann man das Leben nur rückwärts, leben muss man es aber vorwärts.« (Søren Kierkegaard)
18. »Wir sollten auf Gott wetten.« (Blaise Pascal)
19. »Kinder schulden ihren Eltern nichts.« (Barbara Bleisch)
20. »Wer bin ich – und wenn ja, wie oft?« (Plutarch)
21. »Das schauerlichste Übel also, der Tod, geht uns nichts an; denn solange wir existieren, ist der Tod nicht da, und wenn der Tod da ist, existieren wir nicht mehr.« (Epikur)
22. »Alles fließt.« (Heraklit)
23. »Woher weiß ich, dass ich etwas weiß?« (Edmund Gettier)
24. »Wir können nicht wissen, wie es ist, eine Fledermaus zu sein.« (Thomas Nagel)
25. »Die Annahme, menschliches Leben sei heilig, ist einfach mittelalterlich.« (Peter Singer)
26. »Die einfachste Lösung ist immer die richtige.« (Wilhelm von Ockham)
27. »Mehr ist nicht immer besser.« (John Taurek)
28. »Handlungen sind richtig, wenn sie Glück maximieren, und falsch, wenn sie das Gegenteil von Glück produzieren.« (John Stuart Mill)
29. »Urteilen kann als Fortschreiten von einem Gedanken zu seinem Wahrheitswerte gefasst werden.« (Gottlob Frege)
30. »Durch unser Wissen unterscheiden wir uns nur wenig, in unserer grenzenlosen Unwissenheit aber sind wir alle gleich.« (Karl R. Popper)
31. »Soviel jemand zum Nutzen seines Lebens gebrauchen kann, bevor es verdirbt, soviel darf er durch seine Arbeit sich zum Eigentum machen; alles, was darüber hinausgeht, ist mehr als sein Anteil und gehört anderen.« (John Locke)
32. »Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es.« (Simone de Beauvoir)
33. »Liebe ist die einzig vernünftige und befriedigende Antwort auf die Frage nach dem Sinn der menschlichen Existenz.« (Erich Fromm)
34. »Menschliche Natalität bezeichnet nicht nur das leibliche Geborenwerden, sondern auch die Fähigkeit, neue Ideen und Fähigkeiten zu entwickeln.« (Hannah Arendt)
35. »Ich würde nie für das sterben, woran ich glaube; ich könnte ja unrecht haben.« (Bertrand Russell)
36. »Gerechtigkeit ist, Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln.« (Aristoteles)
37. »Gerechte Entscheidungen sollten hinter einem Schleier der Unwissenheit getroffen werden.« (John Rawls)
38. »Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf.« (Thomas Hobbes)
39. »Man kann die Welt nicht verändern, aber man kann seine Einstellung zu ihr verändern.« (Viktor Frankl)
40. »Eine resonante Weltbeziehung sperrt sich gegen Optimierung und ist nicht instrumentell herstellbar.« (Hartmut Rosa)
41. »Der Mensch ist dazu verurteilt, frei zu sein.« (Jean-Paul Sartre)
42. »Wir treffen unsere Entscheidungen mit Blick auf die eigene Endlichkeit.« (Martin Heidegger)
43. »Das Bessere ist der Feind des Guten.« (Voltaire)
44. »Ein Esel steht zwischen zwei gleich großen und gleich weit entfernten Heuhaufen. Er verhungert schließlich, weil er sich nicht entscheiden kann, welchen er zuerst fressen soll.« (Johannes Buridan)
45. »Es gibt keine Tatsachen, nur Interpretationen.« (Friedrich Nietzsche)
46. »Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kommt darauf an, sie zu verändern.« (Karl Marx)
47. »Der zwanglose Zwang des besseren Arguments« (Jürgen Habermas)
48. »Aus dem Sein folgt kein Sollen.« (David Hume)
49. »Wenn du geschwiegen hättest, wärst du ein Philosoph geblieben.« (Boethius)
50. »Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen.« (Albert Camus)
PERSONENREGISTER
VORWORT
Philosophie gilt als einer der nutzlosesten Studiengänge überhaupt. Sie kennen sicher ein paar Betriebswirtschaftler*innen, sicher auch Lehrer*innen, Ingenieur*innen. Und bei vielen anderen Fächern weiß man zumindest, was die Leute machen: Politolog*innen, Verwaltungsfachleute, Chemiker*innen, Städteplaner*innen, Ärzt*innen, Jurist*innen.
Aber Philosoph*innen?
Ich habe das immer anders empfunden. Nachzudenken über die ganz grundlegenden Dinge, sich auf die Suche zu begeben nach »der Wahrheit« (was immer das sein mag) – das fand ich nicht nur spannend, sondern auch nützlich. Philosophen denken oft sozusagen auf Vorrat. Sie beschäftigen sich mit Fragen, die immer wieder virulent werden. Im Gegensatz zu den meisten anderen Berufen tun sie das aber nicht nur im Alarmfall, sondern ständig. Daher stehen wir Philosophen quasi Gewehr bei Fuß, egal was jetzt wieder los ist.
Brauchen große, kapitalistisch agierende Unternehmen das im Arbeitsalltag? Nur selten. Das stimmt.
Und brauchen Regierungen es im Arbeitsalltag? Eigentlich schon, aber durch inhaltliche Kompetenz werden Überlegungen und Verhandlungen nur noch schwieriger.
Wer also braucht Philosoph*innen und Philosophie?
Ich bin überzeugt: Wir alle, jeden Tag!
Philosophie hilft, in der Welt besser navigieren zu können. Sie ist ein Kompass für mehr Eigenverantwortung und Autonomie.
Philosophen sind weder Werbetexter noch Coaches. Sie formulieren daher oft nicht schmissig, sondern eher sperrig. In diesem Buch stelle ich Ihnen eine rein subjektive Auswahl von philosophischen Erkenntnissen vor, die mir als lebenspraktisch hilfreich erscheinen. Es handelt sich um Aussagen klassischer Denker*innen ebenso wie um aktuelle, gegenwartsrelevante Statements von zeitgenössischen Philosoph*innen. Nach einer kurzen fachlichen Einordnung finden Sie in diesem Buch vor allem konkrete Beispiele und Anwendungsmöglichkeiten. Die Betrachtungen können dabei helfen, die Welt und unsere Erfahrungen in ihr besser zu verstehen. Erkenntnisse wie die hier versammelten ermöglichen es uns, tiefer über unsere Werte, Ziele und Beziehungen nachzudenken und bewusst zu wählen, wie wir handeln und entscheiden. Sie helfen, uns von Ängsten und Zweifeln zu befreien, und leisten einen Beitrag dazu, uns selbst und andere besser zu verstehen. So können wir uns leichter und bewusster auf die Welt um uns herum einlassen und uns in Beziehungen zu anderen Menschen einbinden.
Ich hoffe, 50 philosophische Erkenntnisse, die das Leben leichter machen ist für Sie unterhaltsam, anregend und nützlich.
Viel Vergnügen!
Ulrich Hoffmann
1.»Der Zweck des Lebens ist, glücklich zu sein.« (Epikur)
Seit einigen Jahren suchen alle nach »Sinn«, oder, auf Englisch, noch schicker: »Purpose«. Purpose ist eher eine »Aufgabe« als ein »Sinn«, aber die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen.
Aber muss das Leben einen »Sinn« haben? Warum suchen wir danach?
Die These vieler Philosophen: In der Hoffnung auf Glück!
Der griechische Philosoph Epikur (341 – 270 v. Chr.) hielt Glück ebenso für den Lebenszweck wie der Franzose Voltaire (1694 – 1778), dem das Zitat ebenfalls gern in den Mund gelegt wird.
Überliefert von Diogenes Laertius (3. Jh. v. Chr.) ist ein Brief Epikurs, in dem es heißt: »Darum nennen wir auch die Lust Anfang und Ende des seligen Lebens. Wenn wir also sagen, dass die Lust das Lebensziel sei, so meinen wir nicht die Lüste der Wüstlinge und das bloße Genießen, wie einige aus Unkenntnis und weil sie mit uns nicht übereinstimmen oder weil sie uns missverstehen, meinen, sondern wir verstehen darunter, weder Schmerz im Körper noch Beunruhigung in der Seele zu empfinden.«
Und was wäre das, wenn nicht: Glück? Mal ganz abgesehen von der auffälligen Nähe zur WHO-Definition von Gesundheit: ein Zustand des vollkommenen physischen, geistigen und sozialen Wohlbefindens. Somit kein messbares, sondern ein normatives Gut.
Laut Platon (428 – 348 v. Chr.) sind Menschen glücklich, wenn ihre Vernunft, ihr Wille und ihr Begehren miteinander im Einklang sind.
Aristoteles (384 – 322 v. Chr.) glaubte, Glück sei nur möglich als Teil einer menschlichen Gemeinschaft, und wenn wir aktiv tun, wozu wir begabt sind.
Immanuel Kant (1724 – 1804) sagte: »Das Glück des Menschen ist, seine Pflicht zu tun.«
Arthur Schopenhauer (1788 – 1860) mahnte: »Das Geheimnis des Glücks ist, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind, und nicht so, wie man sie gerne hätte.«
In der Psychologie wird heute eher zur ruhigen, länger anhaltenden Zufriedenheit tendiert als zum aufschäumenden Glück. Klar ist dennoch: Menschen wollen lieber zufrieden sein als unzufrieden, lieber glücklich als unglücklich, lieber froh als traurig. Und das ist ja auch vernünftig.
Daraus ergibt sich allerdings nahtlos die Frage: Was ist Glück? Wann bin ich glücklich?
Als ich noch zur Schule ging, fuhren meine Eltern in den Urlaub und ließen mir Geld für Lebensmittel da. Gewitzt kaufte ich statt Salat und Vollkornbrot ausschließlich mein damaliges Lieblingseis: Zitrone. Zwei Liter Zitroneneis pro Tag deckten meinen pubertären Kalorienbedarf – und ich hatte sogar noch Geld übrig! Ich fand mich wahnsinnig clever und das Eis wahnsinnig lecker. Bis … ich es nicht mehr sehen konnte. »Zu viel des Guten ist auch zum Kotzen«, heißt es manchmal. Bei mir ging es nicht ganz so weit, aber nach einer Woche Zitroneneis reichte es mir. (Leider hatte ich noch ein paar Liter in der Tiefkühltruhe.)
Jahrelang konnte ich Zitroneneis nicht ertragen. Inzwischen geht es, aber toll finde ich es nicht. War es nun »Glück«, mich mit meinem Lieblingseis vollzustopfen? Kann Konsum überhaupt glücklich machen?
Hedonismus, die maximierte Sinneslust, klingt erst mal toll. Singen, tanzen, fressen, saufen. Allerdings unterliegt der Hedonismus einer Steigerungslogik. Was wir letzten Monat noch super fanden, reicht uns jetzt nicht mehr. Das führt auf die Dauer zum Exzess.
Also brauchen wir fürs Glück vielleicht eher ein Auf und Ab. Und vielleicht auch einfach Abwechslung.
Meiner Erfahrung nach gibt es keinen einzelnen, einzigen Faktor, der glücklich macht. Nicht einmal lieben und geliebt werden ist es. Und schon gar nicht ein tolles Auto, ein langer Urlaub, ein Besuch im Dreisternerestaurant. Alles schön, aber: der Mix macht’s.
So ist es auch mit dem (Lebens-)Sinn. Es ist gut, eine Arbeit oder Aufgabe zu haben, die wir für sinnvoll halten. Alles andere führt auf die Dauer in Burn-out oder Depression. Außerdem benötigen wir ein uns angenehmes direktes Umfeld. Die unmittelbaren Kolleginnen und Kollegen, die Vorgesetzten, Familie und Freund*innen – die Menschen, mit denen wir Tag für Tag zu tun haben, haben großen Einfluss auf die Zufriedenheit.
Evolutionsbiologisch mag unser Leben nur den »Zweck« haben, die Art zu erhalten. Oder anders gesagt: Aus Sicht des Systems Erde hat ein einzelnes Leben vermutlich gar keinen Zweck.
Subjektiv möchten wir das trotzdem.
Glücklich zu sein ist nichts Schlechtes, und glücklich sein zu wollen ist kein narzisstisches Anspruchsdenken. Wir alle wollen glücklich sein.
»Ein Leben ohne Untersuchung ist nicht wert, gelebt zu werden«, befand Sokrates (469 – 399 v. Chr.). Oft wird der Satz so verstanden, als wären nur intellektuell reflektierte Existenzen etwas wert. Und ein Schafhirte oder Bauarbeiter, der einfach seine Arbeit tut, eben nichts.
Ich sehe das anders. Das eigene Leben zu untersuchen, muss kein abstrakter Höhenflug sein. Wir können uns beobachten und kennenlernen, um herauszufinden, was uns glücklich macht. Haben wir das herausbekommen, können wir tun, was nötig ist, um glücklich(er) zu sein. Und dann ist unser Leben es sicher wert, gelebt zu werden.
So verstanden ist der »Zweck« des Lebens nicht das, was wir tun, der »Sinn«, nach dem so viele von uns suchen. Sondern dieser Sinn, unser Tun, ist die Krücke auf dem Weg zum Glück. Den zu gehen ist unsere Aufgabe, unser »Purpose«.
WAS DIESE ERKENNTNIS IHNEN SCHENKT:
Ein Ziel. Selbstreflexion. Entschlossenheit.
2.»Ändere dein Leben heute. Verlasse dich nicht auf die Zukunft. Handle jetzt, ohne zu zögern.« (Simone de Beauvoir)
»Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute«, murmelte meine Mutter oft, wenn ich als Jugendlicher prokrastinierte. Und das ist nun einmal die Superpower der Adoleszenz.
Eine Redewendung, deren Stoßrichtung der Erkenntnis de Beauvoirs sehr nahe kommt. Nicht selten hörte ich auch: »Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.«
Hat de Beauvoir also nur im Interview mit Alice Schwarzer 1984 den Volksmund in elegantere Worte überhöht?
Nein. Ihr ging es ja nicht um das fristgerechte Abarbeiten einer To-do-Liste oder die Vermeidung kritischer Blicke anderer. Sie redete der Selbstwirksamkeit das Wort: »Verlasse dich nicht auf die Zukunft« ist die Aufforderung, das Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. »Ändere dein Leben heute« beinhaltet die Grundannahme, dass niemand von uns perfekt ist, aber wir alle mit entsprechendem Einsatz näher an unsere Ideale herankommen können. »Handle jetzt, ohne zu zögern«: Drück dich nicht, zerdenke es nicht, komm ins Tun.
Ja, »carpe diem« (lateinisch: »Nutze den Tag«) schlägt in dieselbe Kerbe, aber weit undifferenzierter.
Das Tolle an de Beauvoirs Aufforderung ist der Dreiklang aus Hoffnung, Entschlossenheit und Machbarkeit. Ihr Motto ist offensichtlich: »Besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.« Oder auch: »Jeder Weg beginnt mit einem ersten Schritt.«
Sie preist ein und hält für völlig normal, dass wir alle etwas ändern können sollten. Und vielleicht sogar wollen. Gesünder leben. Freundlicher sein. Umwelt schützen, Sparplan anlegen, konstruktiver streiten. Wer findet sich in der Liste nicht wieder?
In den letzten Jahrzehnten haben wir schmerzhaft gelernt: Das Narrativ vom »immer besser« war Wunschdenken. Weder »der Markt« noch »die Demokratie« haben für Frieden und Freiheit gesorgt, den Hunger in den Entwicklungsländern vertrieben oder die Klimakrise verhindert. Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auf, und so sicher, wie lange versprochen, ist die Rente auch nicht. Verlassen wir uns also nicht allein auf die Zukunft.
Wir müssen selbst aktiv werden. Nicht immer nur reden, grübeln und klagen, sondern reinhauen. Tun, was zu tun ist. Ja, das ist anstrengend und bedeutet Umdenken, Umlernen, Verzicht, Toleranz, Weitsicht. Aber wären wir nicht gern so, wie wir sein könnten? Wären wir nicht gern schon am Ziel? Nur der Weg dahin scheint lang und mühsam.
Die französische Philosophin, Lebensgefährtin von Jean-Paul Sartre, gibt uns einen Schubs. Leg los. Du kannst das, du schaffst das.
»Man wird nicht als Frau geboren, man wird es«, schreibt de Beauvoir zu Beginn des zweiten Buches ihrer Abhandlung über Das andere Geschlecht. Sie fasste unser (soziales) Geschlecht als eine Konstruktion auf, geboren aus Interaktion. Frausein wird Frauen einerseits aufoktroyiert. Andererseits bedeutet das natürlich: Gestaltungsmöglichkeiten! Was nicht fix ist, kann verändert werden.
Das »Ändere dein Leben«-Zitat wendet einen ähnlichen Gedanken auf ein weiteres Feld an: Was nicht fix ist, lässt sich ändern. Damit zu warten wäre doch schade.
Mir gibt diese Überlegung Schwung, wenn ich zu träge (ja, meine Mutter hatte nicht unrecht) oder unmotiviert zum Handeln bin. Ich tue was auch immer dann nicht anderen zuliebe, sondern aus gutem Grund. Ich kann dem entgegenstreben, der ich sein könnte, und je eher ich damit anfange, desto leichter gelingt das und desto schneller nähere ich mich dem Ziel.
WAS DIESE ERKENNTNIS IHNEN SCHENKT:
Motivation. Energie. Entschlossenheit. Optimismus.
3.»Die Welt des Glücklichen ist eine andere als die des Unglücklichen.« (Ludwig Wittgenstein)
Ein Bekannter von mir war längere Zeit arbeitslos. Schuld daran hatten die anderen: die Wirtschaftslage, die Personaler, seine Frau. Alle konnten was dafür, nur er nicht.
Nun war es gar nicht so, dass er selbst in irgendeiner Weise »schuld« an seiner Situation gewesen wäre. Es lief halt erst gut, dann nicht so gut, mittlerweile läuft es wieder gut.
Die Phase, in der es nicht so gut lief, hat er allerdings selbst noch verschlimmert mit einer negativen Sichtweise.
Nun machen es sich Philosophen ja immer gern leicht, indem sie auf Probleme hinweisen, ohne Lösungsvorschläge zu machen. Der österreichische Philosoph Ludwig Wittgenstein hat sich allerdings im Leben fast nie irgendetwas leicht gemacht. Insofern darf man seiner Erkenntnis vielleicht eher einen sehnsüchtigen als einen abschätzigen Tonfall unterstellen.
Für mich liegt der wichtigste Punkt seiner Aussage im berühmten Tractatus logico-philosophicus nicht so sehr in der Beobachtung: Glücklichsein ist besser als Unglücklichsein. Sondern dass der Unterschied so groß ist – eine ganze Welt!
Ich lese diese Aussage in doppelter Hinsicht. Einerseits als Metapher: Wer glücklich ist, lebt zwar nicht wirklich auf einer anderen Erde als unglückliche Menschen, aber es fühlt sich so an. Heißt: Es lohnt sich zu versuchen, glücklich(er) zu werden, denn die Vorteile sind gewaltig. Und tatsächlich haben wir auf unser Glück ja sehr wohl Einfluss, wir können wichtige Wünsche zu realisieren versuchen, wir können uns freuen über das, was wir haben, wir können die Ansprüche senken.
Andererseits lässt sich Wittgenstein hier auch wörtlich verstehen. Wenn die Welt das ist, was wir als Welt wahrnehmen, dann unterscheidet sich die von einem Unglücklichen wahrgenommene Welt maßgeblich und deutlich von der eines Glücklichen. Es sind dann wirklich ganz andere Welten!
Das hilft mir an vielen verschiedenen Stellen. Erstens ist auch diese Annahme eine Motivation, das eigene Glück zu befördern. Zweitens relativiert die Vorstellung meinen Frust über die Welt, wenn gerade alles schiefgeht. Weil ich weiß: Es kommen auch wieder Tage, an denen ich die Welt anders sehe. Drittens macht diese Sichtweise mich toleranter anderen gegenüber, die gerade unglücklich sind.
Der Bekannte beispielsweise beschrieb in seinen andauernden Beschwerden nicht die Welt, die ich sah. Aber möglicherweise die, die er sah. Welch Unsinn wäre es da, ihm erklären zu wollen, dass das alles so nicht sei. Die wirtschaftliche Lage, die Frau, die Personalabteilung … niemand hatte etwas gegen ihn. So sah es jedenfalls für mich aus. Ich war ja auch glücklich. Für ihn aber erschien es so, und vielleicht habe ich uns beiden einen Gefallen getan, indem ich diese Beschreibung nicht zurückwies, sondern sie als eine subjektive Beschreibung eher des Eindrucks von der Welt ansah. Was hätte er davon gehabt, wenn ich gesagt hätte: Stimmt doch gar nicht! Damit will ich keine Multiversen aufmachen, in denen alles jederzeit irgendwie oder auch ganz anders sein kann. Das ist der Stoff, aus dem Spider-Man-Filme sind, das reicht. Wir befinden uns sicher in derselben Welt. Und doch kann diese ganz unterschiedliche Farben und Tonlagen annehmen, und sie alle sind, wenn nicht wahr, dann doch für den Moment wahr. Vor allem sind sie relevant als Narrativ: So sieht meine Welt gerade aus.
Wittgenstein war gewiss kein Vertreter eines gnadenlosen Positivismus. Auch er konnte nicht einfach sein Leben auf »glücklich« schalten. Die Erkenntnis, dass es einen gravierenden Unterschied darstellt, an welchem Ende des Kontinuums wir uns befinden, gewinnt sogar eher an Relevanz, weil es nicht ganz einfach ist, sich selbst gezielt zu positionieren.
Er war jedoch ein Freund klarer Aussagen: »Was sich überhaupt sagen lässt, lässt sich klar sagen«, schrieb Wittgenstein, »und wovon man nicht reden kann, darüber muss man schweigen.« Und: »Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt.« Anders gesagt: Was ich nicht in Worte fassen kann, kann ich auch nicht denken und also weder reflektieren noch bewusst wahrnehmen.
Wir alle müssen mit dem arbeiten, was wir haben, und dort beginnen, wo wir gerade stehen. Für manche Menschen ist es mehr Arbeit als für andere, die Nadel in Richtung »Glück« zu bewegen, und sie schwingt schneller wieder zurück. Ihnen macht Wittgenstein deutlich, dass diese Anstrengung nicht umsonst ist. Und diejenigen, denen es leichtfällt, können sich vielleicht einfach über ihr Glück freuen, statt auf das Unglück anderer verständnislos herabzusehen.
WAS DIESE ERKENNTNIS IHNEN SCHENKT:
Motivation. Mitgefühl. Selbstmitgefühl.
4.»Die Herausforderung im Leben besteht nicht so sehr darin, das Spiel möglichst zu gewinnen. Die Herausforderung besteht darin herauszukriegen, welches Spiel wir spielen.« (Kwame Anthony Appiah)
Schon die Frauenbewegung, spätestens aber die Umweltschutz- und die Anti-Rassismus-Bemühungen der letzten Jahre haben gezeigt: In vielen Industrieländern läuft etwas grundlegend schief. Die meisten von uns können sich bestimmt darauf einigen, dass Frauen gleichberechtigt sein, dass die Menschenrechte für alle gelten, dass wir die Klimakatastrophe abwenden sollten. Warum gelingt das nicht?
Eine mögliche These: Weil viele derjenigen, die in den Industriestaaten die Regeln vorgeben oder vorleben, von Unterdrückung und der Nutzung fossiler Brennstoffe profitieren. Mit anderen Worten: Es ist einfach unbequem, das zu tun, was wir tun müssten, wenn wir es ernst meinen.
Aus einer anderen Perspektive betrachtet könnte man auch sagen, dass die kapitalistische Gewinnorientierung und Steigerungslogik mittlerweile auch in Bereichen angewandt wird, wo sie nicht hingehört und für die sie auch gar nicht geeignet ist (zum Beispiel in Schulen, im Haushalt, in Krankenhäusern, bei Renten, beim Umweltschutz).
In den Achtziger- und Neunzigerjahren setzte sich die neoliberale Annahme durch, eigentlich alles ließe sich durch einen markttechnischen Interessenausgleich optimieren. Motto: Wenn alle für sich selbst sorgen, ist für alle gesorgt. Und tatsächlich waren damals beispielsweise Krankenhäuser oder auch der Telekommunikationssektor ausgesprochen uneffektiv organisiert. Es gab also wirklich sinnvolle Sparpotenziale. Und auch eine Freundschaft oder Beziehung muss sich letztlich daran messen lassen, ob sie mir auf irgendeine Weise guttut. Sonst würde man sie heute als »toxisch« bezeichnen und sie beenden.
Allerdings kann durchaus der Eindruck aufkommen, dass wir ein ganz klein wenig über das Ziel hinausgeschossen sind.
Oder vielleicht auch ziemlich weit.
Die Erkenntnis des britisch-amerikanischen Philosophen Kwame Anthony Appiah in seinem Buch Experiments in Ethics aus dem Jahr 2008 macht darauf aufmerksam, dass dieses Streben nach Exzellenz, nach einem Spitzenplatz, uns vielleicht davon ablenkt, was wirklich wichtig ist im Leben.
Es könnte sein, dass wir ein »Spiel« spielen – oder man könnte auch sagen: an einem Rennen teilnehmen –, das wir gar nicht selbst freiwillig gewählt haben.
Die neueste Generation auf dem Arbeitsmarkt, klagen die Unternehmen, stelle allerhand unerhörte Forderungen: anständige Bezahlung, Anerkennung, weniger Arbeitsstunden, neue Erfolgsmetriken, mehr Lob, Vereinbarkeit von Familie beziehungsweise Privatleben und Beruf. Kann es sein, dass sie uns schon vorleben, was Appiah meint? Werden wir wirklich am Ende zufrieden sein, wenn wir einen dicken Firmenwagen haben und das passende Gehalt, aber dafür auch wahnsinnig viel arbeiten müssen?
Es gibt zahlreiche Vorschläge, wie eine andere Gesellschaft aussehen könnte. Solidarischer, lokaler, unabhängiger vom Willen der Aktionäre. Wir können uns für diese Welt auf die unterschiedlichste Weise engagieren, und dies bereits in vielen kleinen Entscheidungen. Vor allem aber haben wir immer, überall und jederzeit die Möglichkeit zu sagen: Ich will gar nicht euer Spiel spielen, sondern meins!
Marx bezeichnete Religion als Opium des Volkes, Adorno und Horkheimer klagten, dass die Kulturindustrie die Menschen davon ablenke, eine bessere Welt zu fordern. Heute übernehmen soziale Medien und Gehaltserhöhungen diese Aufgabe. Es gibt immer Menschen, die vom Status quo profitieren. Wir müssen nicht darauf warten, das zu tun, was wir eigentlich gern täten. Wir können sofort damit anfangen.
Appiah wurde bekannt durch die These, dass die Universalität des Kosmopolitismus Vorrang habe vor der Differenz der Kulturen. Anders gesagt: Was uns verbindet, ist wichtiger als das, was uns trennt. Ich vermute, vielen von uns geht es wie den Menschen, die die Krankenschwester Bronnie Ware für ihr Buch über 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen befragte. Ihr Ergebnis:
»Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben.«»Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet.«»Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken.«»Ich wünschte mir, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden aufrechterhalten.«»Ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein.«Ist wenigstens irgendeines dieser Ziele in einem der »Spiele« enthalten, die Sie spielen?
WAS DIESE ERKENNTNIS IHNEN SCHENKT:
Freiheit. Empörung. Fokus.
5.»Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit.« (Friedrich Engels)
Freiheit ist einer dieser Begriffe, an denen sich die Philosophen in ihren Betrachtungen ebenso abarbeiten wie wir im Alltag. Wenn ich zum Beispiel notwendigerweise essen und dafür irgendwoher Geld nehmen muss, dann muss ich deshalb arbeiten. Wenn ich einsehe, dass das so ist – ist das dann wirklich Freiheit?
Wenn ich einen Text zusage, der aber nicht gelingen will, weshalb ich mich quäle und nicht hinschmeiße, sondern mich durchbeiße – ist das Freiheit?
Wäre es nicht viel freiheitlicher, einfach aufzuhören und blauzumachen?
Und wie viele Eltern bleiben zusammen »wegen der Kinder« oder wegen der Hausfinanzierung. Ist die Anerkennung dieser gefühlten »Notwendigkeit« wirklich Freiheit?
Vielleicht erst mal ein Wort zur Herkunft des Zitats. Friedrich Engels, ein Freund von Karl Marx, schrieb es in Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft (oft kurz »Anti-Dühring« genannt) dem Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel zu. Doch der hat das gar nicht gesagt. Hegel unterschied zwischen einer »äußeren Notwendigkeit« und einer »inneren Notwendigkeit«, kam dann zu einer »absoluten Notwendigkeit«, die »schlechthin für sich« sei und »nicht von anderem« abhänge. Und weil diese absolute Notwendigkeit einfach so da ist, stelle sie einen Prozess des »Sichselbstfindens« dar, und der wiederum »die Freiheit«.
Aha, hm, hm, so so. Hegel, sagt man nicht zu Unrecht, sei nicht ganz einfach zu lesen.
Mag sein, dass wir eine »absolute Notwendigkeit« in uns tragen, der zu folgen dann irgendwie gleichermaßen zwingend und frei – vielleicht auch im Sinne einer Befreiung – ist. Okay.
Von Einsicht kein Wort, aber die kann man bei philosophischen Texten ja durchaus implizieren.
Engels nun schreibt, Hegel sei der Erste gewesen, der das Verhältnis zwischen Freiheit und Notwendigkeit »richtig darstellte«: nämlich dass Freiheit die Einsicht in die Notwendigkeit sei.
Das hat Hegel aber, siehe oben, nicht gesagt.
Trotzdem macht Engels sich den Inhalt ja erkennbar zu eigen. Da Hegel also zu dieser Angelegenheit schweigt, kann die Erkenntnis Engels zugewiesen werden. Er fährt fort damit, dass Freiheit nicht in einer geträumten Unabhängigkeit von Naturgesetzen bestehe, sondern in ihrer Anerkennung. Daraus ergebe sich dann die Möglichkeit, sie gezielt zu den eigenen Zwecken einzusetzen.