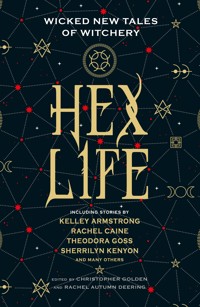7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Thorne Manor ist ein Ort, der schon immer heimgesucht wurde – und einer, der Bronwyn Dale nie wirklich losgelassen hat. Als junges Mädchen konnte sie in dem Haus ihrer Großtante durch eine Zeitschleife reisen. So hat sie William Thorne kennengelernt, einen Jungen in ihrem Alter, der jedoch zwei Jahrhunderte zuvor geboren worden war. Nach einer Familientragödie ist Bronwyn dem Haus ferngeblieben – und war überzeugt, dass William nur in ihrer Fantasie existiert. Jetzt, zwanzig Jahre später, hat Bronwyn Thorne Manor geerbt. Und als sie zurückkehrt, wartet William auf sie. Aber William Thorne ist nicht mehr der Junge aus ihrer Erinnerung. Er ist ein schwieriger und ungestümer Mann geworden, dessen Leben von Tragödien und einem Skandal geprägt ist. Das hat ihn dazu veranlasst, sich auf sein Landhaus und in seine geliebte Moorlandschaft zurückzuziehen. Außerdem ist er Bronwyn gegenüber nicht unbedingt wohlgesonnen, da sie ihn vor all den Jahren verlassen hat. Während ihre Freundschaft wiederauflebt und sich in etwas Tieferes verwandelt, muss Bronwyn sich auch mit den Geistern auseinandersetzen, die im einundzwanzigsten Jahrhundert im Haus spuken. Bald wird ihr klar, dass sie mit William und dem mysteriösen Skandal zu tun haben, der ihn allein auf Thorne Manor leben lässt. Um eine gemeinsame Zukunft mit ihm aufbauen zu können, muss sich Bronwyn der Vergangenheit stellen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
AUSSERDEM VON KELLEY ARMSTRONG
A Stitch in Time(Thorne Manor)
A Stitch in Time
A Twist of Fate
A Turn of the Tide
A Castle in the Air
A Rip Through Time
A Rip Through Time
The Poisoner’s Ring
Disturbing the Dead
Death at a Highland Wedding
Hemlock Island
I’ll Be Waiting
The Haunting of Paynes Hollow
Finding Mr. Write
Writing Mr. Wrong
Rockton
Haven’s Rock
Cursed Luck
Cainsville
Otherworld
Nadia Stafford
The Life She Had
Wherever She Goes / Every Step She Takes
Aftermath / Missing / The Masked Truth
Otherworld: Kate & Logan
Darkest Powers
Darkness Rising
Age of Legends
A Royal Guide to Monster Slaying
The Blackwell Pages (with Melissa Marr)
A STITCH IN TIME
DIE GEISTER VON THORNE MANOR
KELLEY ARMSTRONG
Übersetzt vonSONJA HERBERTH
K.L.A. FRICKE INC
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung der Autorin und/oder des Verlages unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
A Stitch in Time: Die Geister von Thorne Manor © 2025 K.L.A. Fricke Inc.
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel »A Stitch in Time«
Autor: Kelley Armstrong
Übersetzung: Sonja Herberth für Literary Queens
Umschlaggestaltung: Cover Couture
Verlag & Druck: K.L.A. Fricke Inc
48862 Dexter Line, Sparta, ON, Canada
ISBN: 978-1-989046-98-2
INHALT
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Über die Autorin
KAPITEL1
Vor sechs Monaten habe ich ein Spukhaus geerbt. Außerdem die Geister, die darin leben. Zumindest hat Tante Judith mir das in ihrem letzten Brief mitgeteilt, der nach ihrer Teerosen-Handcreme gerochen hat – was erneut einen Weinkrampf bei mir ausgelöst hat. Aber ich verstehe, was sie meint. Nicht, dass es in dem Haus spukt, sondern dass es mich heimsucht. Ich könnte Räucherbündel schwenken und mir einreden, dass ich die Geister zur Ruhe gebracht habe. Aber was dort vor dreiundzwanzig Jahren geschehen ist, sucht mich tatsächlich immer noch heim.
Es ist an der Zeit, dass ich mich dem stelle, und deshalb fahre ich nach Yorkshire, wo ich den Sommer im Landhaus meiner Großtante verbringen werde, während ich entscheide, was ich damit machen will. Was ich aber wirklich will, sind Antworten.
* * *
Während mein Taxi durch Yorkshire rollt, drücke ich die Nase an die Scheibe, als wäre ich wieder ein Kind und mit meiner Familie auf dem Weg nach Thorne Manor. Außerhalb von Leeds habe ich Veränderungen gesehen – Häuser, wo ich mich an Felder erinnere, Einkaufszentren, wo früher Wälder waren –, aber als wir ins Moor einfahren, scheinen wir in die Zeit meiner Kindheit zurückzugleiten. Jede Kirche, jeder Schafstall und jede verfallende Scheune ist genau so, wie ich sie in Erinnerung habe.
Als ich das letzte Mal hierhergekommen bin, war ich fünfzehn, ein Mädchen, das gerade sein Leben begonnen hat. Jetzt kehre ich mit achtunddreißig zurück, als Geschichtsprofessorin an der Universität von Toronto. Außerdem bin ich Witwe. Mein Mann Michael ist seit acht Jahren tot.
Wir fahren durch High Thornesbury, ein malerisch in ein Tal eingebettetes Dorf. Als wir die einspurige Straße hinaufruckeln, muss der Taxifahrer anhalten, um Schafe vorbeizulassen. Dann beginnt er mit dem mühsamen Anstieg auf den steilen Hügel. Oben steht Thorne Manor und mein Herz schlägt schneller, nachdem ich das Fenster heruntergelassen habe, um es besser sehen zu können.
Das Haus scheint verlassen zu sein. Das ist es auch – auf seine Art. Tante Judith hat es selten besucht, nachdem Onkel Stan hier vor all den Jahren gestorben ist. Doch vom Fuß des Hügels aus hat Thorne Manor immer verlassen ausgesehen: ein ahnungsvoller Steinblock von einem Haus, isoliert und trostlos, umgeben von der endlosen Weite des Moors.
Als das Taxi den Hügel hinauffährt, wird das Haus als Ganzes sichtbar. Die dunklen Fenster starren einen wie leere Augen an. Kein Licht scheint daraus oder erhellt die lange Gasse, nicht einmal aus den alten Steinställen dringt ein Schimmer.
Ich verdränge einen Anflug von Enttäuschung. Die Haushälterin weiß, dass ich komme – und ja, ich habe gehofft, das Haus in einem einladenden Licht erstrahlen zu sehen. Aber das hier ist passender: Thorne Manor als ein wunderschöner Schatten, der von einem atemberaubenden, dunkelvioletten Sonnenuntergang beleuchtet wird.
Der Taxifahrer fährt auf die Auffahrt und begutachtet den Rasen, auf dem Klee und Ehrenpreis wuchern.
»Sind Sie sicher, dass wir hier richtig sind?«, fragt er in seinem Yorkshire-Dialekt.
»Ja, bin ich.«
Die Furche zwischen seinen buschigen Brauen wird tiefer. Er hält sich mit einer knorrigen Hand an der Rückenlehne fest, während er sich zu mir umdreht und mich ansieht. »Sie haben das doch nicht etwa über eines dieser Online-Dinger gemietet, oder? Ich fürchte, man hat Ihnen einen üblen Streich gespielt.«
»Ich habe das Haus vor Kurzem von meiner Großtante geerbt und es gibt eine Haushälterin, die weiß, dass ich komme.«
Ich gebe ihm den Fahrpreis und ein höheres Trinkgeld, als ich mir leisten kann.
Er blickt finster drein, als ob ich ihm Blutgeld für seine Beteiligung an einer abscheulichen Tat gegen unschuldige Touristinnen anbieten würde.
»Die Haushälterin sollte hier sein, um Sie gebührend zu begrüßen.«
»Ich habe ihr schon eine Nachricht geschickt«, entgegne ich. »Sie wird bald kommen.«
»Dann werde ich warten.«
Er stellt den Motor ab, nimmt mir exakt den Fahrpreis aus der Hand und sieht mich mit einem warnenden Blick an. Als ich sage, dass ich aussteigen werde, um mir die Beine zu vertreten, murmelt er: »Gehen Sie nicht zu weit. Hier draußen gibt es nichts außer Schafen und Serienmördern.« Und dann schaut er sich um, als ob sich hinter jedem Felsvorsprung einer von beiden verstecken könnte.
Ich schließe die Autotür und atme den Duft der wilden Glockenblumen ein. Als ich zum Haus gehe, höre ich ein Geräusch. Ein rhythmisches Quietschen, das mir bei jeder Wiederholung einen Schauer über den Rücken jagt.
Jemand fährt auf einem alten Fahrrad, dessen Kette jämmerlich quietscht, den Hügel hinauf. Darauf sitzt eine schwarz gekleidete Gestalt. Ihr langer Mantel flattert im Wind, die Kapuze ist hochgezogen, das Gesicht dunkel – bis auf einen leuchtend roten Kreis, wo der Mund sein sollte.
Quietsch, quietsch.
Quietsch, quietsch.
Die Gestalt biegt in die Auffahrt ein. Der Taxifahrer steigt aus und knallt die Tür so fest zu, dass ich zusammenzucke.
»Ich dachte, Sie sagten, es gäbe eine Haushälterin«, sagt er.
Jetzt erkenne ich, dass der Fahrradfahrer ein Mann ist und eine brennende Pfeife zwischen die Zähne geklemmt hat. Er trägt einen langen Mantel, der über den Rücken des Fahrrads drapiert ist, wobei der Saum bedenklich nahe an das Hinterrad heranreicht. Unter seiner Kapuze sieht man ein rundes, glatt rasiertes Gesicht mit Falten und borstenkurzem, grauem Haar.
»Miss Dale?« Die Stimme des Fahrradfahrers … ist nicht die eines Mannes. Ich schaue noch einmal hin, und bei diesem zweiten Blick bin ich mir des Geschlechts weit weniger sicher.
»Miss Crossley?«, sage ich und nuschle die Anrede, da ich nicht weiß, ob ich die richtige gewählt habe.
»Ja.« Sie mustert mich mit einem scharfen Blick. »Sie haben jemand anderen erwartet?«
»Nein. Ich wollte nur sichergehen. Wir sind uns noch nie begegnet.«
Als ich das sage, beleuchtet das Mondlicht ihr Gesicht – und ich zögere.
»Kennenwir uns?«, frage ich. »Sie kommen mir bekannt vor.«
»Ich kümmere mich jetzt seit zwanzig Jahren um das Haus. Aber Sie habe ich noch nie gesehen.«
Es liegt ein Vorwurf in diesen Worten. Ich erwidere gleichmütig: »Ja, ich bin als Kind oft hergekommen, aber nach dem Tod meines Onkels habe ich Tante Judith nur noch in London besucht.«
Ich wende mich an den Fahrer. »Vielen Dank, dass Sie bei mir geblieben sind. Das war nicht nötig, aber ich habe Ihre Gesellschaft sehr geschätzt.«
Delores Crossley sieht ihn mit verschränkten Armen an. Als er sich nicht schnell genug bewegt, verscheucht sie ihn mit einer behandschuhten Hand. »Die junge Frau wollte damit höflich ausdrücken, dass Sie sich verziehen sollen. Sie wird Sie nicht zum Tee einladen. Oder was Sie sich sonst erhofft haben.«
Er richtet sich beleidigt auf. »Ich habe auf sie aufgepasst …«
»Ganz bestimmt. Und jetzt können Sie sich verziehen. Na los!«
Der Fahrer schlendert zurück zum Auto, und ich rufe ihm noch einmal ein aufrichtiges Dankeschön zu. Er ignoriert es und das Taxi fährt in einer Gischt aus Schotter davon.
Ich sage nichts. Delores’ Dialekt aus Nord-Yorkshire zu übersetzen, kostet mich im Moment meine ganze Gehirnkapazität. Dad erzählt immer: Als ich vier Jahre alt war, kam ich von unserem Sommerausflug zurück und sprach wie ein achtzigjähriger Einheimischer aus Nord Yorkshire. Meine Kindergärtnerin befürchtete, ich hätte eine Gehirnverletzung erlitten, weil meine Ausdrucksweise unverständlich war.
Je mehr Delores jedoch redet, desto schneller arbeitet mein interner Übersetzer, und schon bald verarbeitet mein Gehirn ihren Dialekt fast mühelos.
Nachdem das Taxi davongefahren ist, wendet sie sich an mich. »Sie wohnen also hier.«
»Während des Sommers, ja. Wie ich in meiner E-Mail geschrieben habe.«
»Ich hoffe, Sie haben noch kein Rückflugticket gekauft, denn ich habe das Gefühl, dass Sie es früher brauchen werden, als Sie denken.«
Ich begegne ihrem Blick. Sie erwidert ihn stumm.
»Ich werde schon klarkommen«, sage ich entschlossen.
Nach zwei kräftigen Schlägen gegen eine mit Efeu bewachsene Urne legt sie ihre Pfeife ab und schlendert hinein.
Ich schleppe meinen Koffer ins Innere des Hauses. Es riecht nach Tee – der unverwechselbaren Yorkshire-Mischung, die ich seit vielen Jahren nicht mehr getrunken habe. Ich halte inne und könnte schwören, ich höre das Hallo meines Vaters durch den Flur hallen und Tante Judith aus der Küche rufen, wo sie mit einem Teetablett und einer dampfenden Kanne auftauchen wird – nachdem sie unsere Ankunft auf die Minute genau berechnet hat.
Trauer erfasst mich. Zu meiner Rechten hallen Schritte, das Licht geht an, und ich folge der Spur der Beleuchtung ins Wohnzimmer. Der süße Duft von Teerosen umweht mich, als wäre er ins Holz eingegraben. Als ich dieses Zimmer das letzte Mal gesehen habe, war es im modernen Stil der Jahrhundertmitte eingerichtet. Jetzt ist es im Landhausstil gehalten – in Creme und Beige mit rosa Akzenten. Ein gestreiftes Sofa lädt dazu ein, in den tiefen Kissen zu versinken, ebenso ein riesiger Holzsessel, der unter Kissen und Decken vergraben ist. Auf einem Couchtisch liegen Bücher, kunstvoll verstreut.
Tante Judith hat auch die Holzvertäfelung gestrichen, und ich versuche, dabei nicht zu erschaudern. Als Michael und ich direkt nach dem College geheiratet haben, haben wir ein Haus gemietet, für das der Begriff renovierungsbedürftig ein Kompliment gewesen wäre. Ein Crashkurs in Sachen Hausrenovierung wurde zu einer gemeinsamen Leidenschaft, der ich seit seinem Tod nicht mehr nachgegeben habe.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, wie ich Farbe auftrage und die zerkratzten Holzböden neu verlege, durchfährt mich eine lange verschüttete Aufregung.
»Miss Dale!«, ruft Delores aus dem Nebenzimmer.
»Bronwyn, bitte«, sage ich, während ich ihrer Stimme in die Küche folge.
Früher wurde außerhalb des Hauses gekocht – in einer Hofküche. Die moderne Version wäre eher als Servicebereich zu bezeichnen. Er ist kompakt, aber hübsch, mit gestrichenen Holzschränken und einem kleineren Kühlschrank als in meiner Eigentumswohnung.
Ein gutes Viertel des Raums ist dem Herd gewidmet, der bereits angezündet ist und den winzigen Raum so stark erwärmt, dass ich meinen Pullover ausziehen muss. Der schwache Geruch von Öl weht vom Herd. Der Duft ist so vertraut wie der Yorkshire-Tee, den ich auch hier rieche. Eine offene Dose steht auf dem Tresen, als hätte Delores ihn getrunken, während sie das Haus vorbereitet hat.
»Ich habe ein paar Lebensmittel in den Schrank gestellt. Außerdem frische Scones und einen Laib Brot. Meine Frau hat sie gebacken.«
Sie sieht mich an und wartet offenbar auf eine Reaktion.
»Bitte danken Sie ihr von mir.«
Daraufhin brummt sie und deutet dann auf den Herd. »Wissen Sie, wie man den bedient?«
»Ja.«
»Sie müssen ordentlich einkaufen gehen. Ich weiß nicht, wie Sie das ohne Auto bewerkstelligen wollen.«
»Im Testament meiner Tante steht, dass das Auto meines Onkels noch in der Garage steht.«
Daraufhin bricht sie in Gelächter aus. »Das alte Ding kriegen Sie den steilen Berg nicht runter. Sie müssen sich was anderes suchen. Ich kann Sie nicht rumfahren. Sie haben doch gesehen, wie ich mich fortbewege. Bei mir gibt’s keine Mitfahrgelegenheit.«
Ich lächle. »Ich glaube, ich würde auch nicht mehr auf die Lenkstange passen. Aber ich komme schon zurecht. Jetzt, wo ich hier bin, werde ich nichts mehr von Ihnen benötigen.«
»Nein, jetzt, wo Sie hier sind, kann ich dieses Chaos von einem Garten aufräumen. Das wollte ich schon seit Jahren, aber Ihre Tante hat darauf bestanden, dass es die Mühe nicht wert ist. Ihr Testament zahlt mir fünf Jahresgehälter, also werde ich das Grundstück in Ordnung bringen.«
Sie geht durch das Esszimmer, ein kleines Büro und dann den formellen Salon. Dieser ist vollkommen leer.
»Ihre Tante wollte, dass ich die Möbel verkaufe. Sie bat mich, sie in den Stadtladen zu stellen und den Erlös für den Unterhalt zu verwenden. Ich habe ihren Brief, wenn Sie ihn sehen wollen.«
»Das brauche ich nicht. Ich danke Ihnen.«
Obwohl es mir nicht gefällt, dass Tante Judith Möbel hat verkaufen müssen, bin ich nicht überrascht. Thorne Manor war ihr einziger Luxus, den sie von ihrem Großvater geerbt hat – dessen erste Frau eine Thorne gewesen war. Die Tatsache, dass sie es an mich weitergegeben hat, ist Ehre und Verantwortung zugleich, was mein Herz schwer werden lässt und mir gleichzeitig Angst einjagt.
Ich folge Delores die breite, große Treppe hinauf. Meine Hand gleitet über das hölzerne Geländer, das vom Alter grau und seidenweich geworden ist. Dabei erinnere ich mich an all die Male, als ich durch die Haustür getreten bin, meine Tasche fallen gelassen habe und direkt nach oben gerannt bin, während mein Vater unten gelacht hat.
»Äh, Bronwyn? Deine Tante und dein Onkel sind hier unten.«
Stimmt, und ich habe sie vergöttert, aber zuerst musste ich …
»Ihr Zimmer«, sagt Delores, als würde sie meinen Satz beenden.
Ich lächle. »Ich kenne den Weg«, sage ich und biege oben an der Treppe links ab.
Sie schüttelt den Kopf. »Ich habe das große Schlafzimmer eingerichtet. Das alte Zimmer ist klein und dunkel und das Bett ist kurz vorm Zusammenbrechen.«
Aber es hat mir gehört und ich habe dort einige meiner glücklichsten Tage verbracht. Mein perfektes, wunderbares Zimmer – mit seinem perfekten, wunderbaren Geheimnis.
Geheimnis? Nein. Eine Wahnvorstellung.
Ich schlucke, wende den Blick ab und eile hinter Delores her in das große Schlafzimmer.
»Die Bettwäsche ist neu und gewaschen«, sagt sie.
Ich durchquere den großen, luftigen Raum bis zum Kingsize-Bett und glätte die Bettwäsche mit einer übertriebenen Geste, bereit, sie in den höchsten Tönen zu bewundern. Tatsächlich hat sie die Qualität eines Fünf-Sterne-Hotels, und ich seufze genüsslich, als ich sie zwischen meinen Fingern reibe. Dann bemerke ich die dicke, gesteppte Bettdecke. Sie ist eindeutig handgefertigt, und zwar von jemandem, der wusste, was er tat. Sie weist ein Sternenmuster auf schwarzem Grund auf.
»Wow«, sage ich und streiche über die Bettdecke. »Sie ist wunderschön.«
Delores brummt, ist aber sichtlich erfreut. »Meine Frau hat sie für Ihr Tantchen gemacht und ist nie dazu gekommen, sie ihr zu geben.«
Ich drehe mich zu ihr um. »Ich danke Ihnen. Für alles. Das ist weit mehr, als ich erwartet habe.«
Delores winkt mit einer knorrigen Hand ab. »Ich habe ihr gesagt, sie macht zu viel Aufhebens. Man könnte meinen, Königin Liz selbst würde kommen.« Sie stapft aus dem Zimmer. »Ich fahre jetzt besser nach Hause.«
Ich begleite sie zur Haustür und sage dann ein aufrichtiges: »Danke, Miss Crossley.«
»Ich bin ein Mister!« Sie lässt mir keine Zeit zu antworten, sondern begegnet meinem Blick mit diesem herausfordernden Ausdruck. »Ich bevorzuge Mister.«
»Und er? Oder sie?«
Seine Augen verengen sich, als ob ich ihn verhöhnen würde.
Ich fahre schnell fort: »Ich bin Universitätsprofessorin, Mister Crossley. Ich benutze die richtigen Pronomen.«
Ein langsames, nachdenkliches Nicken. »Ich bevorzuge er.« Es folgt eine Pause. »Wenn Sie es vergessen und sie sagen, nehme ich Ihnen das nicht übel.«
»Ich werde es nicht vergessen, Mister Crossley.«
»Del ist auch gut.«
Ja, richtig. Er hat seine E-Mails mit Del unterzeichnet. Das einzige Mal, dass ich Delores gesehen habe, war in der Einleitung des Anwalts, der den Nachlass verwaltet hat.
Er geht auf die Tür zu. »Wenn Sie Probleme haben, rufen Sie an. Oder kommen Sie runter. Wir sind am Fuß des Hügels. Das erste Haus auf der linken Seite. Ein Klacks für ein starkes Mädchen wie Sie.«
»Ich komme schon klar, aber danke.«
»Ich bin morgen früh wieder da. Sehen Sie sich das alte Auto an, ob noch etwas Leben in ihm steckt.«
Ich bedanke mich noch einmal, dann gehe ich hinaus und sehe zu, wie er davonfährt, eine schemenhafte Gestalt auf einem Fahrrad, die frisch angezündete Pfeife zwischen den Zähnen.
KAPITEL2
Del ist weg und ich bin allein – was nichts Neues ist und mich kaum stört, selbst in diesem abgelegenen alten Haus nicht. Ich habe vor, es mir mit Tee, Keksen und einem Buch gemütlich zu machen. Nachdem ich mir mein Nachthemd angezogen habe – eines von Michaels alten T-Shirts –, erscheint mir das Bett oben viel einladender als Tee, Kekse oder gar ein Buch im Wohnzimmer. Ich habe den gesamten Tag auf irgendeinem Sitz verbracht – im Flugzeug, im Zug, im Taxi – und verspüre nun das dringende Bedürfnis, mich auszustrecken und zu schlafen.
Als ich das Licht im Treppenhaus anknipse, blinkt es einmal auf und erlischt dann. Ich versuche es noch ein paar Mal, bevor ich einen Kerzenhalter aus der Küche hole.
Diese Abgeschiedenheit bedeutet, dass das Haus immer wieder von Stromausfällen betroffen ist, und der Anbieter hat es nie eilig, diese zu beheben. Zugegeben, ich muss nicht wirklich eine Kerze anzünden. Es handelt sich lediglich um eine durchgebrannte Glühbirne. Ich könnte in mein Schlafzimmer gehen, indem ich das Licht im Flur anlasse. Was allerdings überhaupt keinen Spaß machen würde. Ich steige eine dunkle Treppe hinauf, allein in einem Spukhaus aus dem achtzehnten Jahrhundert im englischen Moor. Jeder, der auch nur einen Funken Fantasie hat, würde mit einer brennenden Kerze und einem weißen Nachthemd – oder einem übergroßen weißen T-Shirt – hinaufgehen wollen.
Genau das tue ich. Ich höre allerdings kein einziges bedrohliches Knarren einer Bodendiele und sehe kein unheimliches Flackern im Augenwinkel. Wie enttäuschend!
Ich gehe ins Schlafzimmer und …
Etwas bewegt sich im Raum. Ich zucke zusammen und drehe mich, wobei ich fast meine Kerze fallen lasse, nur um mich dann in einem Spiegel zu sehen. Es ist Tante Judiths antiker Schminktisch mit Dreiwegspiegeln. Ich sehe ihn und muss lächeln. All meine Angst ist plötzlich verschwunden. Als Kind saß ich stundenlang an diesem Schminktisch, habe mich schweigend über Cremetiegel und Schminktöpfchen gebeugt und angesichts der exotischen Düfte geseufzt. Tante Judith erwischte mich immer und ich habe es geliebt, denn das bedeutete, dass sie mein Gesicht eingecremt, mir die Lippen geschminkt und mein Haar mit ihrer Silberbürste zum Glänzen gebracht hat. Dann kam die Coldcream heraus, so kühl wie ihr Name, und wischte Tante Judiths Werk ab, bevor meine Mutter es sehen konnte.
Ich gehe zum Schminktisch und lasse mich auf den Hocker sinken. Darauf stehen immer noch Tiegel und Schatullen, deren geschliffenes Glas und silberne Deckel glänzen, als wäre Tante Judith erst vor wenigen Augenblicken hier gewesen. Ich öffne einen Tiegel Nachtcreme, und der Geruch, der herausströmt, ist so vertraut, dass mir die Tränen in die Augen steigen. Ich sitze einen Moment da und schwelge in Erinnerungen. Dann stehe ich auf und puste die Kerze aus.
Das Mondlicht flutet durch das Fenster ohne Vorhänge und ich steige ins Bett. O mein Gott, ich habe nicht übertrieben, was die Bettwäsche angeht. Sie ist so weich, dass ich wahrscheinlich gar nicht mehr aufstehen wollen werde.
Kaum habe ich die Augen zugemacht, bin ich auch schon eingeschlafen.
* * *
Ich wache durch ein Kitzeln auf meiner Wange auf – wie ein verirrtes Haar, das in der nächtlichen Brise weht. Michael hat immer gesagt, dass es zwanzig Grad minus sein müssten, bevor ich bei geschlossenen Fenstern schlafen würde. Ich reiße die Augen auf und …
Ein Gesicht schwebt über meinem.
Mit einem Schrei springe ich auf und kauere mich zusammen, panisch den Raum absuchend. Den leeren Raum.
Als ich etwas Großes und Helles zu meiner Linken entdecke, drehe ich mich zur Seite und schaue aus dem großen Erkerfenster. Ein fast voller Mond leuchtet hindurch.
Ich atme aus und schüttle den Kopf. In der Verwirrung des Aufwachens habe ich den Mond für ein Gesicht gehalten, seine schattenhaften Krater für Gesichtszüge. Und ich bin aufgewacht, weil ein verirrtes Haar meine Wange gekitzelt hat, gefangen in der Brise, die durch das offene Fenster hereingeweht ist, das ich …
Das ich vor dem Einschlafen nicht geöffnet habe. Es ist fest verschlossen.
Nun, dann gab es von woanders einen Luftzug, schließlich ist dies ein altes Haus.
Ich lege mich wieder hin und drehe mich auf die andere Seite, weg vom Fenster. Kaum berührt mein Kopf das Kissen, flüstert mir jemand etwas ins Ohr.
Erschrocken setze ich mich auf und schlage um mich, dabei verheddere ich mich in der Bettdecke. Ich kämpfe mich frei und steige aus dem Bett. »Wer ist da?«, frage ich so zittrig, dass mich Scham überkommt.
Eine Erinnerung flackert auf, von meiner letzten Nacht in diesem Haus, vor dreiundzwanzig Jahren. Ich bin aufgewacht, als eine Gestalt über mir aufgetaucht war. Eine Gestalt, an deren Gesicht ich mich nicht erinnern kann, und die Worte gesagt hat, an die ich mich ebenfalls nicht erinnern kann. Aber sie hat mich schreiend aus dem Schlaf gerissen und dann …
Ich schlucke schwer und reibe mir die Augen. Hier gibt es keinen Geist – und es gab auch nie einen. Ein Haar hat mich an der Wange gekitzelt. Ich habe die Augen geöffnet und den Mond gesehen, dann habe ich mir das Flüstern eingebildet. Ich bin angespannt und gestresst, überwältigt von Erinnerungen und Gefühlen. Und ich befinde mich an einem Ort, den ich einst über alles geliebt habe. An einem Ort, den ich seit zwei Jahrzehnten nicht mehr betreten habe, als sich diese Liebe in Herzschmerz, Trauer und Angst verwandelt hat.
Hier gibt es nichts außer Erinnerungen und so viele davon sind wunderbar. Konzentrier dich darauf! Erinnere dich daran! Vertreibe die Geister und erobere Thorne Manor als einen Ort voller Magie und Geheimnisse zurück!
Ich durchquere das Zimmer und öffne das Fenster. Die nächtliche Brise strömt herein und ich atme sie tief ein. Dabei sehe ich mein geliebtes Moor, durch das sich Wege schlängeln, vertraute Pfade, die meine Füße und mein Herz vor Sehnsucht schmerzen lassen. Irgendwo muht eine Kuh und ein Hund bellt, wie als Antwort. Mein Blick wandert zu der schmalen Straße, die den Hügel hinunterführt, und zu den erhellten Häusern unten. Eine Erinnerung daran, dass ich nicht wirklich allein bin.
Ich steige gerade zurück ins Bett, als ich irgendwo im Haus einen dumpfen Schlag höre. Daraufhin drehe ich den Kopf und lausche. Ein weiterer dumpfer Schlag ertönt, der aus der Richtung meines alten Zimmers kommt.
Ich stelle die Füße auf den Boden, doch ein Jaulen lässt mich zurück aufs Bett springen. Ich schnappe mir den nächstbesten Gegenstand, schwinge ihn wie einen Schild und verstecke mich hinter … einem Kissen? Ich unterdrücke ein ersticktes Lachen, das von einem weiteren schwachen und verzweifelten Jaulen durchbrochen wird.
Noch immer das Kissen umklammernd, schleiche ich zur Tür. Das Geräusch ertönt erneut und lässt meine Nackenhaare sträuben. Ich umfasse den Türknauf.
Was? Du gehst da raus?
Das lässt mich nur mit den Schultern zucken. Ja, ich gehe jetzt da raus. Ich bin nicht mehr fünfzehn und werde mich nicht mehr wie ein verängstigtes Mäuschen in meinem Bett verkriechen.
Nur habe ich mich in jener Nacht nicht in meinem Bett verkrochen, sondern bin weggelaufen. Danach ist alles so schrecklich schiefgelaufen.
Nun, jetzt laufe ich nicht davon. Ich handle klar und entschlossen, bewaffnet mit meinem … Ich schaue auf das Kissen hinunter, werfe es beiseite und schnappe mir den Regenschirm aus meinem offenen Koffer. Auch mein Handy nehme ich mit, bevor ich den Flur betrete.
Die Kreatur jault weiter – erbärmliche Laute, die aus meinem alten Schlafzimmer zu kommen scheinen.
Ich drehe den Knauf, dann schiebe ich die Tür mit einem Knie so fest auf, dass sie gegen die Wand knallt.
Ein Schrei. Ein Kratzen von Krallen auf Holz. Ein orangefarbener Blitz huscht unters Bett.
Orange?
Nun, es ist kein Geist.
Ich lasse das Gesehene Revue passieren: zu groß für eine Maus, zu orange für eine Ratte.
Hm.
Als ich den Raum betrete, schlägt mir der Gestank von abgestandener Luft und Schimmel entgegen. Staub wirbelt vor meinem Gesicht. Mein altes Bett ist tatsächlich kaputt. Der Lattenrost hängt durch, die Matratze ist weg.
Ich stütze meinen Schirm an die Wand, schalte die Taschenlampe meines Handys ein und lasse mich auf den Boden sinken. Als ich mit dem Licht unter das Bett leuchte, blitzen Zähne auf – rasiermesserscharfe Zähne, halb so lang wie mein kleiner Fingernagel. Winzige schwarze Lippen kräuseln sich, ein Fauchen ertönt und orangefarbenes Fell bläht sich auf. Die kleinen Ohren sind flach nach hinten gedrückt.
Es ist ein Kätzchen. Kaum groß genug, um von seiner Mutter getrennt zu sein.
Es faucht erneut. Sie faucht. Ich weiß genug über Katzen, um zu wissen, dass es ein Weibchen ist.
Als ich das Licht von ihm weghalte, sieht mich das Kätzchen. Zumindest scheint es so, denn sein kleiner Kopf wackelt, aber seine Augen haben wahrscheinlich immer noch Mühe zu fokussieren.
Wie alt ist es?
Und was macht es in meinem alten Schlafzimmer?
Das Kätzchen gibt ein leises Miauen von sich.
»Wo ist deine Mama?«, frage ich.
Ein weiteres Miauen. Ich greife unter das Bett und es huscht davon, wobei seine Krallen über das Hartholz kratzen.
Ich beobachte es, dann sehe ich mich um. Hier gibt es eindeutig keine Katzenmutter. Mein Blick wandert durch den mondbeschienenen Raum, während mein Herz vor Liebe zu diesem Zimmer schneller schlägt. Aber dann fällt mir ein, dass ich ja nach einer Katzenmutter suche – oder nach einer Möglichkeit, wie ein Kätzchen hierhergekommen sein könnte. Dennoch fällt mir natürlich alles auf, vor allem der durch die Dunkelheit verdeckte Verfall. Zwei große Fenster, eines mit Blick auf das Moor, das andere auf die alten Ställe. Mein schmales Bett und die zwei Kommoden. Außerdem etwas, das ich fast vergessen hatte: eine kleine Frisierkommode mit einem gepolsterten Hocker und einem Spiegel – eine Überraschung von Tante Judith und Onkel Stan, als ich mit fünfzehn zurückgekommen bin. Mein Blick gleitet über mein eigenes Make-up und die Cremes. Tränen steigen mir in die Augen.
Ich blinzle heftig. Das löst das Rätsel des Kätzchens nicht. Ich gehe umher und betrachte die Wände. Sie sind in perfektem Zustand, – ohne einen Spalt in der Fußleiste, der groß genug wäre, um auch nur eine Maus hineinzulassen. Dann schaue ich hinter die Kommode, den Frisiertisch und das Bett. Auch dort gibt es keine Löcher.
Schließlich gehe ich zu den Fenstern. Sie sind fest verschlossen. Der Geruch hier drinnen lässt mich wissen, dass dieser Raum – anders als der Rest des Hauses – nicht gelüftet wurde.
Ich drehe mich noch einmal um und entdecke das Kätzchen, das unter dem Bett hervorlugt, woraufhin ich mich auf den Boden sinken lasse. Als es miaut, halte ich inne. Es folgt eine Pause. Dann macht es einen zaghaften Schritt. Und noch einen. Es bahnt sich seinen Weg über den Boden und schnuppert an meinen Fingern. Dann reibt es sich an meiner Hand. Als ich seinen Kopf streicheln will, hüpft es auf meinen Schoß und schnurrt zu mir hoch.
Ich kichere leise vor mich hin. »Du bist doch kein Streuner, oder?«
Das Kätzchen ist entzückend. Langes, weiches Fell. Der Rücken und der Kopf sind schwarz-orange gestreift, der Bauch und die Pfoten schneeweiß. Als ich es streichle, reibt es sich erneut an meiner Hand. Eine Hauskatze also – aufgewachsen mit Menschen und einer Mutter, die diesen Menschen ihre Babys anvertraut hat.
Ich hebe das Kätzchen hoch und es schnurrt wie ein Motorboot. Es ist wirklich winzig, hat einen übergroßen Kopf und riesige blaue Augen. Ich weiß, dass Kätzchen mit blauen Augen geboren werden. Bedeutet das, dass es noch nicht alt genug ist, um entwöhnt zu werden? Auf jeden Fall ist es sicher noch nicht alt genug, um auf eigene Faust auf Entdeckungstour zu gehen. Wo kommt es also her?
Während ich es streichle, nehme ich mein Handy in die freie Hand und rufe mit dem Daumen den Browser auf, um nachzusehen, wann sich bei Kätzchen die Augenfarbe verändert. Als ich die Meldung erhalte, dass ich nicht mit dem Internet verbunden bin, werfe ich einen Blick auf das Symbol für die Signalstärke. Es ist kaum vorhanden. Auf der Fahrt hierher hatte ich ein Signal, aber seit ich in Thorne Manor bin, habe ich mein Telefon nicht mehr überprüft.
Ich stehe auf und halte das Kätzchen gerade so fest, dass es nicht herunterspringen kann. Aber das wird es auch nicht, denn als ich es in meine Armbeuge lege, kuschelt es sich an meine Brust.
Ich bringe es nach unten und gebe ihm einen Teller mit Wasser. Im Kühlschrank steht ein kaltes Hähnchen, von dem ich kleine Stücke abreiße, die es aber ignoriert. Als die Standuhr läutet, erwarte ich, dass es drei oder vier Uhr morgens ist. Stattdessen schlägt sie zwölf.
Erst Mitternacht? Wie früh bin ich ins Bett gegangen?
Vielleicht bin ich gar nicht eingeschlafen. Oder nicht so tief, wie ich dachte. Das könnte diese Phantomberührung erklären. Eine Erklärung für Geister sind hypnagoge und hypnopompe Halluzinationen, bei denen man glaubt, etwas zu sehen, während man einschläft oder aufwacht, aber eigentlich schläft und träumt man, ohne es zu merken.
Übermüdet und unruhig von einem langen Reisetag bin ich in einen unruhigen Schlaf gefallen und dachte, dass ich aufwache, weil sich jemand über mein Bett beugt. Aber es war die Traum-Halluzination, die mich tatsächlich aufgeweckt hat. Und der Traum selbst wurde durch das unheimliche Geräusch eines gefangenen Kätzchens ausgelöst.
Trotz dieser Erklärung bin ich nicht erpicht darauf, ins große Schlafzimmer zurückzukehren. Außerdem ist das eine gute Ausrede, um mein ehemaliges Zimmer zurückzuerobern. Ich finde die alte Matratze, die im Lager verpackt ist, und schleppe sie hinein, während das Kätzchen fasziniert zusieht. Ich lege das übergroße Laken und die Bettdecke aus dem Hauptschlafzimmer auf mein schmales Bett. Eine Ecke hängt durch, aber das kann ich morgen reparieren. Fürs Erste lege ich das Kätzchen in eine mit einer Decke ausgelegte Schachtel und um zwei Uhr nachts schlafe ich zu der Musik leiser Kätzchenschnarcher ein.
* * *
Ich erwache durch den Ruf einer Katzenmutter und nehme Gerüche wahr, die nicht in mein Schlafzimmer gehören – den Duft von Sandelholz, den Moschus von Pferden und den verlockenden Geruch eines schwelenden Feuers. Das heißt, ich bin gar nicht wach, sondern befinde mich in einem Traum, in dem die Mutter des Kätzchens ängstlich nach ihrem verlorenen Baby sucht.
In dem Traum schläft jemand neben mir und als ich mich bewege, wird eine Hand auf meine Hüfte gelegt. Eine breite, männliche Hand zieht mich näher heran und ich genieße die Wärme, die von der anderen Seite des Bettes ausgeht. Meine Beine stoßen gegen seine und er streckt sich vor, lädt mich ein, unsere Füße und Waden zu verschränken.
Es ist nicht Michael. Nicht sein Geruch, nicht seine Berührung, nicht einmal sein immer noch vertrauter Atem. Das lässt mich nicht erschrocken zusammenzucken. Es ist acht Jahre her. Ich leide nicht mehr unter Schuldgefühlen, wenn andere Männer in meine Träume eindringen. Michael besucht sie noch oft genug.
Die Finger des Mannes streichen über meine Hüfte und ziehen mich noch näher heran. Ein Kuss, dann berühren seine Lippen meine Stirn und er flüstert: »Bronwyn.«
Ich kenne diese Stimme.
Nein, ich kenne diesen Tonfall mit meinem Namen. Die Stimme kenne ich nicht. Der Duft des Mannes, gleichermaßen vertraut und doch nicht vertraut, der nach Schweiß und Pferd und Sandelholz riecht, verführt mich mit einem Hauch von Erinnerung.
Ich lege seine Hand auf meine Hüfte und lasse meine Finger über die harten Muskeln seines Unterarms gleiten, sodass er leicht erschaudert. Er atmet durch die Zähne aus, als meine Finger über seinen Bizeps zu seiner Schulter wandern. Diese bewegt sich unter meiner Hand, dann beugt er den Kopf und flüstert Worte, die ich nicht verstehe. Ich höre einen britischen Dialekt – vertraut und zugleich fremd. Eine Stimme in meinem Kopf besteht darauf, dass ich ihn kenne, weigert sich aber, mir einen Namen zu nennen.
Ich reiße die Augen auf und sehe, wie sich pechschwarzes Haar über blasser Haut kräuselt. Er küsst immer noch meinen Hals. Es sind kitzelnde Küsse und dabei murmelt er meinen Namen.
Eine Hand ruht immer noch auf meiner Hüfte. Die andere packt mich und zieht mich näher, bis ich seine Härte an meinem Bauch spüre. Ich gebe nach und unterbreche den Kuss, um meine Position so zu verändern, dass sie befriedigender ist. Er gluckst und kommt mir entgegen.
Ich schiebe das Becken gegen seines und er stöhnt leise auf, wobei der Laut in meinem Namen endet. Ich versuche, sein Gesicht zu sehen, aber es ist in meinem Haar vergraben. Er ist also groß. Groß, dunkelhaarig – und vielleicht auch gut aussehend, aber Letzteres ist mir ziemlich egal. Das hier reicht völlig aus. Ein gut gebauter Mann, der meinen Namen stöhnt, sein Körper ist heiß und hart an meinem. Perfektes Futter für eine mitternächtliche Fantasie.
Unsere Beine umschlingen sich weiter und ich stelle fest, dass er nackt ist. Ich trage immer noch mein Nachthemd und mein Höschen, aber er scheint es nicht eilig zu haben, mich davon zu befreien. Auch ich habe keine Eile, sondern genieße die Reise. Außerdem ist das Ziel unvermeidlich. Er drückt sich an mich und ich spreize die Beine, woraufhin er wieder stöhnt und meine Hüften fester umklammert.
Dann jault die Katze.
Er reißt die Augen auf. Der Raum ist zu dunkel, als dass ich mehr als ein Aufblitzen einer hellen Farbe, blau oder grün, erkennen könnte. Bevor ich einen besseren Blick erhaschen kann, stößt er mich mit einem »Was zum Teufel?« von sich.
Diese Stimme …
Nein, nicht die Stimme. Der Akzent. Ein richtiger Londoner Oberschicht-Akzent, den man dort eigentlich nicht mehr hört. Ein Relikt aus einer vergangenen Zeit.
Er springt aus dem Bett, stellt fest, dass er nackt ist, und reißt die Bettdecke mit sich, die er sich dann vor den Schritt hält.
»Wer sind Sie und was zum Teufel machen Sie in meinem Bett?«
Ich antworte nicht, sondern warte darauf aufzuwachen. Das wird natürlich als Nächstes passieren. Zwei Träume haben sich überschnitten – die ängstliche Mutterkatze und die schöne sexuelle Fantasie –, wobei Ersterer den zweiten unterbrochen hat.
Oder vielleicht fängt der Traum wieder an. Ja, ich hätte gern Option zwei, bitte. Die Katze soll bitte schweigen und diese schemenhafte, fluchende Gestalt soll bitte wieder ins Bett kommen.
»Sind Sie taub?«, schnauzt der Mann. »Stumm? Ich habe Ihnen eine Frage gestellt!«
Lieber Morpheus, spule bitte zehn Minuten zurück und lass die Katze weg.
Der Mann steht da, halb im Schatten, aber von sehr schöner Gestalt. Breitschultrig und nackt – bis auf die leidige Decke.
»Ich habe Ihnen eine Frage gestellt«, wiederholt er.
»Zwei.«
Sein schattenhaftes Gesicht verzieht sich. »Was?«
»Sie haben mir zwei Fragen gestellt. Wer ich bin und was ich hier mache.«
Er legt den Kopf schief, entspannt sich ein wenig und blinzelt. Seine hellen Augen verschwinden kurz in der Dunkelheit.
»Sagen Sie das noch einmal!«, verlangt er.
»Ist das ein Befehl, Mylord?«
»Ja, das ist es, Mädchen.«
»Nun, da ich seit vielen Jahren kein Mädchen mehr bin, lehne ich es ab, dem nachzukommen.« Ich halte inne. »Obwohl ich das wohl gerade getan habe, oder?«
»Wer sind Sie?«, fragt er. Seine Stimme ist jetzt tiefer, angespannter, als fürchtete er die Antwort.
»Nur eine Frau, die einen sehr schönen Traum hatte, bevor die Katze gejault hat. Bitte hören Sie auf, mich anzuschreien. Im Halbschlaf waren Sie so viel angenehmer.«
Er starrt mich an. Starrt einfach nur. Ich will gerade noch mehr sagen, als er sich auf mich stürzt und mich am Arm packt. Ich knie noch immer im Bett und sein Ruck wirft mich um, bevor ich mich wehren kann. Plötzlich bin ich auf den Beinen und werde ins Mondlicht gezogen. Mein T-Shirt reißt, aber er scheint es nicht zu bemerken. Grob umfasst er mein Kinn und reißt mein Gesicht nach oben.
Dann erstarrt er. Steht wieder ganz still und haucht: »Bronwyn.«
Ich blicke in ein Gesicht, das mir ebenso vertraut ist wie sein Geruch und seine Stimme. Ich kenne es und kenne es doch nicht. Ein breites Gesicht, mit harten Kanten und einem Drei-Tage-Bart, außerdem einer tiefen Furche zwischen dichten Brauen. Ein Gesicht, das ich mit weichen Zügen und glatten Wangen in Erinnerung habe. Doch unter den nun harten Kanten sehe ich den Jungen, den ich einst gekannt habe. Seine himmelblauen Augen. Den markanten Unterkiefer. Das dunkle Haar, das sich über eine breite Stirn kräuselt. Ich schaue den Mann an und erkenne den Jungen, den ich seit dreiundzwanzig Jahren nicht mehr gesehen habe.
»William«, flüstere ich. Er lässt mich abrupt los und springt zurück.
Ich falle nach hinten und schlage auf dem Boden auf. Als ich aufschaue, ist der Mann verschwunden.
KAPITEL3
Ich sitze auf dem Boden meines Schlafzimmers und blinzle. Eine Katze miaut und ich springe auf, aber es ist nur das Kätzchen, das auf meinen Schoß krabbelt, als würde es sich fragen, wie ich auf den Boden gekommen bin.
Gute Frage, Kätzchen.
Offensichtlich bin ich aus dem Bett gefallen, nachdem ich geträumt habe, dass ich von jemandem herausgerissen wurde.
William.
Vor dreiundzwanzig Jahren bin ich aus diesem Haus gerannt und habe geschrien, dass ich einen Geist gesehen hätte. Ein einziger Vorfall reichte jedoch nicht aus, um mich in die Psychiatrie zu bringen. Erst als ich – in meiner Trauer und meinem Schock – begann, von anderen Menschen zu erzählen, die ich in Thorne Manor gesehen hatte. Von einem Jungen, der vor Hunderten von Jahren in meinem Zimmer gewohnt hat. Einem Jungen, der mein Freund war – und dann mehr als das.
William Thorne.
Ich weiß nicht mehr, wann wir uns das erste Mal gesehen haben. Für mich war William immer ein Teil dieses Hauses, wie die Standuhr im Flur. Meine früheste Erinnerung an Thorne Manor ist die an ein Zimmer, das mir gehörte und doch nicht ganz mein eigenes war. In Williams Schlafzimmer haben wir beide, kaum mehr als Kleinkinder, mit Murmeln gespielt, als ob wir uns schon ewig gekannt hätten. In dieser Erinnerung spüre ich, dass ich bereits viele Male dort war, ihn oft gesehen und dieses Spiel viele Male gespielt habe.
Ich war zu jung, um mir darüber Gedanken zu machen. William war mein Freund im Sommerhaus von Tante Judith. Wenn ich die Augen schloss und an ihn in meinem Zimmer dachte, öffnete ich sie und fand mich in seinem.
Als wir älter wurden, streiften wir umher. In die Ställe, in die Heuscheune, ins Moor, auf den Dachboden, in den Geheimgang und in jeden Winkel des Hauses. Wir mieden seine Familie und das Personal. Ich war Williams Geheimnis – und er meines.
Dann kam die Scheidung meiner Eltern und es dauerte zehn Jahre, bis ich zurückkehrte. Mit fünfzehn war das und ich musste nur an ihn denken, während ich in meinem Schlafzimmer war – und da war er. Wieder in meinem Alter und so unbeholfen und süß, wie es sich ein fünfzehnjähriges Mädchen nur wünschen kann.
Ich verliebte mich in jenem Sommer und es war die perfekte erste Romanze, die man sich vorstellen kann. Wir spazierten Hand in Hand durchs Moor. Wir küssten uns unter dem Sternenhimmel. Wir redeten über alles und wollten nichts anderes, als zusammen zu sein, selbst wenn ich mich im Stall mit einem Buch zusammenrollte, während er seine Pferde striegelte.
Wie ich in Williams Zeit zurückgereist war, brauchten wir nicht zu erklären. Die Antwort war offensichtlich. Er war real und ich war real und deshalb musste das, was geschah, ebenfalls real sein – echte Magie eben. Ein gemeinsames Zimmer, ein gemeinsames Leben. Eine vernünftige Erklärung für ein fünfzehnjähriges Mädchen, das in einen Jungen verliebt war, der zwei Jahrhunderte vor ihr gelebt hatte.
Die Wahrheit war viel härter. Nachdem mein Onkel gestorben war und ich mein Geständnis über William ausgeplaudert hatte, erklärten die Ärzte, dass der Stress die Erinnerungen an einen imaginären Kindheitsfreund in lebhafte Halluzinationen eines Teenagers verwandelt hatte.
Mein Vater ist Historiker und ich habe mich von ihm anstecken lassen, und so – zumindest erklärten das die Ärzte – hätte ich einen Thorne-Jungen imaginiert, der einst in meinem Schlafzimmer auf Thorne Manor gelebt hatte. Ein imaginärer Spielkamerad für ein Einzelkind, das seine Sommer in einem abgelegenen Landhaus verbrachte. Mit fünfzehn Jahren nahm ich – gegen den Willen meiner Mutter – wieder Kontakt zu meinem Vater auf. Der Stress war zu groß und mein Verstand beschwor William von Neuem herauf, machte ihn zu dem Freund und der ersten Liebe, die ich so dringend brauchte.
Heute Abend besuchte ich William erneut und fand ihn als erwachsenen Mann vor, wieder genauso alt wie ich. Doch das war eindeutig ein Traum und irgendwie macht das die Sache noch schlimmer, denn die Flamme des Verlustes, die nie ganz erloschen ist, entzündet eine neue. Michael ist seit acht Jahren tot. Und William Thorne hat nie in meiner Zeit gelebt.
Es dauert lange, bis ich wieder einschlafe. Tränen durchnässen mein Kopfkissen –ich weine um einen Ehemann, den ich verloren habe, und um einen Jungen, den ich nie wirklich hatte.
* * *
Am nächsten Morgen wache ich in deutlich besserer Stimmung auf. Das Kätzchen hat sich an meiner Seite zusammengerollt, als hätte es mein leises Weinen hierhergelockt, und es ist schwer, mit einem kleinen Wesen im Bett zu faulenzen, denn es verlangt nach Frühstück.
Am Vormittag bringe ich das Kätzchen in meinem neuen katzensicheren Zimmer unter. Dann gehe ich in die Garage – früher waren das die Ställe –, um nachzusehen, ob Del bezüglich des Zustands des Autos übertrieben hat. Als ich die Plane abziehe, fliegen Staubmotten auf und ein paar Mäuse rennen in alle Richtungen, aber der Chrom und der kirschrote Lack glänzen noch immer.
Onkel Stans Baby, hat Tante Judith es genannt. Früher war es für mich einfach nur ein altes Auto, jetzt empfinde ich es als Schmuckstück. Es ist ein Austin-Healey Cabrio, allerdings habe ich keine Ahnung, welches Baujahr oder Modell. Mich juckt es in den Fingern, das lederne Lenkrad zu umschließen. Doch diesbezüglich hat Del die Wahrheit gesagt. Die Schlüssel stecken zwar im Zündschloss, aber der Motor springt nicht an. Zwar bin ich keine Kfz-Mechanikerin, aber mein Vater hat mir genug beigebracht, um zu wissen, dass das Problem weder eine leere Batterie noch ein leerer Benzintank ist. Trotzdem klappe ich die Plane zur Seite und lasse das Garagentor offen, um das Auto zu lüften.
Versteckt hinter dem Cabrio entdeckte ich zwei alte Fahrräder. Ich nehme das von Tante Judith, denn es hat einen Vorderkorb. Ein paar Tropfen Öl auf die Kette, ein bisschen Luft in die Reifen, einen Rucksack für zusätzlichen Stauraum und schon bin ich in der Stadt.
High Thornesbury ist mit rund tausend Einwohnern gerade groß genug, dass ich mich unter die Besucher während der Juniferien mischen kann. Ich werde Kontakte knüpfen, wenn ich weniger Jetlag habe und besser in der Lage bin, den Gesichtern Namen zuzuordnen, die dreiundzwanzig Jahre älter sind.
Nach einem Besuch im Eisenwarenladen und beim Lebensmittelhändler ist mein Rucksack voll, aber in meinem Fahrradkorb befinden sich nur eine kleine Tüte Tierfutter und eine Flasche Rotwein, gepolstert durch ein Paar dicke Wollsocken. Dann rieche ich frisches Brot aus der kleinen Dorfbäckerei und da ich noch Platz habe …
Als ich die Stadt verlasse, ist mein Fahrradkorb prall gefüllt. Schuld daran sind die Scones von Mrs. Del. Natürlich könnte man meinen, dass ich nicht mehr brauche, da ich bereits eine Schachtel davon zu Hause habe. Aber wenn ich nur wenige habe, mache ich mir Gedanken um den nächsten Morgen, an dem ich keine haben werde. Außerdem, so schön Kekse aus der Dose auch sind, sie können es nicht mit frischen Scones aufnehmen. Oder Pfefferkuchen. Oder Butterbrötchen.
Wenn ich das Cabrio nicht zum Laufen bringe, werde ich auf diesem alten Fahrrad herumfahren. Der Sattel fühlt sich an, als wäre er aus Zement – ich brauche jede zusätzliche Polsterung, die ich bekommen kann.
Die Fahrt zurück nach Thorne Manor führt eine Sieben-Grad-Steigung hinauf, und ich sporne mich mit der Aussicht auf Schokoladenpfannkuchen an, als ich Del auf seinem Fahrrad auf mich zukommen sehe. Bei Tageslicht sieht er noch bizarrer aus – mit seinem langen Mantel, den klobigen Arbeitsstiefeln, die in die Pedale treten, und der Pfeife, die er zwischen die Zähne geklemmt hat. Auf ein Fischerboot würde er prima passen. Auf ein Fahrrad nicht wirklich.
Sein Gesichtsausdruck ist so verkniffen, dass ich beschließe, ihn besser nicht aufzuhalten. Gerade will ich die Hand zum Gruß heben, da bleibt er stehen und mir wird klar, dass das einfach nur sein normaler Gesichtsausdruck ist. Ungeduld und Verärgerung, eingebrannt in seine verwitterte Haut.
»Ich werde heute nicht nach oben fahren«, sagt er. »Werde in der Stadt gebraucht. Dringende Angelegenheit.« Er verdreht die Augen und lässt mich dadurch wissen, dass es seiner Meinung nach überhaupt nicht dringend ist. Wenn er recht hat, möchte ich nicht die Person sein, die ihn gerufen hat. »Ich wollte vorbeikommen und sehen, ob Sie etwas brauchen. Aha, Sie haben den Krämer gefunden.« Er schaut in den Korb, und sein Gesichtsausdruck verfinstert sich. »Sind Freys Scones nicht nach Ihrem Geschmack?«
Ich lächle. »Sie sind viel zu sehr nach meinem Geschmack, was bedeutet, dass sie morgen früh weg sein werden.«
»Dann bringe ich Ihnen mehr. Gott weiß, dass sie genug davon gebacken hat. Sagte, sie erinnere sich daran, wie Sie einen ganzen Korb allein gegessen haben, als Sie noch ein Knirps waren. Ich entgegnete, Sie hätten wahrscheinlich gelernt, sich zurückzuhalten. Aber offenbar nicht.«
»Frey?«, sage ich. »Ist das die Abkürzung für Freya?«
»Ja.«
»Sie war Lehrerin in der Stadt, nicht wahr? Sie hat mit meiner Tante Whist und Bridge gespielt.«
Freya lebte in Liverpool, als ich mit fünfzehn Jahren zurückkehrte, es ist also über dreißig Jahre her, dass ich sie gesehen habe. Ich erinnere mich an einen weichen Gesichtsausdruck und eine sanfte Stimme. An ein Lachen, das zu herzlich war, um von dieser Stimme kommen zu können. An einen Stapel mit Eselsohren versehener Bücher. Einen Korb mit frischem Gebäck. Den Geruch von Kreide, Salbei und brauner Butter.
»Ich würde sie gern sehen«, sage ich.
»Sie geht in letzter Zeit nicht viel aus. Wartet auf eine neue Hüfte. Sie fährt heute in die Stadt zu einem Arzttermin. Aber sie würde sich freuen, wenn Sie morgen zum Tee kämen.«
»Ich komme gern, wann immer es ihr passt. Oh, und ich habe oben ein Kätzchen gefunden.«
»Oben?« Er zieht die grauen Augenbrauen hoch.
»Eingeschlossen in meinem alten Zimmer.«
Er runzelt die Stirn. »Ich war die ganze vergangene Woche dort und habe geputzt. Keine Kätzchen – drinnen oder draußen. Sie würden sich in der Garage an den Mäusen laben, aber ich habe dort noch nie welche gesehen.«
»Es ist noch sehr jung.« Ich zeige ihm das Bild auf meinem Handy.
»Hm.« Er beugt sich vor. »Es scheint noch nicht groß genug zu sein, um von seiner Mutter getrennt zu sein.«
»Ich weiß. Gestern Abend habe ich versucht nachzusehen, was ich ihm zu essen geben soll, aber ich hatte keinen Handyempfang.«
»Ja, wir sind hier ein bisschen in einem Funkloch. Unten an der Straße ist es in Ordnung, aber im Haus muss man im Wohnzimmer sein. Oder im Vorgarten. Es sei denn, der Wind frischt auf. Oder der Nebel zieht auf. Oder es regnet. Aber ich brauche kein Internet, um Ihnen zu sagen, dass das ein sehr junges Kätzchen ist, das das nicht fressen kann.« Er deutet auf das Trockenfutter in meinem Korb. »Sie müssen es zu einem Brei mischen.« Er sieht mich eindringlich an. »Behalten Sie es?«
»Ich würde gern seine Familie finden, wenn ich kann.«
»Ein so junges Kätzchen? Es hat sich nicht aus der Stadt verirrt. Jemand muss es ausgesetzt haben. Wenn Sie es wollen, gehört es Ihnen.«
Ich sollte ihm sagen, dass ich nur den Sommer über hier sein werde und nichts über Haustiere weiß. Meine Mutter war allergisch, und Michael und ich waren gerade dabei, unser erstes Haus zu kaufen – was auch unser erstes Haustier bedeutet hätte –, als er seine Diagnose erhielt. Danach bin ich einfach nicht mehr dazu gekommen. So wie ich nicht dazu gekommen bin, mich wieder zu verabreden, nicht dazu gekommen bin, Kinder zu bekommen, nicht dazu gekommen bin, ein Haus zu kaufen.
All das stand auf unserer Liste. Nachdem drei Ärzte Michaels Tumor für unheilbar erklärt hatten, machte er eine Liste mit allem, was ich tun sollte, wenn er tot war. Ein Haus kaufen. Mich unsterblich verlieben. Heiraten und Kinder bekommen. Nein, eigentlich sollte ich zuerst ein paar Affären haben. Langfristige Beziehungen vergessen und nur Sex mit heißen Typen haben. Ja, das stand tatsächlich auf der Liste.
Irgendwo darauf stand auch das hier: eine Katze adoptieren. Und obwohl ich sicher nicht die ideale Menschenmutter für ein kaum entwöhntes Kätzchen bin, sage ich Ja, als Del mich fragt, ob ich es behalten will.
Er nickt und meint, er werde mit dem hiesigen Tierarzt sprechen und dann morgen früh vorbeikommen.
* * *
Ich habe mir zwar Schokoladenpfannkuchen als Belohnung für das Erklimmen des Hügels in Aussicht gestellt, aber in Wirklichkeit … Sagen wir einfach, es ist wahrscheinlich gut, dass Michael und ich keine Kinder bekommen haben, denn ich laufe Gefahr, wie meine Mutter zu werden, die mir für eine Leistung Leckereien versprochen hat, dieses Versprechen dann aber nicht eingelöst hat.
Nein, das würde ich meinem Kind nicht antun, da ich weiß, wie es sich anfühlt. Aber ich tue es mir selbst an. Ich lasse die Pfannkuchen sausen und koche stattdessen ein paar frische Eier vom Bauernhof. Und dann, als zusätzlichen Ausdruck von Masochismus, mache ich zwanzig Minuten Ballettübungen.
Meine Mutter war eine professionelle Ballerina und hat gehofft, ihr einziges Kind würde in ihre Fußstapfen treten. Leider habe ich Dads Körperbau geerbt. Ich bin einen Meter fünfundfünfzig groß und nicht gerade dünn. Das war ich nie. Ich war ein properes Kind, das zu einer fülligen Erwachsenen wurde, beides höfliche Euphemismen für eine Figur, die niemals die Prinzessin – oder sogar die Königinmutter – in Schwanensee mimen wird.
Als ich klein war, hoffte meine Mutter, dass ich meinen Babyspeck loswerden würde, auch wenn mein Knochenbau das nicht zuließ. Das erklärt vermutlich, warum es in meiner Kindheit hieß: »Du kannst ein Eis haben, wenn du dein Zimmer aufräumst«, was irgendwann zu »Hier ist ein schönes Joghurt-Parfait« wurde.
Ich bin zweimal pro Woche zum Ballettunterricht gegangen und fand es toll. Als ich neun Jahre alt war, erkannte meine Mutter jedoch, dass ich nie in ihre Fußstapfen treten würde, und behauptete kurzerhand, dass der Unterhalt dafür nicht ausreichen würde. Der letzte Teil war eine Lüge. Wie ich später herausfand, zahlte mein Vater immer extra für meine Stunden.
Ich kann mich nicht erinnern, dass sich meine Eltern je wirklich verstanden hätten. Sie waren wie Kollegen, die gezwungen waren, an einem gemeinsamen Projekt zu arbeiten. Und dieses Projekt war ich. Als ich fünf war, trennten sie sich schließlich. Wie Mom es ausdrückte, war Dad mit einem Mädchen durchgebrannt. Die Wahrheit war, dass er wieder mit seiner Jugendliebe zusammengekommen war und Mom um eine einvernehmliche Trennung mit gemeinsamem Sorgerecht gebeten hatte.
Indem er sie wegen einer anderen Frau verlassen hatte, hatte Dad Mom die Würde geraubt. Sie zahlte es ihm heim, indem sie mich ihm entriss. Sie behauptete, Dad sei gewalttätig, und er verlor das Umgangsrecht. Ich hasste sie dafür– ich hasste sie für vieles –, aber da wardennoch viel Liebe in unserer Beziehung. Aus dem Ballettunterricht nahm sie mich nicht aus Bosheit oder Habgier. Es war klar, dass ich nie eine Ballerina werden würde, und sie wollte mir keine Enttäuschung bereiten. Der Gedanke, dass ich mit dem Tanzen als Hobby glücklich gewesen wäre, kam ihr vermutlich nie in den Sinn, weil sie es auch nicht gewesen wäre.
Meine Mutter ist seit zwei Jahren tot. Lungenkrebs, weil sie ein Leben lang geraucht hat, um als Ballerina schlank zu bleiben. Mein Vater lebt in Toronto und ich sehe ihn mindestens einmal in der Woche. Er ist immer noch mit seiner zweiten Frau zusammen, die eine so liebevolle und nicht böse Stiefmutter ist, wie man sie sich nur wünschen kann.
Als Dad herausfand, dass ich mit dem Ballett aufgehört hatte, bestand er darauf, dass ich wieder damit anfange. Ich tanze immer noch jede Woche mit einer Truppe, und ich liebe es, auch wenn ich in einem Tutu wirklich nicht sonderlich grazil aussehe.
Ich könnte über Masochismus schimpfen, während ich diese Ballettübungen mache, aber als ich meine Pirouetten durch Thorne Manor drehe, steigt meine ohnehin schon gute Laune in die Stratosphäre. Bei Tageslicht ist das Haus einfach nur magisch. Rechtecke aus Sonnenlicht erstrecken sich über die Holzböden. Eine nach Heidekraut duftende Brise weht durch jedes offene Fenster. Ich tanze zwischen Sonne und Schatten, sauge den Duft des Moors ein und spüre, wie der Wind meine Haut küsst. Wenn es in diesem Haus etwas Dunkles geben sollte, dann ist es jetzt nicht hier. Bei Tageslicht kann ich mir nicht vorstellen, dass es überhaupt jemals hier war.
Nach meinen Tanzübungen erkunde ich das Haus und stöbere in seinen Winkeln und Ecken. Was mich am meisten überrascht, ist der Geruch – eine Mischung aus Moor, nasser Wolle und altem Holz sowie ein schwacher Hauch von Kampfer. Es sollte kein angenehmer Geruch sein, aber er ist es, denn es ist der Geruch von Thorne Manor, der Erinnerungen an endlose Tage weckt, an denen ich mich mit einer alten Decke und einem Buch in einer dieser Ecken zusammengerollt habe.
Ich knie neben einer Abstellkammer unter der Treppe und öffne deren winzige, schiefe Tür. Zwar bin ich mir nicht sicher, ob ich noch hineinpasse, aber ich würde es gern versuchen. Gern würde ich mir eine Decke und ein Kissen sowie einen Roman und eine Tasse Milchtee schnappen. Dann so tun, als wäre ich wieder fünf oder fünfzehn und im Laternenlicht lesen, während ich dem Stampfen von Onkel Stans Stiefeln zuhöre und Tante Judiths Rufe vernehme, er solle die verdammten Dinger ausziehen, sowie Dads Lachen über ihre täglichen Abläufe. Meine Augen brennen bei der Erinnerung, aber es ist eine gute. Vielleicht werde ich an einem Tag in diesem Sommer tatsächlich hierherkommen und lesen. Im Moment erkundet das Kätzchen den Raum und ich beobachte es und lächle wie eine nachsichtige Mutter.
Als es davon genug hat, schnappe ich mir Tante Judiths Nähzeug und hole mein T-Shirt von gestern Nacht heraus. Heute Morgen ist mir ein kleiner Riss aufgefallen.
Ein Riss, nachdem William daran gezerrt hat?
Ich schüttle den Kopf. Nein, es ist bereits zehn Jahre alt, und ich habe es mehr als einmal genäht. Es ist eines von Michaels T-Shirts aus meiner Sammlung, von denen drei den Weg in meinen Koffer gefunden haben. Dieses hier ist ein Toronto-Maple-Leafs-T-Shirt. Geboren in Kairo, ausgebildet in England, hatte Michael noch nie ein Eishockeyspiel gesehen, bis er für sein Studium nach Kanada kam. Das hielt ihn aber nicht davon ab, ein größerer Leafs-Fan zu werden als mein Vater, der mich immer noch zu den Spielen schleppt. Michael hatte bis dahin noch nie Schlittschuhe an, aber schon in seinem zweiten Jahr war er in einer Uni-Mannschaft. Er scherzte, dass sie ihn spielen ließen, um der Mannschaft etwas Farbe zu verleihen, aber das hätte nicht den Pokal erklärt, der immer noch in meiner Wohnung steht. Michael machte keine halben Sachen. Die Leute nahmen an, er habe Eishockey gelernt, um sich der kanadischen Kultur anzupassen, aber das kam ihm nie in den Sinn. Er sah sich ein paar Spiele an, dachte sich: Das sieht interessant aus – und lernte es.
Michael stürzte sich ins Leben. Bei jedem Ausflug mit dem Auto wusste ich, dass ich die Fahrzeit verdoppeln musste, weil er ständig einen Umweg machte, um zu sehen, was da drüben ist. Er sprach vier Sprachen und begann nach der Diagnose zum Spaß, Japanisch zu lernen. Als die Diagnose gestellt wurde – ein Glioblastom-Gehirntumor –, scherzte man, dass er sein Hirn durch Überbeanspruchung abgenutzt habe.
Ich habe einen Stapel seiner alten T-Shirts und Trikots – meine einzige Nachtwäsche in den vergangenen acht Jahren. Ich behandle sie wie alte Spitze, wasche sie im Schonwaschgang und flicke jede sich lösende Naht. Und jetzt muss dieses hier repariert werden, was nichts mit einem Traum von vergangener Nacht zu tun hat, sondern mit der Tatsache, dass ich nach acht Jahren vielleicht nicht mehr die Shirts meines toten Mannes zum Schlafen tragen sollte.
Vielleicht eines Tages. Aber nicht heute. Heute schnappe ich mir das T-Shirt und das Nähzeug und mache es mir mit meinem Kätzchen und einer Tasse Tee gemütlich, um den zerrissenen Saum zu nähen, als ob der Besitzer des Kleidungsstücks jeden Moment zurückkommen und es wieder anziehen wollen würde.
KAPITEL4
Am späten Nachmittag ist Enigma bereit für ein Nickerchen. Der Name scheint passend zu sein, wenn man die mysteriösen Umstände ihrer Ankunft bedenkt. Ich bringe das Kätzchen nach oben und setze es in seine Schachtel. Dann werfe ich einen Blick auf das Bett und stelle fest, dass es vielleicht nicht das Kätzchen ist, das ein Nickerchen braucht. Ich habe nach einer schlaflosen Nacht auf einer Überseereise kaum fünf Stunden geschlafen.
Ich ziehe meine Pantoffeln aus und schlüpfe unter die herrlich dicke Bettdecke. Als meine Wange das kühle Kissen berührt, erinnere ich mich an meinen Traum von vergangener Nacht, in dem ich in Williams Bett aufgewacht bin. Ich lächle und kuschle mich ans Kissen, in der Hoffnung, ihn wiederaufnehmen zu können. Aber sobald ich die Augen schließe, wird mir klar, worauf ich wirklich hoffe – nicht auf einen Traum von William, sondern darauf, dass er leibhaftig vor mir steht. Und es ist mehr als eine Hoffnung. Es ist ein verzweifeltes seelisches Flehen, dass William real ist, dass ich die Zeit überwinden und ihn erreichen kann.
Träume wie dieser verwandeln sich garantiert in Albträume. Jahrelang habe ich davon geträumt, aufzuwachen und Michael neben mir zu finden – lebendig, gesund und munter. Dann wachte ich wirklich auf, zitterte vor Kummer und Sehnsucht und hatte Angst, wieder einzuschlafen. In gewisser Weise wollte ich jedoch wieder einschlafen und nicht mehr aufwachen. Ich betrachtete die Schlaftabletten auf meinem Nachttisch und fragte mich, was passieren würde, wenn ich sie alle nehmen würde …
Ich steige zitternd aus dem Bett. Dann schaue ich in den Spiegel des Frisiertischs und sehe die dunklen Ringe unter meinen Augen. Zeit, eine Kanne starken Kaffee zu kochen.
Als ich mich abwende, sehe ich ein Flackern im Spiegel. Es verschwindet innerhalb einer Sekunde und ich verkrampfe mich, weil ich glaube, ein geisterhaftes Gesicht gesehen zu haben. Aber es war etwas anderes. Ein Gesicht, ja. Aber fest und echt, streng und männlich, mit einem Wust schwarzer Locken über der breiten Stirn und Augen so blau wie der Sommerhimmel.
»William«, flüstere ich, und kaum habe ich das Wort ausgesprochen, da verschwindet der Frisiertisch und ich blicke in einen anderen Spiegel. Hinter mir wendet sich William der Schlafzimmertür zu.
Er trägt ein leichtes Jackett über einem weißen Leinenhemd mit hohem Kragen und einer breiten Krawatte, die mit einer saphirfarbenen Anstecknadel befestigt ist. Er hat eine schlanke Figur, sein dunkles Haar ist geglättet, seine Locken sind gebändigt. Ich erhasche nur einen flüchtigen Blick auf sein Profil, dann steht er mit dem Rücken zu mir und verlässt den Raum.
»Lord Thorne?«, ruft jemand aus dem Korridor. »Euer Anwalt ist hier.«
»Bringt ihn in den Salon!«
»Nicht in die Speisekammer?«, entgegnet die andere Person mit einem neckischen Unterton.
William brummt, aber in seinem Ton ist kein Groll zu hören.
Ich kenne die andere Stimme. Sie ist älter als in meiner Erinnerung, aber ich habe sie als Kind oft gehört. Eine Stimme, die uns dazu brachte, ein Versteck zu suchen, bevor sie uns entdeckte. Mrs. Shaw, die Haushälterin der Thornes.