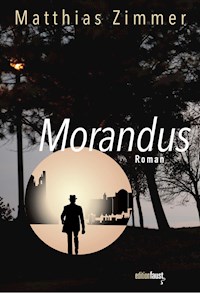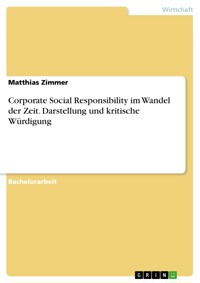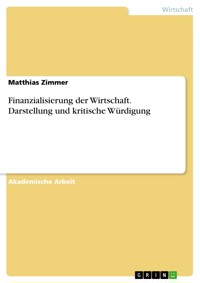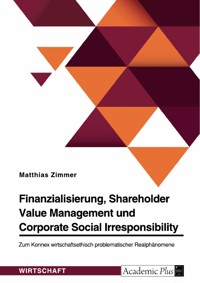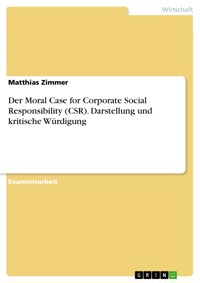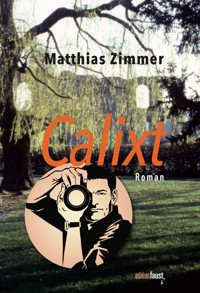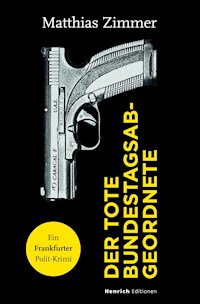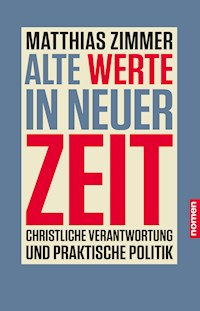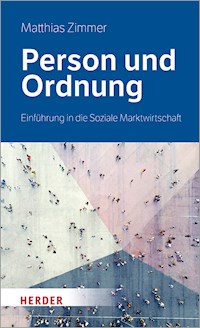Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Zwölf Jahre Deutscher Bundestag -- davon berichtet diese Erinnerungen anschaulich und augenzwinkernd. Es geht dem Autor um die normalen Abläufe im Deutschen Bundestag, um die menschliche Seite, immer auch mit einer Prise persönlicher Wertung. So bietet dieses Buch einen kleinen Blick hinter die Kulissen dessen, was uns über die Medien als Haupt- und Staatsaktionen präsentiert werden: Menschlich, nicht frei von gelegentlichen Eitelkeiten der Akteure, aber auch mit Bewunderung für diejenigen, die sich ganz dem Gemeinwohl verschrieben haben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 365
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
1. Vorwort
2. Zwölf Jahre aus der Vogelperspektive
3. Die Bundeskanzlerin
4. Wie man reinkommt
5. Von Frankfurt nach Berlin
6. Rechte und Vergünstigungen
7. Regierungsbildung und Koalitionsverträge
8. Parlamentarischer Alltag
9. Ausschüsse und Anhörungen
10. Rituale, Symbole, Regeln
11. Fraktion und Fraktionszwang
12. Typologie der Abgeordneten
13. Nebenjob und Nebeneinkünfte
14. Politik und Gesundheit
15. Die CDU
16. Die CSU
17. Die SPD
18. Die Grünen
19. Die Linke
20. Die FDP
21. Die AfD
22. Reden
23. Über die Lüge
24. Journalisten, Talkshows, soziale Medien
25. Interessengruppen und Lobbyisten
26. Reisen
27. Zunehmende Spaltungen
28. Showdown in der Fraktion
29. Führungsfragen
30. Wahlkreis und Basis
31. Ende und Fazit
32. Endnoten
1. Vorwort
Der leider viel zu früh verstorbene Publizist Roger Willemsen hat 2014 ein Buch veröffentlicht mit dem Titel: Das Hohe Haus. Ein Jahr im Parlament.1 Er hatte, unbemerkt von allen, ein Jahr lang auf der Besuchertribüne die Debatten des Deutschen Bundestages verfolgt. Ergebnis war ein höchst unterhaltsames Buch, das zu Recht zu einem Verkaufsschlager wurde. Auch ich habe es mit großem Vergnügen gelesen. Allerdings hatte es einen kleinen Schönheitsfehler. Es hat die Arbeit des Bundestages ausschließlich aus der Brille der parlamentarischen Debatten beurteilt. Der Deutsche Bundestag ist aber viel mehr. Es ist zunächst ein Verfassungsorgan. Das spiegelt auch der Titel des Buches von Willemsen wider, wenn er, ganz unironisch, von dem Hohen Haus spricht. Nach unserer Verfassung, dem Grundgesetz, ist das Volk der Souverän, also der oberste Gesetzgeber. Die Souveränität wird in Wahlen und Abstimmungen wahrgenommen. Eine davon ist die Wahl zum Deutschen Bundestag. Die dann Gewählten sind, so steht es im Grundgesetz, Abgeordnete des gesamten deutschen Volkes und an Weisungen und Aufträge nicht gebunden. Sie sind also nicht nur Abgeordnete ihres Wahlkreises. Das ist sicherlich in der Praxis auch so. Aber die Väter und Mütter des Grundgesetzes wollten deutlich machen: Als Abgeordnete seid ihr dem großen Ganzen verpflichtet und nicht den Interessen eures Wahlkreises. Ein altertümliches Wort dafür ist der Begriff des Gemeinwohls. Abgeordnete sollen dem Gemeinwohl verpflichtet sein. Nicht den organisierten Interessen, nicht (das ist sogar strafbar) jemandem, der dem Abgeordneten für eine Entscheidung Geld gibt. Sondern dem Gemeinwohl. Das und die verfassungsrechtliche Stellung des Deutschen Bundestages als Ausdruck der Souveränität des Volkes begründet den Ehrentitel »Das Hohe Haus«. Das wird auch deutlich, wenn man die Frage nach den höchsten Repräsentanten des Staates stellt. In der Bundesrepublik Deutschland ist der Bundespräsident der höchste Repräsentant. Er wird gewählt von der Bundesversammlung, einem besonderen Organ, das nur zur Wahl des Bundespräsidenten zusammentritt. Es besteht zu einer Hälfte aus allen Mitgliedern des Deutschen Bundestages, zur anderen Hälfte aus gewählten Vertretern der Landtage in Deutschland. Eine solche Wahl ist immer etwas Bedeutsames. Sie steht symbolisch für den föderalen Aufbau der Bundesrepublik: Bund und Länder wählen gemeinsam das Staatsoberhaupt. Der Bundespräsident hat also auch deshalb eine besondere Stellung, weil er die Legitimität des Bundes- und der Ländervertreter des deutschen Volkes hinter sich weiß. Ein starkes Signal der parlamentarischen Demokratie, wie ich finde!
Der Stellvertreter des Bundespräsidenten ist der Präsident des Deutschen Bundestages. Erst an Platz drei der protokollarischen Rangfolge kommt der Bundeskanzler. Das liegt daran, dass ein Bundeskanzler eine abgeleitete Autorität hat: Er wird nämlich vom Deutschen Bundestag gewählt und braucht für politische Entscheidungen eine Mehrheit im Deutschen Bundestag. Auch das spiegelt die besondere Stellung des Deutschen Bundestages, vergleicht man ihn etwa mit der französischen Assemblee Nationale oder dem US-amerikanischen Kongress.
Der Bundestag ist aber mehr als das. Er ist eine Institution, in der viele Teile zusammenwirken: Ausschüsse, Fraktionen, Arbeitsgruppen, die Verwaltung und vieles mehr. Für das parlamentarische Verfahren gibt sich der Bundestag eine eigene Geschäftsordnung. Damit werden viele mögliche Streitfragen im Vorhinein entschärft. Jeder, der selbst in einem Verein tätig ist, kann davon berichten, wie wichtig das ist. Es bleiben, auch auf der Verfahrensebene, noch genügend strittige Fragen, die notfalls durch Mehrheit entschieden werden müssen.
Der Bundestag ist Arbeitgeber. Jeder Abgeordnete hat einige Mitarbeiter, die aus einem festen Budget bezahlt werden, das der Deutsche Bundestag zur Verfügung stellt. Daneben gibt es die Mitarbeiter der Fraktionen, und dann schließlich die vielen Mitarbeiter der Verwaltung. Die Gesamtanzahl der Mitarbeiter schwankt natürlich, weil sie auch abhängig ist von der Anzahl der Abgeordneten. Aber als Faustregel habe ich immer festgehalten, dass auf einen Abgeordneten etwa acht Mitarbeiter kommen, sowohl in den Abgeordnetenbüros, den Fraktionen und der Verwaltung. Also, grobe Messzahl: Bei 700 Abgeordneten etwa 5600 Mitarbeiter, die der Deutsche Bundestag beschäftigt. Eine Art großer mittelständischer Betrieb also, ziemlich weit entfernt von den Arbeitnehmerzahlen deutscher Großkonzerne.
Und dann ist der Deutsche Bundestag auch die Summe der Personen, die dort arbeiten. Vor allem der Parlamentarier. Alle vier Jahre werden neue Persönlichkeiten in den Deutschen Bundestag gespült, andere kommen wieder, einige hören auf, freiwillig oder unfreiwillig; das ist Demokratie. Sie kommen in Berlin zusammen mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen, Prägungen, Ideen, Hoffnungen. Manche sind ehrgeizig, manche opportunistisch, manche haben ein Projekt. Sie kommen aus den unterschiedlichsten sozialen Zusammenhängen. Freilich, ein getreues Abbild des deutschen Volkes sind die Parlamentarier nicht. Es überwiegen Männer und es überwiegen Akademiker. Ansonsten aber gilt: Die Mitglieder des Deutschen Bundestages sind nicht vom Volk unterschieden, sondern nur durch das Volk. Das ist ein wichtiger Unterschied. Zum einen mag es den einzelnen Abgeordneten ein wenig demütig machen, dass er ein Mandat auf Zeit hat und die Wahl nicht bedeutet, dass man nun gewissermaßen einen Adelstitel verliehen bekommen hat. Zum anderen sei das aber auch gegen die häufig zu hörende Anfeindung gesagt, »die da oben« seien ja fürchterlich abgehoben und lebten in ihrer eigenen Blase. Nein, so ist es nicht: Die Abgeordneten führen auch ein ganz normales Leben, haben Familie und nehmen an vielen allen Sorgen und Nöten teil, die das Leben so zu bieten hat: Schlechte Noten der Kinder, Krankheiten, Pflegebedürftigkeit in der Familie, Ärger mit Behörden, mit Handwerkern, um nur einige wenige Beispiele zu nennen. Richtig ist aber auch: Finanzielle Sorgen gehören nicht dazu, zumindest nicht während der Zeit im Bundestag. Die Tätigkeit als Abgeordneter ist recht gut bezahlt, schon um keinen Anreiz zu liefern, käuflich zu sein. Die Diäten sichern die Unabhängigkeit des Abgeordneten. Es gibt immer schwarze Schafe, das ist richtig: Aber nicht aus materieller Not, sondern aus Gier. Dagegen helfen auch noch so hohe Diäten nicht. Am Ende ist es, wie so häufig, eine Frage des Charakters. Und Menschen, die weniger charakterfest sind, gibt es überall. Auch im Deutschen Bundestag. Nach meiner Beobachtung aber weniger häufig. Nicht, weil die Wahl schon eine Charakterprüfung wäre, aber doch eher, weil man sich auf Dauer in der Politik nur halten kann, wenn man nicht allzu offensichtlich ein Lump ist.
All das ist der Bundestag auch. Hinzu kommt natürlich noch das Ergebnis der Arbeit: Viele Gesetze, tausende Drucksachen pro Legislaturperiode, Berichte, Anfragen, Protokolle, eine wahre Leseflut demokratischer Vorgänge. Über diese will ich weniger berichten, aber mehr über einen Blick hinter die Kulissen. Wie das Zusammenspiel der unterschiedlichen Gremien im Bundestag funktioniert, wo es menschelt, wie es zu Konflikten kommt und vieles mehr. Ich stütze mich dabei auf eine lange Erfahrung als Parlamentarier. Und ich will kein Sachbuch vorlegen, sondern eine sehr persönlich gefärbte Schilderung der Erfahrungen, die ich machen durfte. Den Werturteilen wird mancher widersprechen wollen, und das ist in Ordnung. Ich habe mich davon leiten lassen, positive Beispiele besonders und namentlich hervorzuheben, die negativen Beispiele aber eher unter Ausklammerung persönlicher Kritik vorzutragen – mit der Ausnahme jener Fälle, die öffentlich bereits diskutiert worden sind. Der Leser, der ein Enthüllungsbuch erwartet, wird deshalb gut daran tun, dieses Buch gleich wieder zur Seite zu legen; diese Erwartung kann ich nicht erfüllen. Der Leser, der allerdings einen Einblick bekommen möchte, wie es hinter den Kulissen vor sich geht, den darf ich zu weiterer Lektüre ermuntern.
Zu den schönsten Aufgaben des Parlamentariers gehörte es für mich immer, Gästegruppen aus meinem Wahlkreis zu betreuen. Das ist ein segensreiches Programm des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung: Jeder Abgeordnete darf pro Jahr drei Gruppen mit je 50 Menschen aus seinem Wahlkreis einladen. Den Teilnehmern wurde ein großartiges Programm geboten, organisiert durch das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung: Besuche im Bundestag, in den Ministerien, in Gedenkstätten, alles unter dem Schirm der politischen Bildung. Fester Bestandteil des Programms war immer auch eine Debatte mit dem Abgeordneten. Ich habe das immer zum Anlass genommen, weniger über aktuelle Fragen zu sprechen als vielmehr ein wenig darüber zu erzählen, was denn ein Abgeordneter so tut, wie sein Arbeitsalltag zwischen Berlin und dem Wahlkreis so aussieht und habe auch viel Anekdotisches erzählt. Mein Eindruck war: Das hat viel dazu beigetragen, das Bild, das man über »die in Berlin« aus den Medien kennt, zu korrigieren und Verständnis zu wecken für die parlamentarischen Abläufe. Ich glaube, dass wir dies auch brauchen, denn eine Demokratie kann nicht funktionieren, wenn die gewählten Vertreter von einer Aura des Misstrauens und des Unverständnisses begleitet werden. Die Jahre im Deutschen Bundestag haben für mich vieles bedeutet: Kampf, Enttäuschungen, manchmal Niederlagen, aber auch Freude, Kollegialität, Gemeinsamkeit, ja und auch ein wenig Stolz darauf, in so einer fantastischen Institution wie dem Hohen Haus meinen Beitrag zum Gemeinwohl leisten zu dürfen. Ich wünsche mir, dass sich ein wenig davon durch dieses Buch überträgt.
2. Zwölf Jahre aus der Vogelperspektive
Was wird bleiben von der Zeit 2009-2021, was werden die Geschichtsbücher berichten? Was waren die großen Wegmarken, die großen Entscheidungen, über die man in Generationen noch berichten wird? Manches Zeitgenössische erscheint riesig groß und wird in der historischen Perspektive vermutlich klein; und vielleicht sind es kleine Entscheidungen, die im Nachhinein als die Geburtsstunde von etwas Neuem interpretiert werden.
Unzweifelhaft, die zwölf Jahre waren Jahre der Krise und des Krisenmanagements. Ich bin in den Bundestag gewählt worden unter dem Vorzeichen der Finanzkrise, ich bin ausgeschieden in den letzten Wehen der Coronapandemie. Dazwischen lagen die Euro-Finanzkrise und die Migrationskrise. All diese Krisen bestimmten die Schlagzeilen der seriösen und der weniger seriösen Medien über Wochen und Monate. Und sie bestimmten selbstverständlich auch die Arbeit im Deutschen Bundestag. Und die eine oder andere Krise – sie konnte klein gehalten werden. Ich denke etwa an die Spannungen in der Ukraine, die durchaus das Potential eines Flächenbrands gehabt haben und später tatsächlich dazu wurden. Zunächst aber hat die Diplomatie noch die Notbremse ziehen können, auch dank Angela Merkel. Ich denke an die Dauerkrise, die uns die Präsidentschaft von Donald Trump beschert hat (2016-2020); sie konnte eingehegt werden. Aber nie vergessen werde ich die Bilder vom Sturm auf das Kapitol. Die Vereinigten Staaten sind mir jedenfalls fremd geworden. Und das sage ich als lebenslanger Freund der USA, der während des Studiums auch ein akademisches Jahr dort verbracht hat, mit Bedauern und Ratlosigkeit.
Nur wenige Wochen nach meinem Einzug in den Bundestag hörte man in den Fluren über die griechische Finanzkrise raunen. Ich wusste kaum etwas darüber, aber das änderte sich schnell. In den folgenden Wochen ging es Schlag auf Schlag – bis dann auch weitere europäische Staaten in den Sog der Finanzkrise gerieten. Der damals aufgespannte Rettungsschirm mit den 750 Milliarden Euro Garantien machte einen schwindelig; doch die Coronakrise hat gezeigt, dass man auch größere Summen ins Schaufenster stellen kann.
Die Atomkatastrophe in Fukushima traf uns ebenfalls ziemlich unvorbereitet. Die letzte große Katastrophe in Tschernobyl konnte man ja – im Geist des Kalten Krieges – noch als Systemfehler des Kommunismus entschuldigen, aber nun war eine solche Katastrophe in einem Land passiert, in dem Sicherheit großgeschrieben wurde. Ich gestehe, ich war nie ein großer Freund von Atomkraft, vor allem wegen des Arguments, dass wir unseren Nachkommen hier eine Hinterlassenschaft in den Schoß werfen, die ziemlich unverantwortlich ist. Aber der Ausstieg, den wir dann hingelegt haben, war eine Vollbremsung. Ja, es gab damals schon die Argumente, Atomkraft sei doch wenigstens ein klimaneutraler Energieträger. Aber das ist zynisch und dumm. In einer radioaktiv verseuchten Welt will keiner leben, auch wenn das CO2-Level deutlich gesunken ist. Überdies: rechnet man alle Kosten der Atomkraft in den Strompreis mit ein, ist es die bei weitem teuerste Energiegewinnung, die der Mensch jemals erfunden hat. Zu den Kosten der Produktion muss man nämlich eigentlich die der Endlagerung (und der langen Bewachung mit dazu rechnen). Also, was kosten dann eine Kilowattstunde, wenn man wenigstens einhundert Jahre Endlagerkosten und Bewachung dazu rechnen muss? Und das ist optimistisch, denn es geht davon aus, dass es irgendwann auch einmal eine technische Lösung für die Behandlung von Atommüll gibt. Aber das wissen wir heute nicht. Wir wetten auf die Zukunft.
Zu Beginn des Jahres 2011 wurde wir durch den beginnenden arabischen Frühling überrascht. So mancher meinte, dass sich hier etwas wiederhole, was wir bei der friedlichen Revolution in Osteuropa zwanzig Jahre zuvor erlebt hatten: Eine umfassende Demokratisierung der Region von Marokko bis nach Ägypten, ja vielleicht sogar bis über Syrien in den Irak! Aber die europäische Erfahrung wurde nicht zur arabischen Realität. Im Gegenteil. Syrien versank in einen Bürgerkrieg, in Ägypten wurde der gewählte Präsident durch einen Militärmachthaber ersetzt. Im Irak entstand aus den Trümmern des Bürgerkriegs der Islamische Staat, der die Region und auch Europa mit Terror überzogen hat. Das waren alles keine Meisterleistungen westlicher Politik. Im Gegenteil, das stümperhafte Vorgehen des Westens hat all diese Ereignisse erst möglich gemacht. Die überschäumende Demokratiebegeisterung hat den Blick auf die reale Lage und die Machtverhältnisse verstellt. Das traf auch für die deutsche Politik zu, leider. Damit ist viel Unheil über die Welt gekommen. Auch die Flüchtlingsströme, die die europäische und deutsche Politik ab 2015 belastet haben.
Manchmal waren diese Jahre für mich auch Jahre des Zorns, der Hilflosigkeit. Ich erinnere mich gut, als wir in der Fraktion besprochen haben, wie wir den Jesiden helfen, die gerade vom Islamischen Staat abgeschlachtet und versklavt wurden. Wir haben damals beschlossen: Wir greifen zwar nicht militärisch ein, aber geben militärische Hilfe. Nordsyrische Milizen, auch die Kurden, haben dann den IS bekämpft. Aber das war alles abstrakt, wenig fassbar. Das wurde es aber, als die Jesidin Nadia Murat bei uns im Ausschuss für Menschenrechte aussagte. Die junge Frau ist Jahrgang 1993 und verlor 2014 nach einem Überfall auf ihr Dorf durch die IS ihre Familie. Sie selbst wurde versklavt, gefoltert, vergewaltigt; irgendwann gelang ihr die Flucht. Sie kam nach Baden-Württemberg. Die dortige Landesregierung hat ein sehr verdienstvolles Programm aufgelegt, das eintausend traumatisierten Frauen und Kindern einen Neuanfang mit psychotherapeutischer Begleitung ermöglichen sollte. Nadia Murat nutze dies, berichtete über das, was sie erlebt hatte. Sie wurde 2016 Sonderbotschafterin der Vereinten Nationen für die Würde der Überlebenden von Menschenhandel – und sie erhielt 2018 den Friedensnobelpreis. Als sie bei uns aber im Ausschuss berichtete sah ich nur eine junge Frau, die Schreckliches durchgemacht hatte – und gerade mal ein Jahr jünger war als meine eigene Tochter.
Persönlich beschwert hat mich auch das Schicksal der Flüchtlinge. Dass so viele im Mittelmeer ertrunken sind und noch ertrinken, ist ein fortdauernder Skandal für eine sich als zivilisiert bezeichnende Welt. Am meisten erschüttert haben mich Schilderungen aus Libyen. Dort begehen schon Kinder Selbstmord wegen der Ausweglosigkeit der Lage. Ich vermag mir diese Hoffnungslosigkeit, dieses Elend nicht ausmalen. Es ist ein Tiefpunkt auch dessen, was Menschen anderen Menschen antun – und damit Geld verdienen. Ich habe hier eine eindeutige Position. Artikel 1 des Grundgesetzes verpflichtet alle staatliche Gewalt, die Würde des Menschen zu achten und zu schützen. Das ist auch der Maßstab der Flüchtlingspolitik. Wir müssen helfen, vor Ort, ja. Aber wir dürfen diejenigen, die aus Verzweiflung, aus Hoffnungslosigkeit, sich auf den Weg gemacht haben, nicht im Stich lassen. Deswegen habe ich auch immer wieder Appelle mit initiiert und unterschrieben, die für eine großzügige Aufnahmeregelungen dieser Menschen in Not plädierte – sehr zum Ärger mancher Parteifreunde, denen manchmal nicht klar war, dass das »C« im Namen meiner Partei nicht bedeutet, dass man Kirchensteuer bezahlt, sondern eine Verpflichtung ist gegenüber dem Nächsten. Es gibt ein sehr anrührendes Bild von Norbert Blüm, der ein Flüchtlingscamp auf der griechischen Insel Idomeni besucht und dort auch übernachtete. Auf dem Bild hält er sitzend ein kleines Kind im Arm, beinahe tröstend; das Kind scheint sich geborgen zu fühlen. Das ist die christliche Botschaft, die auch in unserem Parteinamen mitschwingt: Menschen zu helfen, Trost zu spenden, Hoffnung zu geben. Darin hat die deutsche Politik versagt, aber mehr noch: Europa hat sich als völlig unfähig erwiesen. In sein letztes Buch hat mir Norbert Blüm eine kleine Widmung hineingeschrieben: »Europa: entweder solidarisch, oder: es geht vor die Hunde.« Die Erbarmungslosigkeit, die Europa angesichts der Flüchtlinge gezeigt hat, lässt hier Schlimmstes befürchten. Noch heute ergreift mich Wut, aber auch Scham, hier nicht mehr getan zu haben.
Gerade in Flüchtlingskrise haben wir viel Gutes gesehen, aber auch die dunklen Seiten in unserer Gesellschaft. Die Willkommenskultur zu Beginn der Flüchtlingskrise hat mich berührt und gefreut. Aber auch viele dunkle Seiten kamen aus den Menschen hervor. »Lauter junge Männer, die sollen lieber eine Waffe nehmen und kämpfen« , habe ich das eine oder andere Mal gehört – auch aus den Reihen unserer Fraktion. Und wenn es darum ging, in unmittelbarer Nähe der eigenen Wohnung eine Flüchtlingsunterkunft zu organisieren, brachen bei einigen Urängste aus. Zur Wahrheit gehört aber auch: Die Übergriffe in der berüchtigten Silvesternacht auf der Kölner Domplatte 2015/2016, aber auch die medial hochgeputschten Straftaten von Flüchtlingen bis hin zu den Morden haben das Klima der Willkommenskultur vergiftet und ein Klima der Ablehnung, der Angst erzeugt. Die Ablehnung des Fremden, des Unbekannten gehört wohl zu unserer biologischen Grundausstattung, die dann mit den zivilisatorischen Notwendigkeiten bisweilen in Konflikt gerät. Ja, es ist eine Zumutung, die Flüchtlingspolitik in einem Raum aufgeheizter Emotionen zu verteidigen. Und es ist belastend, den Populisten, die mit Beifallsstürmen bedacht werden, zu widerstehen. Aber ich bin auch in die Politik gegangen, weil ich an die Verbindlichkeit von Werten glaube und davon überzeugt bin, dass manchmal das Richtige das Unpopuläre ist. Für einen Politiker ist das eine doppelt schwere Frage, denn seine politische Zukunft hängt davon ab, die »richtige« Entscheidung zu treffen – »richtig« mit Blick auf die eigene politische Zukunft, aber nicht notwendig auf die Grundwerte, die ihn leiten sollten.
Immer wieder gibt es deshalb auch schwierige Fragen, die ein Politiker (und auch eine Politikerin) gerne umschifft. Gehört der Islam zu Deutschland? Diese Frage ist durch eine mutige Rede des Bundespräsidenten Wulff in die öffentliche Debatte gekommen und hat seither viel dazu beigetragen, sich mit dem Islam ernsthafter zu beschäftigen. Meine Antwort darauf wäre: Ja, die islamische Welt gehört auch zu unserer Kultur. Islamische Gelehrte haben die Null zu uns gebracht, ohne die es keine geordnete Buchführung und vermutlich auch keinen Kapitalismus gäbe. Die Grundlagen der Scholastik wurden durch die Schriften des Aristoteles gelegt, die über islamische Wissenschaftler zu uns kamen. Und erst einmal die Medizin – auch hier verdanken wir dem Islam sehr viel. Und eine zweite Antwort wäre: Es gibt nicht »den« Islam, sondern eine Vielzahl von Variationen, auch die gewaltbereite, terroristische. Das ist aber kein Alleinstellungsmerkmal des Islam, denn auch die Geschichte des Christentums ist keine Idylle von Solidarität, Toleranz und Freundschaft. Ich habe, auch in meinem Wahlkreis, viele engagierte Muslime gesehen, für die ihr Glauben die Verpflichtung zum friedlichen Zusammenleben bedeutete, zur Hilfe für die Schwachen; über diese hört man aber nichts in den Nachrichten. Ein persönlich sehr prägendes Erlebnis hatte ich ziemlich zu Anfang meiner parlamentarischen Laufbahn. Da war ich zu einer Diskussionsveranstaltung mit muslimischen Frauen eingeladen. Viele trugen Kopftuch und ich stellte mich auf einen schwierigen Abend ein. Als die Frauen sich dann vorstellten, kam heraus: Ärztinnen, Ingenieurinnen, Lehrerinnen! Hoch gebildete Frauen, die auf hohem Niveau diskutierten und überhaupt nicht den Anschein machten, etwas anderes zu sein als deutsche Muslime. Ich war Opfer meiner Vorurteile geworden und weiß seither: Ein Kopftuch sagt wenig über einen Menschen aus, auch wenig über die Fähigkeit zur Integration. Seither sehe ich die Frage des Kopftuchs sehr viel entspannter.
Vielleicht wird man im Rückblick auf jene Jahre weniger über den islamistischen Terrorismus in Deutschland reden als über den rechten Terror. Die Aufdeckung der Morde des Nationalsozialistischen Untergrunds im Jahr 2012 war zu monströs, als dass sich mir die Dimension sofort erschlossen hätte. Mittlerweile sind rechtsterroristische Straftaten nicht nur an der Tagesordnung, sie haben längst auch linksterroristisch oder islamistisch motivierte Straftaten als Spitzenreiter in der Statistik verdrängt. In dieses Gesamtbild passt die Gründung der AfD im Februar 2013. Ursprünglich als Protestbewegung gegen die Euro-Rettungspolitik konzipiert, ist sie längst zu einem Sammelbecken rechter, völkischer, populistischer und identitärer Kräfte geworden, die dem Rechtsterrorismus die ideologische Munition liefern. Das ist aus meiner Sicht eine neue Entwicklung: Die damit einhergehende Enthemmung und Entzivilisierung in der politischen Kultur. Es ist eine Radikalisierung des Konservativismus, mit fließenden Grenzen zum Antisemitismus, zur Islamfeindlichkeit, zur Reichsbürgerbewegung, zu den Querdenkern und Verschwörungstheoretikern.2 Und es ist kein deutsches Phänomen. Österreich unter Sebastian Kurz, Ungarn unter Victor Orban, Polen unter Jaroslaw Kaczynski und der PIS; Marine le Pen in Frankreich, die Fratelli d’Italia und die Lega Nord in Italien: Überall wird in Europa jenseits klassischer konservativer Positionen die politische Rechte neu definiert und man bedient sich dabei ungeniert der rechtspopulistischen, identitären, nationalistischen und präfaschistischen Ideologien. Vielleicht werden wir es in einigen Jahren bitter bereuen, den hier sichtbar gewordenen Anfängen nicht energischer widerstanden zu haben.
Kennzeichen der neuen Rechten (und das unterscheidet sie fundamental von den klassischen Konservativen) ist dabei ihre Affinität zu neuen Technologien, vor allem Technologien der Kommunikation, der Manipulation, der Indoktrination. Der Traum dieser Konservativen ist es nicht, mit einem Pferdewagen gemütlich zu nächsten Poststation zu fahren und dort handgeschriebene Briefe in den Postlauf zu geben, sondern die Manipulation mit Hilfe neuer Medien, die Täuschung, Verdrehung von Wahrheit. Donald Trump hat es hier zu einsamer Meisterschaft gebracht. Die Rede von den »alternativen Fakten« erinnert an totalitäre Systeme. Demokratien leben davon, dass sich der demokratische Diskurs um Wahrheit bemüht. Nur so macht die Hoffnung auch Sinn, es könne so etwas wie einen zwanglosen Zwang des besseren Arguments geben, dem sich alle einsichtsfähigen Diskussionsteilnehmer unterwerfen. Die politische Rede als Instrument der Manipulation oder Verschleierung ist mit demokratischen Gesellschaften nicht vereinbar.
Üblicherweise ist es auch die Aufgabe einer freien Presse, dies sicherzustellen. Und wir haben in den vergangenen Jahren der Presse viel zu verdanken. Über die Steueroasen der Reichen berichtete 2013 ein Netzwerk von Journalisten aus 46 Ländern. Später kamen weiter »leaks« aus der Finanzwelt dazu. Der Verdacht erhärtete sich schnell: Die teuersten Flüchtlinge dieser Welt sind die Steuerflüchtlinge. Das setzt die Kosten in Relation. Journalisten berichten vor Ort über das Elend der Flüchtlinge, über die Verbrechen von Regimen von Russland bis nach Syrien, oft auch unter Gefahr für Leib und Leben. Das fand ich immer mutig und vorbildlich. Auch und gerade Journalisten in Ländern, in denen die Pressefreiheit wenig gilt. Nein, die Pressefreiheit ist wichtig und ein hohes Gut. Es muss aber auch verantwortlich gebraucht werden. Denn manchmal schlagen Sensationsgier und Neuigkeitswahn auch um und die dunklen Seiten des Journalismus werden sichtbar. Die Jagd auf den damaligen Bundespräsidenten Christian Wulff ist ein besonders trauriges Kapitel, in dem einige Journalisten alle Kriterien des journalistischen Ethos und Anstands über Bord geworfen haben. Leider keine Ausnahme im politischen Berlin, wo das Tagesgeschäft auch für die Journalisten sehr rau geworden ist.
Ein Megatrend, der während der zwölf Jahre sich immer mehr in den Vordergrund gedrängt hat, ist das Thema Nachhaltigkeit und globale Erwärmung. In der ersten Legislaturperiode war ich Mitglied und stellvertretender Vorsitzender der Enquete-Kommission »Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität«. Die drei Jahre, die ich dort mitgearbeitet habe, waren inhaltlich die größte Bereicherung: Zum einen wegen der Kolleginnen und Kollegen, die dort in der Kommission mitgearbeitet haben und ihr Wissen, ihre Leidenschaft eingebracht haben; zum anderen wegen der intensiven thematischen Arbeit, die wir dort geleistet haben. Ich bin seither davon überzeugt: In den nächsten Jahren und Jahrzehnten wird der sozialökologische Umbau des Wirtschaftens entscheidend für die Frage sein, ob wir auf diesem Planeten dauerhaft leben können oder ob es sinnvoller ist, wie Stephen Hawking einmal geunkt hat, dass wir uns einen oder mehrere neue Planeten suchen. Die Debatten darüber, wie das zu bewerkstelligen ist, haben mich über diese zwölf Jahre immer wieder begleitet: Sei es in Gesprächen mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern, durch das Aufkommen der Fridays for Future-Bewegung, die endlosen und zähen Debatten vom Kohleausstieg bis hin zum Ausbau erneuerbarer Energien. Ich bin mittlerweile überzeugt: Wir können das schaffen. Es gibt keinen Grund für eine Weltuntergangsstimmung, auch wenn ich manchmal skeptisch war. Wir können es schaffen. Und wenn wir in dreißig Jahren auf diese zwölf Jahre zurückblicken, hoffe ich: wir werden sie als Achsenzeit eins neuen ökologischen Bewusstseins wahrnehmen und vielleicht den Mut bewundern, mit der damals die Weichen für eine neue Form des Wirtschaftens gestellt worden sind.
Schließlich: Die letzten beiden Jahre im Deutschen Bundestag waren durch die Corona-Pandemie gekennzeichnet. Das hat vieles verändert. Ab März 2020 sind Präsenzveranstaltungen ausgefallen, und auch die parlamentarische Arbeit hat sich verändert. Sehr viel entscheidender sind aber zwei Dinge. Zum einen hat die Pandemie, der Not gehorchend, einige Entwicklungen beschleunigt, die bereits im politischen Raum debattiert worden sind, vor allem die Frage von mobilem Arbeiten und Homeoffice. Das wird sicherlich Auswirkungen haben, etwa bei der Frage der Dezentralisierung von Arbeit und dem damit vielleicht auch verbundenen Effekt, dass der Druck auf die Wohnungsmärkte in urbanen Ballungsräumen abnimmt. Zum zweiten hat die Pandemie viel Solidarität offengelegt, viel Zusammenhalt, denn es waren schwere Jahre, gerade auch, was die Zumutungen mit lockdowns und immer wiederkehrenden Wellen anging. Gleichzeitig wurde aber auch ein Bodensatz an asozialem Verhalten deutlich. Die so genannten »Querdenker« waren und sind eine Verfallserscheinung des öffentlichen Gebrauchs der Vernunft, eine Manifestation von Menschen, die nur an sich selbst denken und denen die Gemeinschaft egal ist.
Ob dies langfristig im Gedächtnis der Menschen bleiben wird, kann ich nicht sagen. Die Anzahl der Verrückten und Verschwörungstheoretiker scheint über die Zeit relativ stabil, denn auch die Einführung der Impfpflicht gegen die Pocken in Deutschland im Jahr 1874 ist von den wildesten Fantasien, Gerüchten und Verschwörungstheorien begleitet worden. Irgendwie scheint die These, dass Dummheit doch nur mit einem Mangel an Information zusammenhängt, nicht zu stimmen. Die Information ist heute breit verfügbar. Aber viele sind offenbar nicht in der Lage, Richtiges von Falschem zu unterscheiden. Denn auch die Lüge kommt als Information daher. Ich hatte dann und wann Anwandlungen, daran zu verzweifeln. Andererseits: Die übergroße Mehrheit der Menschen fällt nicht darauf rein. Die Lautstärke der öffentlichen Präsenz erweckt manchmal den Eindruck, hier artikuliere sich eine schweigende Mehrheit. Das Gegenteil ist der Fall. Und ich hoffe sehr, dass dies auch so bleibt. Selbstverständlich ist es nicht, wie das traurige Beispiel der USA zeigt.
Warum ist das wichtig? Weil aus meiner Erfahrung ein Parlament als repräsentatives Organ der Bürger nur dann vernünftig arbeiten kann, wenn diese Arbeit von einer deutlichen Mehrheit auch gestützt wird. Gelegentliche Kritik ist davon unberührt, es wäre seltsam, wenn es keine gäbe. Aber zur parlamentarischen Arbeit gehört ein Grundvertrauen der Bürger darin, dass der Bundestag seine Arbeit ordentlich macht, dass er dem Gemeinwohl verpflichtet ist, nicht dem Eigennutz der Parlamentarier. Deswegen hat die Maskenaffäre auch solche Erschütterungen hervorgerufen. Es mag legal sein, sein Mandat dazu zu nutzen, Geld zu verdienen. Ich finde es aber in hohem Maße illegitim. Parlamentarier werden gut entlohnt und müssen sich nicht noch käuflich machen. Sie müssen auch keine Provisionen kassieren für Maskendeals. Das schadet dem Ansehen des Parlaments und auch der Demokratie.
Parlamentarier sind, das ist für mich eine Erfahrung gewesen, die Transmissionsriemen zwischen dem, was in Berlin passiert und dem, was die Menschen vor Ort denken. Nicht immer wird man jeden im Wahlkreis restlos von der erhabenen Weisheit und Wahrheit der politischen Arbeit in Berlin überzeugen können. Aber man muss es immer wieder versuchen. Man muss erklären, begründen, werben. Man schuldet den Wählerinnen und Wählern im Wahlkreis nicht, dass man ihre Meinung vertritt. Der Abgeordnete ist an Aufträge und Weisungen nicht gebunden, so steht es im Grundgesetz. Man schuldet ihnen aber eine Erklärung, eine Begründung für das, was man in der Regierung beschlossen hat – oder alternativ, warum man als Opposition die Dinge gänzlich anders sieht. Mehr kann man nicht von einem Abgeordneten erwarten – aber auch das ist schon verdammt viel.
Was wird für mich persönlich bleiben nach den zwölf Jahren? Sicherlich ein Gefühl der Dankbarkeit, mitgestalten zu können, Dankbarkeit über intensive Lernprozesse und über viele Freundschaften, Dankbarkeit aber auch dafür, als Politikwissenschaftler einmal auf der anderen Seite des Zauns gewesen zu sein, bei denen nämlich, die ich als Wissenschaftler zuvor bei ihrem Tun beobachtet und nicht selten voller Verzweiflung ausgerufen habe, wie man denn so blind sein könne, das Offensichtliche nicht zu sehen oder zu tun. Da haben mich die zwölf Jahre doch ein wenig Demut gelehrt. Auch im Bundestag gibt es eigene Gesetze, eigene Prozesse, die sich nicht immer glasklar mit den Kategorien der wissenschaftlichen Rationalität fassen lassen. Es menschelt halt. Und es wäre erstaunlich, wenn dem nicht so wäre.
3. Die Bundeskanzlerin
Sie war schon vorher da und blieb es die ganzen zwölf Jahre: Bundeskanzlerin Angela Merkel.3 Es war ihre Ära, ihre Zeit. In den Geschichtsbüchern wird ihre Geschichte erzählt werden, die Entscheidungen ihr zugerechnet. Minister und Ministerinnen kamen und gingen, die Kanzlerin blieb. An viele Namen erinnert man sich schon heute nicht mehr. Und auch für die Parlamentarier gilt: sie sind in der Rückschau auf die Kanzlerschaft Angela Merkel allenfalls eine historische Fußnote. Deswegen steht die Kanzlerin einsam aus der Geschichte heraus, oder besser: die Zeit ist mit ihrem Namen verbunden, im Guten wie im Schlechten.
Ganz oben, an der Spitze der Politik, ist es einsam. Man ist nie allein, aber schwierige Entscheidungen muss man am Ende selbst verantworten. Besser noch: Man wird dafür verantwortlich gemacht, auch wenn es selten Entscheidungen sind, die allein und im stillen Kämmerlein gefällt worden sind. Was ist in den Jahren alles behauptet worden: Angela Merkel hätte den Atomausstieg beschlossen, das Ende der Wehrpflicht besiegelt, die Grenzen geöffnet, die Russen zu nachsichtig behandelt, die deutschen Sparer geschädigt. Bisweilen wird man als Kanzler auch verantwortlich gemacht für Entscheidungen, die überhaupt nicht in die Zuständigkeit des Bundes fallen, wenn etwa die Verantwortung für das Ende der Hauptschulen, kaputte Schultoiletten oder fehlende Krippenplätze auch dort abgeladen wird. Kein deutscher Politiker ist so medial präsent wie ein Kanzler (oder eben eine Kanzlerin), auch dann, wenn er oder sie selten die Öffentlichkeit sucht. Bundeskanzler sein heißt: Man ist der bekannteste Politiker bzw. die bekannteste Politikerin, alle anderen Namen in der Politik sind nachrangig; und dem Bundeskanzler wird zugetraut, dass er alles richtet. Dabei ist das Amt des Bundeskanzlers mit wesentlich weniger Kompetenzen ausgestattet als sie der amerikanische oder französische Präsident genießen. Der Föderalismus tut ein Übriges, um die Bäume des Machthungers im Kanzleramt nicht in den Himmel wachsen zu lassen. Kanzler sind überdies an einen Koalitionsvertrag gebunden. Im Verlauf der Jahrzehnte sind diese Koalitionsverträge immer umfangreicher geworden, ganz so, als könne man für die vorausliegenden vier Jahre en detail bestimmen, was gemacht werden muss. Aber die eigentlichen Bewährungsproben sind die, die nicht im Koalitionsvertrag stehen, die sich einfach ereignen. Darauf müssen Regierungen dann reagieren, und hier zeigt sich Führung dann in besonderem Maß.
Führung besteht aus zwei Komponenten, zumindest im Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland. Die eine Komponente ist ganz formal die Richtlinienkompetenz eines Bundeskanzlers. Sie ist in Artikel 65 des Grundgesetzes festgelegt. Dort heißt es lapidar: »Der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung.« Innerhalb der Richtlinien, die der Bundeskanzler ausübt, gilt das Ressortprinzip: Die einzelnen Minister führen die Ressorts in eigener Verantwortung. Das ist mitunter nicht leicht voneinander abzugrenzen, zumal sich das Kanzleramt in den letzten Jahrzehnten immer mehr zu einer Koordinationszentrale für die Bundesregierung als Ganzes entwickelt hat. Das ist besonders wichtig für die Gesetzgebung. Die Bundesregierung spricht immer als Einheit. Das ist das Kollegialprinzip. Und Gesetzentwürfe der Bundesregierung haben mitunter von den ersten Referentenentwürfen in den Ministerien bis zur Verabschiedung im Kabinett einen langen Weg hinter sich. Dem Kanzleramt obliegt es, die unterschiedlichen Positionen einzelner Ministerien zu Gesetzentwürfen eines Ministeriums zu einem einheitlichen Ganzen zusammenzufügen. Erst dann wird der Gesetzentwurf im Kabinett beschlossen und schließlich dem Bundestag zugeleitet.
Die zweite Komponente ist die persönliche Autorität. Die gehört zur Grundausstattung eines jeden Amtsinhabers. Fast alle haben lange politische Kämpfe zu bestehen gehabt, um schließlich im Kanzleramt anzukommen. Das prägt. Die Techniken der Macht sind allen eigen. Und ein ganz persönliches Charisma auch. Man darf sich unter Charisma nicht den polemisch auftretenden Volkstribun vorstellen, der alle Register der Rhetorik zieht. Manchmal kommt Charisma auch ganz anders daher – und verwandelt sich dann im Kanzleramt. Bei Angela Merkel lag es darin, dass sie sich nie aus der Ruhe bringen ließ, eine stupende Sachkenntnis besaß und die politischen Fragen auch strategisch beurteilen konnte. Ihre Rhetorik war nie aufgeregt – »ich würde mich ja sogar aufregen, wenn es helfen würde« , sagte sie einmal kokett – sondern immer nüchtern, analytisch, beinahe trocken. Man spürte bisweilen, dass ihr auch der Schalk im Nacken sitzen konnte, aber sie war fast immer reserviert, zurückhaltend. Sie zeigte selten Betroffenheit oder Gefühle. Vielleicht lag das auch daran, dass das Kanzleramt eine Art »Todeszone« ist, wie Joschka Fischer es einmal formuliert hat. Man steht unter dauernder Beobachtung, jeder Fehler wird registriert und kann gegen einen verwendet werden; jede falsche Formulierung kann zum Skandal aufgeblasen werden, jede Unsicherheit in Daten oder Fakten kann die gesamte Politik in Frage stellen, Gefühle gelten als Schwäche. Freundschaftliche Beziehungen sind selten, denn jeder andere Politiker ist ein möglicher Konkurrent und könnte Schwächen ausnutzen. Kleine menschliche Fehler – mal zu viel getrunken, mal übermüdet im Plenum nach einer langen Verhandlungsnacht eingenickt – werden gnadenlos thematisiert, und kleinste Anzeichen gesundheitlicher Probleme werden öffentlich breitgewalzt. Helmut Schmidt beispielsweise hat aus gutem Grund verschwiegen, dass er mehrmals ohnmächtig im Kanzleramt zusammengebrochen ist, teilweise minutenlang; er sei nie ganz gesund gewesen, bekannte er später. Krankheit ist Schwäche und wird deswegen unter den Teppich gekehrt, Krankheit kann man sich »nicht leisten«. Auch Angela Merkel war da keine Ausnahme. Ihr Zitteranfälle? Harmlos, zu wenig getrunken. Ihr Skiunfall mit angebrochenem Beckenring ließ sich nicht verheimlichen, machte sie aber eher sympathisch. Sie war nicht beim Golfen verletzt worden, sondern ganz banal beim Skilanglauf auf alten Skiern gestürzt. Das kann jedem Mal passieren. Ein »Po-falla« , lästerten einige unter Anspielung auf den Namen des damaligen Kanzleramtsministers. Aber wenigstens eine sportliche Kanzlerin.
Es gehört ein dickes Fell dazu, dieses Amt auszuüben; man muss einiges an sich abprallen lassen. Sentimentalitäten kann man sich nicht leisten. Jeder wusste, wie eng befreundet die Kanzlerin mit Annette Schavan war und ist. Aber als sie wegen eines angeblichen Plagiats in Bedrängnis geriet, musste sie als Ministerin gehen. Noch schlimmer traf es Norbert Röttgen. Nach seiner verlorenen Wahl in Nordrhein-Westfalen hat ihm die Kanzlerin den Stuhl vor die Tür gesetzt. Machterhalt ist, ebenso wie der Kampf um die Macht, kein Kampf mit Wattebäuschchen. Man geht zwar freundlich und zivilisiert miteinander um, aber Freundschaften, belastbare zumal, gibt es auf dieser Ebene der Politik kaum. Man lässt sich nicht in die Karten schauen und auch nicht die Butter vom Brot nehmen. Die engsten Mitarbeiter von Angela Merkel waren entweder selbst nicht politisch aktiv und wenig öffentlich präsent (vor allem ihre Büroleiterin Beate Baumann und ihre Medienberaterin Eva Christiansen), oder als Politiker hoch loyal und gleichzeitig nur begrenzt ambitioniert (wie die Kanzleramtsminister Thomas de Maiziere, Peter Altmaier und Helge Braun).
Und man muss aufpassen, wem gegenüber man offen redet und wo man dies besser unterlässt. In der Fraktion hat sich Angela Merkel den Luxus des offenen Worts nie geleistet. Zu sehr war ihr klar: Jedes Wort von ihr wird durchgestochen, findet sich wenige Augenblicke später in der Presse wieder. Sie hat begründet, strukturiert, strategische Linien aufgezeigt, aber nie etwas preisgegeben, was nicht schon auf dem Markt der Informationen gehandelt worden ist. »Ich könnte jetzt etwas tiefer gehen« , hat sie bisweilen gesagt, »aber dann steht es ja sofort in der Presse.« Ein wenig Bedauern schwang da mit über eine Fraktion, die löchrig war wie ein Sieb und nichts für sich behalten konnte. Das hat eben leider auch dazu geführt, dass bisweilen wichtige Zusammenhänge nicht klar wurden, zumal dann, wenn das Verhalten anderer wichtiger Akteure damit ins Rampenlicht geraten wäre. Illoyal war Angela Merkel nie, auch wenn sie sich damit selbst hätte entlasten können. Sie beließ es bei vagen Andeutungen, aus denen der kundige Thebaner sich etwas zusammenreimen konnte, ohne allerdings die Kanzlerin als Quelle nennen zu können.
In all den Jahren war sie bei fast jeder Fraktionssitzung am Dienstagnachmittag dabei, von 15 Uhr bis meist sogar gegen 18 Uhr. Den Fraktionsvorstand am Montag nahm sie nie wahr, aber vor der Fraktion hat sie immer wieder die Linien ihrer Politik erläutert und ist dabei auch keiner Debatte ausgewichen. Meist kam sie nach einleitenden Worten des Fraktionsvorsitzenden zu Wort, in einer Form allgemeiner Aussprache. Sie hatte meist nur wenige handschriftliche Notizen, auf die sie sich stützte; aber auch zu Details von Gesetzesvorhaben meldete sie sich zu Wort, wenn die Notwendigkeit bestand. Ging es noch tiefer in die Gesetze hinein, waren ja meist auch die Fachminister der Union oder der Kanzleramtsminister anwesend, die vertieft Auskunft geben konnten. Das war nicht ohne Risiko. Bei der Frage etwa, ob die Grenzen für Flüchtlinge effektiv geschlossen werden konnten, haben in der Fraktion einige Innenpolitiker eine fachlich gut begründete andere Meinung vertreten. Hier wurde dann die Erfahrung der Kanzlerin deutlich, die das nicht nur als reine Fachfrage behandelte, sondern in größere politische Zusammenhänge einbetten konnte.
Offener war Angela Merkel bei Treffen im Kanzleramt. Regelmäßig lud sie beispielsweise auch die Arbeitnehmergruppe der Union ein. Bei einem kleinen Abendessen kam man miteinander ins Gespräch, und hier war sie weniger distanziert, auch offener, ja beinahe fröhlicher. Hier merkte man auch ihre Schlagfertigkeit, ihren Witz. Und aus diesen Runden wurde nie etwas durchgestochen. Sie ließ sich berichten über das, was uns bewegte, zeigte sich immer gut vorbereitet und diskussionsfreudig, auch nach langen und überlangen Tagen. Der Alltag einer Kanzlerin ist nämlich nur wenig dadurch bestimmt, dass man bei schöner Musik die Aussicht aus dem Kanzleramt genießt. Die Termine sind von früh bis spät dicht getaktet, tagein, tagaus. Für Privates bleibt wenig Zeit, und im Urlaub ist man selbstverständlich im Dienst. Urlaub ist nichts anderes als die vorübergehende Verlegung der Arbeit an einen Urlaubsort, unter gelegentlicher Einstreuung von Freizeitkomponenten. Wirklich abschalten vom Kanzlerjob kann man da nicht.
Angela Merkel hatte neben den großen Linien, neben den Haupt- und Staatsgeschäften, auch die Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion im Blick. Schrieb man sie persönlich an, etwa, weil man eine Frage nicht vor dem Forum der Fraktion stellen wollte, konnte es passieren, dass man einen Telefontermin bekam. Ich hatte mich einmal brieflich skeptisch geäußert zu ihrer Russlandpolitik. Wenige Tage später rief das Kanzleramt an und fragte einen Telefontermin an. Sie rief dann an dem darauffolgenden Sonntag an und erklärte mir fast eine dreiviertel Stunde lang ihre Beweggründe. Nicht jeder politisch Verantwortliche hätte das getan – und es hat meine Hochachtung vor ihrer Leistung und ihrem Arbeitspensum nur noch verstärkt.
In der Wissenschaft wird behauptet, Merkel habe von einem pragmatischen Regierungsstil in den ersten beiden Legislaturperioden zu einer Führung durch Überzeugung (conviction leadership) gefunden.4 Dabei ist die Führung durch Überzeugung dadurch gekennzeichnet, dass man dafür auch Verluste bei den Wahlen hinnimmt. Und es stimmt: In der Legislaturperiode 2013-2017 haben zwei Ereignisse in besonderer Weise die Kanzlerschaft und die Koalition auf die Probe gestellt: Das erneute Rettungspaket für Griechenland, obwohl zuvor heilige Eide geschworen worden waren, dass es nicht dazu kommen werde, und vor allem die Flüchtlingspolitik. Es stimmt allerdings auch, dass die Kanzlerin sich schon vorher bei einer Frage mit dem Gewicht ihres Amtes und ihrer Persönlichkeit in einer Frage besonders exponiert hat. Der Atomausstieg 2011 ging wesentlich auf ihr Drängen zurück. Die Explosion in Fukushima hatte ihr Vertrauen in diese Technik grundlegend erschüttert. Mit dem Gewicht ihrer naturwissenschaftlichen Ausbildung warb sie in der Fraktion für einen Kurswechsel. Freilich, die Frage war damals nicht hoch kontrovers. Zwar hatte der Koalitionsvertrag von 2009 am Grundsatz des Ausstiegs aus der Kernkraft nichts geändert, aber die partiellen Laufzeitverlängerungen, auf die man sich damals – auch zur Finanzierung der Energiewende – geeinigt hatte, wurden nun zurückgenommen. Aber hier zeigte sich wohl zu ersten Mal eine Kanzlerin, die nicht nur moderiert, sondern auch die Initiative ergreift und von vorne führt. In der Frage neuer Griechenlandhilfen kam es sogar zum Konflikt mit Finanzminister Wolfgang Schäuble, der eine Zeitlang das geordnete und vorübergehende Ausscheiden Griechenlands aus dem Euro befürwortete. In der Eurogruppe selbst hatte es gar eine Mehrheit von 15:3 für ein Ausscheiden Griechenlands aus dem Euro gegeben. Die Sommermonate 2015 waren hier voller Dramatik. Griechenland hatte einen neuen Präsidenten, der sich den Vorgaben zur Stabilisierung der griechischen Finanzen nicht mehr beugen wollte, einen neuen Finanzminister, der dies auf internationaler Bühne mit Verve vortrug. Angela Merkel hatte wohl kurzfristig mit einem Ausscheiden Griechenlands geliebäugelt, sah aber auch, dass dies möglicherweise einen Bruch mit Frankreich nach sich ziehen könnte. Am Ende lenkte die griechische Regierung ein; die Krise war bewältigt, aber die nächste wartete schon hinter den Kulissen.
Über die Flüchtlingskrise ist viel geschrieben worden, und es gibt auch gute Analysen darüber, wie die Entscheidungen zustande kamen.5 Hier wurde eine neue Seite an Angela Merkel deutlich, ein beinahe lutherisches »Hier stehe ich, ich kann nicht anders.« Ihre Haltung beruhte, wenn ich es richtig interpretiert habe, auf zwei Argumenten. Zum einen die realpolitische Gefahr eines Auseinanderfallens der EU, einer Destabilisierung der Staaten in Ost- und Südosteuropa für den Fall, dass Deutschland die Flüchtlinge zurückweisen würde. Zweitens aber auch auf einer tief verstandenen humanitären Verpflichtung, die sich aus dem christlichen Grundverständnis ergab. Für diese beiden Grundüberzeugungen war sie auch willens, Risiken einzugehen. Wir wissen, dass sie nicht unbedingt eine vierte Amtszeit angestrebt hatte, aber vom ehemaligen amerikanischen Präsidenten Barack Obama in die Pflicht genommen worden ist. Der Westen brauche nun auch leadership gegenüber dem neuen amerikanischen Präsidenten Trump, so die Argumentation. In jedem Fall: Sie hat noch einmal kandidiert und ein schlechtes Wahlergebnis eingefahren. Aber, auch das gehörte zu ihr: Sie blieb bei ihrer Flüchtlingspolitik, trotz des zunehmenden Gegenwinds in der öffentlichen Meinung. Und auch nach den Wahlen 2017 hat sie ihre Politik verteidigt, ja es kam sogar fast zum Bruch mit der CSU über die Flüchtlingspolitik. Hatte man ihr zu Beginn der Kanzlerschaft eine gewisse programmatische Beliebigkeit vorgeworfen, konnte dieser Vorwurf nun als entkräftet gelten. Von Seiten des christlich-sozialen Flügels der CDU haben wir das unterstützt und haben uns auch untereinander stärker vernetzt als je zuvor. Die Kanzlerin war nun die Kämpferin für Humanität und Menschenrechte, für das »C« in der CDU. Das hat geprägt, vor allem in der letzten Legislaturperiode, in der die Kämpfe um ihre Nachfolge ausbrachen und zum Teil hässliche Züge angenommen hatten.6
Wenn ich auf die zwölf Jahre zurückschaue, erscheint mir Angel Merkel als starke und erfolgreiche Kanzlerin, dabei unprätentiös, in gewisser Weise preußisch, mit strategischem Weitblick und analytischer Tiefe ausgestattet. Es gibt sicherlich kein spezifisch weibliches Amtsverständnis, auch kein spezifisch ostdeutsches. Aber Angela Merkel war nicht im Westen sozialisiert und daher auch nicht in ein »old boys« Netzwerk eingebunden; das gab ihr eine gewisse Unabhängigkeit. Ihr Abgang war etwas holprig, aber erfolgreich: Alle ihre Vorgänger waren nicht freiwillig aus dem Amt geschieden. Sie verließ das Kanzleramt unbesiegt. Auch das könnte stilbildend werden, wie so vieles in ihrer Kanzlerschaft, von der man zu Recht als einer Ära sprechen kann.