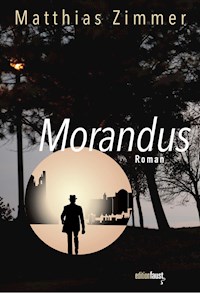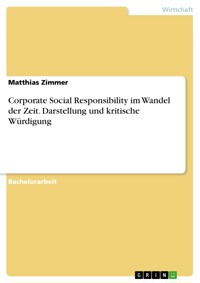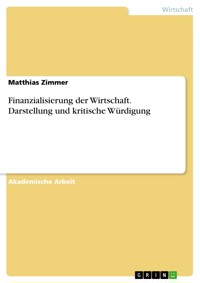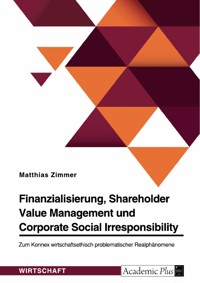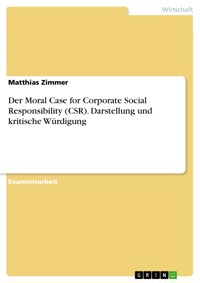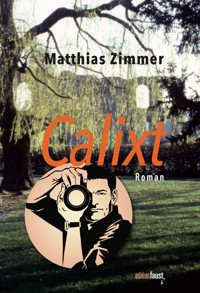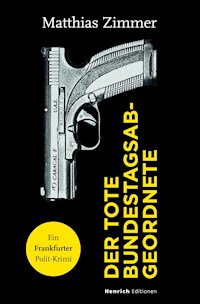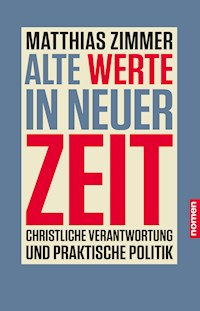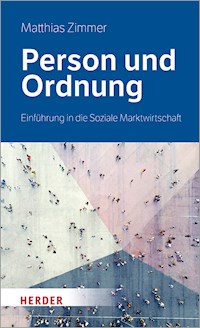
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Soziale Marktwirtschaft ist populär und Bestandteil der kollektiven DNA der Deutschen. Ihr verdanken wir nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs den wirtschaftlichen Aufschwung in der Bundesrepublik und Jahrzehnte wirtschaftlicher Prosperität. Als die Wiedervereinigung Deutschlands vollzogen wurde, sollte das gleiche Rezept nun auch die neuen Länder zu wirtschaftlich blühenden Landschaften umgestalten. Soziale Marktwirtschaft ist allerdings auch eine Projektionsfläche. Wir wissen häufig nur, was sie nicht ist. Was also ist Soziale Marktwirtschaft und was zeichnet sie aus? Darauf gibt dieses Buch Antworten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Matthias Zimmer
Person und Ordnung
Einführung in die Soziale Marktwirtschaft
Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2020
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Verlag Herder
Umschlagmotiv: © Orbon Alija / iStock / Getty Images
Konvertierung: Daniel Förster
ISBN (E-Book): 978-3-451-81948-3
ISBN (Buch): 978-3-451-39984-8
Inhalt
Vorwort
1 Einleitung
2 Ordoliberalismus und katholische Soziallehre als Quellen der Sozialen Marktwirtschaft
Ordoliberalismus und Marktwirtschaft
Katholische Soziallehre und Personalität
Konvergenzen und Divergenzen
3 Kapitalismus, Fortschritt und Marktwirtschaft
4 Grundlagen der Sozialen Marktwirtschaft
Menschenwürde und Menschenrechte
Grenzen des Marktes
Bedürfnisse und Bedarfe
5 Grundprinzipien der Sozialen Marktwirtschaft
Subsidiarität
Eigentum, Miteigentum, Mitbestimmung
Wettbewerb, Konkurrenz, Solidarität
Exkurs: Grenzen der Solidarität
Risiko, Gewinn und Haftung
Familie
Gerechtigkeit
6 Grundprobleme der Sozialen Marktwirtschaft
Arbeit und Identität
Ungleichheit, Armut und Reichtum
Ordnungspolitische Sünden- und Grenzfälle
7 Die praktische Ausgestaltung der Sozialen Marktwirtschaft
Neuorientierung und erste Weichenstellungen
Bewältigung der Kriegsfolgen und Wirtschaftswunder
Ausbau des Sozialstaats und Globalsteuerung
Neubau des Sozialstaats und Wiedervereinigung
Soziale Marktwirtschaft in der Globalisierung
8 Herausforderungen der Sozialen Marktwirtschaft
Die Globalisierung und ihre Folgen
Industrie 4.0 und der Wandel der Arbeitswelt
Grenzen des Wachstums
9 Über den Tellerrand der Sozialen Marktwirtschaft oder: Wie wollen wir leben?
Abkürzungen
Literaturverzeichnis
Über den Autor
Vorwort
Bücher haben ihre Entstehungsgeschichte und ihr Anliegen. Zu der Entstehungsgeschichte dieses Buches gehört eine lange Zugehörigkeit im Ausschuss für Arbeit und Soziales des Deutschen Bundestages, die mich nicht nur mit praktischen Problemen der Arbeitswelt und der sozialen Sicherung konfrontiert hat, sondern mich auch immer wieder herausgefordert hat, mich mit den Grundlagen der Sozialen Marktwirtschaft zu beschäftigen. Was bedeutet es, wenn jemand von einem »ordnungspolitischen Sündenfall« spricht? Was steckt dahinter, wenn die Subsidiarität beschworen wird? Was unterscheidet die Rede von der »Solidarität« in den unterschiedlichen Parteien? Und überhaupt: Welche Rolle spielen Menschenbilder bei der Ausgestaltung einer Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialordnung? Mit diesen Fragen habe ich mich immer wieder beschäftigt und dadurch nebenher die Klassiker des Ordoliberalismus ebenso gelesen wie die großen Künder der katholischen Soziallehre. Dabei sind mir drei Dinge klar geworden. Zum Ersten, dass an der Aussage, die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik sei die Königsdisziplin der Politik, etwas dran ist: nicht nur wegen der Vertracktheit der Materie, sondern auch der philosophischen Tiefe, die man in der Begründung der Menschenbilder finden kann. Zum Zweiten ist mir deutlich geworden, wie eng verzahnt Ordoliberalismus und Soziallehre sind, die ja beide für den sozialen Gestaltungsauftrag in der Union eine eminent wichtige Rolle spielen. Und schließlich drittens, wie stark sich doch die grundlegenden parteipolitischen Orientierungen schon in diesen Grundannahmen über Mensch und Gesellschaft unterscheiden, mehr noch: Wie stark diese Grundannahmen auch formbildend sind für das wirtschafts- und sozialpolitische Wollen. Von der Verwechselbarkeit von politischen Positionen in der heutigen Zeit auszugehen kann deshalb nur eine bedauerliche Folge mangelnder Information und nicht zureichenden Nachdenkens sein. Ich habe im Ausschuss bisweilen mit Freude festgestellt, dass diese These auch von klugen Politikern aus anderen Fraktionen geteilt wird.
Das Anliegen des Buches ist kein primär wissenschaftliches. Ich beabsichtige nicht, neue Erkenntnisse zu präsentieren oder ein Lehrbuch zu schreiben. Ich will aber aus den beiden Perspektiven, der wissenschaftlichen wie der politisch-praktischen Beschäftigung mit der Sozialen Marktwirtschaft, an das Thema selbst heranführen, und auch ein wenig von dem Enthusiasmus teilen, mit dem ich seit meinem Einzug in den Deutschen Bundestag dieses Feld beackere. Wenn es auf diese Weise auch ein wenig Einführung und Hinführung zu dem Thema bewirkt für interessierte Laien, angehende oder aktive Politiker oder schlicht Menschen, die sich fragen, wie denn Politik tickt, wäre der Zweck dieses Buches vollends erfüllt. Allerdings sei auch ein caveat hinzugefügt: Meine Betrachtung der Sozialen Marktwirtschaft ist eine aus der Sicht der Union, ich bin gewissermaßen Partei. Ich kann und will nicht für die Menschen- und Weltbilder anderer im Bundestag vertretener Parteien sprechen und wie sich diese Perspektiven auf ihre Sicht der Sozialen Marktwirtschaft auswirken. Ich werte und bewerte. Aber ich finde, dass dies eine lässliche Sünde ist, weil ja auch die Soziale Marktwirtschaft dadurch gekennzeichnet ist, dass sie den Mut zu Werturteilen hat.
Im Verlaufe des Schreibens fallen Dankesobligationen an. Da ist zunächst einmal der Dank an die Freunde in der CDA, der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft, in der die Soziallehre der zentrale Bezugspunkt ist. Über die Jahre haben wir konstruktiv debattiert, gestritten, sozialpolitische Themenstellungen vermessen, aber auch viele gute Entscheidungen auf den Weg gebracht. Ein besonderer Dank geht an Karl Schiewerling, der als Leiter der Unionsarbeitsgruppe Arbeit und Soziales im Deutschen Bundestag zwischen 2009 und 2017 meine Ausflüge in die Tiefen des Grundsätzlichen nicht nur ertragen hat, sondern durch seine tiefe Verwurzelung in der Soziallehre dafür auch Verständnis hatte. Er hat mich, nach seinem Ausscheiden aus dem Deutschen Bundestag, als Vorsitzender der Stiftung Christlich-Soziale Politik in Königswinter ausdrücklich ermuntert und unterstützt, dieses Buch zu schreiben.
Der zweite Dank geht an die Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss Arbeit und Soziales, die mich immer wieder durch ihre Sachkenntnis angeregt haben. Dabei hat sich gezeigt: Die Leidenschaft für die Themen trägt bisweilen über die Differenzen, die es naturgemäß zwischen den Fraktionen und manchmal auch innerhalb einer Fraktion gibt.
Mein dritter Dank geht an die Kolleginnen und Kollegen der Fraktion, die in der Wirtschaftspolitik zu Hause sind und sich stärker als ich der Tradition des Ordoliberalismus zugeneigt sehen. Mit ihnen hatte ich manche Debatte, die immer wieder aber in der Erkenntnis mündete: Die besten Momente hat die Union dann, wenn sie sich auf die Gemeinsamkeiten aus Ordoliberalismus und Soziallehre besinnt und nicht das Trennende hervorhebt.
Mein vierter Dank geht an all jene, die zu der Entstehung des Buches beigetragen haben, wissentlich oder unwissentlich. Da sind zunächst die Mitarbeiter, die mir immer wieder bei der Beschaffung von Lesestoff behilflich waren, Sachfragen recherchiert haben und dann auch eine kluge Auswahl getroffen haben: Felix Meier, Torsten Diessner und Julia Wandrey. Kevin Bornath und Dr. Steven Kunert waren wertvolle Sparringspartner. Steven und Torsten haben das Manuskript dann auch gelesen und zu seiner inhaltlichen und formalen Verbesserung beigetragen. Für dieses Vertrauen der offenen Ansprache meinen herzlichen Dank – und trotzdem habe ich mich bisweilen dickköpfig verhalten, was bedeutet: Die Unzulänglichkeiten gehen auf meine Kappe.
Zwei Freunde müssen noch separat gewürdigt werden. Prof. Dr. Hermann Ott war mein Bundestagskollege von 2009 bis 2013; wir haben zusammen in der Enquete-Kommission »Wachstum, Wohlstand und Lebensqualität« gearbeitet, lange auch in einer Arbeitsgruppe unter seiner Leitung. Nach seinem Ausscheiden aus dem Deutschen Bundestag haben sich der enge Kontakt und das Fachgespräch gehalten, ja, auch die Freundschaft; er konnte mit meiner abweichenden Meinung ebenso gut umgehen wie ich mit der seinen, und wir haben sehr häufig gemeinsamen Grund gefunden. Seiner intellektuellen (und darüber hinausgehenden) Freundschaft verdankt das Buch einiges. Es zeigt, dass auch über Parteigrenzen hinweg eine solche Freundschaft nicht nur möglich, sondern auch fruchtbar ist.
Älter noch ist die Freundschaft zu Prof. Dr. Dieter Haselbach, der mich für die Ordoliberalen begeistert hat. Seit den gemeinsamen Zeiten als DAAD-Dozenten in den 1990ern in Kanada pflegen wir den Austausch und die Freundschaft, die Lust am ironisch zugespitzten Streit ebenso wie das ernsthafte Ringen um das, was mit Sicherheit gesagt werden kann. Dieter hat Teile des Textes vorab gelesen und kommentiert; dafür bin ich ihm sehr dankbar.
Ich vermute allerdings: Beide, sowohl Hermann als auch Dieter, werden das, was ich hier geschrieben habe, mit einem leichten Kopfschütteln zur Kenntnis nehmen, weil es vom Ansatz und den Folgerungen her ihren eigenen Ansätzen eher weniger entspricht. Auf das weitere Gespräch mit ihnen freue ich mich deshalb ebenso wie auf das Gespräch mit denjenigen, denen es ähnlich geht. Immerhin gibt es auch einen Wettbewerb der Ideen, und ich bin überzeugt davon: Die eigentümliche Mischung aus Ordoliberalismus und Soziallehre, die die Basis der Sozialen Marktwirtschaft bildet, ist eine wirkmächtige Idee, die sich nicht verstecken muss, sondern auch in der heutigen Zeit hoch wettbewerbsfähig ist.
Frankfurt am Main im September 2019
Matthias Zimmer
1 Einleitung
Die Soziale Marktwirtschaft ist hochpopulär, wenig umstritten. Sie ist mittlerweile Bestandteil der kollektiven DNS der Deutschen, gleichsam ein Mythos. Der Sozialen Marktwirtschaft verdanken wir nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs den staunenswerten wirtschaftlichen Aufschwung, wir verdanken ihr Jahrzehnte wirtschaftlicher Prosperität.1 Als die DDR zusammenbrach und die Vereinigung Deutschlands vollzogen wurde, tat man dies auch unter Bezug auf die Erfahrungen in der Bundesrepublik in den Jahren des Wiederaufbaus. Das gleiche Rezept würde nun auch die neuen Länder zu wirtschaftlich blühenden Landschaften umgestalten.
Fragt man hingegen, was denn genau die Soziale Marktwirtschaft ausmacht, dann erhält man eine bunte Fülle von Antworten, die sich nur schwer unter einen Hut bringen lassen. Soziale Marktwirtschaft ist wie eine Projektionsfläche, auf der vieles abgespielt werden kann. Wir wissen häufig nur in der negativen Abgrenzung, was keine Soziale Marktwirtschaft ist: das amerikanische Wirtschaftssystem etwa, weil es zu wenig sozial ist, oder der Sozialismus, weil er den Markt knebelt und hemmt. Was also ist Soziale Marktwirtschaft und was zeichnet sie aus? Darauf will dieses Buch Antworten geben.
Schauen wir zunächst auf die Bestandteile des Begriffs Soziale Marktwirtschaft. Es geht zunächst um Wirtschaft, also um die Kulturleistung der menschlichen Daseinsvorsorge unter Bedingungen des Mangels. Wirtschaften muss man dort, wo kein Überfluss herrscht; das Paradies und das Schlaraffenland brauchen weder eine Wirtschaft noch ökonomische Theorien, weil es keine Knappheit gibt. Wirtschaften bezieht sich auf Güter und Dienstleistungen, die zunächst der Daseinsvorsorge dienen. In einem späteren Stadium können die Wirtschaftsprozesse auch von der reinen Daseinsvorsorge entkoppelt sein. Dann geht es, abstrakt gesprochen, um die Befriedigung von Bedarfen, die mit Lebensstilen zu tun haben. Eine Kulturleistung ist Wirtschaft deshalb, weil der rationale Vollzug des Wirtschaftens an bestimmte Voraussetzungen gebunden ist: etwa an rechtliche Rahmenbedingungen und Garantien. Das bedeutet aber auch: Wirtschaft ist kein Schicksal, keine Naturgewalt, sondern ist ein von Menschen gemachter und gestalteter Prozess. Ein zweiter Punkt ist damit mitgedacht, aber nicht explizit ausgeführt: Die Wirtschaft, von der wir hier sprechen, ist eine geordnete Wirtschaft, die von Regeln und Konventionen ausgeht, die also im Wesentlichen friedlich organisiert ist.
Die Wirtschaft bedient sich des Marktes. Der Markt ist ein allgemeiner Begriff für einen realen oder virtuellen Ort, an dem Nachfrage und Angebot miteinander in Beziehung gebracht werden und der Austausch von Waren, Gütern und Dienstleistungen vonstattengeht – im Austausch gegen andere Waren, Güter und Dienstleistungen oder gegen Geld. Markt bedeutet also nicht »Kapitalismus« und Geld, sondern Märkte können auch als Austauschorte auf Naturalbasis organisiert sein.
Der dritte Bestandteil des Begriffs ist das Soziale. Das ist ein in der politischen Debatte häufig verwendeter, emotional hoch aufgeladener Begriff. Dabei spiegelt der Begriff des Sozialen zunächst nur ein Wesensmerkmal des Menschen wider. Thomas von Aquin hat, Aristoteles umdeutend, geschrieben, der Mensch sei ein politisches, also soziales Wesen. Er ist als ein soziales Wesen auf den Mitmenschen hin angelegt, er braucht den Mitmenschen, um seine Ziele zu verwirklichen, um sich zu entwickeln. Das sehen wir in der Kindheit, wo der Mensch ohne die Zuwendung anderer Menschen nicht leben könnte, das sehen wir im Alter, wenn der Mensch auf Hilfe angewiesen ist. Sozial bedeutet nichts anderes als eine Absage an den Menschen als »gottlosen Selbstgott«, wie es Heinrich Heine einmal abschätzig formuliert hat, also an den Menschen, der keinen Bindungen unterliegt, sich seine eigene Welt schafft. Wir haben zwar als Menschen Freiheit, aber wir unterliegen auch Bindungen, die uns wesensmäßig sind. Daraus ergeben sich Verpflichtungen. Das ist mit dem Begriff des Sozialen hier gemeint.
Eine erste, allgemeine Antwort ist: Die Soziale Marktwirtschaft ist eine Wirtschaftsform, die sich von der freien Marktwirtschaft und der kollektivistischen Planwirtschaft gleichermaßen abgrenzt und auf der Grundlage der individuellen Freiheit den Markt normativ begründet einhegt und begrenzt. Deswegen geht es in diesem Buch auch nicht um ökonomische Theorien oder wirtschaftswissenschaftliche Zusammenhänge, sondern vielmehr um Menschenbilder, Werte, Ordnungen und Ordnungsprinzipien und die Konsequenzen daraus.
Eine erste Orientierung bietet bereits der Begriff: Warum »Soziale Marktwirtschaft« und nicht kleingeschrieben: »soziale Marktwirtschaft«? Hierfür gibt es viele Erklärungen: etwa, dass das Soziale genauso großgeschrieben werden soll wie die Marktwirtschaft. Das wäre ein Hinweis auf die Gleichwertigkeit dahinterstehender Ziele, nämlich der Freiheit in der Marktwirtschaft und der sozialen Sicherung. Eine zweite Erklärung wäre: Die Kleinschreibung unterstellt, dass es die Marktwirtschaft ist, die sozial ist; aber die soziale Sicherung erfolgt durch staatliches Handeln auf der Grundlage der Erträge, die erwirtschaftet werden. Auch daran ist ein wahrer Kern, wenngleich auch ein Teil der Vordenker der Sozialen Marktwirtschaft in eine andere Richtung argumentiert haben – dazu aber später. Ich übernehme die Großschreibung von demjenigen, der den Begriff geprägt hat, bevor das, was damit gemeint ist, in der Praxis umgesetzt war: Alfred Müller-Armack. Er war ein genialer Ökonom und Kultursoziologe und hat den Begriff 1946 erstmals verwendet. Was er mit der Großschreibung andeuten wollte, war: Diese Wirtschaftsordnung der Sozialen Marktwirtschaft ist eine Ordnung sui generis, also eine eigenständige Wirtschaftsordnung, die nicht lediglich aus der Mischung unterschiedlicher Wirtschaftsformen und -stile zu verstehen ist. Die Soziale Marktwirtschaft ist ein Ordnungsmodell mit einer ganz eigenen Begründung und einem sehr eigenen Menschenbild. Müller-Armack hat dieses Menschenbild als »Sozialhumanismus« bezeichnet. Dies war für ihn eine soziale Ordnung, die »ihre Gestaltung auf die ganze Fülle der dem Menschen zugänglichen Werte richtet«.2 Daran ist eines zunächst bemerkenswert: Müller-Armack spricht von einer »sozialen Ordnung«, nicht lediglich einer wirtschaftlichen. Das Wirtschaftliche ist vielmehr in das Soziale eingeordnet. Das war für Müller-Armack keine Beschreibung dessen, was er vorfand, sondern ein Rezept dafür, wie eine Wirtschaftsordnung anzulegen ist: nicht als Herrscherin über den Menschen, sondern als der Ort, an dem Menschen ihre Ziele verwirklichen. Das Soziale bezieht sich nämlich auch darauf, dass Wirtschaft immer ein sozialer Prozess ist. Es ist keine Naturkatastrophe, kein blindes Verhängnis, sondern immer ein von Menschen gemachter, also sozialer Prozess. Das bedeutet aber auch: Es sind Menschen, die die Regeln festlegen und die Grenzen dessen bestimmen, was die Wirtschaft ist. Gerade in Zeiten der Globalisierung ist es sinnvoll, daran bisweilen zu erinnern.
Darum soll es hier auch gehen, um Regeln, Grenzen, aber auch um Mittel und Wege in der Sozialen Marktwirtschaft. Nicht hingegen geht es um eine vollständige und umfassende Darstellung der Sozialen Marktwirtschaft in all ihren Facetten. Hierzu gibt es eine Fülle einschlägiger Literatur. Mir geht es in dieser Schrift um die exemplarische Darstellung der unterschiedlichen Ideen, die das Modell der Sozialen Marktwirtschaft speisen. Sie hat einführenden, keinen ausführlichen Charakter.
Will man ein Konzept und seine Entwicklungslinien verstehen, ist es sinnvoll, zum Ursprung zu gehen. Aus welcher Quelle oder welchen Quellen speist sich die Idee der Sozialen Marktwirtschaft? Eine häufige Interpretation lautet: Die Soziale Marktwirtschaft hat ihren Ursprung im Ordoliberalismus, also jener vornehmlich ökonomischen Schule, die den klassischen Liberalismus weiterentwickelt hat; die Debatten darüber gehen zurück bis in die Weimarer Republik.3 Mit dem Ordoliberalismus sind all diejenigen ökonomischen Denker verknüpft, denen der klassische Liberalismus die Freiheit auch in der Wirtschaft zu stark betont hat. Es bedarf, so die Grundidee, einer Ordnung der Märkte, damit die ökonomische Freiheit selbst nicht in die Unfreiheit führt. Damit zogen die Ordoliberalen die Konsequenzen nicht nur aus den Erfahrungen des 19. Jahrhunderts, sondern auch aus dem Niedergang der Weimarer Republik.
Der Ordoliberalismus ist eine Quelle der Sozialen Markwirtschaft. Aber es gibt noch eine weitere Quelle: die katholische Soziallehre. Die Soziallehre hatte ihre Initialzündung mit der Enzyklika Rerum novarum aus dem Jahr 1891. Darin prangerte Papst Leo XIII. die Verwerfungen der kapitalistischen Wirtschaftsordnung an und plädierte für eine Wirtschaftsordnung jenseits von Liberalismus und Sozialismus. Die darin entwickelten Grundideen wurden 1931 in der Enzyklika Quadragesimo anno durch Papst Pius XI. weiterentwickelt. Vor allem der Jesuit Oswald von Nell-Breuning, der maßgeblich die Enzyklika mit formuliert hatte, wurde einer der prominentesten Vertreter der katholischen Soziallehre in Deutschland. Mit der Neugründung der Union nach 1945 fanden die Ideen der Soziallehre nachhaltigen Eingang in die Programmatik der neuen Partei. Viele der Gründungsaufrufe sind vom Geist der Soziallehre durchtränkt; auch das berühmte Ahlener Programm der CDU von 1947 in der britischen Besatzungszone atmet noch ganz diesen Geist.
Ordoliberalismus und Soziallehre mögen in der Herkunft unterschiedlich gewesen sein, für die Soziale Marktwirtschaft waren diese beiden Quellen aber ein Glücksfall. Erst die Verknüpfung beider Denktraditionen hat die Soziale Marktwirtschaft zu einem durchschlagenden Erfolg gemacht. Diese These zu illustrieren ist ein Hauptanliegen dieses Buches. Dies erklärt auch den Titel des Buches. Die »Person« ist der Grundbaustein der Soziallehre. Das Menschenbild der Soziallehre grenzt sich damit vom Liberalismus ab, der den Menschen nur von der Freiheit her denkt, und von kollektivistischen Ideen, die den Menschen aus der Bindung her interpretieren. Die Personalität des Menschen ist in der Soziallehre konstitutiv für den Aufbau der Gesellschaft, ja der gesellschaftliche Aufbau ist ganz in den Schutz der Personalität gestellt – damit auch der Bereich der Wirtschaft. Bei den Ordoliberalen steht der Begriff der »Ordnung« im Mittelpunkt, weniger ein einheitliches Menschenbild. Die Ordnung kann sich auf den Wettbewerb beziehen, die Märkte, aber auch die Gesellschaft insgesamt.
Um die genaue Klärung, was denn die Soziallehre und der Ordoliberalismus sind, geht es im zweiten Kapitel. Als sehr verkürzte Ausgangsthese sei hier formuliert: Ordoliberalismus ist die Theorie, die in der guten Ordnung des Marktes die Voraussetzung sieht, dass eine Marktwirtschaft fair und sozial ist. Gute Ordnung heißt: Der Staat stellt Regeln für den Wettbewerb auf und überwacht die Einhaltung dieser Regeln. Er stellt sicher, dass jeder Marktteilnehmer eine faire Zugangschance zum Markt hat. Er stellt auch sicher, dass bestimmte Bereiche vom Wettbewerb ausgenommen werden und dass nicht alles auf dem Markt gehandelt werden darf. Arbeitsschutz beispielsweise ist kein Element des Wettbewerbs, sondern verbindlicher Standard für alle; und es gibt gute Gründe, menschliche Organe nicht regulär auf dem Markt zu handeln. Sozial ist die Ordnung des Wettbewerbs deshalb, weil sie allen die Möglichkeit gibt, sich Wohlstand zu erarbeiten. Ordoliberalismus bedeutet also: Der Staat schafft Regeln, die der Markt aus sich heraus nicht hervorbringen kann. Er setzt dem Markt damit Grenzen, ermöglicht aber auch seine Funktionsfähigkeit.
Was ist Soziallehre? Sie ist der Versuch, eine Gesellschaftsordnung zu entwerfen, die der Personalität des Menschen entspricht. Der Mensch wird als Träger, Schöpfer und Ziel aller gesellschaftlichen Einrichtungen benannt. Das schließt auch die Wirtschaft mit ein. Sie hat dienende Funktion; der Mensch ist wichtiger als der Markt. Die Soziallehre entwirft Prinzipien, aus denen heraus Gesellschaft (und damit auch Wirtschaft) strukturiert wird: die Solidarität als horizontales, die Subsidiarität als vertikales Gestaltungsprinzip. Menschliches Handeln, auch in der Wirtschaft, bleibt an das Prinzip des Gemeinwohls gebunden. Die Soziallehre ist also umfassender als der Ordoliberalismus, sie ist eine Lehre der sozialen Ordnung und der sozialen Prinzipien. Der Ordoliberalismus ist eine Lehre der Marktordnung und der Wettbewerbsprinzipien.
Wir werden sehen, dass dies eine Zuspitzung ist, eine idealtypische Darstellung im Sinne Max Webers und weniger eine differenzierte Beschreibung der Erscheinungsformen der Soziallehre und des Ordoliberalismus. Aber für eine erste Orientierung vermag diese holzschnittartige Darstellung hilfreich sein. Wichtig ist es festzuhalten: Der Ordoliberalismus ist keine in sich abgeschlossene Lehre, kein einheitliches Theoriegebäude. Die unterschiedlichen Denker, die unter den Begriff Ordoliberalismus zusammengefasst werden, haben sich untereinander widersprochen, sehr unterschiedliche Perspektiven eingenommen, waren aber in einem einig: dass der klassische Liberalismus des 19. Jahrhunderts fehlerhaft gewesen sei, dass es sich aber lohnt, die dem Liberalismus zugrunde liegende Prämisse vom Wert der Freiheit unter veränderten gesellschaftlichen und sozialen Bedingungen neu zu fassen.
Demgegenüber erscheint die Soziallehre stringenter und gleichzeitig weiter. Stringenter deshalb, weil die päpstlichen Enzykliken eine gewisse Verbindlichkeit haben. Sie werden zwar nicht als Glaubenswahrheiten verkündet, aber das alte Wort: Rom hat entschieden, die Debatte ist beendet, gilt natürlich auch hier. Häufig nehmen die Enzykliken Debatten auf, aber sie regen sie auch an, denkt man etwa an die Einführung des Begriffs der Subsidiarität in der Enzyklika Quadragesimo anno aus dem Jahr 1931. Weiter deshalb, weil die Soziallehre sich nicht auf die Wirtschaft beschränkt, sondern weit darüber hinausgreift; sie ist die Lehre der gerechten Gestaltung der Gesellschaft. Die Soziallehre hat einen größeren Kern als der Ordoliberalismus, weil sie sich nicht nur als wirtschaftliches Handlungsmodell, sondern als gesellschaftliches Ordnungsmodell versteht. Innerhalb dieses Ordnungsmodells ist die Wirtschaft ein Handlungsfeld – nicht den anderen übergeordnet, sondern Wirtschaft wird immer gesehen als auf menschliche Zwecke bezogen und in die Gesamtheit des menschlichen Zusammenlebens integriert.
Sicherlich gab und gibt es zwischen Ordoliberalismus und Soziallehre Gemeinsamkeiten, es gab und gibt aber auch scharf akzentuierte Konfliktlinien. Sich darüber Klarheit zu verschaffen ist keine nur intellektuelle Übung. Meine These ist: Die Entwicklung der Sozialen Marktwirtschaft hat von den Gemeinsamkeiten der beiden Konzepte ebenso profitiert wie von ihrem Spannungsverhältnis. Die Gemeinsamkeiten haben die Durchsetzung des Konzepts der Sozialen Marktwirtschaft befördert und tragen auch heute in sehr unterschiedlichen Milieus dazu bei, die Soziale Marktwirtschaft als Bezugspunkt wirtschafts- und sozialpolitischer Diskurse konsensfähig zu machen. Aber es war gerade das Spannungsverhältnis, das eine Weiterentwicklung der Sozialen Marktwirtschaft immer wieder ermöglicht und ihre andauernde Zukunftstauglichkeit garantiert hat.
Die Soziale Marktwirtschaft ist durch eine besondere Verknüpfung mit dem Kapitalismus gekennzeichnet, und dies ist Thema des dritten Kapitels. Sicherlich, es kann auch Marktwirtschaften ohne Kapitalismus geben, doch unsere ist das historische Resultat einer Vermählung mit dem Kapitalismus, oder besser: in einem sozial regulierten Rahmen. Nun ist der Begriff »Kapitalismus« in vieler Hinsicht aufgeladen, nicht zuletzt durch das Werk von Karl Marx, der den Kapitalismus als eine Übergangsperiode in der weltgeschichtlichen Entwicklung ansah und ihn wegen seiner offensichtlichen krassen sozialen Verwerfungen scharf kritisierte. Diese Kritik war berechtigt und Auslöser vielfältiger Reformbestrebungen, angefangen von den Bismarck’schen Sozialgesetzgebungen über die katholische Soziallehre bis hinein in die Gewerkschaften. Dem lag die Einsicht zugrunde, dass der Kapitalismus eben auch durchaus vorteilhafte Resultate hervorbringen konnte – wenn er nur vernünftig eingehegt und geordnet wird. Das war Thema auch der Ordoliberalen und mithin eine große Herausforderung für die politische Gestaltung in der Bundesrepublik. Heute ist eine neue, globale Herausforderung dazugekommen: Wie kann Kapitalismus mit Formen des Wachstums vereinbar gemacht werden, die die natürlichen Grenzen berücksichtigen und nicht alles dem Primat des Wachstums opfern? Wie kann sichergestellt werden, dass durch die Dynamik des Kapitalismus nicht neue, schroffe Formen der Ungleichheit entstehen? Unzweifelhaft hat der Kapitalismus positive Wirkungen gehabt, denken wir etwa an die deutliche Reduzierung der Menschen, die in absoluter Armut leben, und die Entwicklungsmöglichkeiten, die sich heute für die globale Menschheit eröffnen. Richtig ist aber auch, dass diese Dynamik die natürlichen Grenzen des Wachstums sprengt und damit zu einer Gefahr zu werden droht. Es wird eine Überlebensfrage der Menschheit werden, Formen des Wachstums zu finden, die mit der Permanenz menschlichen Lebens unter friedlichen Bedingungen auf unserem Planeten vereinbar sind.
Das vierte Kapitel ist den Grundlagen der Sozialen Marktwirtschaft gewidmet. Wenn es richtig ist, dass die Menschenwürde im Mittelpunkt auch des Wirtschaftens steht oder stehen soll, dann ergeben sich für Märkte eine Reihe von Beschränkungen. Einige sind offenkundig: Der Verkauf von Sklaven etwa (auch dafür gibt es einen Markt) ist mit der Idee einer Sozialen Marktwirtschaft nicht vereinbar. Ebenso gibt es Grenzen des Marktes, sowohl in dem, was marktfähig ist, als auch in dem, was nicht marktfähig ist. Dabei wird deutlich: Die Soziale Marktwirtschaft lebt nicht nur von den ordnungspolitischen Gesetzlichkeiten, sondern ist eine Wirtschaftsordnung im Rahmen einer bestehenden Rechtsordnung. Die Wertentscheidungen der Rechtsordnung durchtränken auch die Praxis der Sozialen Marktwirtschaft – ebenso im Übrigen wie kulturelle Entwicklungen, also gesellschaftliche und soziale Praxis.
Mit dem fünften Kapitel kommen wir zu den eigentlichen Grundprinzipien der Sozialen Marktwirtschaft, also denjenigen Ordnungsstrukturen, die der Ordoliberalismus als auch die Soziallehre zur Gestaltung von Wirtschaft (und Gesellschaft) bereitstellen. Subsidiarität, Solidarität, Eigentum, Wettbewerb, Risiko, Gerechtigkeit und Familie haben ihren spezifischen Stellenwert in den Wertvorstellungen von Ordoliberalismus und Soziallehre; sie sind manchmal kongruent, häufig aber nicht. Sie spielen aber insgesamt für das Selbstverständnis der Sozialen Marktwirtschaft eine entscheidende Rolle.
Das sechste Kapitel thematisiert einige Grundprobleme der Sozialen Marktwirtschaft, die immer wieder im politischen Raum debattiert werden. Wie viel Ungleichheit verträgt eine Gesellschaft, welche Bedeutung hat die Arbeit für die Lebenslage der Menschen? Darf sich eine moderne Gesellschaft Armut leisten? Wie weit darf sich die Schere zwischen Arm und Reich öffnen? Das wird in der politischen Arena sehr unterschiedlich beurteilt. Das Kapitel schließt mit einer exkursartigen Betrachtung über Sündenfälle und Grenzfälle, also bewussten Abweichungen von vernünftigen zu interessengetriebenen Gestaltungen und inneren Widersprüchen im System der Sozialen Marktwirtschaft selbst.
Die eigentümliche Mischung von Soziallehre und Ordoliberalismus als Grundrezept der Sozialen Marktwirtschaft war zunächst eine Art geistiges Eigentum der Union. Im Laufe der 1950er-Jahre hat sich auch die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) den Ideen der Sozialen Marktwirtschaft angenähert und sie schließlich mit dem Godesberger Programm von 1959 auch offiziell als Grundlage der bundesdeutschen Politik akzeptiert, freilich mit einer durchaus eigenständigen sozialdemokratischen Note. Auch in der FDP und bei den Grünen bildet die Soziale Markwirtschaft den Referenzrahmen des politischen Selbstverständnisses. Das spricht, bei aller Eindeutigkeit der Grundprinzipien, für eine große Offenheit für unterschiedliche Interpretationen, die sich im Verlauf der Geschichte der Bundesrepublik auch immer wieder gezeigt haben. Diese deutlich zu machen ist Gegenstand des siebenten Kapitels, in welchem die wichtigsten Stationen der Entwicklung der Sozialen Marktwirtschaft dargestellt werden. Über die vergangenen siebzig Jahre gab es immer wieder große Meilensteine der Sozialen Marktwirtschaft, die die unterschiedlichen Zugänge widerspiegelten: vom Lastenausgleich über die Rentenreform bis zur Einführung des Mindestlohns. Soziale Marktwirtschaft heute ist nicht nur eine Idee, sondern gelebte und immer wieder neu verhandelte Wirklichkeit. Der innere Kompass der Sozialen Marktwirtschaft hat dabei immer wieder geholfen, auch neue Herausforderungen aus dem Menschen- und Gesellschaftsbild ihrer Grundlagen beantworten zu helfen.
Mit dem achten Kapitel unternehmen wir einen Blick in die Zukunft. Eine Reihe von neuen Entwicklungen gilt es zu meistern, an erster Stelle natürlich die Globalisierung mit den damit verbundenen Verwerfungen. Der Mensch, so scheint es, verträgt nur eine beschränkte Form der Globalisierung, er ist nicht im Globalen beheimatet. Hinzu kommen die Digitalisierung und ihr Einfluss auf die Arbeitswelt. Hier erahnen wir die künftigen Formen mehr, als wir sie bereits beschreiben können; deswegen ist vieles in diesem Zusammenhang auch spekulativ, unabgeschlossen. Spürbarer ist schon die Frage nach den Grenzen des Wachstums, die erstmals mit dem Bericht an den Club of Rome 1972 angesprochen worden sind. Hieran hat sich eine Unzahl an Untersuchungen, offiziellen Stellungnahmen und erneuten Untersuchungen bis auf den heutigen Tag angeschlossen; der Bundestag hat diesem Thema eine Enquete-Kommission gewidmet, die ebenfalls mit einem umfangreichen Gutachten abgeschlossen wurde.4 Es gibt Grenzen des Wachstums, zumindest in der bisher praktizierten Form. Wie damit umzugehen ist, darauf haben Soziallehre und Ordoliberalismus durchaus unterschiedliche Antworten. Das gilt auch für die Gestaltung der Globalisierung und der damit einhergehenden Entwicklungen wie etwa neuen Formen der Arbeit. Globalisierung ist eine Frage wirtschaftlicher Fairness ebenso wie der Einhaltung der Menschenrechte und des Prinzips der Fernverantwortung; auch hier ist keine Blaupause zu erwarten, sondern Leitplanken, die sich aus den beiden Grundkonzepten der Sozialen Marktwirtschaft entwickeln lassen.
Der abschließende Ausblick fasst den Gang der Argumentation noch einmal zusammen und stellt ihn in einen größeren Zusammenhang. Wenn Wirtschaften ein Mittel für menschliche Zwecke ist – und darin waren und sind sich Ordoliberale und Vertreter der Soziallehre einig –, dann müssen die Wert- und Sinnhorizonte menschlicher Existenz in den Blick genommen werden. Warum wollen wir Wohlstand? Wie wollen wir leben? Damit bewegen wir uns von den engeren Fragestellungen der Wirtschaftsordnung weg in das Offene, Spekulative. Aber das ist Soziale Marktwirtschaft eben auch: eine Anfrage an uns selbst, wie wir leben wollen.
Es gibt einen bösen, gleichwohl treffenden Ausspruch des Dominikaners Jean Baptist Henri Lacordaire, wonach im Verhältnis zwischen den Armen und den Reichen es die Freiheit ist, die unterdrückt, und das Gesetz, das befreit.5 Diese Kritik würde für die Soziale Marktwirtschaft nicht zutreffen. Sie verbindet Freiheit und Gerechtigkeit in immer wieder neu zu justierender Art und Weise. Das trägt in besonderer Weise zu ihrer Akzeptanz bei. Sie hat in den vergangenen Jahren eine besondere Flexibilität in der Art und Weise gezeigt, wie sie auf neue Herausforderungen reagiert und reagieren kann. Das trägt zu ihrer Effizienz bei. Und sie hat eine besondere Robustheit gezeigt, wenn ihre Grundlagen infrage gestellt worden sind. Das trägt zu ihrer Stabilität bei.6 Und sie scheint mir das geeignete Mittel, um auf die beiden größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu reagieren: die Nachhaltigkeit und die internationale Gerechtigkeit. Insofern lohnt auch die Auseinandersetzung mit ihren Grundideen. Nur wer die Herkunft kennt, kann die Zukunft gewinnen.
1 Einführend, aber mit starkem Akzent auf der ordoliberalen Tradition: Dieter Grosser, Thomas Lange, Andreas Müller-Armack, Beate Neuss, Soziale Marktwirtschaft. Geschichte – Konzept – Leistung. Stuttgart 1990; Otto Schlecht, Gerhard Stoltenberg (Hrsg.), Soziale Marktwirtschaft. Grundlagen, Entwicklungslinien, Perspektiven. Freiburg 2001, enthält eine Reihe von Aufsätzen ebenfalls mit Schwerpunkt auf der ordoliberalen Tradition; Rolf H. Hasse, Hermann Schneider, Klaus Weigelt (Hrsg.), Lexikon Soziale Marktwirtschaft. Wirtschaftspolitik von A bis Z. Paderborn 2005; sehr nützlich, aber mit Schwerpunkt auf der Wirtschaftspolitik.
2 Alfred Müller-Armack, Diagnose unserer Gegenwart. Zur Bestimmung unseres geistesgeschichtlichen Standorts. Gütersloh 1949, S. 277.
3 Vgl. Dieter Haselbach, Autoritärer Liberalismus und Soziale Marktwirtschaft. Gesellschaft und Politik im Ordoliberalismus. Baden-Baden 1991; sowie neuerdings Jens Hacke, Existenzkrise der Demokratie: Zur politischen Theorie des Liberalismus in der Zwischenkriegszeit. Berlin 2018.
4 Deutscher Bundestag, Schlussbericht der Enquete-Kommission »Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität – Wege zu nachhaltigem Wirtschaften und gesellschaftlichem Fortschritt in der Sozialen Marktwirtschaft« vom 3. Mai 2013, Drs. 17/13300.
5 Gefunden bei Daniel Villy, »Die Marktwirtschaft im katholischen Denken«, in: ORDO,7 (1955), S. 23–69, 36.
6 Gelegentliche Abgesänge auf die Soziale Marktwirtschaft haben sich als verfrüht erwiesen, vgl. etwa Peter Koslowski, »Das Ende der Sozialen Marktwirtschaft«, in: FAZ, 11. November 2006; hingegen scheint in den angloamerikanischen Ländern das Nachdenken darüber zuzunehmen, wie der Kapitalismus, die Marktwirtschaft sozial eingehegt werden können; typisch dazu etwa Robert Reich, Rettet den Kapitalismus: Für alle, nicht für 1 %. Frankfurt am Main 2016, und Paul Collier, Sozialer Kapitalismus. Mein Manifest gegen den Zerfall unserer Gesellschaft. München 2019.
2 Ordoliberalismus und katholische Soziallehre als Quellen der Sozialen Marktwirtschaft
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war Deutschland militärisch besiegt, moralisch am Boden und wirtschaftlich stark geschädigt. Der Nationalsozialismus hatte verbrannte Erde hinterlassen, in fast jeder Hinsicht. Deutschland hatte bedingungslos kapituliert und war auf die Gnade und das Wohlwollen der Siegermächte angewiesen. Die Verbrechen, die die Nationalsozialisten im Namen des deutschen Volkes begangen hatten, waren historisch ohne Vorbild und zerschmetterten das Selbstbild Deutschlands als einer Kulturnation. Der Bombenkrieg hatte die Infrastruktur zu einem nicht unwesentlichen Teil zerstört. Hinzu kamen Energie- und Versorgungsengpässe und eine hohe Anzahl an Vertriebenen und Flüchtlingen aus den deutschen Gebieten im Osten und der Sowjetischen Besatzungszone. Vor dem Krieg war der Lebensstandard Deutschlands in Europa einer der höchsten. Nach dem Krieg war er einer der niedrigsten. Politiker wie Churchill fürchteten, dass die Alliierten über Jahre für die Ernährung der deutschen Bevölkerung würden aufkommen müssen.
Diese verzweifelte Lage schlug sich auch nieder in den ersten politischen Verlautbarungen der von den Alliierten zugelassenen demokratischen Parteien. Die Christlich Demokratische Union war eine neue politische Kraft, die es so vor 1933 nicht gegeben hatte. Sie war aber die Partei, die nach 1949 die Geschicke Deutschlands bestimmen sollte. Sie entstand als Union, also Zusammenschluss von Katholiken und Protestanten, aber auch von Arbeitgebern und Gewerkschaftlern. Ein großer Teil der Gründungsgeneration hatte das Dritte Reich am Rand verbracht: im inneren Exil oder in der Opposition und im Widerstand zu Hitler. Entsprechend las sich auch das Pathos der Gründungsaufrufe zur Union, die die gottlose Regierung der Nationalsozialisten verdammte und einen neuen Geist der Politik, eine ethisch gebundene Politik, herbeisehnte. Der Berliner Gründungsaufruf vom 26. Juni 1945 sprach von einem »Trümmerhaufen sittlicher und materieller Werte« und forderte ein öffentliches Leben, das sich frei hält von Lüge, Massenwahn und Massenverhetzung.
Die Kölner Leitsätze vom Juni 1945 sprachen von Rassehochmut und nationalistischem Machtrausch, der über das deutsche Volk gekommen sei, und folgerten, die Rettung liege allein in der ehrlichen Besinnung auf die christlichen und abendländischen Werte, die das deutsche Volk einst beherrschten. Leo Schwering, der frühe Chronist der CDU, schrieb einmal von einem »Katakombengeist«, der die Gründergeneration einte: ein Geist, der in den Schutzkellern, in den Ruinen der zerstörten Städte, in den Diskussionskreisen des Untergrunds und den Konzentrationslagern entstand. Dieser Geist hatte, wie es Arcadius R. L. Gurland beschrieb, durchaus etwas vom Geist des Urchristentums an sich, das gleichsam aus den Katakomben entstieg, bereit, die Welt neu zu prägen.1 Mit Blick auf die politische Dimension gab es Einigkeit: Eine Demokratie musste erstehen, eine Herrschaft des Volkes, der Würde des Menschen verpflichtet. Vor allem aber musste das Recht wieder zur Grundlage des Lebens werden, die Achtung der Menschenrechte ebenso wie eine unabhängige und freie Justiz. Für die Wirtschaft empfahlen die Gründungsaufrufe weitgehende staatsinterventionistische Maßnahmen bis hin zur Vergesellschaftung bestimmter Industrien. Dieser Notsozialismus der Nachkriegszeit suchte einen sozialen Ausgleich durch Umverteilung. Er konnte sich in Einklang sehen etwa mit der britischen Politik, die nach dem Beveridge Report von 1942 eine expansive Umverteilungspolitik betrieb; Ideen einer deutschen Labour-Politik waren folglich in der britischen Besatzungszone hochpopulär. Das firmierte bisweilen unter Begriffen wie »Christlicher Sozialismus« oder »Sozialismus aus christlicher Verantwortung«, aber natürlich nicht im realsozialistischen Sinn. Es war vielmehr ein in der unmittelbaren Nachkriegszeit beliebtes Schlagwort, mit dem eben nicht eine Nähe zur Sowjetunion oder dem Marxismus angedeutet werden sollte, sondern eine Grundströmung der katholischen Soziallehre benannt wurde, die in der Zeit der Not eine weitgehende Umverteilung und eine starke staatliche Lenkung der Wirtschaft einforderte. Ganz in diesem Kontext ist auch das berühmte Ahlener Programm der CDU in der britischen Besatzungszone aus dem Jahr 1947 zu verstehen. Fanalartig setzt es ein: »Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den staatlichen und sozialen Lebensinteressen des deutschen Volkes nicht gerecht geworden.« Eine Neuordnung der Wirtschaft von Grund auf sei notwendig, die auf das Ziel der Bedarfsdeckung des deutschen Volkes ausgerichtet sei.2 Das Programm war auf die bevorstehenden Wahlen in der britischen Besatzungszone ausgerichtet. Es richtete sich gegen den Staatssozialismus der Nationalsozialisten ebenso wie gegen die Kartell- und Monopolbildungen in der Weimarer Republik und forderte eine echte Mitbestimmung der Arbeitnehmer. Der Begriff des christlichen Sozialismus wurde hier allerdings vermieden, obwohl er zwischen den Zeilen mit den Händen zu greifen war. Gerade in der britischen Besatzungszone fielen solche Forderungen auf fruchtbaren Boden, zumal Großbritannien selbst, mit der neuen Labour-Regierung seit 1945, eine expansive Sozialpolitik betrieb. Überdies war die wirtschaftliche Not in Deutschland überall spürbar; Bewirtschaftung schien zu dieser Zeit ein adäquates Mittel, den Mangel zu verwalten. Vielleicht war aber nun auch tatsächlich das Zeitalter der werktätigen Massen eingeläutet worden, gerade in Deutschland. In Berlin erklärte der CDU-Vorsitzende Jakob Kaiser in diesem Sinn, das bürgerliche Zeitalter sei beendet; man müsse zu einer Synthese von Ost und West kommen, einem Mittelweg also von amerikanischem Kapitalismus und sowjetischem Sozialismus. Deutschland müsse Brücke sein zwischen Ost und West und so die unterschiedlichen Weltanschauungen versöhnen, zur Synthese bringen. Dies schien für Kaiser auch ein kluger Weg, die Einheit Deutschlands zu erhalten.3
Doch es kam anders. Der Ost-West-Konflikt riss Deutschland auseinander. Sehr bald zeigte sich die Notwendigkeit, die westlichen Besatzungszonen zu stabilisieren. Der Marshall-Plan war eine Maßnahme, die Währungsreform eine zweite. Sie führte letztlich zur Blockade Berlins durch die Sowjetunion, zur Luftbrücke der Alliierten, die mit dieser unkonventionellen Maßnahme das freie Berlin über Monate ernährten. Politisch bedeutsam war der wirtschaftliche Zusammenschluss der amerikanischen und britischen Besatzungszone. Hier wurde der Wirtschaftsfachmann Ludwig Erhard zum Verantwortlichen für die Wirtschaftspolitik ernannt und verfügte die Aufhebung der Bewirtschaftung. Nach der Gründung der Bundesrepublik wurde er Wirtschaftsminister und zum Vater des sogenannten Wirtschaftswunders, also des schnellen und nachhaltigen ökonomischen Aufstiegs der Bundesrepublik. Seit 1949 wurde die wirtschaftliche Ordnung in der Bundesrepublik mit dem Begriff »Soziale Marktwirtschaft« belegt, einer Begriffsbildung von Alfred Müller-Armack. Mit diesem Begriff verknüpft sich der Gründungsmythos der Bundesrepublik, der Aufstieg aus der ökonomischen Zerstörung und der materiellen Deprivation.
Die Soziale Marktwirtschaft war in der Ausgestaltung eine recht einmalige Mischung aus den Ideen einer Gruppe von Ökonomen und Soziologen um Ludwig Erhard und den Traditionen der katholischen Soziallehre, die in den frühen programmatischen Verlautbarungen der Union prominent vertreten waren. Sie ergänzten sich in weiten Teilen, widersprachen sich aber auch; aus dieser Reibung entstanden fruchtbare Debatten, die den Verlauf der Innenausstattung der Sozialen Marktwirtschaft begleiteten.
Ordoliberalismus und Marktwirtschaft
Der Mythos der Sozialen Marktwirtschaft ist der Mythos von Ludwig Erhard. Er stand wie kein anderer für diese Form der Wirtschaft: Schon physiognomisch signalisierte er Erfolg und Wohlstand, und in den Bildern aus den 1950er-Jahren wird er häufig auch mit einer dicken Zigarre abgebildet. Man konnte sich wieder etwas leisten, und warum sollte man dies nicht zeigen? Das unterschied den jovial wirkenden Erhard von der eher asketischen Erscheinung des ersten Bundeskanzlers, Konrad Adenauer. Erhards erfolgsreichstes Buch trug den Titel »Wohlstand für alle«. Das Buch enthält keine ökonomische Theorie, aber Reflexionen aus der Praxis und nahm eine Ortsbestimmung der Sozialen Marktwirtschaft vor, nämlich weder Planwirtschaft noch freie Marktwirtschaft. Es lieferte aber auch ein Stichwort für das Ziel der Sozialen Marktwirtschaft, eben keine Spaltung von Arm und Reich, sondern eine ausreichende materielle Sicherung für jedermann. »Wohlstand für alle« – das wurde das große Versprechen der Sozialen Marktwirtschaft.
Die Grundideen Erhards waren nicht vom Himmel gefallen, sondern entstanden in einem Diskussionszusammenhang vieler durchaus unterschiedlicher Ökonomen schon in der Weimarer Republik. Was hatte die alte Ordnung von 1914 zerstört, was war die tiefere Ursache der großen wirtschaftlichen Krise von 1929/1930, die in Deutschland schließlich zum Nationalsozialismus führte? Das waren die großen Fragen, mit denen sich Ökonomen beschäftigten, die später unter dem Begriff ordoliberal oder neoliberal zusammengefasst worden sind. Wir verstehen heute unter »neoliberal« eine ökonomische Theorie, die auf Liberalisierung, Privatisierung und Deregulierung abzielt, doch das war nicht das Verständnis der Vordenker der Sozialen Marktwirtschaft. Der Begriff »neoliberal«, von Alexander Rüstow geprägt, bezeichnete eher diejenigen, die sich vom wirtschaftlichen Liberalismus des 19. Jahrhunderts abkehrten. So zumindest hatten es die Teilnehmer einer Konferenz in Paris im Jahr 1938 verstanden, die im Nachhinein als Geburtsstunde des Neoliberalismus betrachtet worden ist.4 Die spätere Umdeutung des Begriffs »neoliberal« hat aber hier auch ihre Wurzeln. Friedrich A. von Hayek, der schon 1938 mit dabei war, entwickelte später als Kopf der Chicagoer Schule der Ökonomie ein einflussreiches ökonomisches Programm, das als Stichwortgeber der Wirtschaftspolitik von Ronald Reagan und Margaret Thatcher diente. Dieses Programm war »neoliberal« in einem anderen Sinn als 1938 angedacht, weil es stärker auf die Kräfte des Marktes setzte als die Begründer der Sozialen Marktwirtschaft und näher am ursprünglichen Liberalismus war, von dem sich die Neoliberalen ja gerade abwenden wollten.
Der Begriff Ordoliberalismus, der sich in Deutschland schließlich durchsetzte, knüpfte an eine einflussreiche Zeitschrift an, die zum Publikationsorgan der Neoliberalen vor allem in Deutschland wurde. Die Zeitschrift ORDO versammelte alle wichtigen Denker, auch die mehr randständigen, die zum Thema Wirtschaft und Gesellschaft aus liberaler Perspektive etwas zu sagen hatten. Der Anspruch war in dem Namen eingeschrieben: Es ging nicht nur um die Ordnung des Wettbewerbs als zentralem Anliegen der Ordoliberalen, sondern mit dem Namen wurde ganz bewusst auch an den Ordo-Gedanken aus der christlichen Tradition angeknüpft.5 Ordnung wird hier nicht als eine lediglich organisatorische Befriedung verstanden, sondern als die Zusammenfügung von Teilen zu einem sinnvollen Ganzen; der Sinn konnte sich nur aus der Wesensbestimmung des Menschen ergeben, und die wiederum verwies auf ein religiös geprägtes Menschenbild.6
Die neue Schule des Liberalismus bestand aus sehr unterschiedlichen Denkern. Sehr vereinfacht ausgedrückt bestand sie aus drei Flügeln: der »Freiburger Schule« um den Ökonomen Walter Eucken, einem soziologisch orientierten Flügel, dem Alfred Müller-Armack, Alexander Rüstow und Wilhelm Röpke zuzuordnen waren, und einem freiheitlich-individualistischen Flügel, für den vor allem Friedrich A. von Hayek stand.
Der Österreicher von Hayek war der vielleicht radikalste Denker im Umfeld der Ordoliberalen. Sein bekanntestes Buch trug den Titel »Der Weg zur Knechtschaft«. Es entstand während des Krieges in England und war ein unmittelbarer Erfolg; in den USA wurden die Thesen des Buches gar durch eine Kurzfassung im Readers Digest popularisiert.7 Bis heute wird das Buch in den USA vor allem an Universitäten gelesen; es bietet eine scharf geschriebene Verteidigung des Marktes gegenüber allen Planungen und warnt vor der abschüssigen Rutschbahn in den Sozialismus – und diese Rutschbahn beginnt für Hayek mit jeglicher staatlicher Intervention in die Wirtschaft. Zwar müsse der Staat den rechtlichen Rahmen setzen und auch durchsetzen, vor allem durch ein funktionierendes Rechtssystem, ein Geldsystem, Eigentumsgarantien und Patentrechte. Aber jede darüber hinausgehende staatliche Intervention in die Wirtschaft lehnte er ab. Nur im Rahmen eines Systems, das auf Wettbewerb und Privateigentum gegründet sei, könne es auch eine Demokratie geben, so Hayek. Für ihn stand die Freiheit im Zentrum aller Werte, und das wird in dem »Weg zur Knechtschaft« systematisch ausbuchstabiert. Es ist ein manichäisches Weltbild, das hier vorgestellt wird, ein Weltbild, in der die Kräfte von Licht (Freiheit) und Finsternis (Sozialismus in allen Formen) unüberbrückbar voneinander geschieden sind. Deswegen gibt es für Hayek auch keinen »dritten Weg«: Mischformen gleiten unweigerlich zum Sozialismus ab.
Hayek, der 1931 als erster Ausländer eine Professur an der London School of Economics erhielt, war der Antipode zu John Maynard Keynes.8 Dessen Modell einer Konjunktursteuerung war Hayek fremd; Keynes hatte aus der Großen Depression die Lehre gezogen, dass der Staat durch antizyklisches Ausgabeverhalten das Gleichgewicht in der Wirtschaft bewahren und vor Arbeitslosigkeit schützen könne. Hayek hingegen setzte mehr Vertrauen in den Markt. Dieser sei eine sich selbst generierende Ordnung, in der dem Geld eine zentrale Rolle als Kommunikationsmittel zur Festlegung von Preisen zukomme. Keynes’ Theorie bestimmte über viele Jahrzehnte die wirtschaftlichen Strategien vieler Staaten. Hayek, der 1950 an die University of Chicago wechselte, kam erst später zu politischem Einfluss. Sein Lebenswerk wurde schließlich durch den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaft gekrönt, den er 1974 zusammen mit Gunnar Myrdal erhielt.
Hayek schraubte sich durch seine späteren Arbeiten aus dem Kern der Ordoliberalen hinaus, bis hin zum Bruch.9 Die spätere »Chicago School«, die von ihm und Milton Friedman geformt wurde, hatte mit dem deutschen Ordoliberalismus nichts mehr zu tun. Auch die spätere Zusammenarbeit mit dem chilenischen Diktator Pinochet trennte die Chicagoer von den deutschen Ordoliberalen; in Chile wurde ein ganzes Land der Schocktherapie der Ideen des amerikanisch geprägten Neoliberalismus unterzogen. Diese Grundideen spielten auch eine starke Rolle bei der Formulierung des Washingtoner Konsenses der Entwicklungspolitik der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds. Dabei standen Deregulierung, Privatisierung und Liberalisierung prominent im Vordergrund, also die moderne neoliberale Variante des ökonomischen Denkens. Sicherlich spielte für die Entwicklung Hayeks auch das amerikanische Umfeld eine nicht unwesentliche Rolle, auch wenn er aus Chicago 1962 auf eine Professur nach Freiburg wechselte und dort Vorstandsmitglied des Walter-Eucken-Instituts wurde. Er blieb für die Soziale Marktwirtschaft eine provokante, produktive, aber inhaltlich randständige Figur.
Den Kern der sogenannten Freiburger Schule bildeten Walter Eucken (1891–1950) und die Juristen Franz Böhm (1895–1977) und Hans Großmann-Doerth (1894–1944).10 Gemeinsam hatten sie ab 1936 die Schriftenreihe »Ordnung der Wirtschaft« herausgegeben; in der Einleitung zur ersten Schrift legten sie ihr Programm dar und damit den Grundstein zum Selbstverständnis der Freiburger Schule.11 Grundlegend war eine Abkehr von den historischen Schulen der Rechtswissenschaft und der Nationalökonomie. Diese hatten das Recht und die Volkswirtschaft jeweils in ihren historischen Bezügen und Kontexten gesehen und sich damit dem Vorwurf ausgesetzt, relativistisch zu sein. Wie kann, so die drei Autoren, »der Geist die Tatsachen gestalten, wenn er sich selbst vor dem Gang der Tatsachen verneigt?«. Es musste also darum gehen, der wissenschaftlichen Vernunft als einer gestaltenden und objektiven Kraft wieder Geltung zu verschaffen, damit die beiden Disziplinen – die Nationalökonomie und die Rechtswissenschaft – wieder ihren »gebührenden Platz im Leben der Nation einnehmen«. Fraglos ein ambitioniertes Programm, vorgetragen mit hohem Selbstvertrauen, und dies gerade in einer Zeit, in der die Machthaber an einer solchen Eigenständigkeit wissenschaftlicher Vernunft wenig Interesse hatten. Freilich, der Grundgedanke, nicht nur von den Einzelproblemen her zu denken, sondern das Ganze der Wirtschaftsverfassung in den Blick zu nehmen, blieb. So ordnete sich auch der Teilbereich der Rechtswissenschaft, dessen Anwendungsbereich die Wirtschaft betraf, der Wirtschaftsverfassung unter, wenn es etwa um Fragen des Konkursrechtes, der Patente oder des Kartellrechts ging. Diese Wirtschaftsverfassung als »politische Gesamtentscheidung über die Ordnung des nationalen Wirtschaftslebens« müsse dann auch der interpretatorische Rahmen der Gesetzesauslegung sein. Es ging also darum, Wirtschaft nicht nur als ein disparates Phänomen von Teilvorgängen zu betrachten, in denen Märkte, wirtschaftliche Interessen, staatliche Intervention und rechtliche Bestimmungen unabhängig voneinander betrachtet werden und existieren, sondern all dies in einen Ordnungszusammenhang zu bringen. Was aber sollte nun der Kern der Wirtschaftsverfassung sein, wie ihre Physiognomie bestimmt werden?
Die Freiburger Schule war sich darin einig, dass zu den Kernelementen einer Wirtschaftsverfassung das Prinzip des Wettbewerbs gehören müsse. Es war dann vor allem Walter Eucken, der dieses Prinzip näher ausbuchstabierte. Zunächst einmal unterschied Eucken zwei Wirtschaftstypen: die Verkehrswirtschaft und die Zentralverwaltungswirtschaft. Die Verkehrswirtschaft ist eine Koordinationsordnung, die Zentralverwaltungswirtschaft eine Subordinationsordnung. Sie unterscheiden sich wesentlich durch die Frage der Machtverteilung: Die Zentralverwaltungswirtschaft ist durch Konzentration der Macht gekennzeichnet, die Verkehrswirtschaft durch eine Diffusion der Macht. Idealerweise gibt es in einer Verkehrswirtschaft weder eine politische noch eine ökonomische Machtansammlung. Die politische wird dadurch verhindert, dass der Staat die Ordnung gestaltet, aber nicht die Prozesse lenkt; er gibt also die Spielregeln vor, ohne in die Spielzüge einzugreifen. Marktmacht wird dadurch verhindert, dass ein vollständiger Wettbewerb herrscht. Diesen Wettbewerb beschreibt Eucken mit seinen konstituierenden und regulierenden Prinzipien. Zu den konstituierenden Prinzipien gehören als erstes und zentrales Prinzip die Herstellung eines funktionsfähigen Preissystems vollständiger Konkurrenz; dies ist nach Eucken der strategische Punkt, auf den alle Kräfte konzentriert werden müssen.12 Sechs weitere konstituierende Prinzipien bauen darauf auf: die Geldwertstabilität, offene Märkte, die Garantie des Eigentums, Vertragsfreiheit, die Vermeidung von Haftungsbeschränkungen sowie die Vorhersehbarkeit und Stetigkeit der Wirtschaftspolitik. Geldwertstabilität verhindert Marktverzerrungen durch Inflation oder Deflation, offene Märkte sind ein Mittel gegen Unternehmenskonzentrationen; Privateigentum ist eine Voraussetzung für Markt und Wettbewerb, Vertragsfreiheit ist die handlungsorientierte Erweiterung des Privateigentums. Haftung dient dazu, Rationalität und Vorsicht der Beteiligten in den Wirtschaftsprozess mit einzubeziehen, und die Vorhersehbarkeit der Wirtschaftspolitik ist erforderlich, um langfristige Investitionen berechenbar zu machen. Zu diesen konstitutiven kommen die regulierenden Prinzipien. Diese sah Eucken in einer wirksamen Monopolkontrolle, einer Internalisierung externer Kosten (Preise müssen also die wirklichen Kosten widerspiegeln und dürfen Kosten nicht auf die Allgemeinheit verlagern), einer Korrektur der primären Einkommensverteilung durch eine progressive Einkommenssteuer und in Vorkehrungen gegen eine anomale Angebotspolitik zum Beispiel auf Arbeitsmärkten, die zu einem Preisverfall führen.13
Eucken macht deutlich, dass diese Prinzipien aufeinander bezogen sind und eine Gesamtordnung darstellen; sie integrieren Politik, Recht und Wirtschaft auf diese Ordnung hin. Folglich müssen sich auch Verwaltungshandeln und die Rechtsprechung daran messen lassen, was sie zu dieser Ordnung beitragen und inwieweit sie diese Ordnung unterstützen. Die Ordnungsprinzipien der Wirtschaft müssen also mit den Ordnungsprinzipien anderer Ordnungen, vor allem des Staates, abgestimmt sein; der Versuch, kollidierende Ordnungen zu verwirklichen, ist zum Scheitern verurteilt.14 Deswegen bedarf es noch ergänzender Prinzipien vor allem staatlicher Tätigkeit: Dazu gehören die Zurückhaltung bei konjunkturpolitischen Maßnahmen und das Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe; zu den explizit genannten staatspolitischen Prinzipien gehören die Begrenzung der Macht der Verbände (eine Lehre aus der Weimarer Republik) und die Beachtung des Prinzips der Subsidiarität bei der Übernahme neuer Aufgaben sowie der Vorrang der Ordnungspolitik vor der Ablaufpolitik.15 Gleichzeitig ist eine solche Ordnung mit einer demokratischen Verfassung vereinbar, mehr noch: Wie in einem System kommunizierender Röhren verstärken sich Wirtschaftsordnung und Demokratie gegenseitig. Anders formuliert: Die Verkehrswirtschaft ist die der demokratischen Gesellschaft angemessene Wirtschaftsordnung. Vor allem aber steht sie in der Aufgabe, den Menschen das Leben nach ethischen Prinzipien zu ermöglichen.16 Nicht nur deswegen war Eucken der Überzeugung, dass es durchaus Überschneidungen zur katholischen Soziallehre und der evangelischen Sozialethik gebe, vor allem mit Blick auf den Ordogedanken.17 Die Kirchen waren aus seiner Sicht unverzichtbar für eine erfolgreiche Wirtschaftsordnung.
Eucken war in vielerlei Hinsicht prägend: für seine Mitstreiter wie Franz Böhm, der später selbst in die Politik ging und versuchte, die Grundprinzipien der Lehre Euckens zu implementieren; für Ludwig Erhard, der sich zu Euckens Lehre bekannte, aber auch für viele Schüler, die Euckens Gedankenwelt weitertrugen und weiterentwickelten. Hieraus entstand eine sehr spezifische deutsche ordnungspolitische Tradition, die für die Wirtschaftspolitik in Deutschland stilprägend geworden ist, betrachtet man beispielsweise die Bedeutung, die der Geldwertstabilität in Deutschland zugebilligt wird, oder das Denken in subsidiärer Ordnungspolitik. Eucken wurde zwar in andere Sprachen übersetzt, konnte aber nirgendwo eine ähnlich starke Wirkung entfalten wie in Deutschland.
Alexander Rüstow (1885–1963) war der vielleicht schillerndste Denker im Umfeld der Sozialen Marktwirtschaft. Seine Biografin sieht ihn als einen der letzten Universalhistoriker der Kulturkritik, der sowohl den Gegenentwurf zu den geschichtsphilosophischen Entwürfen von Karl Marx als auch von Oswald Spengler liefert.18 Rüstow hatte Mathematik, Physik, klassische Philologie, Philosophie, Nationalökonomie und Recht studiert – eine heute kaum mehr denkbare Studienbreite. Prägend wurde für Rüstow der Nationalökonom und Soziologe Franz Oppenheimer (1864–1943), der selbst ein akademischer Exot war. Dieser hatte als Arzt begonnen, dann aber sozialpolitische Fragen für sich entdeckt und eine Promotion in Nationalökonomie angefertigt; 1919 wurde Oppenheimer der erste Professor für Soziologie an einer deutschen Universität, und zwar in Frankfurt am Main. Oppenheimers Arbeiten sind nicht eindeutig einer Schule zuzuordnen. Er vertrat einen »liberalen Sozialismus«, den er als eine Form des dritten Wegs zwischen Kapitalismus und Kommunismus ansah; Ludwig Erhard, der von Oppenheimer promoviert wurde, sah sich selbst ebenfalls in dieser Tradition. Er habe, so bekannte er später in einer Gedenkrede auf Oppenheimer, in seinem Arbeitszimmer nur ein einziges Bild aufgestellt, das seines Lehrers und väterlichen Freundes Franz Oppenheimer. Und Erhard fuhr fort, er würde sich glücklich schätzen, »wenn die Soziale Marktwirtschaft – so vollkommen oder so unvollkommen sie auch sein mag – weiter zeugen wird auch für das Werk, für den geistigen Ansatz der Gedanken und die Lehre von Franz Oppenheimer.«19
Ähnlich wie Oppenheimer blieb auch bei Rüstow zeitlebens eine kapitalismuskritische, ja antikapitalistische Grundeinstellung bestimmend.20 Rüstow gehörte schon in der Weimarer Republik zu den Grenzgängern von Politik und Wissenschaft. Beruflich begann er als Referent im Reichswirtschaftsministerium und war dort unter anderem an der Ausarbeitung der Kartellverordnung von 1923 beteiligt. Ab 1924 leitete er die wirtschaftspolitische Abteilung des Dachverbands deutscher Maschinenbauunternehmen und war gegen Ende der Republik als Wirtschaftsminister im Gespräch. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten ging Rüstow ins Exil in die Türkei; dort entstand sein monumentales Hauptwerk, die »Ortsbestimmung der Gegenwart«.21 Der geistige Weg Rüstows in der Weimarer Republik führte ihn vom Sozialismus hin zum Liberalismus, dessen Erneuerung er zusammen mit Walter Eucken und Wilhelm Röpke anstrebte; seine Rede aus dem Jahr 1932 über »Freie Wirtschaft – Starker Staat« gehört neben Euckens Aufsatz über »Staatliche Strukturwandlungen und die Krise des Kapitalismus« aus dem gleichen Jahr zu den Gründungstexten des Ordoliberalismus.22
Die »Ortsbestimmung der Gegenwart« war zwar im Exil geschrieben, erschien aber in drei Bänden erst zwischen 1950 und 1957. In einem weiten historischen Blick ließ Rüstow die Entwicklung der Hochkulturen seit der letzten Eiszeit Revue passieren – nicht aller, sondern der europäischen. Zugrunde legte er das spannungsvolle Verhältnis von Herrschaft und Freiheit. In einer arbeitsteiligen Gesellschaft sei Herrschaft die Grundvoraussetzung von Stabilität; die Arbeitsteilung führe zu Fortschritt. Die Überlagerung einer Gesellschaft durch die Herrscher führe zu einer Steigerung des Kulturniveaus. Mit steigendem Kulturniveau wachse aber das Bedürfnis nach Freiheit. Die Ordnung der Herrschaft wirke immer mehr einengend. Ziel sei deshalb ein Ordnungsrahmen, in dem sich Macht begrenzt und ein Optimum an Freiheit ermöglicht wird.
Ein wenig ist man an Fukuyamas Theorie vom Ende der Geschichte erinnert, wenn die Spannung von Freiheit und Herrschaft auf einem näher zu bestimmenden Kulturniveau nun vollständig zugunsten der Freiheit aufgelöst werden kann. Die Überlagerung durch Herrschaft ist, wie es Rüstow ausdrückt, wie eine giftige Substanz, die zur Herstellung synthetischer Reaktionen notwendig ist, später aber vollständig ausgeschieden werden muss, damit das Endprodukt nicht mit dem Gift belastet ist.23 Diese Möglichkeit sei nun erreicht, glaubt Rüstow: Die Bundesrepublik habe dazu die besten Voraussetzungen.24
Es wundert daher wenig, dass Rüstow, der 1949 aus dem türkischen Exil zurück nach Deutschland kam, zum »Festredner der Sozialen Marktwirtschaft«25 avancierte. Die Nachfolge auf dem prestigeträchtigen Lehrstuhl von Alfred Weber in Heidelberg half dabei ebenso wie der Vorsitz der Arbeitsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft, den Rüstow 1955 übernahm. Rüstow wurde zu einem öffentlichen Intellektuellen. Seine Konzeption der »Vitalpolitik« versuchte, Antworten auf die Frage jenseits der Sozialpolitik zu geben. Dabei galt es, die Vitalsituation der Menschen in den Blick zu nehmen. Darunter verstand Rüstow das Lebensumfeld der Menschen, vor allem die negativen Begleitumstände von Industrialisierung, Vermassung und Verstädterung, jenen schädlichen Überlagerungen, die wir dem 19. Jahrhundert verdanken. Bei der Vitalpolitik ging es nicht um soziale Absicherung, sondern die Gestaltung des Lebensumfelds mit dem Ziel, die erneute Einwurzelung des Menschen in kleinräumige Strukturen und Gemeinschaften zu erleichtern, auch als Gegengewicht zu der Konkurrenzgesellschaft. Allerdings konnte die Vitalpolitik dann in Gegensatz geraten mit dem Prinzip des Wettbewerbs. Was, wenn zur kleinräumigen Gestaltung des Lebensraumes Schulen, Verwaltungseinheiten oder Krankenhäuser gehörten, die ortsnah erreichbar sein müssten? Das würde der Staat sicherlich noch organisieren können, mit erheblichem Mehraufwand, aber als staatliche Aufgabe. Was aber, wenn es um Apotheken geht, Bäcker oder Wirtshäuser? All dies sind für die Vitalpolitik vielleicht wichtige Randbedingungen, aber sie stehen im Wettbewerb und haben keine staatliche Existenzgarantie. So blieb vieles bei Rüstow vage und eher Wunschgedanke, auch verklärte Vision vergangener Zeit, und gerade darin glich er Wilhelm Röpke mehr als allen anderen Ordoliberalen.
Wilhelm Röpke (1899–1966) war als Akademiker erfolgreich, mehr noch aber als Publizist; kein anderer Publizist könne, so Hans-Peter Schwarz, »mit größerem Recht die geistige Vaterschaft der Bundesrepublik in Anspruch nehmen« als der Wahlschweizer Röpke.26 Nach einer steilen akademischen Karriere verlor Röpke 1933 wegen seiner Gegnerschaft zum Nationalsozialismus seine Marburger Professur. Nach einer mehrjährigen Zwischenstation an der Universität in Istanbul ging er 1938 nach Genf, wo er neben seiner Lehrtätigkeit eine rege publizistische Tätigkeit entfaltete. In den Kriegsjahren entstanden seine wirkmächtigsten Werke, in denen er wichtige Grundlagen der Sozialen Marktwirtschaft vorbereitete.27 Bei Röpke mischen sich Kulturkritik und ordnungspolitisches Denken. Mit Müller-Armack teilte er die Idee über den Reservenverzehr, über den Verlust sittlicher Substanz und gesellschaftlicher Kohäsion. Der Kapitalismus, die Marktwirtschaft, bedürfe deshalb starker Gegengewichte in der Gesellschaftspolitik, um die zerstörerische Dynamik einer nicht eingehegten marktwirtschaftlichen Ordnung zu kompensieren. Röpke geht aber noch einen Schritt weiter, wenn er sich gegen den »Kult des Kolossalen«28 wendet, also sinnlose Größenüberschreitung von Betrieben und zentralistische Tendenzen. Es komme darauf an, das dem Menschen zuträgliche Maß nicht zu überschreiten, auch nicht in der Wirtschaft. Kritisch betrachtete Röpke auch die »Proletarisierung« der Gesellschaft, die Auflösung der traditionellen dezentralen Strukturen, angefangen mit der Familie. Staatliche Sozialpolitik sah er deshalb mit Skepsis, denn sie befördere die Auflösung dieser Strukturen. Gleichwohl waren seine Gegenrezepte häufig skurril, etwa wenn er empfahl, dass die Industriearbeiter zu Nebenerwerbsbauern werden sollten, weil dies helfe, konjunkturell bedingte Arbeitslosigkeit abzufedern. Röpkes Weltsicht war, wie es Kritiker ihm vorhielten, von der dezentral, kleinbäuerlich und kleingewerblich orientierten Wirtschaft in der Schweiz ebenso stark beeinflusst wie von dem dortigen Demokratieverständnis. Der Modernisierung der bundesrepublikanischen Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg stand er skeptisch gegenüber, mehr noch: Er wurde zunehmend zum »Kassandrarufer« der Sozialen Marktwirtschaft,29 weil diese immer weniger in der Lage schien, sich gegenüber den organisierten Interessen durchzusetzen, und darüber hinaus der Kult des Konsums zu einer säkularen Ersatzreligion in der Bundesrepublik zu werden drohte. Die europäische Integration begleitete er kritisch, denn hier war aus seiner Sicht ein Zentralismus angelegt, der weit über föderale Lösungen hinauszugehen drohte.
Röpke ist mit seinem Plädoyer für das menschliche Maß, für kleinräumige und dezentrale Strukturen, bisweilen als Vorläufer grünen Selbstverständnisses gesehen worden. Das war er sicherlich nicht, wenn man seine Warnungen vor der Übergriffigkeit des modernen Staates mit sozialpolitischen Programmen in die Gesamtschau integriert. Auch seine Verteidigung der Totalitarismusidee ist aus dem Kontext der Zeit zu verstehen. Nicht nur von der politischen Ordnungsidee, sondern auch wirtschaftlich waren Kommunismus und Faschismus für Röpke Formen des Zentralismus und sie widersprachen seinem organischen Menschen- und Weltbild. In diesem Sinn war er ein Konservativer. Gleichzeitig mischen sich bei ihm liberales Menschenbild und sozialromantische Ordnungsvorstellungen auf frappante Weise, etwa, wenn er gegen die Folgen der Motorisierung der Gesellschaft anschreibt. Ebenso wie Alexander Rüstow schien seine Idealvorstellung einer Gesellschaft einem moderat technisierten Biedermeier zu entsprechen. Doch der Geist des Fortschritts, der Geist der Modernisierung war nicht mehr in die Flasche zu zwingen. Nun entfaltete das Wirtschaftswunder selbst eine Dynamik, die die bundesrepublikanische Gesellschaft modernisierte und sich von dem idealen Gesellschaftsbild Röpkes immer weiter entfernte. Als Röpke starb, wirkte er längst wie aus der Zeit gefallen – ob in die Vergangenheit oder die Zukunft, darüber mag man streiten.
Alfred Müller-Armack (1901–1978) hatte sich mit einer »Ökonomischen Theorie der Konjunkturpolitik« 1926 in Köln habilitiert. Seine Forschungen führten ihn von der reinen Nationalökonomie weit weg; er wurde 1940 Professor für Nationalökonomie und Kultursoziologie, insbesondere Religionssoziologie. Nach dem Krieg begann Müller-Armacks politische Karriere, die untrennbar mit Ludwig Erhard verbunden war. Er wurde 1947 Berater von Erhard, ein Jahr später Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des Frankfurter Wirtschaftsrats. Erhard berief ihn 1952 als Abteilungsleiter Grundsatzfragen in das Bundeswirtschaftsministerium, sechs Jahre später wurde er dort Staatssekretär mit Zuständigkeit für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Müller-Armack stand also im Zentrum der Gestaltung der Sozialen Marktwirtschaft, wie er auch ihre geistesgeschichtliche Fundierung formuliert hat.30
Dabei stand vor allem die Frage für Müller-Armack im Vordergrund, wie eine Gesellschaft zusammengehalten werden kann. In einem großen geistesgeschichtlichen Bogen bestimmt er die Lage seiner Zeit.31 Zu den geschichtlichen Wachstumsringen gehöre die seit dem 19. Jahrhundert zu beobachtende Wendung hin zu einer durchsäkularisierten Massenkultur. Dies sei einhergegangen mit dem Verlust an sozialer Substanz, der Verleugnung innerer Gleichgewichtskräfte. Die Folge sei eine Vermassung des Menschen und ein Verlust an Sinnorientierung. Dieser wiederum habe zu »Idolbildungen« geführt, ein Begriff, mit dem Müller-Armack die Überhöhung von Volk, Rasse, Klasse, Liebe, Kunst, Jugend oder Freiheit kennzeichnet und so auch zu einem Teil den Nationalsozialismus erklärt. Die Idolbildungen betrachtet Müller-Armack als ein »religiöses Sinnphänomen in einer sich säkularisierenden Welt«,32 Teile der menschlichen Existenz werden als Ganzes genommen und quasi-religiös überhöht. Gegen diese Partikularisierung des Denkens setzt Müller-Armack das Bemühen um eine neue Anthropologie, die den Menschen in seiner Gesamtheit ernst nimmt. Er spricht von einem »Sozialhumanismus«, der eine soziale Ordnung anstrebt, »die ihre Gestaltung auf die ganze Fülle der dem Menschen zugänglichen sozialen Werte richtet und sich bei Realisierung dieser Ziele jener indirekten und vielseitigen Verfahren bedient, durch die wir (…) uns befreien können von jener primitiven, niederdrückenden Enge, die uns aus den bisherigen Lenkungssystemen so trist und dürftig entgegenschlägt«.33 Der Sozialhumanismus zielte also auf die Ganzheit des Menschen, auf seine vielfältigen Ziele; dem müsse, so Müller-Armack, auch eine Wirtschaftsordnung Rechnung tragen. Die Soziale Marktwirtschaft war für Müller-Armack deswegen auch eine »konstruktive Neuschöpfung«,34 weil sie einen Ausgleich von Freiheit und Bindung ermöglichte und die Kräfte des Fortschritts gleichzeitig sozialen Zielen dienstbar zu machen in der Lage war.
Die Soziale Marktwirtschaft war für Müller-Armack eine instrumentelle Ordnung, die eingebunden war in die Hoffnung auf eine erneute Einbettung des Menschen in größere Sinnzusammenhänge, die den Menschen als Ganzes wieder in den Blick nahm, auch und gerade mit Blick auf die Transzendenz. Die Voraussetzungen schienen für Müller-Armack günstig. Die neuesten Erkenntnisse der Physik hätten den Glauben in den Positivismus, in die rein rationale und empirisch leistbare Erklärbarkeit der Welt, erschüttert. Überdies sei der Schock der Stunde null – und damit der Schock der Erkenntnis über die Menschheitsverbrechen – ein geschichtlicher Moment der Umkehr und der Rückbesinnung. Die Stunde null als ein Moment der christlichen metanoiete, der Umkehr,35 der Bekehrung zu einem christlichen Leben: Diese Hoffnung von Müller-Armack hat sich nicht erfüllt, zu sehr waren Lebenswelt und christliche Botschaft schon auseinandergefallen. Die moderne Gesellschaft, auch die der Bundesrepublik Deutschland, konstituiert sich mit Verweis auf das christliche Menschenbild als einem, aber nicht einem ausschließlichen Identitätshorizont. Für Müller-Armack war dies zu wenig. Er musste aber konstatieren, dass der »endgültige Abbau jener sozialen Substanz, die aus der Vergangenheit her als festigendes Element im Gesellschaftsbau herüberragte«,36