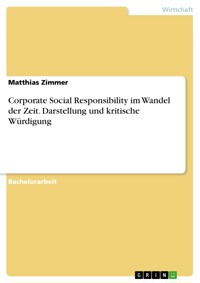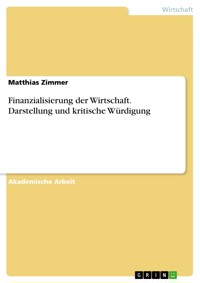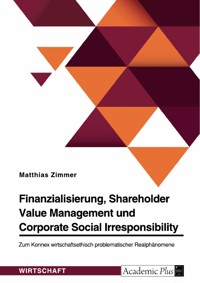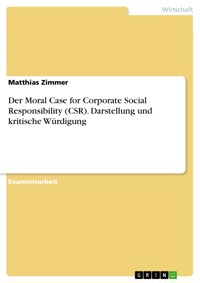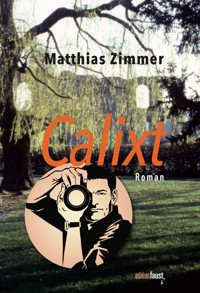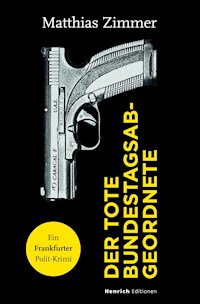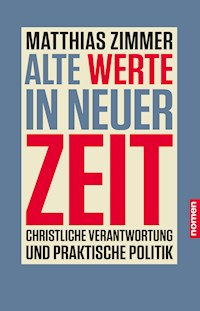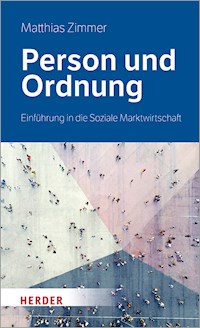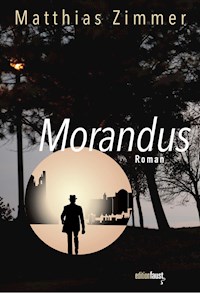
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Faust
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Die Vergangenheit vergeht nicht. Sie bleibt des Menschen Wegbegleiter, manchmal auch sein Fluch." Das Fundament eines Lebens liegt in den Leben anderer wie ein Ziegel einer Mauer, niemals frei. Wer bin ich im Geflecht der Geschichten, ist die Frage, die dem Buch "Morandus" von Matthias Zimmer vorangestellt ist. Der Protagonist des Romans, der aus dem Vorharz stammende Bauunternehmer Ernst Funk, ist nach dem Krieg nach Kanada ausgewandert und hat dort eine Familie gegründet. Die Zeit der Jugend – die Erinnerungen an seine erste Liebe, an den Krieg – war begraben, er hatte sich in Kanada neu erfunden, eine makellose Existenz aufgebaut. Doch eines Tages rührt sein Freund und langjähriger Gesprächspartner Landau an diesem Konstrukt, als er ihn im Zuge einer wissenschaftlichen Studie über deutsche Auswanderer befragt. So kommt etwas ans Licht, was längst der Vergessenheit anheimgefallen war, und der so gut befestigte Stein löst sich aus der Mauer, bringt etwas ins Rollen, das nicht nur das Leben von Funk von Grund auf ändern sollte. Als über 60-Jähriger reist er erstmals an die Orte eines Geschehens, das seit mehr als vierzig Jahren auf ihm lastet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1. Auflage 2021
© Edition Faust, Frankfurt am Main 2021
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Kopien, Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
www.editionfaust.de
Lektorat: Elvira M. Gross, Wien
Satz: Uwe Adam, Adam-Grafik, Freigericht
ISBN 978-3-945400-89-0
eISBN 978-3-945400-96-8
Matthias Zimmer
MORANDUS
Inhalt
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
I
Je suis mon passé. Ich bin meine Vergangenheit. Ich bestehe in und aus meiner Erinnerung. Für einen Historiker wie Landau war das eine banale, selbstverständliche Feststellung. Je suis mon passé: Ich bin, der ich geworden bin. Vergangenheit und Gegenwart sind nur durch einen Wimpernschlag getrennt. Jeden Moment kann die Vergangenheit in uns einbrechen und Vergessenes freilegen. Wir sind keine unbeschriebenen Blätter, keine geschichtslosen Projekte. Wir sind in Geschichte und Geschichten verstrickt. Wenn wir uns Geschichten erzählen, lernen wir, uns zu verstehen. Wir sind unsere Geschichten. Wir sprechen durch unsere Geschichten, weil sie unser Gedächtnis sind. Und am Ende verwehen unsere Geschichten wie wir selbst, es sei denn, sie werden aufgeschrieben und weitergegeben.
Landau konnte mit Sartre an sich nichts anfangen, aber Je suis mon passé traf den innersten Kern seiner Forschungen. Es war eine Art Leitmotiv, das sich durch seine Untersuchungen zog. Was sind wir, was macht uns aus? Der Mensch ist das sich erinnernde Tier, nichts wird vergessen. Gerade in letzter Zeit spürte Landau, wie sehr sich frühe Erinnerungen wieder in sein Bewusstsein drängten und seine Träume beherrschten. Die Kunst des Alterns. Waren das erste Anzeichen einer neuen Lebensphase? Wie viel er auch darüber gelesen hatte, jetzt erst wusste er: Die Vergangenheit vergeht nicht. Sie bleibt des Menschen Wegbegleiter, manchmal auch sein Fluch. Erst durch Erinnern verstehen wir, gewinnen uns selbst. Erinnerung ist dabei immer in andere Geschichten und Zeitläufte verstrickt, in fremde Biographien, fremde Erinnerungen.
Zum Alter gehört das Vergessen. Es verlängert das Exil; das Geheimnis der Erlösung ist die Erinnerung, heißt es in einer jüdischen Weisheit. Aber wie weit reichte sie zurück? Nur in die eigene Biographie oder griff sie doch erheblich weiter? War die Geschichte individuell zu betrachten oder vielmehr kollektiv? Die Antwort hinge wohl davon ab, inwieweit ein jeder Herr seiner eigenen Biographie war. Und er selbst? Das alte Spannungsverhältnis von Selbstbestimmung und Fremdbestimmung betraf freilich gerade auch den Historiker. Es blieb unauflösbar und geheimnisvoll.
Landau tadelte sich ob seiner Grübeleien und schritt den Saskatchewan Drive entlang, hin zu seinem Büro im Henry-Marshall-Tory Building der University of Alberta. In Kanada trugen die Universitätsgebäude häufig Namen. Manchmal waren damit Erinnerungen an große Taten für die Universität verbunden, wie im Fall des ersten Universitätspräsidenten Henry Marshall Tory, manchmal nur die Erinnerung an einen ausgestellten Scheck. Die Kanadier zeigten hier einen etwas nüchternen Pragmatismus. Auch Erinnerung hat ihren Preis. Im Sekretariat fischte er seine Post aus dem Postfach und zog sich damit in sein Büro zurück, ein funktionaler Raum, dem er durch zwei englische Clubsessel, eine Stehlampe, die an Art Deco denken ließ, und überfüllte Bücheregale die Anmutung von Gemütlichkeit zu geben versuchte. Den großen Teil seines Lebens verbrachte Landau im Büro. Früh hatte er sich ein diszipliniertes Arbeiten angewöhnt, das er in seinem Berufsleben beibehalten hatte. Dazu gehörte die strenge Trennung von Arbeit und Privatleben. In seinem Haus im Akademikerviertel Belgravia, das nach dem Auszug seiner beiden Kinder für ihn und seine Frau beinahe grotesk überdimensioniert war, hatte er sich nie ein Arbeitszimmer eingerichtet.
Landau war ein Meister der Trennung. Mit seiner amerikanischen Frau Mary sprach er nur englisch. Deutsch, die Sprache, in der er bis zu seiner Flucht aus Wien 1938 aufgewachsen war, spielte in seinem Beruf als Professor für neuere deutsche Geschichte eine Rolle, aber niemals in seinem Privatleben. Auch seine beiden in Kanada geborenen Kinder Mark und John hatten die Sprache erst bei den Besuchen in Österreich gelernt. Zuhause wurde ausschließlich englisch gesprochen. Nicht, dass Landau des Deutschen nicht mehr mächtig gewesen wäre, im Gegenteil. Gerade die Trennung der Lebenssphären sorgte dafür, dass seine Muttersprache nicht, wie es bei anderen Migranten aus dem deutschsprachigen Raum häufig zu beobachten war, stückweise durch englische Redewendungen und Syntax kolonisiert wurde. Er sprach immer noch ein grammatikalisch und idiomatisch korrektes Deutsch. Manchmal, zugegeben, zeigte es Ansätze des Musealen, ein Festhalten an Ausdrücken, die aus dem Gebrauch gekommen waren, und hie und da erlaubte er sich auch eine umstandslose Übersetzung englischer Wörter, wenn der deutsche Begriff ihm nicht geläufig war. Den Anrufbeantworter als „Antwortmaschine“ zu bezeichnen, gut, das hatte ihm vor ein paar Jahren ein Schmunzeln seiner österreichischen Freunde eingebracht, erinnerte er sich, allerdings waren solche sprachlichen Fehlleistungen eine Ausnahme, zumal Landau es sich in den letzten zehn Jahren zum festen Programm gemacht hatte, jedes zweite Jahr die mehrmonatigen Sommerferien in Österreich zu verbringen.
Und war er nicht immer ein talentierter Netzwerker gewesen? Durch Geschick und seine guten Beziehungen, vor allem zu Bruno Kreisky, hatte sich die Gelegenheit eines Stipendiums in Wien ergeben, mit Logismöglichkeit, zentral in der Leopoldstadt, unweit von seinem alten Gymnasium. Zu seiner Zeit trug es noch den Namen des Erzherzogs Rainer, mittlerweile war es nach einem berühmten Ehemaligen, Sigmund Freud, benannt. Alle zwei Jahre wurde das Stipendium erneuert und gab Landau damit Gelegenheit, neue Kontakte in seiner alten Heimat zu knüpfen, vor allem innerhalb der SPÖ, der er weltanschaulich durchaus nahestand. Immerhin war er für transatlantische Fragen informeller Ratgeber der Partei geworden und hatte sich mit einer englischsprachigen Geschichte Österreichs seit dem Krieg revanchiert, dabei die Verdienste der Sozialisten ein wenig stärker betont, als es für einen unparteiischen Historiker unbedingt schicklich erschien.
Bisweilen leisteten ihm Mary und die Kinder in Wien Gesellschaft, nie aber die vollen drei Monate, die er dort regelmäßig verbrachte. Er schätzte das. So blieb ihm Zeit, alte Freundschaften wieder aufleben zu lassen, Bekanntschaften, die nach der erzwungenen Emigration abrupt abgebrochen waren. Wie großbürgerlich seine Familie einst gelebt hatte! Der Vater war ein anerkannter Chirurg am Allgemeinen Krankenhaus gewesen, ein belesener Mann, der gerne Gäste aus Literatur und Musik bei sich bewirtete. Als die Stimmung umschlug, hatte er noch vor dem Anschluss an das Reich Vorkehrungen getroffen, um Österreich schnell in Richtung USA zu verlassen. Wohl hatte er das kommende Unheil, wenn nicht gesehen, so doch geahnt. Er selbst, Landau, war damals dreizehn Jahre alt gewesen, freilich zu jung, um die Dimension der Ereignisse erfassen zu können, andererseits alt genug, um Zeit seines Lebens eine Traurigkeit zu empfinden, die nur diejenigen befällt, die ihre Heimat für immer verlassen. Die Lebensumstände … Landau seufzte. Auch für ihn blieb Wien eine Zwischenstation, da eine Rückkehr aus beruflichen und familiären Gründen nicht möglich war.
Seine Frau hatte er während des Studiums in Yale kennengelernt, bei einem Gartenfest seines akademischen Lehrers Hajo Holborn. Mary war eine enge Freundin von Hanna Holborn, die den Sommer bei ihrem Vater verbrachte. Wie frisch, wie natürlich Mary wirkte! Sehr amerikanisch, optimistisch, immer gut gelaunt. Er hatte ihr in den Jahren der Ehe einiges zugemutet. Schon die Übersiedlung ins kanadische Edmonton, wo er Anfang der sechziger Jahre nach einigen Lehraufträgen in den USA seine erste feste Stelle gefunden hatte. Was für ein Kulturschock, besonders für Mary! Sie war ein Gewächs der Ostküste und nun mit ihm in der Prärie gelandet. Ihre Erziehung im durch und durch protestantischen Geist war beinahe puritanisch, und seine jüdische Herkunft damit schon Problem genug, wenngleich er in keiner Weise praktizierte, ja später ihretwegen sogar konvertiert war. Besser Edmonton als Wien, dachte sich Landau. Ein Leben im urbanen Wien, der Stätte der Musik, der leichten décadence, des süßen Lebens, der Kunst, undenkbar, das hätte Mary komplett überfordert. Deswegen hatte sich die Frage einer Rückkunft gar nicht gestellt, er selbst hatte sie Mary nie gestellt, denn instinktiv war er sich ihrer Ablehnung, ja Empörung sicher. Und doch hatte ihn Wien nie losgelassen, die Stadt hielt ihn in ihren Fesseln, wie er sich eingestehen musste. Hörte er das Fiakerlied, hatte er sogleich lächerliche Tränen in den Augen, die zärtlichsten, wohligsten Erinnerungen hüllten ihn ein, dessen war er sich wohl bewusst, hielt diese Gefühlsduselei aber vor seiner Frau und seinen Kindern verschlossen. Was für ein Bild würde er auch von sich geben? Das passte nicht zu jenem, das er von sich selbst hatte – als Lehrer, als Vater, als Ehemann. Sein Leben war notwendige professionelle, mitunter ironische Distanz zu den Dingen, antrainiert durch die Umstände und die akademische Ausbildung. Dadurch konnte er sich und seine Familie schützen. Mit der Zeit war, wie er sich selbst eingestand, die Seele mit Hornhaut überwachsen; galt er vielleicht deshalb oft als unnahbar, ja abweisend?
So waren die Aufenthalte in Wien zunächst ein angenehmes Wiedererinnern, mit der Zeit aber ein schmerzliches Wiedererkennen, das ihn ob seiner eigenen Gefühle zunehmend ratlos machte. Wo gehörte er nun selbst hin, zu welcher Heimat? War Heimat das Schicksal, die Herkunft also, oder war sie bewusste Entscheidung? Früher hätte Landau behauptet, es sei eine Entscheidung: Dort, wo meine Familie ist, wird auch meine Heimat sein. Doch im Lauf der Jahre spielte ihm das Unbewusste zusehends Streiche. Seine Träume versetzten ihn zurück in die Kindheit, und es war ihm, als könnte er dort sogar einzelne Gerüche wahrnehmen. Zumeist waren es Szenen aus den ersten sechs oder sieben Jahren, die er wiedererlebte, selten aus der Zeit der frühen Jugend. Die Eindrücke wurden mit den Jahren stärker, farbiger, intensiver. Der Geruch etwa, wenn seine Mutter Buchteln zubereitete, mit Powidl gefüllt, dem süßen Zwetschgenmus. Das Hochgefühl bei der Fahrt mit der Liliputbahn im Prater. Das Gefühl, zuhause barfuß über die weichen Teppiche zu laufen. Manchmal wachte er mittendrin auf und fühlte sich seltsam disloziert, ein Schauspieler in einem falschen Film, und so musste er sich erst orientieren, mühsam wieder in die Gegenwart zurückbringen, in der er ein kanadischer Hochschulprofessor war, verheiratet mit einer Amerikanerin, Vater von zwei Kindern, politisch eher links, ohne empfangsbereite religiöse Antenne, im Alter zunehmend introvertiert.
Freilich, die plötzlichen Rückrufe der Erinnerung hatten auch seine professionelle Fantasie beflügelt; nicht umsonst steht Mnemosyne an der Wiege der Geschichtsschreibung. Landau hatte durch viele Gespräche herausgefunden, dass solche Formen der Erinnerung durchaus verbreitet waren. Mary hatte ihm von ähnlichen Erfahrungen berichtet, ebenso seine Kollegen und Freunde. Sie gehörten ja etwa der gleichen Generation an. Allerdings erinnerten sie sich in unterschiedlicher Intensität. Landau überlegte, ob und wie man diese Gedanken und Erkenntnisse wissenschaftlich nützen könnte. Woran ließe sich die Wirkung der Erinnerung überhaupt festmachen? Irgendwann Mitte der achtziger Jahre war dann die Idee zu einem Forschungsprojekt entstanden, in dem sich Landau Formen der Erinnerung einmal systematisch anschauen wollte, und zwar vor allem bei deutschen Migranten in Kanada. Eine solche Eingrenzung lag nahe, zumal sich Kanada als ein Land rühmte, das Identitäten unterschiedlichster Herkunft großzügig Platz einzuräumen versprach. Nichts anderes bewegte die Politik des Multikulturalismus. Aber was, wenn dadurch das Private, Intime öffentlich würde? Wenn Erinnerungen sich als politisch handlungsleitend erwiesen? Konnte die stolze Idee einer multikulturellen Gesellschaft unter dem Ansturm legitimer Erinnerungen überhaupt noch eine integrierende Wirkung entfalten? Was würde passieren, wenn eine Gesellschaft in ihre Geschichten zerbrach, in die einzelnen Motive, wenn sie selbst keine integrierende Metaerzählung mehr bereitstellen konnte, ja darauf sogar bewusst verzichtete?
Landau empfand sich keineswegs als Gegner des Multikulturalismus, hielt aber eine kritische Distanz für angemessen, zumal ja auch die österreichische Erfahrung eines Vielvölkerstaates durchaus ambivalent war. Ungemein bereichernd, das ja, betrachtete man die kulturellen Früchte, selbst noch in den Nachwirkungen. Manès Sperber, mit wie viel Bewunderung er ihn gelesen hatte! Oder wie er den klugen Gregor von Rezzori zu Anfang der achtziger Jahre über den ORF entdeckt hatte, später Paul Celan mit seinen Studenten immer wieder diskutiert: eine bunte deutschsprachige Vielfalt, so ganz anders als der bundesrepublikanische oder österreichische Mief nach 1945, offener, weltläufiger und gleichzeitig unbefangen heimatverbunden. Auf der anderen Seite musste man eingestehen, dass der Vielvölkerstaat politisch hoch flüchtig war, instabil, ein permanentes Fragezeichen. Die Kanadier hingegen gingen an das Multikulturelle mit einer gewissen Naivität heran, der die historische Dimension fehlte. Sie waren einfach nur neugierig, aber die Neugier war unverdächtig wie die kulturellen Manifestationen selbst. Diese blieben ohne Tiefgang, meist beschränkt auf kulinarische Hervorbringungen und folkloristische Kleidung, alles eher in einem Disney-Format. Landau schnaubte verächtlich. Kultur war hier nur Erinnerung ohne existenzielle Bedeutung und deshalb auch keine Quelle von Konflikten. Multikulturalismus war ja nicht das Ausbalancieren unterschiedlicher kultureller Identität in einem Vielvölkerstaat, er war ein Mittel der Integration in einer Gesellschaft von Migranten, deren Ausgang noch nicht feststand.
Und sein eigenes Leben? Welchen Ausgang nahm es? Landau wischte den Gedanken beiseite, wandte sich lieber wieder allgemeineren Fragen zu. Sowieso konnte er die Frage nach dem Stellenwert der Erinnerung mit seiner Familie nicht ausmachen. Es fehlte ihr die Erfahrung der Migration von Grund auf. Mary, gewiss, sie hatte viel erlebt, doch unter völlig anderen Bedingungen. Von Massachusetts, ihrer Heimat, nach Alberta zu gehen, mochte ähnlich einschneidend gewesen sein wie für andere eine Umsiedlung nach Iowa. Aber, und das erschien Landau als ausschlaggebend, sie verblieb doch in einem ähnlichen Kulturkreis, in der gleichen Sprache. Abgesehen natürlich von geringfügigen Abweichungen im Schriftlichen. Spannender war da schon der deutsche Kulturkreis, die deutschsprachige Gemeinschaft in Alberta, zu der Landau, zugegeben, über viele Jahre instinktiv Abstand gehalten hatte. Deutsche gab es dort schon vor dem Krieg, gewiss; doch nach dem Krieg hatte Kanada eine große Einwanderungswelle von Deutschen erlebt, die bis Anfang der fünfziger Jahre anhielt. Ein Teil der Einwanderer war im Dritten Reich schuldig geworden und suchte einen Neuanfang, andere waren der Perspektivlosigkeit der deutschen Nachkriegssituation entflohen und hofften, sich in Kanada ein besseres Leben aufbauen zu können. Alberta war eine der Provinzen, in denen sich deutsche Zuwanderung besonders bemerkbar machte. Es gab deutsche Clubs, deutsche Metzgereien, deutsche Bäckereien, auch ein reges gesellschaftliches Leben, in dem alles Deutschsprachige von Ostpreußen bis Österreich zu einem ununterscheidbaren Deutschtum zusammenfloss, das in der neuen Heimat mit besonderer Hingabe gepflegt wurde.
In den achtziger Jahren hatte es in Deutschland eine Debatte der Intellektuellen um die Frage gegeben, was denn die deutsche Identität sei. Landau hatte davon einiges bei seinen Besuchen in Österreich am Rande mitbekommen und war zunächst amüsiert. Deutschtum … was sollte das konkret sein? Offensichtlich widmeten sich umgekehrt die Kanadier der Frage nach ihrer Identität mit ebenso großer Ausdauer und Gelehrsamkeit. Konnte man den Punkt, was denn nun kanadisch und was deutsch sei, womöglich dadurch eingrenzen, dass man die Migranten in den Blick nahm? Die Deutschen in Alberta – Landau legte Wert darauf, den Begriff weniger im Sinne einer Staatsangehörigkeit als eines Kulturraumes zu benutzen – waren allesamt gut integriert, angepasst, sie „funktionierten“ in ihrer neuen Heimat. Viele trugen aber eine stille Sehnsucht in sich, eine Sehnsucht nach dem Deutschland, das sie kannten, in dem sie aufgewachsen waren. Wann immer er auf deutsche Einwanderer traf, brachte Landau das Gespräch darauf, was sie denn in Kanada vermissten.
Richtiges Brot, Schnitzel, deutsches Bier waren die häufigsten Antworten. Aber, wenn er nachhakte, hörte er auch: die Gemeinschaft, die Geschichte, mit der man aufwächst, die kulturelle Tiefe. Und doch war bei jenen, die später wieder nach Deutschland gereist waren, die Freude über das Wiedererkennen nicht so groß wie die Enttäuschung über die Andersartigkeit ihrer Heimat. „Früher war aber …“ wurde dann geklagt: weniger Verkehr auf den Straßen, die Nachbarschaft freundlicher, die Jugend höflicher, die Neubauten schöner. Jeder trug seine ganz persönliche Enttäuschung in sich. Deutschland hatte sich verändert, und man war nicht mehr Teil dieses Deutschlands. So bestätigte sich für Landau die Vermutung, dass das Leben in der deutschen Gemeinschaft in Alberta immer mehr zu einem Leben in einem Zwischenraum, nicht mehr deutsch, aber auch noch nicht vollständig kanadisch geworden war. Museal, wie es Landau einmal bissig formulierte, eine Fliege im Bernsteinmantel, aber für Historiker natürlich interessant.
Bis auf wenige Ausnahmen hatte er keine Kontakte zu der deutschen Gemeinschaft, er wollte nicht vereinnahmt werden. Eine der wenigen Ausnahmen war Ernst Funk, ein erfolgreicher Bauunternehmer, mit dem er sich über die Jahre angefreundet hatte. Sie hatten sich 1968 kennengelernt, im Vorfeld der Neuwahlen zum kanadischen Parlament. Landau war kurz zuvor kanadischer Staatsbürger geworden und engagierte sich für die Liberalen, für Trudeau. Bei Hu Harris waren sie einander begegnet, der damals im Wahlkreis für die Liberalen antrat. Landau hatte Funk damals angesprochen, „Unser kanadischer Kennedy …“, und hatte auf ein Bild von Trudeau gezeigt. – „Könnte Deutschland auch gebrauchen“, hatte Funk nur erwidert. Das wiederum hatte den Widerspruchsgeist von Landau geweckt: „Deutschland und ein Kennedy? Nie im Leben! Katholisch ja – aber von dem Jugendwahn sollten die Deutschen doch geheilt sein.“ Funk hatte ihn entgeistert angesehen und dann nur erwidert: „Unser Jahrgang und Jugendwahn? Schön wär’s!“ Landau erinnerte sich, dass er vor Lachen laut losprusten musste, und das war der Beginn ihrer Freundschaft.
Zwar hatte er zunächst das Preußische an Funk mit einer ironischen Distanz vermessen, doch im Laufe der Zeit merkte er, dass sich hinter dem steifen Äußeren ein mitfühlender und aufgeschlossener Mann verbarg, der mit großem Ernst für seine politischen Überzeugungen eintrat. Ein Mensch, der fröhlich sein konnte, witzig, seine Vorliebe für Spott nicht gerade teilte, aber schätzte; ein anregender und gebildeter Gesprächspartner – und nicht nur ein Bauunternehmer, dessen vorrangige Interessen sich im Geldverdienen erschöpften. Funk kam dem Ideal eines Bildungsbürgers alteuropäischer Herkunft nahe, einem Bildungsbürgertum, als dessen Vertreter – und Erbe – sich Landau in gewisser Weise sah. In Funk hatte er einen Dialogpartner auf Augenhöhe gefunden, wenn es um deutsche Literatur ging, um Philosophie, vor allem auch um theologische Fragen. Funk war in der katholischen Dogmatik sehr bewandert, gerade was die neueren Entwicklungen nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil betraf. Überdies verfügte er über einen reichen Schatz an Zitaten und ein breites Spektrum an sonstigen Interessen, ganz so, als ob ihn sein eigener Beruf als Bauingenieur nur am Rande interessierte. Auf ihr erstes Treffen sind sie bisweilen zurückgekommen, auf die damalige Aufbruchsstimmung, zumal Hu Harris als einer der wenigen Kandidaten für die Liberalen in Alberta einen Sitz im nationalen Parlament gewinnen konnte. Ansonsten war Alberta „schwarz wie die Nacht“, wie Landau bisweilen lästerte. Aber immerhin, es gab einen Lichtblick, und sie hatten gemeinsam das Licht entzündet, zumindest 1968.
Sie trafen sich regelmäßig, jedoch nicht häufig, sprachen oft über Deutschland, über die politischen Entwicklungen, ohne dass Funk je eine politische Präferenz in der deutschen Politik geäußert hätte. Überhaupt blieb er in seinen eigenen Urteilen meist abwägend, zurückhaltend. Nicht jedoch Landau, der zu deutlichem Urteil neigte, verbunden mit Spott und Ironie für all das, was ihm gestrig und überholt erschien. „Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit“, so hatte er Schiller bisweilen zitiert und so auch den Regierungswechsel in Deutschland 1969 kommentiert. Die Lust an der Provokation hatte mit der akademischen Lehre zu tun, in der Landau es immer wieder darauf anlegte, eingeübte Sichtweisen seiner Studenten aufzubrechen; sie ergoss sich aber auch über seine sonstigen gesellschaftlichen Kontakte, was gelegentlich zu Verstimmungen führte, unter denen dann wiederum Mary litt. Mary hatte keine Antenne für Ironie und Zynismus. „Du hast keinen Respekt vor den Menschen und vor Gott“, warf sie ihm bisweilen vor. Und bei Gott, hatte sie nicht recht? Funk hingegen hatte sich an der scharfen Zunge Landaus nie gestoßen, auch dann nicht, wenn das Ziel des Spottes die deutschkanadische Gemeinschaft war, in der sein Freund aktiv mitarbeitete.
Landau hatte ihm auch gelegentlich von seinen Studien über deutsche Auswanderer in Kanada erzählt, über die Befragungen, die er durchführte. Daran hatte sich aber nie ein vertieftes Gespräch angeschlossen, das etwa Auskunft über Funks Motive der Auswanderung hätte geben können. „Pioniergeist und ein wenig Überdruss an Deutschland“, hatte Funk einmal kurz angebunden geantwortet, als ihn Landau danach gefragt hatte, dann aber die Unterhaltung beendet mit dem Hinweis, das sei alles schon ziemlich lange her. Umso überraschter war Landau dann, als Funk im Frühjahr 1989 während eines Mittagessens von sich aus das Gespräch auf das Forschungsprojekt brachte.
„Ich habe im Kanadakurier einen Artikel über dein Projekt gelesen und die Bitte, sich für Befragungen zu melden“, begann er. „Ich verstehe immer noch nicht so ganz, was du mit diesen ganzen Geschichten anfangen willst.“ Landau stieg sofort darauf ein, mit dem Stolz desjenigen, der alles gründlich durchdacht hatte und von der Bedeutung des Projekts überzeugt war.
„Es geht mir um Fragen des Selbstverständnisses. Was bedeutet es, Deutscher zu sein? Was hat es bedeutet? Denn das Bild Deutschlands, dass die Deutschkanadier hier haben, entspricht ja schon lange nicht mehr dem Bild des heutigen Deutschlands. Und schließlich: Was bedeutet Multikulturalismus mit Blick auf die deutschen Einwanderer?“
„Also eine Art kollektives Gedächtnis der Deutschkanadier?“, fasste Funk zusammen.
„Ja, das auch. Obwohl die Gründe für die Migration ja sehr unterschiedlich sind. Aber die Interviews sind auch eine Quelle von Alltagserfahrungen. Es ist, sagen wir, eine Geschichte von unten, die sich fast nie in den klassischen Quellen der Geschichtswissenschaft findet.“
„Eine Geschichte der kleinen Leute“, ergänzte Funk.
„Richtig, keine große Politik und Diplomatie. Geschichte wird von Menschen gemacht.“
„Und was versprichst du dir davon? Du musst doch auch nach bestimmten Gesichtspunkten auswerten, diese ganzen Geschichten destillieren, Strukturen herausarbeiten.“
Es wurde ein sehr langes Mittagessen. Die Bedienung hatte mehrmals Kaffee nachgeschüttet und sich wohl im Stillen über die beiden älteren Herren gewundert, die sich angeregt in einer ihr fremden Sprache unterhielten. Landau hatte Funk geduldig geantwortet, die Technik der Befragung erläutert und die Hintergründe, die die Historiker mit dem Konzept der „oral history“ verbanden. Erst im Nachhinein war Landau der Verdacht gekommen, dass Funk mehr als ein bloß wissenschaftliches Interesse haben könnte. Aber welches? Funks Sohn Peter, den er wenige Tage später auf dem Campus traf, konnte sich darauf ebenfalls keinen Reim machen. Er ermunterte Landau aber, seinen Vater doch selbst zum Objekt der Forschung zu machen und fügte hinzu: „Vielleicht bekomme ich dann über die Wissenschaft heraus, was in der Familie als gut gehütetes Geheimnis gilt.“ Landau war darauf nicht weiter eingegangen.
Doch es ließ ihm keine Ruhe. Als sie sich zwei Monate später wieder in dem Restaurant verabredet hatten, kam Landau ohne Umschweife darauf zu sprechen, noch bevor sie eine Bestellung aufgeben konnten. Woher das plötzliche Interesse? Funk wich aus: Er sei nun beinahe vierzig Jahre in Kanada, das sei doch auch die Zeit der biblischen Wanderung.
„Du bist aber nicht Moses“, hatte Landau halb scherzhaft gesagt, „und Kanada ist nicht die Wüste Sinai.“ Funk, der sonst die spöttischen Bemerkungen Landaus mit einer Handbewegung wegwischte, zuckte dieses Mal lediglich mit den Achseln.
„Ich frage mich manchmal schon, wie wohl mein weiteres Leben in Deutschland verlaufen wäre. Ab einem gewissen Alter neigt man zum Bilanzieren, zumal sich frühe Erinnerungen mächtig in den Vordergrund schieben.“ Und zum Bilanzieren gehöre auch, schob er nach, Rechenschaft über das Zufällige und das Unausweichliche eines Lebensweges abzulegen, soweit dies eben möglich sei.
„Ich nehme an“, und dabei blickte er Landau direkt in die Augen, „dass dies auch die Folie deiner Forschungen ist? Ich finde die Frage spannend: what’s bred in the bone“ – Funk verwendete hier die englische Redewendung – „und was unser eigener Anteil ist. Wie frei wir sind, oder wie stark unser Schicksal schon von Mutter Natur angelegt ist, oder vielleicht durch die Zeitläufte. Denn eines ist sicher: Dass ich einmal Bauunternehmer in Kanada werde, das war mir nicht in die Wiege gelegt.“
„Es ist schwer zu entscheiden, was uns wirklich angeboren ist oder wie die eigene Biographie anders verlaufen wäre, wenn man an bestimmten Weggabelungen des Lebens eine andere Richtung eingeschlagen hätte“, erwiderte Landau. „Vielleicht muss man akzeptieren, dass man die Summe seiner Entscheidungen ist, immer in Strukturen, Situationen und Geschichten eingebettet.“
Und, nachdem sie bestellt hatten, fuhr Landau fort: „Auch mir ist der kanadische Hochschullehrer nicht in die Wiege gelegt worden, denn in einer idealen Welt“ – und nun zögerte Landau etwas, weil er kurz davor stand, etwas preiszugeben, was er bislang kaum jemandem anvertraut hatte – „in einer idealen Welt habe ich mir als Jugendlicher ein Leben als Komponist und Musiker erträumt, selbstverständlich in Wien, wo denn sonst.“
Nach einer kurzen Pause fügte halb singend er hinzu: „Wien, Wien, nur du allein / Sollst stets die Stadt meiner Träume sein …“ Es waren die ersten Zeilen des Wienerlieds von Rudolf Sieczyński, das in seiner Jugend an beinahe jeder Ecke der Stadt zu hören gewesen war. „Ein wenig ist jedes Leben eine kleine Vertreibung aus dem Paradies“, ergänzte er und ärgerte sich dann doch über seine Offenheit, über das peinliche Pathos seines Bekenntnisses.
Funk bemerkte dies nicht, nahm den Ball aber auf. „Das verlorene Paradies“, sagte er nachdenklich, „ist es nicht wie eine Urerfahrung? Die Bilder der gefallenen Engel, sie sind tief in das Unterbewusstsein eingekrochen, weil sie doch etwas über den Menschen aussagen: Er verliert sein Paradies und muss sich in der Welt behaupten, unter Schweiß und Tränen sein Brot essen.“ Gedankenversunken betrachtete er das Glas Weißwein auf dem Tisch, bevor er es zur Hälfte in einem Zug leerte, dann sagte er: „Ich habe aber habe das Paradies sogar zweimal verloren, bevor ich auf die Wanderschaft gegangen bin. Ein drittes Paradies gibt es nicht.“
Landau schaute ihn verblüfft an; seine Antwort kam ihm hilflos vor. „Das ist doch sehr überhöht, beinahe so wie die unglückliche Kundry, die Gott gelästert hatte und zu einer unruhigen Wanderschaft auf der Erde verbannt wurde.“ Und dann, nach einer Pause, als ob er das Bekenntnis ironisch brechen wollte: „Du aber, du hast doch nicht Gott gelästert?“ Ihm missfiel die Richtung, die das Gespräch nun genommen hatte, und er bedauerte beinahe, die Vertreibung aus dem Paradies erwähnt zu haben. Metaphysischer Unfug, er hatte es lediglich als ein Bild verwenden wollen, ganz ohne den religiösen und spirituellen Ballast. Deswegen überraschte ihn Funks Antwort nicht nur, sie traf ihn wie ein Schlag in die Magengrube: „Haben wir Überlebende unserer Generation nicht alle Gott gelästert?“
Landau war zunächst verunsichert, dann erregt, ja empört. Unsinn! Völliger Quatsch. Dann wiederum: Schuldgefühle! Sie kommen bei den Überlebenden von Katastrophen häufig vor. War es das? Ein Schuldgefühl, theologisch verbrämt? Er kämpfte sichtlich mit sich, und es brauchte einen kurzen Moment, bis er sich wieder gefangen hatte. In sein Schweigen hinein sprach Funk, als wollte er sich erklären. Er habe keine Absicht gehabt, ein verletzendes Wort zu sagen. Doch habe das Gespräch in ihm viele Fragen aufgeworfen, denen er sich eigentlich nicht habe stellen wollen.
„Ich glaube“, sagte Funk, „dass dein Projekt die beteiligten Menschen dazu zwingt, eine erzählende Ordnung in ihr Leben zu bringen. Damit ist immer auch die Elle von Schuld und Verstrickung angelegt, gerade in unserer Generation. Meine Frage wollte nichts unterstellen. Aber wir können uns von den Verstrickungen nicht befreien. Da gibt es glücklichere Generationen.“
Landau nickte. Das war zweifellos richtig. Für ihn war aber Schuld individuell, sie war nicht das Schicksal einer ganzen Generation. Er könne, erwiderte er, so manches nicht ganz nachvollziehen, sich aber vorstellen, dass seine, Funks, Geschichte, einen wertvollen Beitrag zum Forschungsprojekt leisten würde. „Hast du Lust, dein Leben einmal in die erzählende Ordnung zu bringen und so der Wissenschaft einen Dienst zu erweisen?“
Unverzüglich willigte Funk ein, gerade so, als habe er nur auf das Angebot gewartet, als sei das Gespräch auf dieses Ergebnis hingesteuert. Man verabredete sich für Mitte August, der ruhigen Zeit auf dem Campus, in der die Studenten noch nicht den Campus bevölkerten, aber die Vorbereitungen für das neue akademische Jahr schon angelaufen waren. Dann verlor sich das Gespräch in politischen Aktualitäten und ein wenig Klatsch aus der deutschen Gemeinschaft, plätscherte aus, ohne noch einmal den nun vertagten sensiblen Punkt anzusprechen oder sich ihm noch einmal zu nähern, und Landau hatte den Eindruck, dass dies auch von Funk so gewollt war.