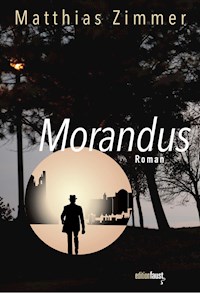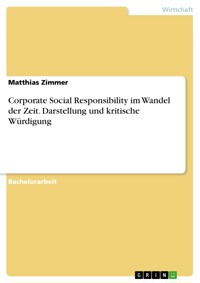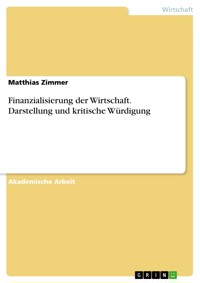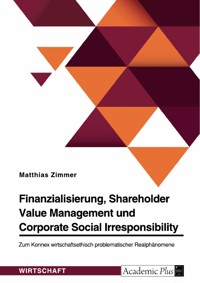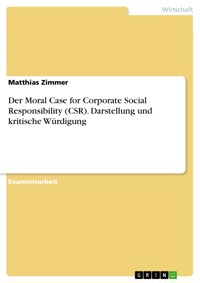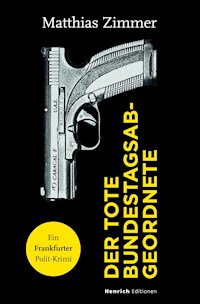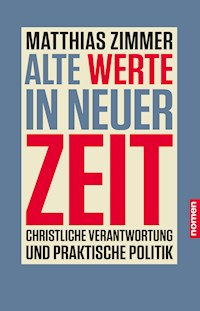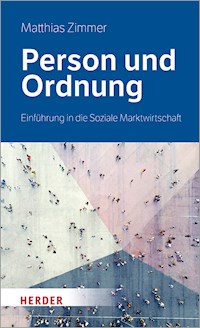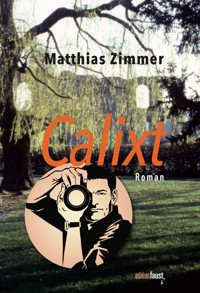
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Faust
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was ist es, was unser Leben prägt, was sich uns einprägt über Generationen hinweg? Der berühmte Historiker Rudolf Herzberg blickt auf sein Leben: seine Laufbahn in der DDR, seine sozialistische Grundüberzeugung, sein Familienleben. Gleichzeitig sieht sich sein Sohn, der vor vielen Jahren aus der DDR geflohen war, vor die Aufgabe gestellt, eine Rede zum dreißigsten Jahrestag des Mauerfalls vorzubereiten. Dazu muss er sich seiner Vergangenheit stellen, aber auch dem, was seinem Vater wichtig war. Kann man auf Erinnerungen bauen? Aus den unterschiedlichen Perspektiven von Vater und Sohn entsteht ein neuer Blick auf die Vergangenheit und auf die Frage, was es braucht, um dem Leben Sinn und Bedeutung zu geben. CALIXT – nach MORANDUS der zweite Roman von Matthias Zimmer
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für KerstinImmer wieder
1. Auflage 2023
© Edition Faust, Frankfurt am Main 2023
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Kopien, Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
www.editionfaust.de
Lektorat: Elvira M. Gross, Wien
Satz: Uwe Adam, Adam-Grafik, Freigericht
Druck: TZ-Verlag & Print GmbH, Roßdorf
Printed in Germany
ISBN 978-3-949774-16-4
eISBN 978-3-949774-17-1
Matthias Zimmer
CALIXT
INHALT
I. PROLOG
II. LEHRER UND SCHÜLER
III. EIN BRIEF
IV. DER PRIESTERKÖNIG
V. DIE REPUBLIK DER HISTORIKER
VI. EIN DISPUT
VII. ANFÄNGE
VIII. BLOCH
IX. GOG UND MAGOG
X. ZWEI VORTRÄGE
SCHLUSSAKT
I
PROLOG
Andreas Kaelber, Doktorand der Geschichte an der Universität Jena, saß nun schon seit vielen Stunden in dem Archivraum an dem ihm zugewiesenen Schreibtisch. Wie alle Leseräume in den Archiven, die er kannte, war auch dieser wenig einladend: kahl, die Wand lediglich durch eine offizielle Fotografie des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier an der Stirnseite geschmückt, eingepasst in einen schlichten schwarzen Rahmen und ein weißes Passepartout. Die Plastikhartschale, die als Stuhl diente, war sicherlich ergonomisch nicht optimal, erfüllte aber ebenso ihren Zweck wie der Resopaltisch. Der Fußboden war mit einem bräunlichen Linoleum bedeckt. Eine deutsche Amtsstubenatmosphäre, dachte Kaelber. Der Raum war groß, etwa zwanzig Tische. In die leicht stickige Luft mischte sich der Staub von Akten: zusammengeschnürte Papierbündel, Ordner, Karteikarten. Hier lagerte ein Teil der Hinterlassenschaft der DDR, oder zumindest das, was noch übriggeblieben war. Kaelber blätterte Akte über Akte durch, mitunter musste er Zeilen mehrfach lesen, da sie ihm in das Dunkel des Halbschlafs entglitten. Dann zuckte er zusammen wie jemand, der durch ein lautes Geräusch oder einen bösen Traum aufgeschreckt wurde, und zwang sich, wieder mit neuer Konzentration auf die bedruckten Seiten zu schauen, zu lesen, zu exzerpieren, wenn notwendig. Was er jetzt aber las, mit immer neuem Anlauf, das ließ ihn hellwach werden, er vermochte es kaum auszusprechen, eine Notiz war auch nicht notwendig. Klar und deutlich stand es in den Akten und ließ keinen Zweifel zu: Der über die DDR hinaus berühmte und anerkannte Historiker Rudolf Herzberg, Professor an der Universität Jena, Träger bedeutender Auszeichnungen, darunter der Johannes-Becher-Medaille für die Entwicklung der sozialistischen Nationalkultur und des Vaterländischen Verdienstordens in Silber, Ehrendoktor der Universität Turin, hochgerühmter Lehrer und Doyen der Historiker des Mittelalters und der frühen Neuzeit in der DDR – dieser Rudolf Herzberg war Inoffizieller Mitarbeiter der Staatssicherheit gewesen. Deckname: Calixt.
1938
„Das war einer deiner besseren Scherze“, sagt die Stimme zu Herzberg.
„Wie bitte?“
„Einen katholischen Schutzheiligen als Decknamen für die die Stasi zu wählen. Das war einer deiner besseren Scherze“, wiederholt die Stimme. „Subversiv irgendwie.“
„Wer bist du?“
„Ich bin unter vielen Namen bekannt. Du kennst mich vielleicht unter dem Namen Esra.“
„Nein.“
„Oder Azrael“, ergänzt die Stimme.
„Der Engel des Todes“, flüstert Herzberg.
„Nicht so melodramatisch. Ich bin der, der die Menschen begleitet. Der ihnen den Weg weist.“
„Wohin?“
„Wohin auch immer sie gehen.“
„Wohin gehe ich?“
„Das wird sich zeigen, Calixt“, sagt die Stimme sanft.
„Wo bin ich?“
„Auch das wird sich dir zeigen. Schau hin.“
Herzberg spürt, dass er in einem weichen, tiefen Sessel sitzt. Langsam funzelt ein Licht an. Er schaut sich um, kann niemand erkennen. Der Raum scheint groß zu sein, die Wände sind nicht zu sehen. Erstreckt sich der Raum ins Nichts, ins Nirgendwo? Er kann es nicht sagen. Vor ihm beginnt es heller zu werden. Eine Leinwand. War hier ein Vorhang aufgegangen wie im Kino? Bemerkt hatte er nichts davon. Auf der Leinwand erscheint eine Schrift. „Er lebt und er lebt nicht.“ Was das wohl bedeutet? Soll er fragen?
„Rätselhaft“, murmelt er stattdessen nur.
„Wie vieles in deinem Leben“, erwidert die Stimme.
„Das habe ich nie so empfunden.“
„Menschen sind Meister darin, ihre jeweilige Gegenwart als das unvermeidliche und folgerichtige Ergebnis ihres bisherigen Lebens zu interpretieren. Aber das ist es nicht.“
„Bist du der Historiker oder ich?“ Herzberg ist sich nicht sicher, ob er zu weit gegangen ist. Aber was soll ihm passieren? Was kann passieren? Was will Esra von ihm? Er gesteht sich ein, er weiß es nicht, und das macht ihm Angst.
„Fürchte dich nicht. Du erinnerst dich an diese Worte? Fürchte dich nicht. Du bist der Historiker. Aber ich kenne dich besser als du dich selbst. Ich bin dein Historiker. Ich bin nicht dein Richter. Fürchte dich nicht. Sieh hin.“
Mit einem Mal fluten Bilder, Geräusche, Gerüche den Saal: kein Kino im üblichen Sinn, sondern ein Eintauchen in das Leben selbst. Herzberg ist nicht mehr Beobachter. Er ist wissender Teil seiner selbst, der sich wiedererkennt. Es ist, als ob er als Gast in seinem eigenen Kopf säße. Und gleichzeitig sich selbst beobachtet. Eine eigentümliche Art der Dialektik, denkt er, Subjekt und Objekt zugleich. Vielleicht ist das der Sinn der rätselhaften Worte: Er lebt und er lebt nicht?
1938. Er ist dreizehn Jahre alt, läuft über die Wiese hinter dem großen Haus seiner Eltern. Er läuft und sieht sich laufen, eine Gleichzeitigkeit des Erlebens, die ihn zunächst verwirrt. Er denkt und hört sich denken, nein: Er hört seinem jungen Ich beim Denken zu. Er ist auf dem Weg zu Birrenbach, dem Pastor der Gemeinde. Dort wird er seine Freunde treffen.
„Birrenbach“, sagt er halblaut vor sich hin. „Ich hatte ihn beinahe vergessen.“
„Er hat dich nie vergessen. Wie deine Freunde Morandus und Remigius.“
Herzberg erwidert nichts darauf, nickt nur.
Er sieht nun, wie Birrenbach die Kirche betritt. Die Szenerie im Film hat sich geändert. Es ist der Firmunterricht, bei dem zwei Jahrgänge zusammengefasst worden sind. Er nimmt den besonderen Geruch der Kirche wahr, in deren Kühle der Weihrauch festsitzt. Die Firmlinge, alle zwischen zwölf und vierzehn Jahren alt, sitzen auf den harten Kirchenbänken. Der Blick schweift zu dem reich verzierten Barockaltar von St. Peter und Paul, zu den Wandbildern, zum steinernen, deutlich erhöhten Predigtstuhl mit seinen reichen Ornamenten.
Birrenbach ist jung, vielleicht Mitte oder Ende dreißig. Damals erschien er ihm unendlich alt, unendlich klug. Seine eindringliche, leicht näselnde Stimme erzählt das biblische Gleichnis vom Kamel und dem Nadelöhr und erklärt es. Kommt es ihm wirklich etwas einfach vor? Nun ja, für uns Kinder war es das damals nicht. Fragen über Fragen, und kaum jemand konnte Antworten geben. Birrenbach schon. Er stand den Kindern Rede und Antwort, ging auf jedes von ihnen ein. So brachte er ihnen den Glauben nahe. Die Aufrichtigkeit seines Glaubens überzeugte, nicht die Intensität. Zu glauben schien natürlich zu sein, und vernünftig. Birrenbach machte sich einen Spaß daraus, die Kinder in seiner Jugendgruppe, zu der auch Herzberg gehörte, nicht bei ihrem Taufnamen zu nennen, sondern bei dem Namen des Heiligen, der an ihrem jeweiligen Geburtstag verehrt wird. Daher Calixt, Morandus, Remigius. Es befestigt den Glauben, sagte er, wenn ihr an die Heiligen denkt, die mit eurem Geburtstag verbunden sind. Und wirklich, es führte dazu, dass sich die drei Jungs intensiv mit den Heiligen auseinandersetzten. Ein Leben im Glauben.
Später habe ich ihn verloren, den Glauben, geht es Herzberg durch den Kopf. Damals aber war es selbstverständlich am westlichen Rand des katholischen Eichsfeld. Eine Jugend mit Gott. Eine Jugend in Geborgenheit, trotz allem. Gott gehörte zu unserer Kindheit dazu. Der Glaube gehörte dazu, auch wenn die Nazis versucht haben, ihn zu verdrängen, auszumerzen. Für Birrenbach war er keine steife, altbackene Angelegenheit. Er war jung, frisch, ein fröhlicher Glaube. Birrenbach sagte: Die Apostel, das waren doch keine alten Herrschaften. Das waren junge Leute, so wie ihr. Ein wenig wie die Wandervögel. Die wollten etwas verändern, die wollten etwas Neues. Birrenbach verkörperte diesen Esprit ebenfalls. Er war sportlich, unkonventionell. Gleichzeitig zelebrierte er in aller Feierlichkeit die Messe. Ja, das ist das richtige Wort: zelebrieren. Er schien ein anderer, wenn er vor seiner Gemeinde stand und die lateinischen Worte sprach. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Die Worte habe ich gewusst, noch bevor ich sie verstand. Die tridentinische Messe, wie schade, dass sie abgeschafft worden ist! Aber warum beschwere ich mich, ich war seit Ende des Krieges nicht mehr in einer Messe.
„So lange?“, fragt die Stimme leise.
„Spielt es eine Rolle?“
„Was glaubst du?“
„Glauben? Ich weiß es nicht.“
„Eine kluge Antwort.“
Aus der Ferne erklingt leise Musik: das Miserere von Gregorio Allegri. Auf dem Bildschirm eine Innenansicht der Kirche St. Peter und Paul in Lindau. Miserere mei, Deus, Erbarme Dich meiner, Gott. Eine Musik, die ein inneres Leuchten hervorbringt. Zerstöre meine Ungerechtigkeit, Reinige mich reichlich von meiner Ungerechtigkeit. Herzberg erinnert sich. Er hat das Miserere in dieser Kirche zum ersten Mal gehört. Ein Chor aus dem nahen Göttingen. So hatte er sich die Gesänge der himmlischen Heerscharen vorgestellt: leise, eindringlich, schwebend, durchsichtig und doch geheimnisvoll. Birrenbach erzählte, es sei geheime Musik gewesen. Bei Strafe der Exkommunikation sei es verboten gewesen, die Musik zu kopieren. Mozart indes habe sie nach bereits einmaligem Hören komplett niedergeschrieben. Niemals ist Musik dem Göttlichen näher gewesen als bei Allegri. Es ist die Musik entkörperter Seelen, schwerelos, reiner Geist. Das ist der Schatz der Kirche: Seelenheil wird hier sinnlich erfahrbar.
Die Frage hat Herzberg immer beschäftigt: Was ist der Unterschied zwischen dem Geist und der Seele? Die Sprache gibt hier keinen guten Anhaltspunkt: Man ist beseelt, vergeistigt. Stirbt man, ist der Körper entseelt – aber wo ist der Geist? Der Körper wird nicht entgeistigt, oder?
„Esra, ich habe keine Schmerzen mehr. Ich spüre die kaputte Hüfte nicht mehr.“
„Das wäre auch in höchstem Maße erstaunlich.“
„Bin ich noch der, der ich war?“
„Das Sein kennt viele Manifestationen. Es bleibt aber immer es selbst. Also, ja.“
„Ich bin tot, nicht wahr?“
„Hast du diesen Eindruck?“
„Ich spüre meinen Körper nicht mehr.“
„Ist das eine Voraussetzung des Lebens?“
„Etwa nicht?“
„Fehlt dir etwas?
„Nein.“
„Kannst du dich selbst begreifen als der, der du bist?“
„Ja.“
„Ist das nicht die Definition des Lebens, wenn man von so profanen Dingen wie der Fortpflanzung absieht?“
„Bin ich dazu nicht ohnehin zu alt?“
Esra lacht. „Da ist dir doch eine Last genommen, oder?“
„Lass uns weiter den Film sehen.“
Wieder wechselt die Szenerie. Herzberg findet sich im Studierzimmer von Birrenbach. Hunderte von Büchern, alle versehen mit einem Exlibris. Ihn interessieren die großen Bildbände. Einen großen Band nimmt er aus dem Regal und legt ihn auf den kleinen Holztisch beim Fenster. Es ist ein französisches Buch aus den 1890er Jahren, ein Bestiarium. Darin sind Tiere abgebildet, aber auch Fabelwesen wie der Mantikor, das Einhorn oder der Hyppogreif. Gibt es diese Wesen überhaupt? Die Frage hatte ihn damals lange beschäftigt. Und noch bevor er sie für sich formuliert, hört er sie bereits in dem Film, an Birrenbach gerichtet.
„Gibt es Mantikore und Einhörner?“, fragt Birrenbach amüsiert zurück. „Nun, die Menschen damals waren jedenfalls davon überzeugt.“
„Aber sie hatten doch noch nie eines dieser Tiere gesehen, oder?“
„Und du, hast du schon einmal einen Tiger gesehen? Oder ein Känguru? Und doch glaubst du, dass es sie gibt. Wie ich übrigens auch, und ich habe auch noch nie einen Tiger oder ein Känguru gesehen.“
„Ja, schon“, erwidert Herzberg etwas kleinlaut. „Aber alle sagen doch, dass es Tiger gibt. Und dass es eben keine Einhörner gibt. Oder Drachen. Oder einen Minotaurus, von dem wir neulich im Geschichtsunterricht gehört haben.“
„Ob etwas existiert oder nicht, ist also davon abhängig, was die Leute darüber sagen?“ Birrenbach macht eine wegwerfende Handbewegung. „Die Leute. Was wissen die schon. Die braucht Gott nicht, um die Wahrheit seiner Schöpfung zu bezeugen.“
„Das verstehe ich nicht.“
„Die Leute glauben viel. Auch viel Unsinn.“
„Aber sie glauben auch an Gott. Und an die Auferstehung. Und an die Jungfrau Maria.“ Herzberg ist verwundert über sein junges Ich.
„Wo ist da der Unterschied? Wie kann ich etwas sicher wissen?“
„So sicher wie ein mathematischer Lehrsatz?“ Birrenbach hält einen Moment inne. „Komm mit“, sagt er dann und geht hinaus in den Garten. „Was siehst du?“
„Bäume, die Wiese und Häuser.“
„Ja, genau. Siehst du den Hasen im Bau?“
„Nein, der ist doch im Bau versteckt.“
„Genau. Aber dein Hund wüsste ganz genau, wo der Hase ist, auch wenn du es nicht sehen kannst. Und der wäre jetzt vermutlich schon im Garten und würde versuchen, den Hasen aus seinem Bau zu scheuchen. Dein Hund nimmt also den Garten anders wahr als du. Er kann vielleicht schlechter sehen, aber um ein Vielfaches besser riechen. Wer hat jetzt recht?“
„Er sieht also die Welt anders, weil er besser riechen kann?“
„Genau. Wir sind immer auf unsere Sinne angewiesen: Hören, sehen, riechen, schmecken, tasten. Und unsere Sinne sind begrenzt, sie sind unvollständig. Deswegen ist Wahrheit nie etwas, das mit den Sinneseindrücken zu tun hat. Die Wahrheit können wir nur mit dem Geist erfassen.“
Birrenbach geht in den Garten und hebt einen Apfel auf. „Ein Apfel“, sagt er wie beiläufig. „Rot, mit einigen braunen Flecken, nicht schön rund, sondern ein wenig unförmig. Aber ein Apfel, nicht wahr?“
„Ja. Ein Apfel.“ Herzberg ärgert sich über das Unbeholfene in der Antwort seines jüngeren Ich. Aber er erinnert sich, wie es weitergeht und dass er hier, ein Gespräch erinnernd, sieht, was seinen weiteren Lebensweg bestimmt hat.
„Und nun, Rudolf“, sagt Birrenbach,“ gibt es gelbe, grüne, braune Äpfel; kleine und große, runde und ovale, verwachsene und glänzende, süß und sauer schmeckende. Aber wie unterschiedlich sie auch sein mögen, wir bezeichnen sie als Apfel. Und wir haben eine Idee, warum der Apfel kein Pfirsich ist, obwohl die auch rund sind, gut schmecken und rot oder gelb sein können. Das ist der Kern der Erkenntnis. Wir beziehen die sehr unterschiedlichen Sinneseindrücke auf Begriffe, weil wir in der Lage sind, das zu benennen, was den Dingen gemeinsam ist und was nicht. So erkennen wir die Welt. Und steht nicht in der Bibel schon: Am Anfang war das Wort? Das Wort ist kein Eindruck der Sinne, sondern Ausdruck des Geistes. Das Wort ordnet die Welt. Und Gott verbürgt die Wahrheit der Welt durch das Wort. Er könnte uns in der Allmächtigkeit auch täuschen und sich einen Spaß daraus machen, uns Dinge vorzugaukeln. Er könnte auch Einhörner erschaffen in seiner Allmächtigkeit, er tut es aber nicht. Er ist ein wahrhaftiger Gott, der uns die Welt erkennen lässt. Aber wir müssen die Wahrheit auch suchen.“
„Aber wie kann ich dann Gott erkennen?“
„Eine gute Frage. Ich meine, wir können ihn nur indirekt erkennen. So wie wir aus dem Schatten eines Menschen schließen, dass ein Mensch existiert. Gott ist nicht von dieser Welt und er übersteigt alle unsere Sinneseindrücke. Deswegen kann man Gott auch nicht erkennen. Er offenbart sich einigen Menschen, und das muss eine erschütternde Erfahrung sein, weil sie alle Sinne anspricht und übersteigt, alles Denken überflutet und so unfassbar ist, dass wir es in Worte nicht fassen können. Und was wir nicht in Worte fassen können, das können wir vielleicht mit dem Herzen begreifen.“ Birrenbach legt den Apfel beiseite und sagt nach einem Moment stillen Nachdenkens: „Gott ist die Wahrheit selbst, ihr Anfang und ihr Ende. Wir können Gott nicht erkennen, so wie wir einen Apfel erkennen.“
Birrenbach wendet sich um, zurück ins Haus, öffnet die knarzende Tür. „So, genug für heute. Komm in ein paar Tagen wieder und denk darüber nach, was ich gesagt habe.“
Der Film fädelt aus. So also war das, denkt Herzberg. Ich erinnere mich. So viele Fragen, und Birrenbach konnte etwas damit anfangen. Konnte den Weg weisen.
„Esra, gibt es Einhörner?“
„Hattest du je gedacht, dass es mich gibt? Du hast mich immer für ein Märchen, eine Legende gehalten. So wie ein Einhorn. Wenig schmeichelhaft, muss ich dir sagen.“
„Hm, also weil es dich gibt, existieren auch Einhörner?“
„Jetzt wirst du albern. Brauchst du Einhörner?“
„Nein. Aber ich brauche auch keine Spinnen oder Kängurus. Und trotzdem existieren sie.“
„Aber vielleicht brauchen andere Menschen Einhörner?“
„Wie meinst du das?“
„Durchaus wörtlich. Brauchen die Menschen nicht manchmal ihre Fantasie, ihre Träume, um mit der Welt klarzukommen? Die nackte Erkenntnis allein beantwortet keine der wichtigen Fragen. Wenn du weißt, dass das Universum aus einem Urknall entstanden ist, gibt es dir keinen Aufschluss darüber, warum du lebst. Oder würde es dir gefallen, dich als Produkt blinden Zufalls zu verstehen?“
„Und Einhörner helfen?“
„Ja, sie sind ein Teil der Antwort darauf, wie wir in einem großen Ganzen leben. Und dass die Welt mehr ist als die Dinge, die wir sehen. Menschen können träumen, im Gegensatz zu Robotern. Und ihre Träume sind ein wichtiger Teil ihrer Existenz. Eine eigene Realität.“
„Das geht mir jetzt zu weit. Menschen müssen die Welt erkennen, um sie zu verbessern. Nicht in ihren Träumen leben.“
„Aber Rudolf. Sie wissen doch um die Möglichkeit einer besseren Welt nur aus ihren Träumen. Und du warst es doch auch immer – ein Träumer. Schau hin, wie es begonnen hat.“
Wieder erscheint auf der Leinwand das Studierzimmer von Birrenbach. Und wieder ist Rudolf darin zu sehen, in ein Buch vertieft. Die Bäume draußen sind kahl, es ist Winter. Er sitzt in einem Sessel am Fenster mit Blick auf den großen Garten.
„Was liest du da?“, fragt Birrenbach.
Rudolf hält das Buch kurz hoch, es sind die Historien von Herodot.
„Keine leichte Lektüre“, sagt Birrenbach mit einer gewissen Bewunderung.
Rudolf antwortet nicht, schüttelt den Kopf. Ich bin verwirrt, denkt Herzberg, fragt aber nicht nach.
„Ich verstehe etwas nicht“, sagt der junge Rudolf. „Ich verstehe es nicht.“
„Was ist denn an Herodot so schwer?“
„Wir haben im Unterricht gelernt: Geschichte ist das, was gewesen ist. Man muss also das, was war, genau berichten. Nichts weglassen, nichts hinzudichten.“
„Ja, so wird es in der Schule unterrichtet“, pflichtet Birrenbach bei. „Man soll erzählen, wie es eigentlich gewesen ist.“
„Ja“, sagt Rudolf, „und dann schreibt Herodot, er erzähle, wie es die Griechen oder die Perser berichten, will aber selbst kein Urteil darüber abgeben, ob es wahr oder falsch ist. Aber wenn ich als Historiker berichte, wie es eigentlich gewesen ist, muss ich doch Wahres von Falschem trennen.“
„Das stimmt. Du musst dich auf gesichertes Wissen zurückziehen. Aber für einen guten Historiker ist das vielleicht auf Dauer zu wenig. Es reicht doch nicht aus zu sagen: Dann passierte dies, dann passierte das. Ein guter Historiker muss auch Antworten auf die Frage haben: Warum ist es eigentlich passiert?“
„Ja, aber es wird doch auch deutlich. Der trojanische Krieg hat begonnen, weil Paris dem Agamemnon seine Braut Helena geraubt hat.“
„Das war die Ursache, aber nicht der Grund“, erwidert Birrenbach. „Nach dem einen fragst du mit weshalb‘, nach dem anderen mit ‚warum‘.“
„Verstehe ich nicht.“
„Nun, du erinnerst dich, dass vor ein paar Wochen die Synagogen in Deutschland zerstört worden sind?“
„Ja. Die schöne alte Synagoge in Göttingen ist auch zerstört worden.“
„Nun, die Ursache für die Zerstörungen war ohne Zweifel die Ermordung des deutschen Gesandten in Paris. Der Grund war aber ein anderer: der Hass auf Juden insgesamt. Und der beruht auf alten Geschichten, auf Gerüchten, auf Verdächtigungen, auch auf Fälschungen. Es zeigt, wie stark sich Menschen manipulieren lassen. Der Hass auf Juden setzt sich von Generation zu Generation fort, er wird dann beinahe zu einer Selbstverständlichkeit.“ Birrenbach schüttelt den Kopf und legt eine Hand auf Rudolfs Schulter. „Es ist nichts schwerer, als Märchen von der Wahrheit zu trennen. Viele Menschen brauchen die Märchen, aus vielerlei Gründen. Herodot trennt beides nicht. Er ist deswegen für uns aber nicht weniger interessant. Durch ihn erfahren wir nämlich nicht nur, was damals passiert ist, sondern gleichzeitig, was die Menschen geglaubt haben, dass passiert ist. Heute würde es kein Historiker mehr so machen. Aber Herodot konnte sich nur auf Erzählungen stützen und diese aufschreiben. Er hatte keine Möglichkeit, die Wahrheit zu ermitteln. Das sollte der Leser für sich selbst tun.“
Das Bild verschwimmt, auf der Leinwand erscheint ein altes Frontispiz.
„Du erkennst es“, sagt Esra.
„Ja, es ist Clio, die Muse der Geschichtsschreibung. Tochter der Mnemosyne, der Erinnerung.“
„Ein schönes Bild, nicht wahr? Die Geschichtsschreibung als Tochter der Erinnerung. Erst kommt die Erinnerung, sie wird wieder und wieder erinnert, erzählt. Dann, im zweiten Schritt, die Geschichtsschreibung. Die Erinnerung wird aufgeschrieben. Die nächste Generation gewissermaßen. Und sie wird gewertet, Wahres von Falschem geschieden, Fakten von Meinungen. So hat dein Weg begonnen: als Schüler der Clio im Studierzimmer des katholischen Pfarrers.“
„Es war dieses Bedürfnis, den Dingen auf den Grund zu gehen. So wie es Birrenbach erklärt hatte: Ursachen sind häufig offensichtlich, Gründe versteckt, geheim, verborgen. Ich wollte hinter das Offensichtliche sehen, den geheimen Plan der Menschheitsgeschichte entdecken.“
„Die Geschichte hat keinen Plan. Das war schon immer dein marxistischer Irrtum.“
„Ach nein? Woher kommt wohl die Idee? Doch aus der christlichen Offenbarung. Am Ende der Zeit steht die Erlösung. Warum soll ein Marxist da weniger Recht haben als der Christ?“
„Weil das Ende der Geschichte nicht das Ende der Zeit ist“, erwidert Esra sanft. „Euch ging es immer um das irdische Paradies. Den Christen geht es in ihrem Glauben nicht um Irdisches. Es geht um die Aufhebung der Zeit in der Ewigkeit. Nicht um die Aufhebung der Geschichte in der irdischen Glückseligkeit.“
„Willst du mit mir streiten?“
„Nein. Ich bin hier, um dir dabei zu helfen, dein Leben zu verstehen.“
„Warum? Als Voraussetzung wofür?“
„Gerechtigkeit, Versöhnung und Frieden. Nicht mehr.“
Herzberg fällt erst jetzt auf, dass er bloß eine Stimme hört, aber kein Gesicht sieht. Wie sieht Esra aus? Er versucht im Halbdunkel etwas auszumachen, einen Körper, ein Gesicht, aber wohin er auch sieht, er ist umgeben von Körperlosigkeit und Formlosigkeit. Er erkennt weder seinen Sitz noch sonst irgendetwas, nichts außer der Leinwand, auf der immer noch Clio sich abbildet.
„Du wirst mich erst erkennen, wenn du sehen gelernt hast“, sagt Esra. „Bis dahin werden wir noch viel Zeit miteinander verbringen.“
„Zeit spielt hier eine Rolle?“
„Nein, ich habe den Begriff gebraucht, damit du es verstehst. Zeit spielt hier keine Rolle. Wir sind außerhalb der Zeit. Über ihr. In ihr. Je nachdem.“
Herzberg sieht, dass die Leinwand sich verdunkelt. Die Dunkelheit, die ihn umgibt, hat nichts Bedrohliches, sie wärmt, sie fühlt sich behütend an. Herzberg schließt die Augen. Er ist ganz bei sich.
DIE AUFGABE
In Trier hatte es in der Nacht ein wenig geschneit, was selten der Fall war; frühmorgens aber, als sich Franco Herzberg auf den Weg in die Schule machte, war der Schnee schon wieder verschwunden und hatte eine feuchte Nässe hinterlassen. Von der St.-Anna-Straße nahe seiner Wohnung im Stadtteil Olewig nahm Herzberg den Bus zu den Kaiserthermen. Von dort war es ein kurzer und angenehmer Fußweg zum Auguste-Viktoria-Gymnasium, wo er seit mehr als zwanzig Jahren als Fachlehrer für Geschichte und Deutsch arbeitete und seit einem Jahr stellvertretender Schulleiter war. Heute früh hatte er einen Termin beim Schulleiter, gleich zur ersten Stunde.
Er liebte den Weg von den Kaiserthermen zu seiner Schule, durch den barocken Palastgarten, vorbei an der Konstantinbasilika bis zum Altbau des Auguste-Viktoria-Gymnasiums, für dessen neubauliche Ergänzung er in all den Jahren kein freundliches Wort gefunden hatte. Doch die Pracht des alten Trier verzückte ihn stets aufs Neue; und wie viele alte Gebäude konnte man hier entdecken! Schon bei seinem ersten Besuch in Trier war er hingerissen von der Geschichte, die sich hier auf Schritt und Tritt fand. Sie kündete von den Römern, die Augusta Trevororum einst gründeten und vorübergehend zu einem der Zentren des Römischen Reiches gemacht hatten. Davon zeugten die Kaiserthermen, das Amphitheater und die riesige Basilika. Und immer wieder ins Erstaunen setzte ihn der Dom, diese Pracht christlicher Tradition mit dem ummauerten Garten und dem gotischen Kreuzgang, in dem die Scholastik noch lebendig zu sein schien. Trier atmete Geschichte, völlig unbefangen und wie selbstverständlich, und brachte sie auch mit der Moderne zusammen. Nicht überall eine glückliche Fügung, wie es Franco wohl wusste. So hatte er nach seiner Flucht aus der DDR 1986 das Studium in Trier begonnen, auf dem ultramodernen Campus in Tarforst, dessen Hauptgebäude eher einem gestrandeten Raumschiff als einer Universität glich. Bald hatte er sich hier heimisch gefühlt, viele Jahre in dem kleinen Studentenwohnheim neben der Universität wohnend.
Trier war ihm vertraut, war seine Heimat geworden. Nicht wenig für jemanden, der die Stätte seiner Jugend verlassen, sich ihr durch eine riskante Flucht entzogen hatte. So waren mit den Jahren die Erinnerungen an Jena verblasst, verschorft. Er war längst angekommen im Westen Deutschlands, die Teilung des Landes vor beinahe dreißig Jahren überwunden. Mit Jena verband ihn nichts mehr, mit Trier hingegen alles: seine Frau Kathrin, seine Kinder Peter und Paula, seine Freunde, seine Arbeit. Selbst sein historisches Forschungsinteresse, das er sich über die Universitätszeit hinaus bewahrt hatte, richtete sich auf Regionalgeschichte. Geschichte ist konkret und lokal. Anders als seinen Vater interessierten ihn nicht die großen Fragen der Geschichte, sondern die erfahrbare, konkrete Geschichte vor Ort. Deshalb war er seit vielen Jahren im Vorstand des Trierer Vereins für Regionalgeschichte und kümmerte sich als dessen Schriftführer um das Jahrbuch der Regionalgeschichte Trier, in welchem sich allerlei Aufsätze von gelehrten Experten und kundigen Laien fanden, die Geschichte der Stadt und seiner Umgebung bis hin zur Mittelmosel betreffend. Er selbst hatte dort einige Beiträge veröffentlicht, etwa zur strategischen Bedeutung der von Sebastien Vauban im siebzehnten Jahrhundert gebauten Festung Mont Royal oder zu den unterschiedlichen konfessionellen Entwicklungen an der Mittelmosel seit der Reformation, sah aber seine Aufgabe vorwiegend darin, junge Wissenschaftler zu Forschungen in der Regionalgeschichte zu motivieren und ihnen eine erste Publikationsmöglichkeit zu geben. Aus diesem Grund nahm er, unregelmäßig, immer wieder einmal einen Lehrauftrag an der Universität zu regionalgeschichtlichen Themen wahr. Er selbst war 1995 an der Universität promoviert worden, mit einer Studie über Schulen im kurtrierischen Raum vom sechzehnten bis zum neunzehnten Jahrhundert, also vor der Bildungsreform von Humboldt. Dieser Arbeit hatte er auch seine Position am Gymnasium verdankt, das aus einer 1652 gegründeten Mädchenschule hervorgegangen war. Der damalige Direktor hatte ihn bei der Suche nach Quellen unterstützt und später Einfluss darauf genommen, dass Franco nach dem Ende des Referendariates seiner Schule zugeteilt wurde. Das war 1996, und Franco hatte erstmals, als frisch eingestellter Studienrat, das Gefühl, sich nun neu beheimaten zu können, nach zehn Jahren des Suchens, des Forschens, der Unsicherheit. Nun war er, bevor der Unterricht für ihn in der dritten Stunde begann, auf dem Weg zum Direktor.
Der Direktor, etwa in Francos Alter, aber ungleich distinguierter wirkend, kam gleich zur Sache. „Franco, wir feiern im Herbst den dreißigsten Jahrestag des Falls der Mauer. Unser Gymnasium wird dazu eine Festveranstaltung durchführen und du sollst die Festrede halten.“ Das war in einem Ton formuliert, der weder Widerspruch noch eine Bedenkzeit zuzulassen schien. So reagierte Franco nach einem kurzen Moment des Erstaunens lediglich mit der Frage: „Warum ich?“ Der Direktor lächelte und nahm seine Brille ab; das tat er immer dann, wenn es darum ging, einer Aussage besonderen Nachdruck zu verleihen, wozu er die Brille wie einen Dirigierstab benutzte und damit Löcher in die Luft stocherte. „Das Ministerium will den Geist der nationalen Einheit ein wenig beschwören und hat verfügt, dass an allen Gymnasien das Thema der deutschen Einheit in diesem Jahr eine besondere Rolle spielen soll. Wir sind in der Wahl der Mittel frei und flexibel. Aber ich will schon eine Veranstaltung durchführen, in der das Thema der Teilung eine Rolle spielt, der Freiheitsdrang, die demokratische Revolution. Das ist dann unser Auftakt für weitere Veranstaltungen, Workshops, Unterrichtseinheiten und Exkursionen, vor allem für die Klassen der Oberstufe. Und wer wäre hier besser geeignet als du? Du bist dort geboren und aufgewachsen, du bist aus der DDR geflohen, hast deine Verwandten noch dort; für mich bist du geradezu prädestiniert, diese Auftaktveranstaltung zu gestalten – am 9. November, exakt dreißig Jahre danach. Und wir werden dann bis zum 3. Oktober 2020 weitere Veranstaltungen folgen lassen. Wir wollen nachvollziehen, was die Menschen damals bewegt hat, was sie umgetrieben hat.“
„Und was konkret erwartest du von mir?“
„Persönliches. Keine Geschichtsstunde im klassischen Sinn. Keine staatstragende Festrede. Ich will, dass du unserer Oberstufe die Menschen dort nahebringst, ihre Sorgen und Nöte des Jahres 1989. Ihre Hoffnungen. Du hast es doch am eigenen Leib erlebt, du bist Zeitzeuge. Denk darüber nach!“
Franco wusste, dass der letzte Satz das Gespräch nicht nur beenden sollte, sondern auch eine Aufforderung zum Gehen war, zumal der Direktor seine Brille wiederaufgesetzt hatte.
„Ich denke darüber nach“, sagte er beim Hinausgehen, fühlte dabei eine seltsame Mischung aus Vorfreude und Beklemmung aufsteigen. Er würde es mit Kathrin besprechen, am Abend, nun war es Zeit, sich auf den Unterricht vorzubereiten. „Ausgerechnet ich“, murmelte er, „ich habe doch damit abgeschlossen.“ Oder hatte er es nicht? Er konnte Kathrin jetzt nicht anrufen, sie war bei Gericht, wo sie als Anwältin einen Mandanten zu vertreten hatte. War es eine Aufgabe, die es ihm abverlangen würde, nach Jena zu fahren? Vielleicht sogar seine Schwester zu sehen? Das war der Teil, der ihm Beklemmungen verursachte. Dann aber war da der Gedanke, dass er selbst um der Freiheit willen ein Risiko eingegangen war. Ein Gedanke, der den Jugendlichen hier in Trier fremd blieb, sie waren alle in der Selbstverständlichkeit von Freiheit groß geworden. Interessierte das aber irgend jemanden? Er war sich nicht sicher. Bis zum Abend würde er versuchen, seine Gedanken zu ordnen.
Den ganzen Tag lang hatte er über die Worte des Direktors nachgedacht. Während des Unterrichts, nachmittags während der Vorbereitungen für den nächsten Tag, während er das Abendessen in der Küche zubereitete. Kathrin kam gegen 19 Uhr, fröhlich, aber ein wenig erschöpft. Sie war eine Frohnatur, nicht unbekümmert, doch mit einer positiven Grundhaltung zum Leben, wie sie der rheinische Katholizismus wohl hervorbrachte. Kathrin stammte aus der Eifel nahe Köln, hatte aber in Trier studiert, wo sie einander kennengelernt hatten. Ihr fehlte so völlig die schwermütige Ader, die er mit sich selbst und Thüringen verband. Sie war schon während des Studiums ein wenig drall gewesen, und im Lauf der Jahre hatte sich das stärker ausgeprägt, ohne dass sie dick wirkte. Nein, sie genoss die guten Seiten des Lebens, vor allem den Riesling von der Mosel, und man sah es ihr an. Und dann hatte die Geburt der beiden Kinder jeweils ein paar Pfunde als beständiges Andenken hinterlassen.
Erst nach dem Essen öffnete Franco eine Flasche Wein und nahm zwei Gläser aus dem Schrank.
„Das bedeutet, du hast was auf der Seele“, sagte Kathrin lauernd.
„Du kennst mich fast ein wenig zu gut“, seufzte Franco, stellte die Flasche und die beiden Gläser auf den Tisch, goss langsam den Riesling ein. Dann setzte er sich ihr gegenüber auf den Sessel, prostete ihr zu und nahm einen kräftigen Schluck.
„Ich soll einen Vortrag an der Schule halten. Am Jahrestag der Maueröffnung. Und über meine eigenen Erfahrungen berichten.“
„Da werde ich dir kaum helfen können. Du hast darüber wenig erzählt. Ganz so, als sei es kein Teil mehr von dir.“
Kathrin hatte recht. Bis auf ein paar dürre Angaben hatte er das Thema kaum angeschnitten. Seine Mutter war kurz nach seiner Flucht gestorben, mit dem Vater hatte er gebrochen. Und seine jüngere Schwester, die war nach wie vor eine Überzeugte. Hatte sich nie distanziert und saß für Die Linke seit einigen Jahren im Stadtrat von Weimar. Da war sie von Jena aus mit ihrem Mann hingezogen, einem ehemaligen Offizier der NVA, der nach der Wende in der Wirtschaft Karriere gemacht hatte. Die beiden hatten zwei Töchter, die damals, bei der Beerdigung seines Vaters, noch klein waren. Unzweifelhaft würde die Jugendweihe mittlerweile schon hinter ihnen liegen.
Nein, er wollte mit diesem DDR-Mief nichts mehr zu tun haben, auch nach über dreißig Jahren nicht. Allein die Erinnerung daran schmerzte: an den Vater, den treuen Diener des Regimes, ein anerkannter Historiker, linientreu; an die Mutter, drei Jahre jünger als der Vater, eine glühende Kommunistin, Gefangene im Konzentrationslager Ravensbrück im Februar 1945, von sowjetischen Truppen auf dem Todesmarsch am 3. Mai befreit. Seine Mutter, die Heldin des Widerstands gegen die Faschisten. Sie hatte seine Flucht als Verrat empfunden, sein Vater vermutlich ebenso. Ja, es war auch ein wenig aus Scham, dass er sich diesem Abschnitt seiner Biografie nicht mehr stellen wollte. Auch nach der Wende hatte er seinen Vater nicht mehr wiedergesehen, dessen Briefe unbeantwortet gelassen. Als er von seinem Tod erfuhr, hatte er es bereut. Das war 1995, kurz nach seiner Promotion. Seine Schwester, glaubte er, hatte ihn für den Tod der Mutter und des Vaters mitverantwortlich gemacht. Vater sei, sagte sie, ohne Mutter nicht lebensfähig. Nach dem Begräbnis war er sofort wieder