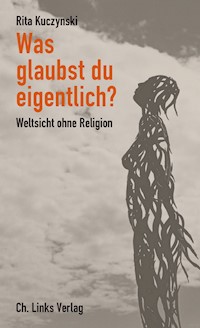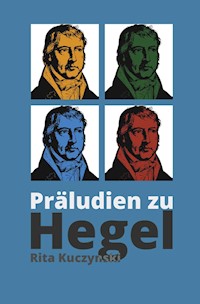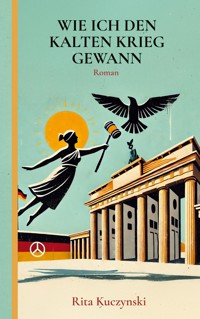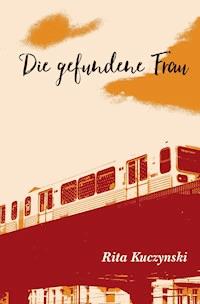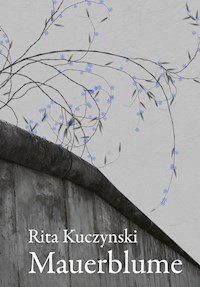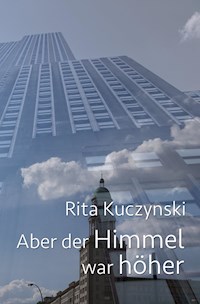
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das hatte sie nicht erwartet, ausgerechnet in den USA, dem Land ihrer unbegrenzten Möglichkeiten, findet ihr "Traum" vom "anything goes" mit dem 11. September 2001 sein jähes Ende. Anna Hausen, Malerin, aus dem Osten Deutschlands kommend, erlebt in Washington D.C. den Terroranschlag hautnah. Noch bevor Hubschrauber über der Stadt kreisen, die Sicherheit simulieren sollen, begreift sie: Es gibt schon wieder einen Bruch in ihrem Leben. Ihre schöne Zeit nach dem Ende des Ostblocks, da sie Landesgrenzen leichtfüßig überschreiten konnte, ist vorbei. Schon bei der Gepäckkontrolle am Dulles Airport muss sie gegen die Angst angehen, die sie früher überkam, wenn sie beispielsweise auf dem russischen Flughafen Scheremetjewo eincheckte. Wegen einer steinharten Salzbrezel, die sie als Andenken an Max im Koffer verstaut hatte, steht sie nun bei der Gepäckkontrolle vor einem amerikanischen Sicherheitsbeamten und wird peinlichst befragt. Sie hatte vergessen, dass diese Brezel auch eine Essware sein könnte. Dass sie noch rechtzeitig durch den Sicherheitscheck kommt und ihr Flugzeug erreicht, liegt vor allem daran, dass sie reflexartig ihr im Ostblock erlerntes Verhalten gegenüber Sicherheitsbeamten reaktiviert und sich fatalistisch in das Geschehen dieser Sicherheitskontrolle gibt. Sie wird sich verabschieden müssen von ihrer Illusion, zu glauben, mit dem Ende des Kalten Krieges hätte das immerwährende Spannungsverhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit ein verlässliches Maß gefunden. Und: Sie wird sich verabschieden von Max, ihrem amerikanischen Partner, von dem sie sich eigentlich schon zu lange verabschiedet hat, denn auch der gemeinsam erlebte Anschlag und der Schock darüber hat sie nicht wieder näher gebracht. Im Gegenteil. Zurück in Berlin beginnt Anna als Designerin in einer Werbeagentur zu arbeiten, die zu einem internationalen Konsortium gehört.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Imprint
Rita Kuczynski
Aber der Himmel war höher
epubli 2014
Für Sabine und Uschi
1
Der Mai war zu kalt. Er war auch zu feucht. Dass ich aufs Wetter achte, ist neu. Marion meint, ich würde weniger erwarten. Ich suchte nach Verlässlichem. Und schlechtes Wetter käme - wie gutes Wetter.
Das stimmt so aber nicht. Ich will nur Klarheit. Also ein Ende mit Max. Denn Klarheit in der Liebe ist unweigerlich das Ende. Jedenfalls habe ich es so erfahren. Daher achte ich zurzeit auf Wärme. Sogar einen Wollpullover habe ich mir gekauft, mitten im Mai. Ich kann die Trennung nicht länger leben. Das ist alles. Und dafür ist es viel. Zu viel denke ich manchmal. Dennoch will ich es versuchen. Ich habe mir daher auch eine neue Bahncard gekauft. Wegfahren hilft ja. Wir fahren doch das ganze Leben lang fort. Fort von uns. Wir merken nur Jahre später erst, dass wir gefahren sind. Dann können wir uns nicht erinnern, von wo wir losfuhren. Manchmal glauben wir, um den Anfang unseres Fortgehens zu wissen. Dann werde zumindest ich ruhiger, weil ich das Gefühl habe einen Faden in die Hand zu bekommen, an den ich mich halten kann. Aber bald verliere ich ihn wieder. Nicht dass er reißt. Er war gar nicht da. Denn der Anfang, um den ich glaubte zu wissen, war gar keiner. Auch deshalb liebe ich Bahncards und sammle Meilen bei allen Fluggesellschaften.
Obwohl Max gar nicht mehr in Europa ist, habe ich mir also eine Euro-Bahncard gekauft. Nicht weil das Angebot besonders günstig war, sondern weil ich glaubte, meinen Aktionsradius durch diese Card vergrößern zu können. Denn auch wenn Max schon lange nicht mehr im Lande ist, sind doch die Städte voll von Erinnerungen an ihn.
Mitunter gehe ich ins »Café Einstein« Unter den Linden, um zu gucken, ob Max dort die »Financial Times« liest. Er weigerte sich, diese Zeitung auch noch zu abonnieren. Schließlich hatte er schon drei Tageszeitungen. Natürlich weiß ich, dass Max eigentlich nicht dort sein kann. Trotzdem sehe ich mich um nach ihm, wie ich mich immer umgesehen habe, wenn ich dieses Café betrat. Irgendwann verweilt mein Blick dann auf der braunen Holzleiste, an der Fensterfront zur Straße. Tageszeitungen auf Halter gespannt, zieren die Wand zwischen den einzelnen Fenstern. Langsam steuere ich sie an und hole mir die »Financial Times« von einem der Wandhaken. Ich bestelle mir einen Espresso, den mit Kandiszucker. Ihn habe ich mit Max hier immer getrunken. Dann durchblättere ich Seite für Seite das rosa Papier der Zeitung, bis ich bei den Börsenkursen angelangt bin. Nicht dass sie mich sonderlich interessieren. Aber ich brauche die Nachrichten aus aller Welt, bis ich mir eingestehe, dass Max nicht hier sein kann. Dann lese ich noch, wie der Dollar zum Euro steht, auch weil ich dann weiß, ob Max’ Aktien Verluste oder Gewinne gemacht haben. Danach trinke ich den letzten Schluck Espresso aus. Ich liebe diesen kalten Schluck. Deshalb hebe ich ihn mir immer auf, bis ich auf der letzten Seite dieser Zeitung angelangt bin. Dann lege ich drei Euro auf den Tisch. Ich trage die Zeitung zurück zur Wand und hänge sie ordentlich an einen freien Haken. Die Kellner kennen meine Gewohnheit. Manchmal, wenn ich sehr früh komme, entschuldigen sie sich, dass die aktuelle Ausgabe der »Financial Times« noch nicht da sei. Sie geben mir dann die Ausgabe des Vortags. Sie liegt unter dem Tresen.
Marion sagt, es gehe so nicht weiter mit mir. Marion ist Psychoanalytikerin. Und dafür, dass sie diesem Beruf nachgeht, ist sie erstaunlich pragmatisch. Für andere hat sie meist einen vernünftigen Vorschlag, aus scheinbar aussichtslosen Situationen herauszufinden. Nur für sich meist nicht.
In ihrer Gutherzigkeit hat Marion in einer Sonntagszeitung unter der Rubrik ‚Zusammenleben’ für viel Geld und ohne mich zu fragen, eine Annonce für mich aufgegeben. Es sollte eine Geburtstagsüberraschung werden. Und so saßen wir dann an diesem Tag, da ich 51 Jahre alt geworden war, zusammen und sortierten 63 Briefe. Marion hatte professionell formuliert. Und da sie Max auch kannte, wusste sie, womit ich nicht umgehen kann. Schließlich blieben nur zwei Zuschriften übrig, die Erfolg versprechend schienen.
Ich war gar nicht so begeistert. Aber ich wollte Marion auch nicht enttäuschen. Also habe ich mir schwarze Wimperntusche und blauen Lidschatten gekauft. Da ich nie zuvor in meinem Leben Lidschatten benutzt hatte, musste ich erst einmal sehen, wie mit solch einer Farbe umzugehen war. Nachdem ich endlich verstanden hatte, dass sich das Blau besser mit den Fingern und nicht mit der beigelegten Schwammbürste auftragen ließ, war das Resultat zufrieden stellend. Ich hatte es geschafft, die Farbe gleichmäßig über das Augenlid zu verteilen.
Max hätte beim Anblick der blauen Bemalung sicher vor Lachen losgeprustet. Dann hätte er mich gefragt, ob es mir nicht gut gehe. Ich hätte gelacht, weil ich meist lache, wenn es mir nicht gut geht und ich mich zu keiner Antwort entschließen kann. Dann hätte ich ihm von der blauen Schminke abgegeben. Auf die Stirn hätte ich sie ihm geschmiert. Natürlich hätte er versucht, sich dagegen zu wehren. Wir hätten uns gebalgt, so dass der blaue Lidschatten auf unserer Kleidung gelandet wäre. Danach wären wir Fleckensalz kaufen gegangen. Im Buntwäscheprogramm hätten wir die Schminke aus unseren Sachen gewaschen.
Aber Max war nicht da. Also hatte ich Stunden mit dem Kosmetikspiegel verbracht. Ich hatte den Spiegel erst vor Tagen gekauft. Es war ein Sonderangebot. Marion meinte, ich müsste den Tatsachen endlich ins Auge sehen. Da ich mit Spiegeln keine Gewohnheit hatte, kaufte ich einen Drehspiegel. Die Vergrößerungen im Spiegel zu wechseln, gefiel mir.
Endlich hatte ich es also geschafft, den Lidschatten so aufzutragen, dass er einigermaßen manierlich aussah.
»Leuchten werden Ihre Augen mit unseren Farben«, versprach die Packungsbeilage.
Na ja, so schlimm war es denn doch nicht. Aber ich sah anders aus - und das war es, was ich im Sinne hatte. Ich wollte ein Zeichen setzen. Ich wollte nicht aussehen, wie ich ausgesehen hätte, wenn ich mit Max durch die Stadt gegangen wäre.
Der Einfachheit halber hatten Marion und ich beschlossen, bei den zwei übrig gebliebenen Kandidaten mit dem Berliner zu beginnen. Sich im Café »Adlon« zu treffen, hatte der Berliner Kandidat vorgeschlagen. Für alle Fälle hatte er mir seine Handynummer gegeben. Es könne ja immer etwas dazwischen kommen. Es kam nichts dazwischen. Nur dass ich ihn in der Lounge des Hotels nicht fand. Denn seine Beschreibung, er sei groß, also von stattlicher Natur, war angesichts der tiefen braunen Sessel, in denen die Besucher hier versanken, eine nutzlose Information. Also wählte ich seine Handynummer. Drei Tische vor mir suchte ein Mann in seiner Tasche nach dem klingelnden Gerät und meldete sich. Eigentlich hätte ich sofort auflegen und gehen sollen. Mein Gefühl sagte mir, dieser Mann, ganz in Schwarz gekleidet, sucht keinen Neuanfang, wie er in seinem Brief so wortreich beschrieben hatte. Jedenfalls nicht mit mir. Aber ich wollte Marion nicht enttäuschen. Schließlich war es ihr Geburtstagsgeschenk für mich. Also meldete ich mich. Dass ich keine drei Meter entfernt von ihm stand, verunsicherte ihn für einen Augenblick. Aber dann fing er sich, half mir aus dem Mantel und bat mich Platz zu nehmen. Bei einem Kaffee spielten wir unser Abfragespiel. Verheiratet waren wir beide schon. Ich einmal mehr als er. Dann gestand er mir, dass er als Immobilienhändler vor nicht langer Zeit pleite gegangen war. Das komme häufiger vor in dieser Branche. Aber ebenso häufig komme es vor, dass man ganz schnell wieder reinkommt ins Geschäft. Die Frau, die er liebte, habe ihn gleich nach seinem Bankrott verlassen. Er sei mehr als entsetzt gewesen. Denn auch ihretwegen hatte er einige riskante Käufe getan.
Ich hörte mir das eine Weile an. Dann hörte ich nicht mehr hin. Ich dachte an Max und daran, dass wir nie auf die Idee gekommen waren, im »Adlon« für irrsinnig viel Geld einen Kaffee zu trinken. Selbst wenn der Kaffee hier etwas besser schmeckte als anderswo. Ich starrte den Mann an, der einen Neuanfang wollte. Ich sah nur noch die Bewegung seines Mundes, aus dem Worte fielen, die ich nicht mehr hören wollte. Ich wusste, dass es eigentlich nicht recht war, was ich da tat. Denn ich täuschte ihn. Natürlich musste er denken, ich hörte ihm gebannt zu. Ja, ich hinge gerade zu an seinen Lippen. So verwunderte es nicht, dass er entzückt war, eine so begierige Zuhörerin gefunden zu haben. Um so erstaunter war er dann, als ich nach der zweiten Tasse Kaffee abrupt aufstand und mich so verabschiedete, dass für einen Widerspruch kein Raum blieb.
Ich nahm den Hunderter-Bus und fuhr zum Bahnhof Zoo. Im Café von Lofferiere am Kurfürstendamm bestellte ich nach einigem Zögern den Eisbecher, den ich mich mit Max dort immer gegessen hatte. Ich dachte daran, dass wir uns in den letzten Monaten viel gestritten hatten. Ich verstand erst jetzt, dass ich mich mein ganzes Leben lang immer nur in kluge, eigentlich in sehr kluge Männer verliebt hatte. In Männer, die mehr wussten als ich. Ich suchte nach Gewissheiten. Ich war süchtig nach Antworten, die keinen Widerspruch zuließen oder ihm standhielten. Solche Antworten suggerierten mir Sicherheit. Sie sprachen von Hoffnung, dass es vielleicht doch ein Einsehen gäbe. Zumindest für Stunden.
So war es auch mit Max. Ich war ruhig, wenn er sprach. Selbst seine mitunter dozierende Art, mir die Welt zu erklären, nahm ich lachend hin. Zu früh hatte ich jegliche Parameter verloren für das, was wahr und was falsch war. Denn alles ist wahr, und alles ist falsch. Es kommt auf die Bezugspunkte an. Sie allein ordnen die Dinge. Sie allein bestimmen die Grenzen, in denen wahr bleibt, was wir für wahr vereinbart haben. Treten wir hinaus über die von uns selbst bestimmten Grenzen, fällt zusammen, was uns hielt, weil die Koordinaten sich verändert haben.
Ich falle dann mit. Falle durch alle Raster, wohin, weiß ich nicht. Aber dass es kein Laut da gibt, wohin ich falle, weiß ich. Mitten in solch bodenlosem Fallen fängt mich einer dieser klugen Männer auf. Einer von denen, die auf alles eine Antwort haben. Nicht dass ich ihnen das vorwerfe. Im Gegenteil, auch Max liebte ich dafür. Ich war ihm dankbar. Begierig nahm ich seine Antwort auf und deckte meine Unsicherheiten zu mit ihnen, so gut ich konnte. Ja, süchtig nach Zuspruch bin ich immer gewesen. Und so lange Max da war, waren seine Antworten auch stimmig. Das heißt, ihr Klang war stimmig. Weil die Logik seiner Antworten aber nicht mehr stimmte, ihr Klang also brüchig wurde, wenn er nicht da war, konnte ich es kaum erwarten, ihn wiederzusehen. Seine Antworten beschützten mich.
Aber dann kam auch für Max der Tag, da ich alle seine Antworten kannte. Ich also wusste, was er als Nächstes erwidern würde, würde ich nachfragen. Und da wurde wieder alles wahr und alles falsch. Ich begann, ihm zu widersprechen. Das war der Anfang vom Ende. Denn ich änderte die Bezugspunkte, von denen aus ich auf Max zuging, ihn zu umarmen. Ich verließ ihn. Ich war dagegen. Ich verließ ihn dennoch. Mit jeder neuen Frage entfernte ich mich von ihm. Ich kam nicht dagegen an. Ich kannte inzwischen den Rhythmus der Schritte, in dem ich mich von ihm entfernte. Schließlich war Max nicht der erste Mann, den ich verließ. Weil ich nicht immer fortgehe, nachdem ich einen dieser klugen Männer verlassen habe, tauge ich zur Ehefrau.
Ich aß mein Eis auf und zahlte. Ich nahm den Bus nach Hause. Seit ein Bus beinahe von meiner Haustür zum Kurfürstendamm fährt, fühle ich mich weniger allein in der Stadt. Angekommen an meiner Haltestelle, machte ich noch einen Spaziergang durch den Park. Es ist ein Park, in dem Jogger, Schwule, Spaziergänger sowie Kinder und ihre Eltern neben einander bestehen können. Ich lief den großen Trümmerberg hinauf. Auf einem gesprengten Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg hatten Berliner den Schutt ihrer zerstörten Häuser abgeladen. Dann haben sie den Berg mit Bäumen bepflanzt. Im Winter, wenn diese Bäume keine Blätter haben, kann man von dem Trümmerberg aus weit über Berlin sehen. Aber ab Mai sieht man nur noch zwischen den Baumlücken hier und da ein Stück von der Stadt. Angekommen auf dem höchsten Punkt des Berges, machte ich meinen kleinen Rundgang. Nachdem das Pärchen, das auf der Brüstung des Bunkers saß, gegangen war, pfiff ich vorsichtig durch die Zähne. Ich tat es noch einmal. Die Squirrels kamen nicht. Sie kommen nicht immer, wenn ich sie rufe. Die Squirrels sind graue Eichhörnchen. Ihre Heimat ist eigentlich Nordamerika. Sie haben einen buschigeren Schwanz als die europäischen, und sie sind auch größer.
Wie die Squirrels hier in diesen Park gekommen sind, weiß niemand. Ich hatte sie zum ersten Mal in Berlin gesehen, nachdem ich vor Jahren das erste Mal aus Manhattan zurückgekommen war. Sie sind, so weit ich weiß, nur in diesem Park hier und in keinem anderen von Berlin. Warum, weiß ich nicht. Aber ich war hoch erfreut, als ich sie auch hier sah. In New York erblickte ich sie zum ersten Mal in Manhattan - und zwar in dem schmalen Park von Riverside. Dort waren sie so zahm, dass sie auf dem Weg saßen und darauf warteten, dass die Passanten sie fütterten. Im Central Park sind die Squirrels auch. Nur füttert sie dort niemand.
Als ich im letzten Jahr von New York zurückkam, habe ich den Squirrels vom Trümmerberg Früchte aus dem Central Park mitgebracht. Sie fraßen sie mit sichtlichem Vergnügen. Doch Nüsse aus dem Supermarkt fressen sie auch. Ich pfiff noch einmal. Eines der Squirrels pfiff zurück. Aber es ließ sich nicht blicken. Ich war dennoch erleichtert, dass sie überhaupt antworteten. Ihre Anwesenheit in diesem Park gilt mir als Zeichen dafür, dass es einen diskreten, einen heimlichen Zusammenhang zwischen den Orten gibt. Einen, der hinter allen Koordinaten von hier und jetzt liegt. Ohne sie wäre der Park nur halb so schön. Bevor ich den Trümmerberg wieder hinabstieg, schaute ich noch einmal durch die Baumlücken über die Stadt. Ich wollte mich vergewissern, dass alles noch war, wie es gestern auch war. Solche Gewissheiten beruhigen mich seit einigen Jahren.
Als ich an meinem Haus ankam, sah ich schon von weitem Marions Wagen. Sie kam auf mich zu und küsste mich auf die Stirn. Sie habe sich schon gedacht, dass ich diesem Mann keine einzige Minute eine Chance geben würde. Marion hatte etwas getrunken. Dennoch sagte sie mit fester Stimme, so könne es nicht weitergehen mit mir. Ich stimmte ihr zu. Wir beschlossen, ins Kino zu gehen, auch weil wir dort keine Möglichkeit hatten, länger über mein Desaster zu diskutieren.
2
Es klingelte. Ich wollte, dass es aufhörte. Es hörte nicht auf. Im Gegenteil. Der Ton verstärkte sich und wurde penetrant. Also stand ich auf. Es war der Postbote. »Eilt«, stand auf dem Umschlag. Wortlos hielt der junge Mann seinen Zeigefinger auf eine Stelle seines elektronischen Geräts. Ich sollte den Empfang quittieren. Ich machte mit seinem Schreibgerät irgendwelche Krakel auf das Display. Ohne Brille fällt es mir immer schwerer, meine Unterschrift Buchstabe für Buchstabe zu schreiben. Ich gab ihm seinen elektronischen Stift zurück. Er wünschte mir noch einen schönen Tag und zog ab. Jeder wünscht ja jedem heutzutage einen schönen Tag und geht danach.
Einen Moment lang hatte ich den Wunsch, den Postboten zurückzurufen, um meine Unterschrift, nachdem ich meine Brille endlich gefunden hatte, noch einmal zu geben. Denn ich bestehe noch heute bei meiner Unterschrift auf jedem Buchstaben. Einzeln und zusammen gelten sie mir als Zeichen oder besser als Gewissheit, dass da ein Teil von mir geblieben ist, auf den ich jederzeit zurückkommen kann. Ich also den Zusammenhang mit mir nicht verloren habe. Nachdem ich die Wohnungstür schon geöffnet hatte, wurde ich mir glücklicherweise der Lächerlichkeit meines Anliegens bewusst. Ich schloss die Tür wieder.
Der Eilbrief mit persönlicher Übergabe, wie auf dem Briefaufkleber zu lesen war, war von diesem Consulting-Büro. Ich hatte letztlich doch zugesagt. Nun wollte man meine Unterlagen für die Krankenversicherung. Aber vorab sollte ich in diesem Büro anrufen.
Ich schaltete die Nachrichten von CNN ein und ging ins Bad. Morgens weiche ich gern in den englischen Sprachraum aus. Da ich Englisch nie so gut gelernt habe, dass ich die Nuancen der Nachrichten verstehe, behalten sie etwas Ungefähres. Ich muss nicht auf Anhieb entscheiden, ob die gemeldeten Katastrophen in einem bedrohlichen Zusammenhang zu mir stehen. Ich kann also erst einmal in Ruhe duschen und frühstücken, bevor ich mich dem Weltgeschehen im Einzelnen zuwende.
Während ich mir das Shampoo in die Haare massierte, dachte ich an Emmi. Wahrscheinlich, weil die Nachrichtensprecherin aus Washington berichtete. Warum meldet sich Emmi eigentlich nicht? Sie wollte anrufen, sobald sie aus Washington zurückgekommen war. Emmi war absolut dagegen, dass ich die Stelle in diesem Büro annehme. Sie wollte, dass ich weiter malte. Das wollte ich auch, nur nicht so wie in den letzten Jahren. Denn es passierte nichts mehr. Ich meine, nichts wirklich Neues. Meine Bilder waren routiniert. Es fehlte ihnen die innere Anspanung, ja auch Angst, ob das, was ich tun wollte, auch wirklich herausfand aus mir.
Als ich Emmi davon erzählte, lachte sie nur und sagte, das glaube sie nicht. Dagegen ist bekanntlich nichts zu sagen. Schon gar nicht, wenn Emmi es sagte.
Dennoch, ich habe schon lange nicht mehr in einem anderen Büro gearbeitet als in meinem eigenen. Seit dem Mauerfall und der ihr rasch folgenden deutschen Einheit habe ich überhaupt noch nicht in einem Angestelltenverhältnis gearbeitet. Die neue, die westdeutsche Bürokratie ist mir noch undurchschaubarer als die alte, die ostdeutsche. Auch deshalb habe ich mir gleich nach der Wiedervereinigung eine Steuerberaterin gesucht.
Ich hörte das Diktiergerät ab. Es liegt nachts neben meinem Bett. Zwischen Schlaf und Schlaf fallen mir die Sätze ein, denen ich mich tagsüber verweigere. Dann ärgere ich mich, weil ich die Sätze nicht wiederfinden kann am Tag. Sätze wie diese:
»Wir gehen so lange fort von uns, bis wir nicht mehr zurückfinden. Danach versuchen wir ein anderes Leben. Und noch eins und wieder eins, bis wir irgendwann wissen, es ging weiter ohne uns. Wir haben uns überlebt. Danach werden wir sicherer. Denn niemand erwartet noch etwas von uns. Wir können also neu beginnen.«
Ich ließ die Sätze auf dem Band stehen und schaltete das Gerät ab. Ich rührte Honig in den Joghurt. Nach dem Frühstück rief ich in diesem Büro an, um meine Versicherungsnummer und die Krankenkasse durchzugeben. Eine freundliche Frauenstimme bedankte sich und meinte, dass man sich auf mein Kommen freue. Ich freue mich auch, sagte ich und wusste noch, bevor ich zu Ende gesprochen hatte, dass das so nicht stimmte.
Ich drehte CNN den Ton ab, machte den Fernseher aber nicht aus, sondern legte die Fernbedienung auf den Küchentisch. So hatte ich die Gewähr, den Ton schnell wieder einschalten zu können, falls die in einander fallenden Bilder noch eine Nachricht vom Tage anzeigten, von der ich meinte, ich kennte sie noch nicht. Seit Monaten schüttete ich mich zu mit Nachrichten. Inzwischen bin süchtig nach ihnen. Es ist mein Versuch, nicht zurückkommen zu müssen auf mich. Ich weiche mir aus.
Das Telefon klingelte. Emmi! Endlich! Ihre Stimme war leise. Sie stockte, dann sagte sie, dass sie aus Washington anrufe und erst in drei Wochen komme. Sie habe das Praktikum verlängern können. Die National Gallery of Art sei atemberaubend schön. Am liebsten würde sie auch nachts darin verweilen. Aber da führe kein Weg herein. Sie habe mit dem Direktor des Museums gesprochen. Ausgelacht habe er sie und an ihrem Verstand gezweifelt.
Ich fragte Emmi, ob sie ihr Zimmer am Dupont Circle verlängern konnte.
Nein, sagte sie. Aber sie habe Max getroffen, und er habe ihr ein günstigeres ganz in der Nähe besorgt. Gleich an der 16. Straße.
In mir zog sich etwas zusammen, als ich den Namen Max hörte. Ich zwang mich, nicht zu fragen, wie es ihm gehe.
»Er hat nach dir gefragt. Ich habe gesagt, dass es dir gut geht. Das war doch richtig«, fragte Emmi.
»Ja, natürlich«, sagte ich bestimmt, nach einer Pause, die zu lange war, um von Emmi nicht bemerkt zu werden.
»Ich habe ihm auch nicht gesagt, dass du für Herbst New York abgesagt hast.«
»Das war völlig in meinem Sinn«, sagte ich, nun mit fester Stimme, da Emmi verunsichert schien.
Ich versprach Emmi, nach ihrer Wohnung zu sehen und die Post aus dem Briefkasten zu nehmen. Sie bedankte sich und legte auf. Ich hielt den Hörer in der Hand, bis ich ein Freizeichen hörte. Ich vermisste dieses ozeanische Rauschen in der transatlantischen Telefonleitung. Vor Jahren, als wir noch nicht per Satellit telefonierten, gab es dies noch und signalisierte zumindest mir, dass die Entfernungen zwischen hier und dort immens seien.
Emmi war mir vor Jahren zugelaufen. Plötzlich war sie da. Bei einer Auftragsarbeit in einer Werbeagentur habe ich sie kennen gelernt. Sie war gerade zwanzig geworden und kam aus Paris. Aber eigentlich kam sie aus Halle, wie ich bald erfuhr. Sie sah immer übermüdet und abwesend aus. Sie schien mir in dem Büro so fehl am Platz, dass ich sie ansprach, ob sie sich verirrt habe. »Ein bisschen«, sagte sie ohne jede Scheu und lachte verlegen. Ein paar Tage später erzählte sie mir unter Tränen etwas von einer Abtreibung, von einem französischen Architekten und von einem gelben Nachthemd aus Seide, mit dem er sie abfinden wollte. Denn er habe nie die Absicht gehabt, mit ihr eine ernsthafte Beziehung, wie er sich ausdrückte, einzugehen. Noch ein paar Tage später nahm sie mich mit in ihre Wohnung. Sie lag in Berlin-Prenzlauer Berg. Das Haus war heruntergekommen, wie es viele Häuser hier waren.
Die Wohnung war ein großes Zimmer. Neun mal neun Meter, wie ich von Emmi erfuhr. Sie lag im obersten Geschoss und glich einem Lagerraum mit Terrasse. Denn die Wohnung war vollgestellt mit Krügen aller Art, die ordentlich in Regalen ihren Platz gefunden hatten. Emmi genoss mein Erstaunen und sagte, irgendwann werde sie ihr eigenes Museum haben. Bis dahin müssten die Krüge hier zwischengelagert werden. Sie in einen Speicher zu geben, wäre zu teuer. Sie holte einen Tonkrug aus dem Regal. In dem Krug waren bunte Papierkugeln. Emmi nahm eine heraus und gab sie mir.
»Wirf sie aus dem Fenster, morgen in aller Frühe, und wünsche dir etwas, bevor die Kugel auf dem Asphalt aufschlägt. Es wird in Erfüllung gehen. Bestimmt«, sagte sie und stellte den Krug zurück ins Regal.
Ich bedankte mich und steckte die Kugel in die Jackentasche. Dann lief ich an den Regalreihen entlang und fragte Emmi:
»Und wo hast du all diese Krüge her?«
»Ich habe sie selbst gesammelt.«
In ihrer Stimme klang Stolz. Nach einer Pause sagte sie.
»Das heißt, den allerersten Krug hat mir mein Vater geschenkt.«
»Und warum nur Krüge«, fragte ich.
»Die Krüge haben ein Geheimnis. Ich muss es herausfinden. Jeder Krug trägt ein Teil davon in sich. Deshalb können es nicht genug Krüge sein.«
Ich sagte nichts mehr. Ich setzte mich auf eine Holzkiste. Sie stand vor der neun Meter langen Fensterfront. Draußen regnete es. Die Fenster waren nicht dicht. Emmi hatte ein Laken vor die Terrassentür gelegt. Denn wenn der Wind wie jetzt auf den Fenstern stand, regnete es herein. Außerdem zog es. Sie müsse die Reparaturen selbst organisieren, sagte Emmi. Denn die Hausverwaltung sollte die Wohnung besser nicht betreten. Sie habe doch die Wände innerhalb der Zimmer allein abgetragen. Emmi zeigte auf die nachgebesserten Fußbodendielen, wodurch der Übergang von einem Raum zum anderen noch zu sehen war.
Emmi lehnte ihre Stirn an die Fensterscheibe. Sie brauche diesen Blick. Sie brauche diese Weite und ihre Unbestimmtheit, sagte sie. Der Blick über die roten Ziegeldächer gebe ihr Gewissheit, die Richtung nicht zu verlieren.
Ob sie einen Tee machen solle, fragte sie und ging auf eine Tür zu, die ich bis dahin nicht wahrgenommen hatte. Die Tür war ganz und gar in die Wand eingefügt und mit Raufasertapete überklebt. Sie führte zu einer schmalen, aber langen Küche. Vor dem Fenster stand ein Schreibtisch. Auf ihm waren Bildbände über Bildbände gestapelt. Rechts vom Fenster ging eine Speisekammer ab, in der eine Matratze lag, neben der wiederum ein Fernseher stand.
Seit mir Emmi ihre Dachwohnung gezeigt hatte, ließ ich sie nicht mehr aus den Augen. Sie mich allerdings auch nicht. Ich spürte so etwas wie Verantwortung für sie. Lange konnte ich nicht sagen, warum.
3
Ich versuchte mich auf den ersten Arbeitstag zu konzentrieren und meine Unsicherheiten hinter einem heiteren Taglächeln zu verpacken. Die Sekretärin begrüßte mich freundlich.
»Na, dann kommen Sie mal.«
Sie führte mich in ein Zimmer, das hinter ihrem lag.
»Büroräume sind schließlich dazu da, dass gearbeitet wird in ihnen«, sagte sie. »Also, nun nehmen Sie doch Platz.«
Sie bot mir einen Stuhl an.
»Möchten Sie vielleicht einen Kaffee?«
»Ja, gern.«
Sie machte für sich auch einen und bot mir eine Zigarette an. Ich lehnte dankend ab.
»Es stört Sie aber …«
»Rauchen Sie ruhig«, unterbrach ich sie. »Ich war selbst einmal Raucherin.«
Sie zog an ihrer Zigarette.
»Sie ahnen ja gar nicht, wie wählerisch Herr Frischauf, unser Geschäftsführer ist. Über dreihundert Bewerbungen waren eingegangen, nachdem er nun doch endlich diese Stellen annonciert hatte. Ich habe über eine Woche nur mit diesen Unterlagen zu tun gehabt. Alle andere Arbeit ist liegen geblieben. Und dann hat er flugs zwei aus dem Eingangskorb gezogen. Eine von beiden war Ihre Bewerbung. Na, und nun sitzen Sie hier.«
Sie hielt inne in ihrem Redeschwall und musterte mich mit diesem Blick, von unten nach oben und wieder nach unten. Ein Blick, der allein unter Frauen üblich ist und der etwas Taxierendes hatte. Ich versuchte, nicht arrogant zurückzublicken, was mir wahrscheinlich nicht gelang. Jedenfalls gewann ihre Stimme an Sachlichkeit. Sie sei hier keinesfalls nur die Sekretärin, sondern auch als Assistentin der Geschäftsführung beschäftigt. Außerdem sei sie noch für die Buchhaltung zuständig, betonte sie. Dann gratulierte sie mir, dass ich diese Stelle bekommen hatte. Sie beugte sich etwas zu weit zu mir herüber. Über den großen ovalen Tisch, an dem wir inzwischen saßen, reichte sie mir die Hand.
»Also, ich bin die Lisa Beckmann. Aber alle nennen mich hier Lisa«, sagte sie.
»Und bin Anna Hausen.«
Marion hatte mir eingeschärft, distanziert zu bleiben, gerade mit Sekretärinnen. Also bot ich ihr nicht an, Anna zu mir zu sagen, obwohl Lisa Beckmann einen Moment lang darauf zu warten schien. Doch dann fuhr sie in ihrer schnellen Art zu reden fort.
»Bernhard« sagte sie nun beinah familiär, »suchte ja schon monatelang. Was ihn dann wirklich veranlasst hatte, die Stellen auf einmal so plötzlich zu annoncieren, weiß niemand hier.«
Lisa Beckmann redete weiter auf mich ein. Dabei warf sie ihren langen Zopf, zu dem sie ihre gebleichten Haare gebunden hatte, von einer Seite der Schulter zur anderen. Lisa trug ein weites Kleid. Damals wusste ich noch nicht, dass sie immer weite Kleider tragen würde, vornehmlich schwarze. Nachdem sie ihre Zigarette geraucht hatte, ging sie mit mir ins nächste Zimmer. Es war ein Berliner Durchgangszimmer, in dem drei Schreibtische standen. Einer an der linken, einer an der rechten Wand und einer vor dem einzigen Fenster im Raum. Das Zimmer war ziemlich dunkel, aber groß.
»Wer zuerst kommt, besetzt den besten Platz«, sagte Lisa und erwartete Dank, dass sie mir den Platz am Fenster so selbstverständlich zugewiesen hatte. Das Telefon klingelte. Sie verschwand im anderen Zimmer.
Der Blick vom Parterre aus dem Fenster war ein Blick in einen Berliner Hinterhof. Der Hof glich eher einem Schacht als einem Hof. Denn vom Schreibtisch, an den ich mich probehalber schon mal gesetzt hatte, konnte ich das Dach des Hauses nicht sehen und damit auch nicht den Himmel. Mein Gegenüber auf diesem Hof war ein geräumiges Zeitungsarchiv, wie ich bald von Lisa Beckmann erfuhr. Wann immer ich also aus diesem Bürofenster sehen sollte, sah ich auf einen betonierten Hof, an dessen anderem Ende sich ein bis zur Erde hin verglastes Büro befand, in dem es darauf ankam, die Neuigkeiten von gestern und vorgestern auf immensen Datenbanken zu speichern. Ich bemaß die Größe des Hofes, der dreihundert Quadratmeter nicht überstieg.
Da ging die Tür auf. Etwas unvermittelt stand Bernhard Frischauf vor mir. Akkurat und aufwändig gekleidet. Er trug einen Anzug mit Weste aus englischem Tuch, die seinen Bauch verdecken sollte. Dazu einen seiner teuren Hüte.
So gekleidet hatte ich ihn in Washington bei Max kennen gelernt, wo er für zwei Tage Hausgast war. In dieser Zeit wohnte ich noch bei Max. Herr Frischauf, so erklärte mir Max damals, sei hier zwei Tage im Auftrag eines internationalen Versicherungskonsortiums. Er sei also ein höchst wichtiger Mann. Max grinste mich an. Herr Frischauf selbst leite in Berlin eine erfolgreiche Consulting-Gesellschaft und habe eine Menge Einfluss. Dass er ihm vornehmlich meinetwegen angeboten hatte, bei uns zu schlafen, kapierte ich erst später.
Max hatte allerlei edle Sachen für unser Frühstück mit Bernhard Frischauf eingekauft und auf der Terrasse den Tisch selbst gedeckt. Zwischen dem ersten und zweiten Mohnhörnchen fragte mich Herr Frischauf dann mit einigem Interesse aus. Dabei beträufelte er die in Stücke zerlegten Hörnchen mit Honig und schaffte es, dass, während er sie in den Mund schob, kein Honig auf seine Weste kleckerte. Er aß mit demonstrativem Genuss. Nachdem er das zweite Hörnchen verspeist hatte, fragte ihn Max, ob seine Geschäfte mit den hiesigen Partnern vorankämen.
Herr Frischauf wischte sich mit der Serviette säuberlichst die Mundwinkel, wodurch eine Pause entstand, die Max’ Neugierde steigerte. Bevor er antwortete, zupfte er an seiner Weste und setzte sich aufrecht in Max’ liebsten Terrassenstuhl. Dann erfuhr ich, dass seine Consulting-Gesellschaft ein versicherungstechnisches Konzept für ein höchst interessantes Produkt entwickelt hatte und dass Max in seiner Redaktion einiges dazu beigetragen hatte, es in Washington an den richtigen Stellen bekannt zu machen.
»Die Entwicklung sei beinahe abgeschlossen«, sagte Bernhard Frischauf, während ich ihm unaufgefordert Kaffee nachgoss.
»Wenn alles läuft, wie er sich vorstellte, dann könnte seine Firma auch noch die internationale Produktwerbung übernehmen«, fügte er hinzu und sah zuerst Max und dann mich bedeutungsvoll an.
Warum, verstand ich erst einen Tag später.
Nach dem Frühstück ging er seiner Wege. Für den nächsten Abend bat mich Max, Pasta zu machen und von einem Laden am Dupont Circle schwarzen Trüffel zu holen. Herr Frischauf liebe sie. Und warum sollte man ihm nicht eine seiner kleinen Annehmlichkeiten servieren, sagte Max. Ich war ein wenig überrascht von seiner großzügigen Gastfreundschaft gegenüber Herrn Frischauf. Aber natürlich kaufte ich schwarze Trüffel und kochte.
Als ich abends die Pasta servierte und Bernhard Frischauf den Trüffelhobel samt der Trüffel auf einem Teller reichte, war er hocherfreut und lobte sie wegen ihres guten Geruchs. Denn schon am Geruch erkenne man ihre Qualität. Während er Trüffel über die Pasta hobelte, fragte er, ob ich mir vorstellen könne, in seiner Consulting-Gesellschaft, genauer in einem seiner Grafikbüros, zu arbeiten. Beispielsweise als Designerin, die auch ab und zu kleine Texte schriebe? Er suche exakt diese Kombination für eine Stelle. Er sei nämlich dabei, etwas auszuprobieren. Seine Gesellschaft habe da auch für Künstler einige Möglichkeiten. Und von mir als Malerin habe er immerhin schon gehört. Aber nun habe ihm Max erzählt, ich schriebe auch kleinere Texte, die sogar Max gefielen. Und Max habe einen Geschmack, auf den man sich verlassen könne. Er spiele nämlich nicht nur die Geige beinah so gut wie Paganini, er sei darüber hinaus auch ein begnadeter Buchautor, wie er mehrfach bewiesen habe. Er sah Max an, dem diese Schmeicheleien nicht unangenehm waren.
Ich könne ja mal darüber nachdenken, sagte Herr Frischauf. Wenn ich Lust hätte, könnte ich ja mal reinschauen. Er gab mir seine Visitenkarte und sagte, dass er sich freuen würde, wenn ich ihn mal anrufen würde in Berlin.
Ich sah zu Max. Er reichte mir die Schüssel mit Pasta und sah mich mit Unschuldsmiene an. Ich kannte ihn zu lange, um nicht genau zu wissen, dass er dieses Essen samt Hausgast sorgfältigst eingefädelt hatte. Denn seit geraumer Zeit redete er auf mich ein, ich solle mein freiberufliches Sein als Malerin aufgeben, damit ich wieder unabhängiger vom Galeriebetrieb werde. Nachdem Herr Frischauf am nächsten Morgen in aller Frühe abgereist war, kam Max in mein Bett und flüsterte mir ins Ohr.
»Da kannst du mal sehen, weshalb es sich lohnt, nach Washington zu kommen.«
Und nun stand Bernhard Frischauf vor mir und begrüßte mich mit einem Lächeln, das eigentlich Max galt. Es war dieses kumpelhafte Lächeln, das es so eher nur unter Männern gibt.
Nachdem er seine große braune Ledertasche auf einem der leeren Schreibtische abgestellt hatte, fragte er auch prompt, wie es Max denn gehe.
»Ich hoffe gut«, sagte ich. Ich hoffte es wirklich.
»Er ist schon ein erstaunlicher Mensch, finden Sie nicht?«, fragte er.
»In der Tat«, sagte ich und meinte es auch so. Nur war ich gerade bemüht, Max in eine Ferne zu stellen, in der mich seine Abwesenheit weniger lähmte. Und für Tage gelang es mir auch schon. Zurück blieb diese diffuse Trauer um etwas unwiederbringlich Verlorenes, das mit Max nur noch bedingt zusammenhing.
»Also, grüßen Sie ihn von mir, sagte Herr Frischauf.
»Wann kommt er denn wieder nach Berlin?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Ich glaube, das weiß er selbst noch nicht«, versuchte ich lapidar zu antworten.
»Na, wie dem auch sei. Ich habe mir Ihre Bilder noch einmal angeschaut.«
Er redete ein Weilchen herum, bis er endlich sagte:
»Am besten wären Sie meines Erachtens in unserer Versicherungsabteilung aufgehoben. Ihr Talent, Risiken und Ängste zu malen, zeugt von viel Erfahrung mit diesem Milieu. Und entschuldigen Sie, ich habe auch nochmals mit Max telefoniert.«
Bernhard Frischauf ging zu seiner Ledertasche und holte einige Seiten aus einer Mappe.
»Ich wusste gar nicht, dass Sie auch schreiben können.«
Er las den Anfang eines Textes vor, den ich nach dem 11. September geschrieben hatte. Es war ein Beitrag für ein Protestmeeting deutscher Künstler, die sich zu jener Zeit in Washington aufhielten.
Er unterbrach sein Vorlesen und suchte nach einer bestimmten Seite. Dann fuhr er fort.
»Zeugen von etwas Entsetzlichem, von etwas Ungeheuerlichem zu werden, können wir uns nicht aussuchen. Es auf unsere eigene Kleinheit zu reduzieren, müssen wir uns jedoch ein Leben lang wehren.«
Er sah mich an.
»Das ist gut gesagt, und es ist der Duktus, den wir hier brauchen, Frau Hausen. Ich hoffe, Sie verzeihen Max, dass er mir diese Seiten gemailt hat. Denn der Text bestätigt, was ich annahm. Sie haben auch eine sprachliche Kraft, Katastrophen zu beschreiben. Und das ist genau das, was wir hier brauchen.«
Er legte die Seiten zurück in die Mappe.
»Wichtig für uns ist«, sagte er, »dem potenziellen Kunden ein künftiges Unglück so vor Augen zu führen, dass nicht auf dem ersten Blick Panik entsteht. Das ist im Übrigen die Stärke Ihrer Bilder. Sie wecken erst auf den zweiten Blick Urängste. Eben das ist Ihr eigentliches Talent. Eben dies müssen Sie nutzen für Ihre Arbeit hier. Verstehen Sie? Dadurch mobilisieren Sie die diffusen Ängste der Kunden langsam, aber nachhaltig. Und eben solch eine Mobilisierung nicht zu benennender Ängste ist genau das, was wir hier in unserer Branche brauchen. Wieviel Sie unserer Consulting-Gesellschaft wert sind, können Sie an Ihrem Jahresgehalt ablesen. Machen Sie also Werbung, die bei unseren Kunden Katastrophen assoziiert, ohne dass Panik entsteht. Nutzen Sie Ihr Talent, kombinieren Sie nun Bild mit Text. Erfinden Sie Ihre Objekte so, dass die Ängste, die Sie hervorrufen, nicht sofort, sondern in die Ferne wirken. Denn das ist, wovon unser Versicherungsgeschäft lebt.«
Er schlug mit der flachen Hand auf den Schreibtisch, auf dem er Platz genommen hatte. Dann sprang er auf und lief im Zimmer hin und her.
»Wir wollen die Zukunft an der Gegenwart so beschreiben, dass sich die Ängste unseres Kunden ganz allmählich aufbauen. Denn das ist wichtig im Versicherungsgeschäft. Dass wir das Unbehagen langsam wachsen lassen, um es dann hoffentlich gleich in einem ganzen Versicherungspaket für unsere Kunden abzufangen. Also Schritt für Schritt den Kunden zu uns zuführen und zwar so, dass er von sich aus den Entschluss fasst, unser Angebot dankbar anzunehmen. Er muss davon überzeugt sein, unser Angebot sei das beste für ihn und der sichere Weg, seine Ängste loszuwerden. Verstehen Sie?«
Er sah mich fest an.
»Das gelingt uns aber nur, wenn wir nicht von vornherein Panik erzeugen, denn dann läuft er uns als Kunde einfach fort. Wir aber wollen ja seine Furcht sicher auffangen.«
Bei dem Wort »auffangen«, glänzten seine Augen.
»Und« fuhr er fort, »genau diesen Zeitpunkt abzupassen, hat eine Menge mit Intuition, also mit Kunst zu tun.«
Er setzte sich wieder auf den Schreibtisch.
»Unter uns«, sagte er nun in einem vertraulichen Ton, »gute Versicherungen zu verkaufen, ist eine der höchsten Künste.«
Er sah mich verschmitzt an. Nach kurzer Pause meinte er, er erwarte also, dass ich meine Erfahrung als Künstlerin bedingungslos einbringe in diese Arbeit.
»Wichtig ist auch hier die so schmale Gratwanderung zwischen Realität und ihrem möglichen Bruch. Abbruch. Den wir oft so sehr fürchten, weil wir für unbestimmbare Zeit den Boden unter den Füßen verlieren.«
Er sah mich an. Sein Gesicht hatte Farbe bekommen. Er zupfte an seiner Weste herum. Dann ging er zum Hoffenster und schloss es.
Er liebe diese Brüche und er liebe die Versicherungen gegen solche Brüche.
»Denn Versicherungen sind wie Brücken. Wir gehen über sie und lassen unsere Angst zurück. Wir übersteigen unsere kleinen und großen Katastrophen und kommen sicher auf die andere Seite.«
Er wisse nicht genau, was er mehr liebe, den Bruch oder das Aufscheinen einer Hoffnung, die sich in unserem Versicherungspaket dartut. Wahrscheinlich liebe er den Wechsel von einem zum anderen. Bilder zu erfinden, die den Wechsel zwischen Abbruch, aufflackernder Panik und Fortgang des Gewohnten reibungslos ermöglichen, werde also meine Aufgabe hier in seinem Unternehmen sein.
Er zog eine Mappe aus seiner Ledertasche. Es war mein Arbeitsvertrag. Er legte ihn auf den Schreibtisch, den mir Lisa zugewiesen hatte. Über mein Gehalt habe ich den anderen Mitarbeitern gegenüber zu schweigen. Den Vertrag solle ich unterschrieben nur ihm persönlich zurückgeben. Er sah mich an. Es sei eine Menge Vertrauen, das er mir da entgegen bringe, sagte er. Schließlich kenne er mich kaum. Aber er vertraue Max.
»Also dann fangen Sie mal an«, sagte er und öffnete die Tür zum Sekretariat.
»Lisa, Sie werden Anna Hausen Zugang zu allen hausinternen Passwörtern geben. Einschließlich die zu den Netzwerken.«
»Jawohl«, antwortete Lisa Beckmann und fragte dann aber doch mal nach.
»Zu allen?«
»Ja, zu allen.«
Er sah auf die Uhr und verschwand, ohne sich zu verabschieden.
Lisa Beckmann erfüllte ihren Auftrag sofort. Sie gab mir alle Sicherheitscodes und die dazu gehörigen Pinnummern. Dann ließ sie mich unterschreiben, dass sie mich belehrt habe, die Passwörter nicht an Dritte weitergeben zu dürfen. Ich unterschrieb.
Nachdem Lisa Beckmann gegangen war, öffnete ich erst einmal wieder das Hoffenster. Dann starrte ich in den Bildschirm. Nach einer Weile suchte ich bei »Google« die Website der »Financal Times« und landete schließlich bei den Börsenkursen. Sie standen gut, jedenfalls für Max. Dann klickte ich einen Link zu einem CD-Discounter an. Für sechs Euro wurden im Sonderangebot sieben Walzer von Johann Strauß angeboten. Natürlich konnte man sie sich online anhören. Ich konnte nicht widerstehen. Ich ging auf Real Play. In erstaunlicher Qualität erklang der Kaiserwalser über die eher unscheinbaren Lautsprecher, die auf meinem mir zugewiesenen Schreibtisch standen. Begeistert von ihrem Klang, machte ich die Musik lauter.
Da kam Lisa Beckmann rein.
»Also Frau Hausen, das ist hier bei uns eher nicht üblich, dass wir Radio hören.«
Sie sagte das mit einem freundlichen Ton und versuchte zu lachen.
»Das müssten Sie dann mit der Geschäftsführung absprechen.«
Ich klickte, den Ton weg und entschuldigte mich, dass ich für einen Augenblick vergessen hatte, dass ich ja in einem Büro saß.
»Na, daran werden Sie sich noch gewöhnen. Selbst wenn es schwer fällt, solch ein freies Dasein, wie Sie es ja wohl hatten, aufzugeben. Aber schließlich, arbeiten müssen wir alle.«
Sie sah mich an.
Ich nickte.
»Wie gesagt, ich habe nichts dagegen. Nur letztlich muss das die Geschäftsleitung entscheiden.«
»Machen Sie sich keinen Stress Frau Beckmann. Ich kann, wenn ich wirklich Musik hören will, meine MP3-Player mitbringen«, versuchte ich sie zu beruhigen.
Sie sagte nichts und zog sich in ihr Sekretariat zurück.
4
Nach diesem ersten Bürotag hatte ich eine unbändige Lust, ins Fitnessstudio zu gehen. Ich wollte auf das Laufband. Aus Angst, ich könnte den Herausforderungen dieses Jobs körperlich nicht gewachsen sein, kaufte ich mir gleich eine Jahreskarte für das Studio. Sie war ein Sonderangebot und wirklich sehr günstig.
Marion lästert ja über mich, weil ich das Bandlaufen so liebe. Sie meint, meine Neigung zum Laufband mache mein abnormes Verhältnis zur Welt sichtbar. Neben der Kunst lasse ich nichts wirklich gelten. Welcher gesunde Mensch mit ausgeglichenem Verstand käme sonst auf die Idee, rastlos auf der Stelle zu treten, wenn er einen Park vor der Haustür hat, sagt sie. Ich subsumiere eben alles unter Bilder, auch die Natur, sagt Marion. Selbst das Laufband sei für mich eine Metapher, die mir klarmachen soll, dass auch ich nicht wirklich vorankäme, sagt sie.
Aber das stimmt so nicht. Ich mag das Laufen auf dem Band seines Kicks wegen, den es auslöst, jedenfalls bei mir. Denn nach etwa fünfzehn Minuten Laufen habe ich mich derart auf der Stelle eingelaufen, dass ich die Studiosituation um mich herum vergesse. Nach 50 Minuten wird das Bandlaufen dann eine Herausforderung durchzuhalten, nach spätestens 90 Minuten höre ich auf und gehe mit weichen Knien vom Band und spüre und denke nichts mehr. Und eben diesen Zustand mag ich.
Heute probierte ich erstmalig die neuen Laufsocken aus, die ich in Washington gekauft hatte. Max hatte mir zu dieser Sorte geraten, und Max verstand etwas von Laufsocken. Schließlich läuft er viel länger als ich. Wir haben uns beim Laufen auf dem Campusgelände kennen gelernt. Damals war ich mit einem Kunststipendium in Buffalo. Und weil wir häufig zusammen liefen, fühlte sich Max ein wenig verpflichtet, zu meiner Präsentation in der Buffalo Hall zu erscheinen. Ich hatte ihm, während wir die Runden drehten, davon erzählt. Eher aus Höflichkeit blieb er dann auch zum Empfang. Dort erzählte ich von meiner großen Wohnung in Berlin und dass ich sie gelegentlich vermiete, behauptete Max. Ich erinnerte mich nicht. Ich erinnere mich selten, was ich so vor mich hinerzähle auf Empfängen. Auch Max selbst hatte ich beinahe vergessen, als seine Mail mit der Anfrage kam, ob er bei mir zwei Zimmer mieten könne. Natürlich sagte ich zu. Denn die Aussicht, dass er für zwei Jahre käme, würde bedeuten, dass ich für zwei Jahre meine Mietfrage gelöst hätte und mein Atelier behalten könnte.
Max war auf Suche nach Streichinstrumenten aus den volkseigenen Beständen der zahlreichen DDR-Orchester. Er hoffte, wenigstens eine oder zwei Stradivaris unter den Geigen zu entdecken. Auch ein Violincello von Guarneri oder Rugeri hoffte er zu finden. Doch die Sammlung aus der ehemaligen DDR enthielt nichts wirklich Großes, wie mir Max irgendwann enttäuscht gestand. Aber er wollte nicht aufgeben. Daher dehnte er seine Nachforschungen auf die ehemaligen Ostblockstaaten aus, wofür er aus New York auch tatsächlich Gelder bekam. So wurden aus zwei Jahren letztlich vier. Er reiste viel durch ehemalige Volksrepubliken von Warschau bis Bukarest, von Moskau bis Alma Ata. Bald kannte er Osteuropa besser als ich.
Erst allmählich begriff ich: Max war auf der Suche nach dem perfekten Klang. In den Geigen von Stradivari meinte er, ihm nahe zu sein.
Da er in der ehemaligen Sowjetunion, was die Stradivaris betraf, am fündigsten wurde, reiste er immer wieder dort hin. Meist nicht länger als eine Woche. Er hörte auf Anhieb, ob ein Instrument echt war. Er brauchte keine Expertise, hat er mir des Öfteren nicht ohne Stolz gesagt.