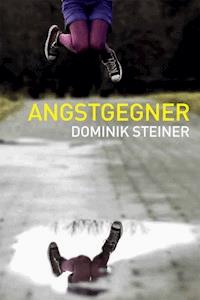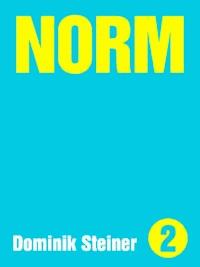12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: edition subkultur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lu schiebt Krise. Er ist 16 und hat keinen Plan, wie oder was er sein möchte. In seinem Heimatort findet er kaum Antworten. Also will er schnellstmöglich dort weg. Sein Fluchtplan: eine Ausbildung zum Verkäufer im lokalen Supermarkt.
Lus bester Freund und Nachbar Kneter hat auch ein großes Projekt: Lu soll endlich selbstbewusst werden. Deshalb will er Lus Scheitern filmisch begleiten. Für Lu ist das ein wachsendes Ärgernis.
Nur mit Milena teilt Lu kurze, magische Momente. Aber bald muss er einsehen, dass Kneter, der Supermarkt und überhaupt die ganze Welt da draußen ihm diese Momente nicht lassen, wenn er nicht endlich zeigt, was er wirklich will.
Eine Geschichte über das Wollen und Müssen und über das Anderssein in der Tristesse einer deutschen Provinz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 186
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Sicherheitshinweise: Lesen kann triggern, also an Dinge erinnern, die man vergessen hat und vielleicht gar nicht wissen will. Lesen bildet. Es kann die Sicht auf die Welt verändern, den Horizont erweitern und Dummheit, Einfalt und Leichtgläubigkeit stark beeinträchtigen.
Weitere Hinweise zur GPSR und zum EU-Lieferkettengesetz finden Sie unter:
periplaneta.com/gpsr-eu-lieferkettengesetz/
DOMINIK STEINER: „Aber ich bin laut“ Roman
1. Auflage, Juli 2025, Edition Subkultur Berlin
© 2025 Periplaneta - Verlag und Medien / Edition Subkultur Inh. Marion Alexa Müller, Bornholmer Str. 81a, 10439 Berlin subkultur.de - [email protected]
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Übersetzung, Vortrag und Übertragung, Vertonung, Verfilmung, Vervielfältigung, Digitalisierung, kommerzielle Verwertung des Inhaltes, gleich welcher Art, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags.
Die Handlung und alle handelnden Personen sind erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit realen Personen oder Ereignissen wäre rein zufällig.
Korrektorat, Satz & Layout: Thomas Manegold Cover: Dominik Steiner, Thomas ManegoldCover made with Sora by Open AI
print ISBN: 978-3-948949-46-4
epub ISBN: 978-3-948949-47-1
Dominik Steiner
Aber ich bin laut
Roman
subkultur.de
„And all life’s fears could invade my ears.
I can handle it.“
The Chameleons
„Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht.“
Unbekannt
1
„Geh! Das bist du“, sagt ein Typ neben mir, den ich nicht kenne. Ich will ihn fragen, ob das mein Name war. Aber ich habe Angst vor der Antwort. Ich hoffe, ich habe mir meinen Namen falsch gemerkt. Jetzt ist er wieder da: mein Name. Laut und schief. Aus der Stimme meines Lehrers. Herr Schmadrig erklärt mich tatsächlich zum Sieger.
„Geh’, Lu“, höre ich immer lauter. „Geh!“
Jetzt gehe ich. Ich geh’ ja schon. Meine Mitschüler machen mir Platz. Vorhin, beim 1000-Meter-Lauf, sind mir alle davongerannt. Jetzt bin ich der Einzige, der sich bewegen darf. Das ist eindeutig Betrug. Alle merken das. Und keiner hält mich auf. Ohne Gegenwehr steige ich aufs Treppchen. Von dort oben sehe ich sie. Da stehen alle, die besser waren als ich. Es müssen Hunderte sein.
„Der?“, höre ich. „Wieso der?“
Ich kann die Frage nicht beantworten. Ich kann sie nur hören. Leise und immer wieder: „Wieso der?“
Jubel. Schon wieder. Diesmal klingt er echt. Der Zweit- und der Drittplatzierte kommen nach vorne. Sie steuern direkt auf mich zu. Sie steigen das Treppchen hoch und stellen sich unter mich. Sie winken. Sie lachen. Sie tun so, als könnte man sich hier frei bewegen. Entsetzt bemerke ich, was sie mit dieser Fuchtelei auslösen: Handykameras. Ich glaube, jeder hier hat mindestens drei davon. Plötzlich sind die überall. Ich kann nicht hinsehen. Ich kann nicht wegsehen. Ich kann gar nichts mehr.
Mitten in der Menge entdecke ich meinen besten Freund Kneter. Ich warte auf ein geheimes Signal von ihm. Er sieht doch viel besser, was ich machen soll, jetzt, wo ich zum Sieger erklärt wurde, jetzt, zwischen all diesen Kameras, aber ich merke, dass auch er angesteckt ist. „Wieso der?“, sagt sein Blick.
Auch das noch: Schmadrig kommt. In seiner Hand baumeln Medaillen. Ich will keine davon! Ich will, dass Schmadrig diese Show beendet. Spätestens jetzt weiß wirklich jeder, dass ich hier falsch bin. Schmadrig nicht. Obwohl er der Lehrer ist. Obwohl er immer weiß, was richtig und was falsch ist! Ehrfürchtig hängt er mir die erschwindelte Medaille um. Ich muss aufpassen, dass ich nicht umkippe, weil mich das Gewicht so überrascht. Meine Lippen zittern. Sie fühlen sich an wie meine Arme, als ich mal den Kühlschrank tragen musste. Ich glaube, die Medaille wiegt mehr. Ich glaube, gleich knackst etwas. Wie damals beim Kühlschrank. Und jeder kann das jetzt sehen.
Das ist also ein Sieg. Ich will nie wieder gewinnen.
2
„Die haben dir also 1000 Punkte zu viel gegeben.“
Kneter sieht mich vorwurfsvoll an. Vielleicht glaubt er, ich habe das absichtlich gemacht. Seit meiner Gefangenschaft auf dem Podest frage ich mich, ob andere sehen können, was ich denke. Kneter verstärkt diesen Verdacht: „Ich hab’ dir zugeschaut, als du da oben warst ...“ Er sagt das, als wüsste ich es nicht. „... du hast ausgesehen, als hättest du das Denken verlernt.“
„Hat man gesehen, dass ich da nicht rauf gehöre?“, frage ich. Ich spüre die Antwort, bevor Kneter was sagt. Und Kneter sagt sofort etwas: „Jeder hat gesehen, dass du da nicht raufgehörst.“
Ich würde jetzt gerne gehen. Aber wir sind immerhin an unserem Lieblingsort: dem Boden in einer Seitengasse der Altstadt. Also bleibe ich. Kneter setzt die Dose Violent an und trinkt. Als er seinen Energydrink wieder abstellt, erinnere ich mich, wie ich vom Podest heruntergestiegen bin. Es waren nur zwei Schritte, aber die waren anstrengender als das ganze blöde Sportfest.
„Was hat Schmadrig dir eigentlich im Büro gesagt?“, fragt Kneter.
„Er hat gesagt: ,Das hätte nie passieren dürfen.‘ Das war ein technischer Fehler.“
„Mich wundert das nicht“, giftet Kneter. „Da hat einfach ein krankes System versagt. Selbst wenn du gewonnen hättest. Was ist das schon? 1000 Punkte bei einem Sportfest. Glaubst du, irgendjemand interessiert sich für Punkte?“
„Jetzt interessiere ich mich dafür“, gebe ich zu.
„Das ist aber jetzt nicht wichtig! Wir sind wegen einer Aktion hier. Sind wir doch, oder?“
„Von mir aus.“
„Also. Da helfen uns deine Punkte nicht.“
„Was willst du machen?“, frage ich.
„Ich würde sagen: Auf Kommando stehen wir auf. Faust ballen. In die Luft strecken. Dann die Parole und dann durch die Altstadt.“
„Welche Parole?“
„Es muss was sein, was jeder kennt.“
„Wieso brauchen wir überhaupt ’ne Parole?“
„Weil wir damit Druck erzeugen wollen. Also denk’ dir mal was aus.“
„Was wollen wir eigentlich?“
„Wir wollen hier raus“, sagt Kneter.
„Ok, ich will wirklich hier raus.“
„So wörtlich meinen wir das nicht. Eigentlich wollen wir es hier nur besser haben als vorher. Verstehst du?“
„Ich will trotzdem hier weg“, gestehe ich.
„Wo willst du denn hin?“
„Weiß nicht. Alles ist besser, als hierzubleiben. Aber keine Angst, ich helf’ dir schon beim Schreien.“
„Ich will nicht hier weg ...“, sagt Kneter erhaben. „... hier gibt’s Violent und wir sind ungestört. Wie lange sitzen wir jetzt schon hier, hm? Und hast du da schon einen Menschen vorbeikommen sehen?“
„Eben. Wann sieht man hier schon mal Menschen?“
„Wenn wir schreiend durch die Straße laufen, sehen wir Menschen.“
„Aber die will ich nicht sehen! Und ich will nicht, dass die mich sehen! Dann schrei’ ich lieber nicht.“
„Du schreist!“, ordnet Kneter an.
„Dazu müsste ich erstmal wissen, was ...“
„Schrei einfach.“
„Keine Parole?“
„Die fällt uns dann schon ein. Also: Stimmbänder ölen!“
Diese Stimme. Wie laut der ist.
„Und jetzt raus!“
3
Das war mal meine Welt. Jetzt klopf’ ich mit dem Hammer drauf rum. Immer auf die gleiche Stelle. Mein Baumhaus ist morsch geworden. Bald wird es einstürzen, hat mein Vater gesagt. Deshalb bauen wir es lieber selber ab. Ich denke nicht, dass es einstürzt. Aber ich kann nicht erklären, wieso ich das denke. Meistens glaubt mir mein Vater nur, wenn ich gute Erklärungen habe. Und mein Gefühl ist keine Erklärung, das weiß ich schon. Jetzt sitzen wir hier zu dritt und klopfen, so laut wir können. Die Musik hilft uns beim Zerstören. Mein Vater hat sie aufgedreht. Die Bässe hämmern stärker ins Holz als ich. Kneter zieht Nägel aus der Decke. Er sieht aus, als würde ihm das Spaß machen. Er zieht einen Nagel nach dem anderen ab. Ich will, dass mein Baumhaus stehen bleibt. Ich will einen Weg finden, den Verfall zu stoppen. Aber die Zerstörung ist schneller als ich. Ich sehe, wie mein Vater die Balken hochdrückt. Jetzt ist schon die Decke geknackt. Mein Vater dreht sich. Das Brett dreht sich mit ihm. Es ist so leicht. Es klatscht auf die Wiese wie ein nasses Stück Stoff.
Jetzt sitze ich auf den Trümmern im Gras. Die Reste meines Baumhauses verteilen sich um mich. Ich habe den Hammer gegen eine Säge getauscht. Die Wand ist jetzt offen. Das Dach ist komplett weg. Die Musik dröhnt ungebremst ins Freie. Kneter wütet da oben einfach weiter herum. Wieviel Energie der hat. Ich hätte das verhindern müssen. Aber wann? Und wie?
„Hey Lu, träumst du?“
Ich schrecke auf. Bea. Meine große Schwester steht neben mir. Sie dreht die Musik leiser.
„Sorry, dass ich’s nicht eher geschafft habe. Ihr seid ja schon ziemlich weit“, sagt sie.
„Geht.“
„Kann ich noch was helfen?“
„Nein, die kriegen’s hin.“
„Was machst du denn?“
„Klopfen und sägen.“
„Haben sie dich rausgeschmissen?“
„Wie kommst du denn da drauf?“
„Du wirkst so, als wärst du rausgeschmissen worden.“
„Ich bin freiwillig hier“, versuche ich mich rauszureden.
„So wie bei der Siegerehrung? Oh mein Gott! Ich hab dich da oben auf dem Podest gesehen!“
Ich will das jetzt nicht hören, also schaue ich weg.
„Dass die nicht vorher gemerkt haben, dass das nicht stimmen kann“, sagt Bea.
„Du hast mich nicht werfen sehen“, protze ich. „So groß sind die Unterschiede da nicht.“
„Lu, pass einfach auf, dass du dir nicht weh tust beim Sport.“
„Ich passe immer auf, dass ich mir nicht weh tue!“
„Dann muss dir die Schule ja ziemlich weh tun.“
„Das weißt du doch.“
„Ich wusste nicht, dass du sie schmeißen willst.“
„Wissen das jetzt schon alle?“
„Mama hat erzählt, dass du nach diesem Jahr abbrechen willst.“
„Ich will einfach arbeiten! Das liegt mir viel mehr als die ganze scheiß Theorie“, gebe ich an.
Jetzt sehe ich, dass auch die Wände meines Baumhauses weg sind. Wenn ich es weiter aus den Augen lasse, verschwindet es vielleicht, ohne dass ich mir merken kann, wie das alles zerstört wurde. Kneter und mein Vater arbeiten so gut zusammen, als wären sie seit Jahren ein Team, das meine Welt vor meinen Augen auseinander nimmt.
„Du und arbeiten“, stichelt Bea weiter.
„Was soll das denn heißen?“
„Ich hab dich noch nie arbeiten sehen.“
„Eben. Dann wird’s Zeit.“
Ich fühle mich überrumpelt. Wirklich eilig habe ich es nicht mit der Arbeit. Aber ich will endlich frei sein. Ich weiß, dass ich es nie auf die Uni schaffen werde. Trotzdem sehe ich eine Chance, hier raus zu kommen: Supermärkte. Die gibt es überall. Ich muss nur die Ausbildung überstehen, dann kann ich mir die Stadt aussuchen, in der ich lebe und arbeite. Per Edeka ad astra. Oder so. So gut habe ich in Latein aufgepasst, um zu wissen, was das heißt. Ich sehe Bea gnädig an. Ich gebe ihr noch eine Chance, mich zu verstehen. Dieser Blick muss dafür vorerst reichen.
4
Ich sitze auf der Fensterbank und sehe in die Nacht. Ich höre alte Musik. Sonic Youth. Als „Schizophrenia“ zu Ende ist, schiebe ich das Video zum Anfang zurück. Ich wüsste jetzt gern, ob ich traurig bin, aber da ist niemand, den ich fragen kann. Alle sind woanders. Alle liegen verstreut herum: meine Eltern und Bea in ihren Betten, die Einzelteile meines Baumhauses im Gras. Ich bin das einzige Teil in dieser Konstruktion, das noch nicht an seinem Platz ist. Jetzt bleibe ich einfach wach, bis ich die Konstruktion verstehe. Ich bleibe wach, bis mir klar ist, wie ich mich fühle. Mein Handy vibriert. Ohne aufs Display zu sehen, ahne ich, wer das ist. Ich schaue zum Haus auf der anderen Straßenseite. Dort, im zweiten Stock, sitzt Kneter im Fensterrahmen. Im Licht der Straßenlaterne ist nur ein Umriss von ihm zu erkennen. Trotzdem weiß ich genau, dass er mich im Blick hat. Ich will wegsehen, aber ich schaue aufs Display.
Kneter schreibt:
Schau mal was ich gefunden habe.
Ein Video lädt. Als es sichtbar ist, erschrecke ich. Ich sehe mich selbst - auf dem Podest. Die Medaille um den Hals. Der Blick voller Angst. Eingefallen und starr sehe ich aus. Besiegt. Das zu sehen, fühlt sich noch schlimmer an, als dort zu stehen. Da oben musste ich mich nur von Innen ertragen, jetzt muss ich das auch noch von außen sehen, als wären mir 1000 zusätzliche Augen gewachsen, die mich alle peinlich finden. Wahrscheinlich für immer.
Panisch checke ich die Views, Likes und Kommentare. 89 Views. 13 Likes und ein Kommentar: Smalltown Boy. Tränenlachsmiley.
Dann ploppt eine Nachricht von Kneter auf:
Die haben dich gefickt!
Ich sehe, dass er weiterschreibt. Ich kann das alles nicht mehr. Ich lege das Handy weg, schalte das Licht aus und lege mich ins Bett. Jetzt ist es offiziell: Ich bin ein Verlierer. Für immer. Jemand hat meine größte Niederlage auf YouTube hochgeladen und ich steh für immer mit dieser Medaille um den Hals im Netz herum. Das heißt: Es gibt jetzt genau zwei Möglichkeiten - mein Versagen geht viral, was mir mehr Angst macht, als der Tod, oder es interessiert niemanden, dann habe ich sogar als Internetopfer versagt. Ich hätte da niemals hochgehen dürfen. Ich hätte niemals auf Herrn Schmadrig hören dürfen! Aber er ist mein Lehrer. Er ist doch dafür da, dass ich auf ihn höre. OK: Er war mein Lehrer. Zum Glück ist das jetzt vorbei. OK: Das ist es nicht. Nicht, solange ich hier im Internet festsitze. Was im Internet passiert, kann nicht mal Herr Schmadrig korrigieren – selbst wenn er wollte. Was kann der überhaupt? Sicher hätte er nicht mal die Antwort beim Quiz in Musik gewusst: „Smalltown Boy“. Seitdem nennen die mich so. Nur, weil ich ein Lied richtig erraten habe. Das hat die in der Klasse echt erstaunt, dass ich das weiß. Dabei war die Antwort so leicht. Ich hab’ mich fast geschämt, der Einzige zu sein, der das wusste. Die haben einfach keine Ahnung, wie oft ich hier liege und Musik aus der Vergangenheit höre. Die haben einfach keine Ahnung, wie scheiß still es hier ist, ohne Musik.
Ich brauch jetzt dringend meine Playlist.
„There is no end to this“. New Order. Eine Zeile aus „Procession“. „Alone, alone, alone“. Dieses Wort. Es liegt vor mir, wie ein Selbstporträt. Jetzt ist es endlich da: Mein Gesicht. Eigentlich sollten da irgendwelche klugen Antworten rauskommen. Oder Lösungen. Oder zumindest Zeichen, dass ich am Leben bin. Aber mein Gesicht ist wie ein Vorhang. Und jeden Tag wickele ich mich wieder darin ein. Jetzt ist das Teil weg. Als käme da, wenn ich Play drücke, ein Hausmeister, der mich befreit und den Stoff einfach zur Seite schiebt. Jetzt sehe ich das, was ich wissen will. Die einzigen Fragen, die mich wirklich interessieren: Wie berühre ich jemanden? Wie berühre ich jemanden wirklich? Wie halte ich jemanden, ohne ihn festzuhalten? Wie lasse ich mich fallen, ohne jemand anderen fallen zu lassen? Und wieso kann ich mir immer nur was vorstellen, wenn diese Musik läuft!? „It’s a problem, you know“, sagt der Song. Ich weiß! Ich weiß das doch, denke ich. Dann starte ich das Lied von vorn.
5
Als seriöser Kaufmann habe ich die Beine übereinandergeschlagen. Ich blende alles aus, was bisher in meinem Leben passiert ist und bin bereit, es nun ganz neu und endlich erfolgreich zu gestalten. Die Voraussetzungen dafür sind ideal: Die Bügelfalte meiner Hose ist akkurat, mein Jackett sitzt locker, genau wie die Krawatte, die ich mir selbst gebunden habe. Mir gegenüber sitzt Herr Woigl. Er ist Marktleiter. Ich habe ihm eine unwiderstehliche Bewerbung geschrieben. Ich will Verkäufer werden. Jetzt sofort.
„Also, deine Noten sind schon ein bisschen problematisch“, sagt er.
Deswegen sitze ich hier und nicht in der Schule, denke ich. Und sage nichts.
„Aber dein Anschreiben hat mir gefallen. Du bist motiviert. Das mögen wir hier.“
Stundenlang habe ich an dem Anschreiben herumgedoktort. Konzipiert war das als Manifest, in dem alles steht, was ich in meiner Lehrzeit zu sagen beabsichtige. Ich merke, dass mein Vorsprung jetzt schon dünn wird.
„Was reizt dich denn am Berufsbild des Verkäufers?“, fragt Herr Woigl.
„Die Arbeit mit Menschen“, wiederhole ich die Worthülse, die ich auch in meinem Anschreiben großzügig verwendet habe.
„Ja, das ist ein angenehmer Teil unseres Berufs.“
Unser Beruf. Wie schön das klingt. Das zu hören freut mich mehr, als ich mir eingestehen will.
„Ich denke, der Beruf könnte dir Spaß machen. Du kannst bei uns ein bisschen Selbstbewusstsein aufbauen.“
Woher weiß der, dass ich Selbstbewusstsein brauche? Bevor ich los bin, habe ich extra nochmal in den Spiegel geschaut. Heute habe ich keine einzige Schwachstelle finden können. Ich rücke mich zurecht. Ich halte für eine Sekunde Blickkontakt, dann schiele ich auf den Kugelschreiber neben dem Laptop.
„Wo soll ich unterschreiben?“, frage ich energisch.
„Du kannst auch erst mal einen Probetag hier arbeiten, wenn du magst.“
„Einen Probetag?“
„Da bekommst du nochmal einen genaueren Einblick in das Berufsbild.“
Ich mag das Berufsbild auch so, denke ich. Ich mag alles, was ich darüber gelesen habe. Ich dachte, er kann das spüren. Aber er sieht mich an und erwartet offenbar eine Antwort.
„Ich schaue mal, wann ich Zeit habe“, biete ich ihm großzügig an.
„Jetzt gleich würde auch gehen.“
„Jetzt gleich?“ Dieser Druck hier. Mir wird heiß.
„Äh, ein Freund wartet draußen auf mich.“
„Tja, daran wird er sich gewöhnen müssen, wenn du hier anfängst“, sagt Herr Woigl und zuckt die Schultern. „Also, was meinst du?“
„Klar“, antworte ich so sicher, wie ich kann. „Ich will alles über unseren Beruf wissen. Am liebsten jetzt gleich.“
Unser Beruf. Er macht mir Spaß. Dauernd passiert etwas. Überall gibt’s was Neues zu sehen. Ganz schön spannend, so ein Becher. Was da alles drauf steht: Calcium unterstützt die Muskelfunktion und trägt zur Erhaltung von Knochen und Zähnen bei. Und hier! Noch besser: Enthält biologisch aktive Biogarde-Markenkulturen mit Lactobacillus acidophilus und Bifidobakterien. Bifidobakterien. Was für ein wunderbares Wort. Wie magisch das klingt. So einschüchternd und wild. Da muss eine geheime Macht dahinter sein. Mal schauen, was da noch alles steht.
„Willst du das auswendig lernen?“ Herr Woigl kniet neben mir. Er schaut mich streng und trotzdem irgendwie kumpelhaft an. Ich sehe, dass er gleichzeitig sprechen und im Zeitraffer Joghurt ins Kühlregal räumen kann. Ich will ihm zeigen, wie lernfähig ich bin und stelle sorgfältig die Buttermilch ins Regal.
„Erst die alte Ware raus, dann die Neue rein“, erklärt Herr Woigl.
Ich habe gar nicht gesehen, dass er die alten Sachen ausgeräumt hat. Ist das Schikane oder hab’ ich nicht aufgepasst? Ich konzentriere mich jetzt. Ich nehme den Becher wieder raus. Eigentlich interessiert es mich wirklich, was da noch drauf steht.
„Wichtig ist, dass wir bei den Molkereiprodukten schnell sind, da müssen wir auf die Kühlkette achten, verstehst du?“
Ich bin schnell, denke ich. Die Zeit auf dem Siegertreppchen soll nicht umsonst gewesen sein. Irgendwas Gutes muss ich von da oben doch mitgenommen haben. Jetzt sehe ich die Gläser in dem Karton. Eingepfercht stehen sie da. Diese Enge da drin. Fast so eng wie zwischen den ganzen Handykameras zu stehen. Vorsichtig pflücke ich die Gläser da raus. Ich ziehe sie, wie einen Stecker, von dem ich hoffe, dass er dem Video den Strom abdreht. „Das darf gern ein bisschen schneller gehen!“, höre ich Herrn Woigl neben mir. Unmöglich, denke ich, das Zeug ist viel zu zerbrechlich. Das darf jetzt nicht schief gehen. Da hängt viel zu viel dran. Sanft stelle ich die Gläser ins Regal. Ganz sanft.
Auf einmal sehe ich Kneter. Er irrt durch den Gang. Er sieht aus, als hätte er etwas verloren. Irgendwas Großes, etwas, was er gar nicht verfehlen kann. Ich frage mich, ob er mich erkennt. Mein Sakko habe ich gegen einen weißen Kittel getauscht. Seit ich hier am Kühlregal stehe, bin ich jemand anderes geworden. Jetzt treffen sich unsere Blicke. Kneter zögert einen Moment. Dann kommt er entschlossen auf mich zu.
„Warum hast du nicht zurückgeschrieben?“, fährt er mich an.
„Ich muss mich konzentrieren“, sage ich gedämpft.
„Wir müssen uns beeilen! Ich check nicht, wie du so ruhig bleiben kannst.“
„Ich brauch’ noch bisschen.“
„Ok, ich warte.“
„Hier?“
„Klar, wo sonst, der Laden ist doch offen, oder?“
Ich merke, dass sich Herr Woigl neben uns aufrichtet. Gleich serviert er mich ab, denke ich. Aber sein Blick sieht harmlos aus. „Für einen ersten Eindruck reicht mir das“, sagt er. Und: „Kommst du kurz mit ins Büro?“ Kneter und ich sehen uns an. Mir wird mulmig. Ich habe mich schon wieder unterbrechen lassen. Das hätte nicht passieren dürfen. Ich brauche den Job. Sonst komme ich nie aus diesem Sumpf raus, in den ich mich in der Schule manövriert habe.
30 Minuten später bin ich wieder im Sakko. Es ist zum Sakko eines Arbeiters geworden. Ich habe unterschrieben. Der Vertrag ist sicher in meinem Rucksack verstaut. Der Rucksack fühlt sich so leicht an, als wäre darin alles, was ich jemals brauchen werde. Ich fühle mich frei. Diesmal habe ich wirklich alle abgehängt. Und ich musste nicht mal rennen dafür. Für meinen Triumph waren nur nötig: ein Supermarkt, ein paar Becher und ein weißer Kittel, der mir gar nicht so schlecht steht. Ich bewege mich endlich wieder aus eigener Kraft. Kneter hat vor dem Laden auf mich gewartet. Jetzt schlendern wir die Straße hinunter.
„Was hat er gesagt?“ fragt Kneter.
„Wir kriegen das schon hin.“
„Sonst nichts?“
„Sonst kaum was“, untertreibe ich. „,Du musst noch sehr viel lernen‘, hat er noch gesagt. Und: ,Wir müssen viel arbeiten, wenn das was werden soll, aber zum Arbeiten sind wir ja hier.‘ Und: ,Ein bisschen skeptisch bin ich schon. Aber wir brauchen dringend Leute, das sag’ ich dir ganz ehrlich.‘ Ich habe genickt. Zu allem. Dann habe ich unterschrieben. Jetzt weiß ich endlich, wer ich bin: Ich bin ein Arbeiter. Einer von denen, die zupacken und auch ein Sakko ausfüllen können. Ich flöße mir fast schon selbst Respekt ein.
„Hast du dir mal überlegt, wie du dich für das Video rächen kannst?“, fragt Kneter.
„Wieso rächen, was kann ich da groß tun?“
„Das kann dich doch nicht kalt lassen!“
„Könnte schlimmer sein. Ich bin da ja nicht nackt“, spiele ich es herunter, weil ich nicht dran denken will, in meinem momentanen Triumph.
„Du bist bald nackt, wenn du dich nicht wehrst. Die ziehen dich aus. Die ziehen dich komplett blank.“
„Das interessiert doch eh niemanden. Das klickt kaum jemand.“
„Aber es könnte jemand klicken. Jederzeit könnte das viral gehen“, mahnt Kneter.
„Das ist einfach nicht krass genug.“
„Lu, ich glaub dir kein Wort und du glaubst dir selbst nicht, wenn du das sagst.“
Stimmt. Verdammt. „Und was willst du machen?“, frage ich.
„Ich will den Idioten ’ne Antwort geben“, sagt Kneter.
„Ok?“
„Wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann machen die uns platt, Lu.“
„Wen meinst du?“
„Na, alle. Jeder, der ein Handy bedienen kann, kann dich heute platt machen. Macht dir das keine Angst?“
„Ich vertraue darauf, dass die meisten nur Pornos schauen wollen. Oder Katzen. Oder Musik hören.“
„Ich nicht.“
„Und überhaupt: Wenn ich arbeite, lege ich das Handy weg. Dann interessiert mich das alles nicht mehr“, gebe ich großspurig bekannt.