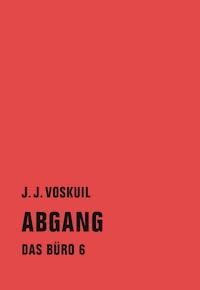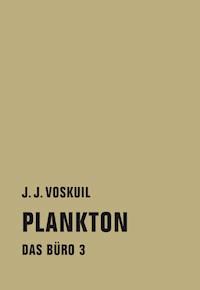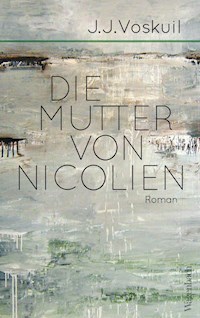(1982)
Er schob sein Namensschild ein, betrachtete die kleine Pforte zwischen Pförtnerloge und Küche, betrat die Küche, grüßte Wigbold, der an seinem Tisch saß und ihm zuschaute, und sah es sich auch von der anderen Seite an. »Sind sie jetzt fertig?«, fragte er, während er sich Wigbold zuwandte.
»Es muss nur noch gestrichen werden.«
Maarten nickte. »Es ist schön geworden.«
»Wenn sie bloß nicht meinen, dass ich mich da hinsetze.«
»Das ist auch nicht nötig. Wenn Sie nur herankönnen.«
»Und dann sicher dauernd hin- und herlaufen.«
»Ich habe da jetzt dreimal gesessen«, er unterdrückte seine Irritation, »es kommen höchstens fünfzehn Telefonate pro Tag.«
»Na, dann haben Sie wohl ruhige Tage gehabt.«
»Das ist möglich«, er hatte keine Lust, eine Diskussion darüber anzufangen, »aber auf jeden Fall müssen Sie nicht mehr außenrum laufen.« Er wandte sich ab, ging in die Halle und durch die Schwingtür, nahm die Post vom Tresen und stieg die Hintertreppe hinauf in sein Zimmer. Er schloss die Türen des Besucherraums und des Karteisystemraums, legte die Post auf seinen Schreibtisch, stellte seine Tasche unter den Schreibmaschinentisch, machte das Fenster einen Spalt auf, hängte sein Jackett auf, knipste die Schreibtischlampe an und setzte sich an den Schreibtisch. Er griff zu seinem Brieföffner, nahm den obersten Brief vom Stapel und schnitt ihn auf. Es war eine Mitteilung des Historikerverbands, dass sich Doctorandus M.Grosz dazu bereit erklärt habe, anstelle von Doctorandus de Vlaming als Redner auf dem Ende März stattfindenden Kongress über Mentalitätsgeschichte aufzutreten. Die Nachricht überraschte ihn. Er las sie noch einmal, fragte sich, warum Mark es ihm nicht gesagt hatte, und erinnerte sich, dass der ihm in den letzten Wochen auffallend unfreundlich vorgekommen war. Während er darüber nachdachte, kam Joop ins Zimmer. »Morgen«, sagte sie.
»Tag, Joop«, sagte er abwesend.
Sie blieb an seinem Schreibtisch stehen. »Kann ich eigentlich nicht mit nach Münster?«
Er schüttelte den Kopf. »Nein, nur die Leute von der Inventarverzeichnisuntersuchung.«
Sie verbarg ihre Enttäuschung. »Na, dann habe ich es mal einen Tag lang schön ruhig.«
»Ich habe mir überlegt, dass wir, wenn wir diesen Kongress hinter uns haben, mal mit allen zum Seemuseum fahren«, sagte er, um sie zu trösten.
»So wie damals nach Arnheim?«
Er nickte. »Wäre das was?«
»Aber sicher!«
Er lachte. Während sie sich abwandte und in den Karteisystemraum ging, legte er den Brief zur Seite und griff zum nächsten. Lien kam in den Raum, unmittelbar gefolgt von Ad. »Tag, Maarten«, sagte sie.
Er sah auf. »Tag, Lien.« An ihrer Stimme meinte er zu hören, dass da etwas war, doch sie ging, ohne ihn anzusehen, in den Karteisystemraum. Er sah Ad an. »Tag, Ad.«
»Tag, Maarten.« Ad stellte seine Tasche auf den Schreibtisch, hängte sein Jackett über den Stuhl und setzte sich.
Maarten stand auf, nahm das Schreiben der Historiker mit zu Ads Schreibtisch und legte es ihm hin. Während Ad den Brief las, wobei er ihn ein Stück von sich weghielt, sah er zu.
»Ja«, sagte Ad und gab ihn mit einem verschmitzten Lächeln zurück.
»Wusstest du das?«
Ad schüttelte den Kopf. »So etwas sagt er mir nicht.«
»Komisch.«
»Findest du?« Er sah Maarten weiter mit demselben Lächeln an.
»Weil ich mit ihm noch darüber gesprochen hatte.«
Lien kam mit einer Mappe wieder aus dem Karteisystemraum und ging an ihnen vorbei zum Flur.
»Vielleicht war das, als du in Aix warst?«
»Das ist schon wieder eine Woche her.« Er ging zurück und setzte sich an den Schreibtisch. »Ich habe gestern Abend Blazer getroffen.« Er nahm den Brief, den er gerade gelesen hatte. »Er hat sich weggedreht.«
»Wo war das denn?«, fragte Ad neugierig.
»Im Molsteeg. Er kam auf dem Fahrrad von der Torensluis, als wir gerade aus dem Molsteeg kamen.«
»Vielleicht hat er dich nicht gesehen?«
»Vielleicht«, sein Ton war sarkastisch, »aber er hat schon eine rote Birne gekriegt.«
»Der Leserbrief ist ihm wohl nicht bekommen.«
»Das war ein dummer Brief. Und dann noch dieser Brief von Saskia Schelvis, die ihm den Kopf gewaschen hat.«
»Ich hätte eigentlich gedacht, dass er klüger wäre.«
»Zumindest härter.«
Sie schwiegen.
Maarten heftete einen Umlaufzettel an den zweiten Brief und legte ihn in sein Ausgangskörbchen. Er schnitt den dritten Brief auf und vertiefte sich in den Inhalt, zurückgelehnt auf seinem Stuhl.
Ad stand auf und kam an seinen Schreibtisch.
Maarten sah auf.
»Eigentlich würde ich gern einen anderen Stuhl haben.« Er lächelte herausfordernd.
Die Bitte überraschte Maarten. »Was für einen Stuhl denn?«
»So einen, wie sie ihn in den anderen Abteilungen haben.«
»So einen Großkotzstuhl?«
»Auf unseren Stühlen kriege ich Rückenschmerzen.«
»Rückenschmerzen?«
»Findest du das komisch?«
»Na ja, komisch … Wenn du Rückenschmerzen kriegst … Ich finde nur, dass es Idiotenstühle sind, mit diesen dicken Sitzpolstern und den Rückenlehnen.«
»Das finde ich nun gerade sehr angenehm.«
»Und was machen wir dann mit deinem Stuhl?«
»Den stellen wir an den Sitzungstisch.«
Maarten dachte nach. Die Vorstellung, dass zwischen dem einfachen Holzmobiliar seiner Abteilung so ein Stuhl stehen würde, fand er wenig erheiternd.
»Aber wenn es nicht geht …«, sagte Ad ein wenig gekränkt.
»Nein, wenn du Rückenschmerzen bekommst …« Er riss sich zusammen. »Ich werde Panday fragen, ob noch Geld dafür da ist.«
»Danke.«
»Hast du eigentlich irgendeine Idee, wie weit Rie mit ihrem Vortrag für Münster ist?«
»Sie wird wohl über diese Inventarverzeichnisuntersuchung sprechen.« Seine Stimme klang gleichgültig.
»Ja, schon, aber schafft sie das?«
»Das musst du sie fragen.«
»Das kann ich sie zwar fragen«, sagte Maarten ungeduldig, »aber vielleicht ist es besser, wenn du das machst, denn auf mich reagiert sie allergisch.«
»Vielleicht tut sie das bei mir ja auch?«
Maarten ignorierte die Bemerkung. »Ihr habt auf jeden Fall mehr Kontakt. Und außerdem sieht sie in dir nicht den Chef.«
Ad schwieg.
»Du musst ihr keine Aufträge erteilen. Du könntest ihr nur helfen, wenn sie stecken bleibt.«
»Ich werde sie danach fragen«, sagte Ad widerwillig.
»Danke.« Er sah wieder auf den Brief in seiner Hand, während Ad sich abwandte und zurück an seinen Schreibtisch ging.
Die Tür ging auf. Freek Matser betrat den Raum. »Guten Morgen«, sagte er reserviert.
»Tag, Freek«, sagten Ad und Maarten.
Freek kam an Maartens Schreibtisch und blieb dort stehen.
Maarten sah auf.
»Kann ich dich etwas fragen?«, erkundigte sich Freek mit ironischem Unterton und leicht stotternd. »Oder bist du dafür im Augenblick nicht in der Stimmung?«
Maarten ließ sich auf seinem Stuhl zurücksinken. »Du kannst mich immer etwas fragen.«
Freek lachte kurz. »Vielleicht ist es ethisch nicht so ganz vertretbar, aber dürfte ich wohl erfahren, was jetzt mit dem Geld von Ed passiert?«
»Das ist noch nicht entschieden.« Er sah ihn musternd an. »Wolltest du das etwa haben?«
Freek stockte kurz, als müsste er sich zwingen, die Worte aus dem Mund zu bekommen. »Ich hätte nämlich gern wieder eine normale Anstellung.«
Die Bitte überraschte Maarten. »Setz dich mal.« Er zeigte zum Stuhl auf der anderen Seite seines Schreibtisches.
»Aber nicht, wenn es ein Gefallen ist!«, sagte Freek drohend. Er setzte sich.
Maarten schüttelte den Kopf. »Nein, natürlich nicht.« Er sah Freek an. »An welche Stelle hattest du denn gedacht?«
»Auf jeden Fall keine w-wissenschaftliche Stelle!«, sagte Freek mit aufkommender Entrüstung.
»Eine Verwaltungsstelle?«
»Und im n-niedrigsten Rang, den es dafür gibt!« Er stotterte bei dem Gedanken, dass Maarten ihm einen höheren Rang andrehen könnte.
»Um deine Bibliografie abzuschließen?«
»Unter anderem.«
Maarten schwieg nachdenklich.
»Und ich will auch gern die redaktionelle Arbeit für das Bulletin machen.«
Maarten nickte. »Aber keine Aufsätze.«
»Ganz sicher keine Aufsätze, und auch keine Buchbesprechungen!« Es klang drohend.
»Ich verstehe.«
»Das kann ich mir kaum vorstellen.«
Maarten ignorierte es. »Und wie viele Tage sollen es werden?«
»Fünf! Die halbe Stelle, die ich jetzt habe, und die halbe Stelle von Ed.«
»Ich werde mit Balk darüber sprechen. Aber das wird wohl nicht sofort entschieden werden. Soll ich dich anrufen?«
»Gern. Ich habe bloß noch kein Telefon.«
Maarten sah ihn verwundert an.
»Ich wohne nicht mehr zu Hause«, sagte Freek widerwillig.
»Wie ist denn deine Adresse?« Er griff mechanisch zu einer Karteikarte, seine Überraschung verbergend.
»Gib her!« Freek streckte die Hand aus.
Während Freek seine Adresse auf die Karteikarte schrieb, sah Maarten zu. »Danke«, sagte er, als er die Karte wieder entgegennahm. Er sah auf die Adresse. »Dann werde ich dir schreiben.«
»Ich kann auch anrufen.« Er stand auf.
»Ja, aber ich weiß nicht, wie lange es dauert.«
»Heute bin ich auf jeden Fall hier.« Er wartete noch einen Moment, sah Maarten streng an, wandte sich ab und verließ den Raum.
»Wusstest du, dass er geschieden ist?«, fragte Maarten.
»Nein«, sagte Ad.
Maarten nahm sich den Brief wieder vor.
»Ob du das wirklich machen solltest?«, fragte Ad.
»Was?«
»Ihn hier wieder einzustellen.«
»Warum nicht?«
»Weil er völlig verrückt ist.«
»Ach. Hier gibt es noch mehr, die verrückt sind.«
Er ging die Post weiter durch, heftete Umlaufzettel mit Hinweisen für die Bearbeitung einzelner Briefe an und erhob sich. Auf dem Weg zur Tür legte er den Stapel auf die Ausziehplatte des Schreibtisches von Ad. »Ich bin kurz bei Balk.« Er verließ das Zimmer, stieg die Treppe hinunter, betrat den Durchgangsraum, grüßte Simon Hoevers und stieß die Tür zu Balks Zimmer auf. Balk saß an seinem Schreibtisch. »Hast du kurz Zeit?«, fragte er.
»Einen Augenblick«, sagte Balk, während er mit dem Schreiben fortfuhr.
Maarten setzte sich. Er nahm eine Zeitschrift von dem niedrigen Tisch und blätterte darin. Sie enthielt einen Aufsatz von Balk. Er ging ihn flüchtig durch, legte das Heft wieder zurück und sah vor sich hin.
Balk machte ein paar Striche unter den Text, den er gerade geschrieben hatte, und warf seinen Stift hin. »So!« Er stand auf, setzte sich in seinen Sessel in der Sitzecke, schlug die Beine übereinander und sah Maarten forschend an.
»Matser möchte wieder eine Stelle haben.«
»Jetzt wieder eine Stelle?«, fragte Balk unbehaglich.
»Ganztags.«
»Du hast ihm doch wohl gesagt, dass wir keine freie Stelle haben?«
»Darüber wollte ich mit dir sprechen.« Er wartete einen Moment, seine Worte abwägend. »Ich habe mich gefragt, ob wir das Geld, das wir noch für Aushilfskräfte haben, nicht für eine Planstelle umwidmen können.«
»Du weißt, dass das Hauptbüro gerade diese festen Stellen loswerden will!«
»Das weiß ich, aber solange der Beschluss noch nicht gefasst ist …«
Balk presste die Lippen aufeinander.
»Ich würde es nicht vorschlagen, wenn Matser nicht von unschätzbarer Bedeutung für das Musikarchiv wäre. Jemanden mit seinem Wissen auf diesem speziellen Gebiet findet man sonst nicht.«
Balk sprang auf, ging zu seinem Schrank, suchte hastig in einem Stapel Mappen, kam mit einer Mappe zurück, schlug sie auf seinem Schoß auf und studierte die Zahlen. »Ganze Tage?«
»Ja.«
»Dafür haben wir kein Geld.«
»Er hat jetzt eine halbe Stelle, und Res hatte auch eine halbe Stelle.«
»Aber das ist Gehaltsgruppe 32!«, sagte Balk ungeduldig. »Matser sitzt in 112!«
»Er will in 32 bleiben.«
Balk zog die Augenbrauen zusammen. »Was für ein Unsinn!«
Maarten schmunzelte. »Er ist ein bisschen verrückt.«
Balk dachte einen Augenblick nach. »Gut!« Er stand auf. »Ich werde es dem Hauptbüro vorschlagen, aber rechne nicht damit, dass es klappt!«
Während er die Mappe zurück in den Schrank legte, stand Maarten ebenfalls auf und ging zur Tür. »Hast du noch etwas von Bavelaar gehört?«, fragte er, die Hand an der Türklinke.
»Die kommt vorerst nicht wieder.«
»Was hat sie denn bloß?«
»Laut Gesundheitsamt ist es etwas Psychisches. Jedenfalls kann von Arbeiten noch keine Rede sein.«
Maarten nickte. Er verließ den Raum, stieg die Treppe hinunter und ging ins Verwaltungszimmer, in dem Panday an seinem Schreibtisch saß, mit einer Liste vor sich. »Tag, Herr Panday.«
»Tag, Herr Koning«, sagte Panday freundlich und sah auf.
Maarten schaute sich um. »Wie läuft es hier jetzt?« Seit Bavelaar nicht mehr da war, herrschte hier eine unwirkliche Stille, als würde absolut nichts mehr passieren.
»Oh, ganz gut.«
»Sie vermissen Fräulein Bavelaar nicht?«
»Ach, es geht«, sagte Panday diplomatisch.
Maarten nahm einen Stuhl und setzte sich. »Ich habe mich gefragt, ob im Haushalt noch Geld für einen Stuhl ist.«
»Oh, aber sicher doch.«
»Ich meine so einen Drehstuhl mit Armlehnen, wie Volkssprache und Volksnamen sie haben.«
»Ja, das geht schon.«
Es wunderte Maarten, dass er es nicht nachsehen musste, Bavelaar hätte das sofort gemacht. »Da sind Sie sich sicher?«
»Ja«, beruhigte ihn Panday.
Maarten schmunzelte. »Würden Sie dann einen für uns bestellen?«
Panday zog träge einen Schreibblock zu sich heran und griff zu einem Stift. »Einen?«, fragte er und sah auf.
»Einen!« Er stand wieder auf.
»Das mache ich. Einen Stuhl also.«
»Vielen Dank.« Nicht zur Gänze beruhigt verließ er den Raum und ging in die Halle. Mark kam die Treppe herunter. Maarten blieb stehen, um ihn zu abzufangen. »Ich habe gelesen, dass du de Vlaming vertrittst?«, sagte er, als Mark bei ihm war.
»Ja«, sagte Mark knapp. Er sah Maarten böse an.
»Das ist schön.«
Mark reagierte nicht darauf.
»Warum hast du mir das nicht gesagt?«, fragte Maarten, unsicher, was Marks Haltung zu bedeuten hatte. »Aus Bescheidenheit?«
Marks Gesicht straffte sich. Sein Mund zog sich in seinem Bärtchen zusammen. »Nein, aus Verärgerung.«
»Aus Verärgerung?«, fragte Maarten verblüfft.
»Weil du nicht bereit warst, mich dabei zu unterstützen.« Er sah Maarten starr an, wobei die Pupille in seinem rechten Auge kreiste.
»Dazu war ich durchaus bereit!« Der Vorwurf empörte ihn. »Ich wusste nur nicht, wie. Und du wolltest mich auch noch wissen lassen, ob du es überhaupt wolltest!«
»Das sehe ich dann anders!«
Der schroffe Widerspruch machte Maarten hilflos. »Aber ich war sehr wohl dazu bereit!«
»Trotzdem sehe ich das anders!«
»Nein!« Er war plötzlich wütend. »Das kannst du nicht! Ich werde doch wohl wissen, was ich selbst gedacht habe?«
Mark sah ihn starr an, ohne zu reagieren. Das dauerte einige Sekunden. Dann wandte er sich ab und ging durch die Schwingtür in den Kaffeeraum.
Gekränkt stieg Maarten die Treppe hinauf. Erst als er in seinem Stockwerk war, kam er wieder halbwegs zu Sinnen. Er zögerte vor seiner Tür, wandte sich ab und ging über den Flur zu Freeks Zimmer. Freek war nicht da. Hinter dem Bücherregal hörte er das Klappern einer Schreibmaschine. Er sah um die Ecke. »Weißt du, wo Freek ist?«
Rie sah auf. »Gerade war er noch da«, sagte sie gleichgültig.
»Dann suche ich mal weiter.« Er ging wieder auf den Flur, betrat Eefs Zimmer, grüßte ihn, schaute ins Mittelzimmer, grüßte Joost, Jarings Zimmer war leer. Er ging über den Flur zurück in sein Zimmer. »Dein Stuhl ist unterwegs«, sagte er zu Ad. »Tag, Bart.«
»Tag, Maarten.«
»Weiß einer von euch, wo Freek ist?«
»Gerade eben war er noch im Karteisystemraum«, sagte Bart.
Maarten ging in den Karteisystemraum. Joop war allein. »Ist Freek nicht hier?«
»Er ist gerade wieder weg«, sagte Joop. Sie richtete sich ein wenig auf und sah in Siens Raum auf der anderen Seite des Lichtschachts hinüber. »Und da ist er auch nicht.«
»Dann ist er sicher Kaffee trinken.« Er wollte sich abwenden.
»Du solltest mal mit Lien reden«, sagte sie.
Er sah sie musternd an. »Was ist mit Lien?«
»Da ist wieder alles völlig verfahren!« Sie strich sich mit der Hand über die Stirn. »Die steht völlig neben sich.«
Die Mitteilung beunruhigte ihn. »Wo ist sie?«
»In dem Kämmerchen von Ad.« In ihrem Ton lag etwas Höhnisches. »Das ist auch so was.« Ihrem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, fand sie es unheimlich verrückt.
»Ich werde mal nachschauen.« Er ging wieder in sein Zimmer und die Treppe hinauf in den dritten Stock. Dass Lien nun auch schon in dem kleinen Zimmer von Ad saß, überraschte ihn. Die Tür stand halb offen. Sie saß mit dem Rücken zu ihm an einem kleinen Schreibtisch, der neben den Schreibtisch von Ad gestellt worden war, reglos, ihren Kopf über Papiere gebeugt. Da ihr die Haare vor dem Gesicht hingen, konnte er es nicht sehen. Er nahm Ads Stuhl und setzte sich neben sie. »Was ist los?«, fragte er freundlich.
Sie blickte langsam auf, ohne den Kopf zu heben. Sie wirkte verzweifelt, Tränen standen ihr in den Augen. »Ich kann es nicht«, sagte sie mit erstickter Stimme.
»Gib mal her.« Er streckte die Hand zu ihren Papieren aus, und als sie sich nicht rührte, nahm er das oberste Blatt. Es war in allen Richtungen mit Wörtern und kurzen Sätzen beschrieben, manche wieder durchgestrichen, andere mit einem Kringel darum. Er betrachtete es näher und sah, dass es Varianten ein und desselben Satzes waren, in immer anderen Formulierungen und einer anderen Wortfolge. »Das Problem ist, dass du nicht weißt, an wen du dich richten sollst«, stellte er fest. »Du findest den Ton nicht.« Er sah sie an. Sie reagierte nicht. Eine Träne tropfte auf den kleinen Stapel Papiere, der übrig geblieben war. »Wenn du jetzt Peter mal erklären würdest, was du machst. Du schreibst einfach: ›Lieber Peter, du hast gefragt, was ich mache. Mein Auftrag ist es zu untersuchen, wo es in den Niederlanden im vorigen Jahrhundert bemalte Möbel gab. Die Quelle, die ich dafür benutze, ist das Inventarverzeichnis. Wir haben soundso viele Inventarverzeichnisse aus soundso vielen Orten. Die gehe ich gerade durch. Über das Ergebnis kann ich also noch nichts sagen, wohl aber über die Probleme, auf die ich stoße …‹ Und dann erzählst du kurz, welche Probleme du hast. Das ist es. Mehr brauchst du nicht zu tun. Für die Deutschen ist das genug.« Er wartete erneut, sie von der Seite musternd, doch es kam keine Reaktion. »Du musst nur fünf Minuten reden …« Sie sah langsam auf, niedergeschlagen, ratlos, er hatte nicht den Eindruck, dass seine Worte sie erreicht hatten. »So wichtig ist es doch nicht?« Er hatte Mitleid mit ihr. Sie schüttelte den Kopf, ihr Gesicht wieder von ihm abgewandt. Maarten stand auf. »Versuche jetzt einfach mal, es Peter zu erzählen. Und wenn das nicht klappt, macht es nichts. Dann übernehme ich es gern.« Er wartete auf eine Reaktion, doch sie rührte sich nicht. »Es kann wirklich nichts schiefgehen«, sagte er noch. Als sie weiter schwieg, wandte er sich zögernd ab und ging langsam wieder auf den Flur. In Gedanken stieg er die Treppe hinunter, während er sich fragte, was er tun sollte. Als er den Raum betrat und die Tür hinter sich schloss, ging die Verbindungstür auf. Gert sah um die Ecke. »Ich habe gehört, dass Ad einen neuen Stuhl bekommt?« Er dämpfte seine Stimme ein wenig.
Maarten blieb stehen und sah ihn an, ironisch.
»So einen hätte ich eigentlich auch gern.« Er grinste verlegen.
»Hast du auch Rückenschmerzen?«
»Das nicht.«
Das Telefon klingelte.
»Solange du keine Rückenschmerzen hast, kriegst du keinen neuen Stuhl«, sagte Maarten und wandte sich ab. »Unsere Stühle halten sicher noch hundert Jahre.« Er nahm den Hörer ab. »Koning!«
»Jaap hier. Kannst du kurz kommen?«
»Ich komme.« Er legte den Hörer auf. »Ich bin kurz bei Balk«, sagte er und ging zur Tür.
Balk stand an seinem Schreibtisch, die Hand auf dem Hörer des Telefons. Er sah Maarten geistesabwesend an, doch er fasste sich wieder. »Ich habe mit dem Hauptbüro telefoniert!« Er sprach die Worte kurz und energisch aus. »Sie haben nichts dagegen, wenn das Geld für Aushilfskräfte für eine Planstelle umgewidmet wird, wohl aber, dass Matser sie bekommt! Das gibt Ärger mit der Gewerkschaft!«
»Warum?«, fragte Maarten verwundert.
»Weil er überqualifiziert ist!«
»Aber wenn er es doch selbst will?«
»Warum will dieser Mensch das denn eigentlich?«, fragte Balk gereizt.
»Weil er nur Verwaltungsarbeiten machen will.«
»Was sind das für Faxen!«
Maarten zuckte mit den Achseln. »Er ist ein frustrierter Mann.«
»Dann muss er sich eben irgendwo anders Arbeit suchen«, sagte Balk ungeduldig. »Wenn er die Stelle einer Verwaltungskraft besetzt, betrachtet die Gewerkschaft das als unlautere Konkurrenz.«
»Eine einfache Verwaltungskraft bringt uns nichts.«
»Warum nicht?«
»Weil wir für sie keine Arbeit haben. Verwaltungskräfte haben wir genug. Matsers Bedeutung liegt ja gerade darin, dass er auf diesem Gebiet mehr weiß als jeder andere, und wenn das nur in einem Verwaltungsrang möglich ist, dann eben in einem Verwaltungsrang!«
Balk presste nachdenklich die Lippen zusammen. »Kannst du dazu einen Brief schreiben?«
»Dazu kann ich einen Brief schreiben.«
»Ich meine: mit Argumenten!«
»Natürlich.«
»Gut! Schreib dann mal einen Brief!«
Maarten nickte. Als Balk sich abwandte, um wieder an seinem Schreibtisch Platz zu nehmen, drehte er sich zur Tür um.
»Ich unterschreibe den Brief dann!«, informierte ihn Balk noch, als Maarten seine Hand bereits an der Türklinke hatte.
*
»Hey, seid ihr schon da?«, sagte er überrascht. Sie saßen zu viert im vorderen Teil des ersten Waggons. »Ich dachte, dass ich immer der Erste wäre.« Er legte seine Tasche in die Ablage und zog seinen Mantel aus.
»Wir dachten gerade: Hurra, er kommt nicht!«, sagte Rie mit rauer Stimme.
»Was hättet ihr dann gemacht?« Er fand den Scherz nur mäßig.
»Eine Party geschmissen.«
»Nein, dabei könnt ihr mich tatsächlich nicht gebrauchen.« Er legte den Mantel zu seiner Tasche und setzte sich auf die andere Seite des Gangs.
»Na, was mich betrifft, darfst du gern dabei sein«, sagte Frits.
Ad grinste, die Lippen fest aufeinandergepresst.
Draußen pfiff der Schaffner. Die Türen schlugen zu. Der Zug setzte sich langsam in Bewegung.
»Hast du deinen kleinen Vortrag noch fertig bekommen?«, fragte Maarten und beugte sich etwas vor, um Lien, die am Fenster saß, sehen zu können.
»Ja«, sagte sie verlegen.
»Wann?«
Sie zögerte. »Heute Nacht um vier Uhr.«
»Um vier Uhr?«
Sie lachte ein wenig und wurde rot.
»Furchtbar! Was tun sie dir an!« Er sank in den Sitz zurück, besann sich, stand wieder auf und nahm seine Tasche aus dem Netz. »Habt ihr die Aufsätze der Deutschen schon gelesen?« Er öffnete den Verschluss der Tasche und holte ein Bündel Fotokopien heraus.
»Ich schon«, sagte Rie.
»Ja, ich auch«, sagte Frits.
»Lien?«, fragte Maarten und beugte sich vor.
»Noch nicht alle.«
»Vielleicht können wir sie mal durchgehen?« Er musste etwas lauter sprechen, um das Rattern des Zuges zu übertönen.
Frits, Rie und Lien holten ihre Fotokopien hervor, Ad sah zu.
»Wie findest du sie?«, fragte Maarten und wandte sich Frits zu. »So im Allgemeinen?«
»Ich finde sie eigentlich unheimlich gut.«
»Sie wissen dort wenigstens, was arbeiten heißt«, sagte Rie abschätzig.
»Hast du sie gelesen?«, fragte Maarten Ad.
»Ich werde mal zuhören«, wich Ad aus.
»Findest du sie denn nicht gut?«, fragte Frits.
»Ich finde sie schon gut«, sagte Maarten. »Sehr gut natürlich, aber ich finde auch, dass sie sich zu einseitig auf den Einfluss der Wirtschaftskonjunktur richten. Das ist Güntermann. Was Güntermann vor allem interessiert, ist die Wellenbewegung in der Erwerbung und Verbreitung neuer Gegenstände. Ich halte das nicht für unser oberstes Ziel.«
»Was ist denn unser Ziel?«, fragte Rie.
»Herauszufinden, welche Gegenstände Menschen benutzen, um sich als Gruppe von anderen Gruppen zu unterscheiden. Der frühere Volkscharakter. Ich glaube, dass ich dazu etwas sagen werde.«
»Das ist doch alles kalter Kaffee!«, sagte Rie.
Maarten lächelte, um seinen Ärger zu verbergen. »Den mag ich. Heutzutage nennen sie das übrigens ›Mentalitätsgeschichte‹.«
»Ich finde es schon interessant, dass sie den Computer benutzen«, sagte Frits. »Das müssten wir eigentlich auch machen.«
»Ich glaube nicht an den Computer«, sagte Maarten entschieden.
»Sicher, weil er modern ist«, sagte Rie.
Ad grinste.
»Das in erster Linie«, sagte Maarten ironisch.
»Er scheint mir schon sehr praktisch zu sein«, sagte Frits.
»Er engt ein«, sagte Maarten kategorisch. »Man wird gezwungen, sich auf eine Ordnung der Fakten festzulegen, bevor man irgendetwas weiß, während ich erst hinterher ordnen kann, nachdem ich meine Daten endlos hin und her geschoben habe.«
»Dann änderst du einfach dein Programm«, sagte Frits.
»Dazu bin ich zu faul.« Er sah Rie an. »Das muss dich doch ansprechen.« Er lachte gemein.
»Ich sage doch nicht, dass ich für den Computer bin«, sagte sie gleichgültig.
In Rheine warteten sie an dem zugigen Bahnsteig auf den Nahverkehrszug nach Münster. Es war inzwischen hell geworden, ein trübes, trostloses Licht, das tief über der Stadt hing, als ginge das Morgengrauen direkt in die Abenddämmerung über. Der Zug nach Münster bestand aus fünf schmutzig-roten, altmodischen Waggons, die während des Fahrens so viel Krach machten, dass ein Gespräch unmöglich war. Die Landschaft, durch die sie fuhren, war wellig: schwarze, umgepflügte Äcker, verregnete, fahle Weiden, ein vereinzeltes Dorf, ein paar kleine Fabriken. Die Leute, die an den Haltestellen einstiegen, waren unförmig und schlecht gekleidet: Männer mit Schirmmützen, Frauen mit Männerhüten. Die meisten stiegen zusammen mit ihnen in Münster aus, gingen eine schmale Betontreppe hinunter in eine farblose, unterirdische Passage, die sich zum Ausgang hin zu einem hallenden Raum weitete, in den durch hohe, schmutzige Fenster ein wenig Tageslicht drang. Lien blieb zurück. Maarten wartete auf sie am Anfang des Fußgängertunnels unter dem Bahnhofsvorplatz, während die anderen weitergingen. Sie kam ganz langsam aus dem dunklen Gang zum Vorschein und sah in die Läden. »Wolltest du etwas kaufen?«, fragte er, als sie ihn erreicht hatte.
»Ich wollte Geld wechseln«, sagte sie beklommen.
»Du brauchst doch kein Geld?«
Sie zögerte. »Nein, aber ich muss zur Toilette.«
»Ich habe Geld.« Er gab ihr sein Portemonnaie. »Ich warte dann mal.«
Sie wandte sich ab und lief wieder zurück. Während er auf sie wartete, beobachtete er die herein- und herausströmenden Menschen um sich herum. Lien kam träge aus dem Gang, als würde sie schlafwandeln. Als sie ihm das Portemonnaie zurückgab, lächelte sie entschuldigend. »Dir graust davor, oder?«, fragte er.
»Ein bisschen.«
Er sah auf seine Armbanduhr. »In sechs Stunden ist es vorbei.«
Die drei anderen standen oben an der Tunneltreppe, an der Ecke einer Einkaufsstraße, und warteten. »Wohin müssen wir jetzt?«, fragte Frits.
»Dahin!«, sagte Maarten und zeigte in Richtung der Stadt.
Sie passierten eine breite Promenade mit Bäumen, wo früher der Stadtwall gewesen war, und kamen in eine trostlose Einkaufsstraße. Aus Lautsprechern ertönte »Stille Nacht, heilige Nacht«. Ein Weihnachtsmann verteilte Prospekte. Die Schaufenster waren mit Weihnachtskugeln und kleinen Weihnachtsbäumen aus Pappe verziert.
»Zuerst möchte ich unsere niederländischen Gäste herzlich willkommen heißen«, sagte Güntermann. Sie saßen zu zwölft an einem Tisch in der Bibliothek seines Instituts bei Kaffee und Kuchen. »Wir freuen uns sehr über Ihre Anwesenheit und hoffen, dass dieses Treffen der Anfang einer engeren grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sein wird.« Er sah Maarten an, der neben ihm saß.
»Wir auch«, sagte Maarten.
»Vielleicht darf ich für heute folgendes Programm vorschlagen«, fuhr Güntermann fort. »Ich hatte mir gedacht, dass zunächst unsere niederländischen Gäste kurz über ihre Untersuchungen berichten. Anschließend haben wir Gelegenheit, Fragen zu stellen. Alles in allem wird das eine Stunde in Anspruch nehmen. Für das Mittagessen haben wir Plätze in einem italienischen Restaurant ganz in der Nähe reserviert, in der Hoffnung, dass Ihnen das gefällt. Anschließend, so gegen halb drei, werden wir unsererseits über unsere Untersuchungen berichten und eventuelle Fragen Ihrerseits beantworten, danach haben wir dann noch eine gute Stunde für eine grundsätzlichere Diskussion über weitere Ziele und eine mögliche Zusammenarbeit. Ist Ihnen das recht?« Er sah erneut Maarten an.
»Sehr«, versicherte Maarten.
»Dann möchte ich Sie bitten, jetzt das Wort zu ergreifen«, sagte Güntermann höflich.
»Gerne«, sagte Maarten. »Zuerst möchte ich Ihnen danken für Ihre freundlichen Worte. Wir freuen uns ebenso sehr auf diese Auseinandersetzung, wobei wir uns bewusst sind, dass sie für uns ungleich wichtiger sein wird als für Sie, und sei es nur, weil Sie mit Ihren Schülern auf dem Weg, den wir soeben eingeschlagen haben, schon weiter vorangeschritten sind. Ich schlage dann vor, dass zuerst Herr Bloembergen, Frau Veld und Frau Kiepe etwas über ihre Untersuchungen aufgrund von Nachlassinventaren berichten. Herr Muller wird dann etwas sagen über die Geschichte des Weihnachtsbaums in den Niederlanden, besonders über die Quellen, die er dazu benutzt hat, und zum Schluss werde ich selbst eine Übersicht über die anderen Untersuchungen an unserem Institut geben, damit Sie eine Gesamtübersicht haben. Genügt das?« Er sah Güntermann an.
»Bitte«, sagte Güntermann.
Maarten sah Frits an. »Frits?«, fragte er, nun wieder auf Niederländisch. »Fängst du an?«
Als sie am späten Nachmittag das Gebäude der Universität verließen, war es dunkel. Ein leichter Regen fiel, der in nassen Schnee überging. Leicht betäubt betraten sie den großen Platz, ziellos. In der Dunkelheit, außerhalb des Lichts der Straßenlaternen, blieben sie stehen. Vor ihnen lag die dunkle Masse des Doms. Nur wenige Menschen gingen über den Platz. Es war auffallend still.
»Unternehmen wir noch etwas?«, fragte Frits.
»Können wir uns nicht noch den Dom ansehen?«, fragte Lien.
Maarten sah auf seine Armbanduhr. »Das geht noch.«
Im Dom brannten Kerzen. Der kahle Raum war schummerig beleuchtet. Im Chor saßen Leute in ihren Mänteln und sangen Weihnachtslieder. Sie gingen langsam hinter dem Altar entlang, blieben eine Weile beim Uhrwerk stehen, bis es fünf Uhr schlug und die Herolde herauskamen, liefen zwischen den umherschlendernden Besuchern weiter und kamen auf der anderen Seite des Altars wieder zurück ins Schiff. Maarten setzte sich in eine Bank und lauschte den Weihnachtsliedern. Ad setzte sich neben ihn. »Das lief ganz gut, oder?«, fragte Maarten.
»Besser, als ich es erwartet hatte«, bestätigte Ad.
»Und alle drei!«
»Ja.«
»Auch wenn Rie immer wieder merken lassen muss, dass sie das alles für Unsinn hält.«
»Das findest du doch auch?« Es lag eine leichte Bosheit in seiner Stimme.
»Aber ich lasse es mir nicht anmerken.«
»Warum eigentlich nicht?«, fragte Ad neugierig.
»Das weiß ich nicht.« Er war ganz träge geworden. »Ich glaube, dass es eine Frage der Zivilisation ist. Man spuckt nicht in die Suppe eines anderen.«
»Aber so musst du mit ihnen mitheulen.«
»Ja«, gab Maarten zu. »Aber dafür werde ich ja auch bezahlt!«
Bevor sie zum Zug gingen, tranken sie im Ratskeller noch ein Glas Bier. Als sie durch die Tür mit grünen und braunen Bleiglasscheiben und dem schweren, braunen Vorhang in den dunklen Raum traten, sahen sie, dass es brechend voll war, doch in der Ecke wurde gerade ein Tisch frei. Der Krach der Leute um sie herum und an der Theke war so ohrenbetäubend, dass ein normales Gespräch nicht möglich war. Er hatte auch kein Bedürfnis danach. Etwas hingeflegelt, mit seinem Glas in der Hand, beobachtete er in sich gekehrt die trinkenden und lärmenden Deutschen an der Theke.
»Bist du mit dem Tag zufrieden?«, rief Frits.
Maarten sah ihn lächelnd an. »Sehr zufrieden«, schrie er zurück. Er sah Lien an. »Dein Vortrag war sehr gut.«
Sie wurde rot. »Der war überhaupt nicht gut.«
»Und deiner auch«, sagte er zu Rie.
»Da war doch auch nichts dabei«, sagte Rie gleichgültig.
Maarten hob sein Glas und machte eine Geste in die Runde. »Ihr wart alle drei verdammt gut. Nächstes Mal muss ich nicht mehr mitkommen!« Und er trank sein Bier mit einem schiefen Lächeln aus.
»Wir müssen uns jetzt aber verdammt beeilen«, sagte er und sah auf seine Armbanduhr, »sonst verpassen wir noch den Zug.« Er schritt kräftig aus. Rie und Frits gesellten sich zu ihm, Ad und Lien gingen hinterher. Es hatte inzwischen aufgehört zu regnen. Die Geschäfte waren noch geöffnet, auf der Straße herrschte Betrieb. Sie arbeiteten sich, beschallt von den Weihnachtsliedern aus den Lautsprechern, zwischen den Menschen hindurch, bogen links ab in Richtung Bahnhof, passierten die Promenade und überquerten die stark befahrene Ringstraße, über die sich eine ununterbrochene Reihe von Autos an ihnen vorbeischob.
»Ad und Lien sind verschwunden«, sagte Frits, als sie bereits ein Stück die Einkaufsstraße zum Bahnhof entlanggelaufen waren.
Maarten drehte sich um. Sie blieben stehen. Ad und Lien waren nirgends zu sehen.
»Die haben beschlossen, heute Nacht hierzubleiben«, sagte Rie boshaft.
»Verdammt«, sagte Maarten verärgert, die Bemerkung ignorierend. Er sah auf seine Armbanduhr. »So verpassen wir den Zug.«
»Soll ich schnell zurücklaufen?«, schlug Frits vor.
»Lauf du mal zurück«, sagte Maarten, »und frag, ob sie verrückt geworden sind.«
Sie sahen Frits nach, der rennend zwischen den Menschen verschwand.
»Wenn man mit Lien unterwegs ist, passiert immer so etwas«, sagte Rie. »Sie ist nie pünktlich.«
Er antwortete nicht darauf. Erneut sah er auf seine Armbanduhr und nahm sich zusammen.
»Du bist sicher so einer, der immer pünktlich ist«, vermutete Rie.
»Ja. Immer! Seit dem Kindergarten!«
»Ich auch.« Unerwartet kam ein wenig Wärme in ihre Stimme, als würde sie diese Gemeinsamkeit näher zusammenbringen.
»Noch drei Minuten«, stellte Maarten fest und sah auf seine Uhr. »Wenn sie jetzt nicht kommen, können wir es wohl vergessen.«
In dem Moment kamen sie zu dritt und in aller Seelenruhe um die Ecke. Maarten winkte ungeduldig. »Macht hin«, murmelte er. Sie beschleunigten ihre Schritte ein wenig. »Rennen!«, sagte er, als sie ihn erreicht hatten. »Wir haben noch drei Minuten!« Er wandte sich ab und lief vor ihnen her, durch den Tunnel und die Halle, sah nach links und nach rechts auf die Gleisangaben, raste, zwei Stufen gleichzeitig nehmend, die Treppe hinauf, wartete ungeduldig am abfahrbereiten Zug, bis sie hinter ihm hinaufkamen, stieg als Letzter ein, worauf die Tür hinter ihm zuschlug, die Pfeife ertönte und der Zug sich in Bewegung setzte. »Das ist gerade noch mal gutgegangen«, sagte er keuchend.
»Wir haben für uns alle eine Flasche Genever gekauft«, sagte Ad, als sie, immer noch schnaufend, fünf Plätze auf beiden Seiten des Ganges gefunden hatten. Er öffnete seine Tasche und gab Maarten und Frits jeweils eine Flasche.
»Mensch!«, sagte Maarten überrascht. Er betrachtete die Flasche. »Doornkaat! Verdammt lecker!«
»Ja, das hast du immer gesagt. Es war eine Idee von Lien.«
Lien hatte ihre Tasche ebenfalls aufgemacht. »Die ist für dich«, sagte sie verlegen zu Rie.
»Wie seid ihr an das Geld gekommen?«, fragte Maarten und sah von Lien zu Ad.
»Das habe ich bei einem von Güntermanns Studenten gewechselt«, sagte Lien.
Es rührte Maarten. Er saß mit der Flasche in der Hand da und sah sich das Etikett an, nicht recht wissend, wie er seine Dankbarkeit zeigen sollte. »Ich freue mich wahnsinnig darüber.« Er fragte sich, ob er ihnen nicht das Geld dafür geben sollte, doch er fand es unhöflich, das anzubieten.
Der Zug ratterte durch die Dunkelheit. Der Waggon war voller Menschen, die sich in den Fenstern noch einmal spiegelten. Der Mann neben Maarten, ein junger Deutscher, sank zur Seite, legte den Kopf auf Maartens Schulter und begann zu schnarchen. Maarten blickte genervt zur Seite und bemerkte, dass Rie lachend zusah. »Halt mal fest.« Er reichte ihr die Flasche und setzte den Mann wieder gerade hin. Der Mann blieb einen Moment dösig sitzen, mit seinem Kopf hin- und herschwankend, und sank dann erneut an seine Schulter.
»Er ist besoffen«, sagte Rie mit einer rauen Stimme. »Wenigstens einer, der heute normal ist.«
*
Unterwegs zu seinem Zimmer kam ihm auf halber Treppe Balk entgegen. Sie gingen schweigend aneinander vorbei. Zwei Stufen höher erinnerte er sich an seinen Brief ans Hauptbüro. Er drehte sich um. »Hast du schon eine Antwort auf den Brief bekommen?«
Balk blieb stehen. Sein Gesicht verzog sich, als würde er etwas äußerst Unangenehmes hören. »Welchen Brief?«, fragte er verärgert, während er die Hand hinter sein Ohr legte.
»Den Brief ans Hauptbüro«, wiederholte Maarten, etwas lauter und deutlicher artikulierend.
»Ich weiß von keinem Brief.«
»Der Brief wegen der Anstellung von Matser!«
»Oh, den! Der ist verschickt!«
»Aber hast du darauf schon eine Antwort bekommen?«
Balk schüttelte verärgert den Kopf. »Warum sollte ich darauf eine Antwort bekommen haben?«
»Weil sie Einwände gegen seine Einstellung hatten!«
»Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Davon weiß ich nichts mehr! Ich habe jetzt andere Dinge im Kopf!« Er wandte sich ab und ging weiter.
Verblüfft stieg Maarten weiter hinauf zu seinem Zimmer. Er suchte auf seinem Schreibtisch die Unterlagen für die Sitzung zusammen, brachte sie zum Sitzungstisch, stellte seinen Stuhl ans Kopfende, setzte sich und wartete auf seine Abteilung. Gert kam herein. »Gestern in der Bibliothek habe ich Blazer gesehen«, sagte er und nahm rechts neben Maarten Platz. »Er sagt, dass ich an allem schuld bin.« Sein Gesicht hatte einen etwas verwunderten Ausdruck.
»Du?«, fragte Maarten.
Frits und Tjitske kamen nun ebenfalls herein, sofort gefolgt von Ad und Sien.
»Wegen meiner Kritik an seinem Buch«, sagte Gert unglücklich. »Wenn ich diese Kritik nicht geschrieben hätte, würde er den Leserbrief so nicht geschrieben haben. Er sagt, dass er damit sein eigenes Glashaus eingeworfen hat.«
»Aber der Brief war doch gegen mich gerichtet?« Er sah seitlich zu Joop und Lien, die sich nun ebenfalls gesetzt hatten.
»Ja, aber du bist genial, sagt er«, er lachte ein wenig, »und ich bin nur ein kleines Licht.«
»Das ist natürlich wahr.« Er lachte gemein.
Gert lachte ebenfalls, aber nicht von Herzen.
»Ich würde ihn einfach links liegen lassen.« Maarten wandte sich ab und sah in die Runde. »Sind alle da?«
Es wurde still.
»Ja«, sagte Tjitske.
»Das Komische ist, dass ich immer das Gefühl habe, einer würde fehlen«, sagte er und sah sich um.
»Das wird wohl Bart sein«, sagte Joop.
»Ja, vielleicht ist es Bart«, sagte er langsam. »Oder ich bin es selbst.« Er sah auf die Papiere. »Ich wollte anfangen mit dem Ausschnittarchiv. Erinnern sich noch alle, was das ist?« Er sah mit einem sarkastischen Gesichtsausdruck in die Runde.
Niemand reagierte.
»Ich rufe noch einmal die Fakten in Erinnerung. Vor ein paar Jahren habe ich die Verantwortung dafür der Dokumentation übertragen. Damals waren das noch alle außer Bart, Ad und mir. Vor Kurzem habe ich entdeckt, dass Joop die Einzige ist, die daran noch etwas tut. Das geht natürlich nicht. Was machen wir da?«
Er sah die Reihe entlang.
Niemand sagte etwas.
»Niemand?«
»Können wir es nicht ein bisschen anders organisieren?«, schlug Lien schüchtern vor.
Er sah sie an. »Wie denn?«
»Vielleicht könnten wir die gegenseitige Kontrolle abschaffen?«
»Was auch beschlossen wird, ich mache nicht mehr mit!«, fiel Sien ihr aufgebracht ins Wort. »Ich habe genug davon, hier immer alles allein zu machen, während alle anderen sich zu schade dafür sind!«
Maarten sah sie überrascht an. Sie wandte den Kopf ab und sah mit verzerrtem Gesicht, auf dem sich ihre Emotionen spiegelten, starr auf den Tisch. »Aber deshalb entwickeln wir doch gerade eine andere Regelung?«, sagte er.
»Ich mache es nicht mehr!«, wiederholte sie. Sie war kreidebleich geworden und zitterte am ganzen Leib. »Ich glaube an keine einzige Regelung mehr!«
»Auch nicht, wenn du die Regelung selbst entwickeln darfst?«
Es war mucksmäuschenstill geworden.
»Ich habe mich dreimal bei dir beschwert!«, platzte sie los, ohne ihn anzusehen. »Und du kommst erst jetzt damit! Ich habe keine Lust, immer die Petze zu spielen. Ich mache es echt nicht mehr!«
Er schwieg. Während er sie ansah und sich fragte, was er nun tun sollte, wunderte es ihn, dass ihr Vorwurf ihn so wenig berührte, er hatte nicht einmal wie sonst das Bedürfnis, sich zu verteidigen. Gott sei Dank dauert das hier nur noch vier Jahre, ging es ihm durch den Kopf. Das amüsierte ihn. »Tja«, sagte er langsam, »wenn sogar Sien ihren Glauben an die Menschheit verloren hat …«
Gert hob die Hand. Maarten sah ihn an. »Es ist eigentlich auch meine Schuld, denn ich mache nichts mehr daran.«
»Warum nicht?« Er sah ihn prüfend an.
»Weil ich die Ausschnitte selbst nicht mehr brauche, jetzt, wo ich Archivforschung mache.«
»Und ob andere sie brauchen, interessiert dich nicht?« Es lag Ironie in seiner Stimme.
»Nein, eigentlich nicht – oder zumindest sehr wenig.« Er lachte nervös.
»Aber was nun?«, fragte Maarten und sah in die Runde.
»Dann müssen Tjitske und ich es machen«, sagte Joop. »Schließlich ist es unsere Arbeit.«
Maarten sah sie an. Ihre Unterstützung rührte ihn. In diesem Moment hatte er das Gefühl, dass sie die Einzige in dieser kleinen Truppe war, der er zu hundert Prozent vertrauen konnte. Er wandte sich Tjitske zu. »Tjitske?«
»Oh, ich will es wohl machen«, sagte Tjitske gleichgültig.
»Könntest du dann mit Joop eine Regelung entwickeln und sie mir bis Ende des Jahres vorlegen, damit sie zum 1. Januar in Kraft treten kann?«
»In Ordnung.«
Er sah Joop an.
»Das wird wohl nicht schwer sein«, sagte Joop fröhlich.
Er legte ein Durchschlagpapier auf seinen Schreibtisch, nahm sein Glas aus der Schreibtischschublade, stellte die Packung Buttermilch daneben, legte das Päckchen Butterbrote dazu und schenkte sich ein. »Ich fange heute Nachmittag mit dem Jahresbericht an«, sagte er zu Ad, der, vom Bücherregal verborgen, auf der anderen Seite des Zimmers saß.
»Du bist früh dran.«
»Ich will mich endlich wieder einmal an diesen Vortrag für die Historiker machen.«
»Kommst du damit eigentlich voran?«
»Kaum.«
Die Tür des Karteisystemraums ging auf. Lien und Frits kamen zu seinem Schreibtisch. Er sah sie an, während er an seinem Brot kaute.
Lien sah Frits an. »Fragst du?«
»Frag du mal«, sagte er.
Sie sah Maarten verlegen an. »Frits und ich wollten gern zwei Tage nach Gent.«
»Was wollt ihr da?«, fragte er misstrauisch.
»Da gibt es einen Vortrag über die Verwendung von Inventarverzeichnissen.«
»Und warum müsst ihr dann zwei Tage fahren?«
»Weil es abends ist, und da kommen wir nicht mehr zurück.«
Er sah verblüfft von einem zum andern. »Zwei Tage für einen Vortrag?«
Sie lachte verlegen.
»Es scheint ganz interessant zu sein«, verteidigte Frits den Plan.
»Habt ihr schon mal ausgerechnet, was das das Büro kosten würde?«, fragte Maarten empört. »Für einen Vortrag! Der außerdem auch noch veröffentlicht wird. Zumindest, wenn er die Mühe lohnt!«
»Ich könnte vielleicht noch bis Rotterdam zurückkommen«, bat sie.
»Ich denke gar nicht daran!«, sagte Maarten energisch. »Wir werden hier kein Tollhaus zulassen!«
»Na, dann geht es nicht«, sagte Frits phlegmatisch.
»Es war nur so eine Idee«, sagte Lien schuldbewusst.
»Aber schon eine merkwürdige Idee.«
Sie wandten sich ab, Frits zum Besucherraum, Lien ging zurück in den Karteisystemraum.
»Manchmal glaube ich, dass die Leute verrückt geworden sind«, sagte Maarten mürrisch.
»Es wird wohl etwas anderes dahinterstecken«, vermutete Ad maliziös.
In der Mittagspause ging er zum Markt. Ein starker Wind wehte, und es war unwirtlich. Er zitterte in seinem zu dünnen Mantel. Hinzu kam, dass er sich bereits seit ein paar Tagen krank fühlte, Schmerzen in der Brust, fiebrig, doch er hatte sich nicht die Zeit gegönnt, darauf zu achten. Ich fühle mich beschissen, dachte er missmutig. Auf dem Markt kaufte er drei Kilo Kartoffeln, ein Kilo Boskop und ein Kilo Zwiebeln und kehrte auf einem anderen Weg zurück. Als er an der Garderobe seinen Mantel auszog, kam Lien gerade aus dem Zimmer. Sie blieb stehen. »Du glaubst sicher, dass ich jetzt böse bin?«, fragte sie.
»Das fehlte noch«, sagte er mürrisch.
Mit dem Gefühl, von allen im Stich gelassen worden zu sein, setzte er sich an seinen Schreibtisch. Er suchte die Informationen für den Jahresbericht zusammen, brachte sie in die richtige Reihenfolge, drehte seinen Stuhl eine Vierteldrehung herum, spannte ein Blatt mit vier Durchschlägen in die Schreibmaschine, tippte oben: »Jahresbericht der Abteilung Volkskultur für 1982«, zog den Zeilenschalthebel zweimal durch und dachte über den Anfang nach. Aus dem Nichts kam die Erinnerung an den Tod von Ed Res. Er dachte an den Moment, als Rie sein Zimmer betreten hatte, und war plötzlich aufgewühlt. Einige Sekunden lang saß er regungslos an seiner Schreibmaschine, die beiden Zeigefinger über den Tasten, dann tippte er mit verbissenem Gesicht: »Zu unserer großen Bestürzung setzte Ed Res am 16. September seinem Leben ein Ende.«
*
Er stand mit Kopfschmerzen auf. Während er im Dunkeln zum Büro ging, versuchte er, sich zu erinnern, was er am Abend zuvor gemacht hatte, doch er fühlte sich zu elend, um sich lange damit zu beschäftigen. Ihn fröstelte, und er suchte sich in seinen Mantel verkriechend Schutz vor dem Wind, wobei er feststellte, dass der Schmerz in seiner Brust dadurch nicht besser wurde. Ohne sich umzusehen, folgte er dem bekannten Weg an der Gracht entlang, an den Seitenstraßen automatisch vor dem Verkehr innehaltend wie ein blindes Pferd. Er schob sein Namensschild ein und stieg langsam die Treppe hinauf, wobei er hin und wieder einen Moment stehen blieb, um Luft zu holen. Außer dass er Kopfschmerzen hatte, war ihm auch übel, und als er endlich an seinem Schreibtisch saß, war er erschöpft. Mitten auf dem Schreibtisch lag die erste Fassung des Aufsatzes von Frits, ein undeutlicher weißer Fleck im Halbdunkel. Er sah darauf, ohne die Schreibtischlampe anzumachen, lehnte sich in seinem Stuhl zurück und hielt seine Hand schützend vor die Augen. Als er jemanden die Treppe hinaufkommen hörte, riss er sich zusammen, knipste die Lampe an und beugte sich über die erste Seite. Joop betrat den Raum. Sie grüßte ihn und ging weiter zum Karteisystemraum. Träge schlug er die Seiten um und sah sich lange eine Grafik an, ohne sie zu begreifen. Lien und Ad kamen herein. Ad brachte ihm einen Brief und machte eine Bemerkung, worauf er etwas antwortete, hatte jedoch sowohl die Bemerkung als auch die Antwort sofort wieder vergessen. Er fragte sich, ob er Fieber hatte. Seine Haut war trocken, pergamentartig, ihm war schwindlig, und er fror. Als er unten Fotokopien gemacht hatte und wieder die Treppe zu seinem Zimmer hinaufstieg, spürte er außerdem einen stechenden Schmerz in seiner Brust und war außer Atem. Er ging in den Karteisystemraum. Sien stand an Joops Schreibtisch. Sie sah ihn prüfend an. »Du siehst schlecht aus«, stellte sie besorgt fest. »Willst du nicht nach Hause gehen?« Ihre Besorgnis rührte ihn. »Ich komme eigentlich, um ein Lakritz zu holen«, sagte er mit einem misslungenen Lächeln. Lien gab ihm ein Lakritz. »Du kannst gern die ganze Schachtel haben«, sagte sie. – »Nein, eins reicht.« Er ging wieder in sein Zimmer und blieb vor seinem Schreibtisch stehen. Beim Anblick der Arbeit, die dort lag und wartete, sank ihm der Mut. »Ich glaube, ich gehe nach Hause«, sagte er, noch bevor er über die Entscheidung hatte nachdenken können. »Ich bin krank.« Bart stand auf und sah ihn an. »Was hast du denn?«, fragte er beunruhigt. – »Ich glaube, dass ich die Grippe habe.« Er schlug die Mappe, mit der er beschäftigt gewesen war, zu, legte sie zurück auf den Stapel, zog die Hülle über seine Schreibmaschine und steckte Frits’ Aufsatz in seine Tasche zu seinem Brot. An der Tür blieb er stehen und drehte sich zu ihnen um, die Hand an der Türklinke. »Ihr seht ja, wenn ich wieder da bin.« Er versuchte zu lächeln, doch es gelang ihm nur mäßig.
»Alles Gute«, sagte Ad.
Bart war stehen geblieben. »Ich würde mich jetzt mal gut auskurieren«, sagte er fürsorglich.
»Darauf kannst du Gift nehmen«, scherzte er.
Ihm war übel, und er fühlte sich schwindlig, als er die Treppe hinunterstieg, die Hand am Geländer, um nicht zu stolpern. Er schob sein Namensschild aus und verließ ungesehen das Büro. Draußen war es kalt. Der Schmerz in seiner Brust war nun so stechend, dass er nur mühsam aufrecht gehen konnte. Während er aufpassen musste, nicht zu stolpern, ging er, ohne nach links und rechts zu sehen, nach Hause. Nicolien war im Schlafzimmer und staubsaugte, die Betten waren noch aufgeschlagen, das Fenster stand offen. Sie erschrak, als sie ihn eintreten sah. »Was machst du hier?«, fragte sie und stellte den Staubsauger aus.
»Ich bin krank.« Er fühlte sich albern.
»Krank?« Es klang, als könnte sie sich das nicht vorstellen. »Was hast du denn?«
»Ich fühle mich elend.« Er zog einen Stuhl zu sich heran und setzte sich erschöpft.
»Was heißt denn das: elend?«
»Alles!«, sagte er mühsam. »Kopfschmerzen, Übelkeit, Schmerzen in der Brust …« Dass er auch noch Fieber hatte, konnte er gerade noch für sich behalten.
»Und möchtest du jetzt ins Bett?«
»Ja.«
»Aber ich muss dein Bett noch machen.«
»Ja, geht das?«
»Natürlich geht das. Wenn du krank bist …« Sie zog die Decken und das Überschlaglaken seines Bettes auf den Boden, legte das Kissen daneben und zog das Bettlaken straff. »Was sie wohl im Büro gesagt haben?«
»Nichts.« Er fühlte sich zu elend, um über die Frage nachzudenken. »Sien hat gesagt, dass ich schlecht aussehen würde und nach Hause gehen soll.«
Sie drehte sich abrupt um. »Aber dafür hast du ihr doch sicher eins aufs Dach gegeben?«
»Ich fand es ganz nett«, sagte er ohne viel Kraft.
»Aber so etwas sagt man doch nicht?«
»Ach.«
»Das ist doch der Weg, jemandem einen Tritt zu versetzen?«
Er schüttelte den Kopf.
»Bist du etwa deswegen nach Hause gekommen? Weil Sien es gesagt hat?«
»Nein, natürlich nicht.«
»Jemandem zu sagen, dass er schlecht aussieht!«, sagte sie entrüstet, während sie das Oberlaken und die Decken wütend über das Bett zog. »Wie kommt jemand bloß auf so was?«
Er zog seine Schuhe aus, ohne eine Antwort darauf zu geben, und begann, sich auszuziehen.
»Müssen die Vorhänge etwa auch zu?«, fragte sie.
»Bitte.« Er ging ins Bad, holte das Thermometer aus dem Arzneischränkchen, schlug das Quecksilber herunter und schmierte es mit Vaseline ein.
Sie sah es, aber sie sagte nichts. »Brauchst du vielleicht sonst noch was?«, fragte sie, als er mit dem Thermometer in der Hand unter die Decke kroch.
»Einen Becher warme Milch, bitte.«
Während er auf der Seite lag, unter der Decke, hörte er sie in der Küche hantieren. Das gab ihm ein Gefühl der Sicherheit. Er sah auf seine Armbanduhr, die dicht vor ihm an Nicoliens Kissen lag, und wartete, bis die fünf Minuten um waren.
»Und?«, fragte sie, als sie ins Zimmer kam. »Hast du Fieber?«
»Neununddreißig vier«, antwortete er nicht ohne Genugtuung. Was auch immer sie über ihn sagen mochten, ein Wichtigtuer war er nicht. Zumindest nicht in diesem Fall.
»Soll ich dann nicht den Arzt rufen?«
An ihrer Stimme hörte er, dass sie erschrocken war, und das bereitete ihm, so erbärmlich ihm zumute war, heimliches Vergnügen. »Nein, keinen Arzt.«
»Warum nicht?«
»Weil es schon von selbst wieder weggeht.«
Sie zog den Hocker an sein Bett und stellte den Becher mit der Milch darauf. »Hier ist deine Milch. Werde dann mal schnell wieder gesund!«
Ihre Fürsorglichkeit rührte ihn so, dass ihm Tränen in die Augen stiegen. »Danke.« Danach sank er in einen Zustand halber Bewusstlosigkeit. Er träumte, dass alle Menschen zwischen dem Nieuwezijds Kolk und der Keizersgracht in einer dicken Flüssigkeit herumtrieben wie kleine, schwarze Puppen. Nicolien und er waren auch darunter. Ratlos versuchte er, die Position ihrer Betten zu bestimmen, damit er in dem offenen Raum seinen eigenen Platz darin abgrenzen könnte, worauf er schweißgebadet und nach Luft schnappend wach wurde. Es war dunkel. Aus dem Wohnzimmer kam gedämpfte Musik: eine Violinsonate von Mozart. Er lauschte kurz und sank dann erneut in den Schlaf.
*
Es klingelte. Er hörte Nicolien durch den Flur gehen und die Wohnungstür öffnen. Kurze Zeit später schlug in der Tiefe des Hauses die Haustür zu. Der Schlüssel wurde im Schloss gedreht. »Wenn Herr Koning mich rufen lässt, ist etwas nicht in Ordnung«, hörte er Bals sagen. Das verschaffte ihm Genugtuung. Er drehte sich auf die Seite und sah zur Wohnzimmertür. »Hier ist es«, sagte Nicolien. Die Tür ging auf. Sie knipste das Licht an. Vor ihr her trat Bals ins Zimmer. Er blieb vor Maartens Bett stehen und sah aufmerksam auf ihn herab. »So«, sagte er. »Wie geht’s?«
»Es könnte besser sein.«
»Erzählen Sie mal.«
»Ich bin letzte Woche Freitag krank geworden. Neununddreißig vier, Kopfschmerzen, Schmerzen in der Brust …« In seiner Hast, alle Informationen so rasch wie möglich loszuwerden, strauchelte er über seine Worte. »Das ist seither so geblieben.«
»Letzte Woche Freitag!« Sein Gesicht drückte Bedenken aus. »Und heute haben wir Donnerstag!«
»Ich dachte, dass es von selbst vorbeigehen würde.« Er fühlte sich schuldig.
Bals sah sich um, stellte seine Tasche auf den Tisch und holte ein Stethoskop heraus. »Ich würde Sie gern kurz abhören.«
»Möchten Sie einen Stuhl?«, fragte Nicolien.
»Nein, ich setze mich einfach aufs Bett.«
Maarten kam hoch. Seine Laken waren klamm vom Schweiß. Obwohl das Zimmer geheizt war, fror er, sobald er unter der Decke hervorkam. »Soll ich meine Pyjamajacke ausziehen?«, fragte er.
»Ziehen Sie sie einfach ein bisschen hoch – und mit dem Rücken zu mir.« Er wartete, bis Maarten sich von ihm weggedreht hatte und setzte ihm das Stethoskop auf den Rücken. »Atmen Sie einmal tief ein … Luft anhalten … und langsam wieder ausatmen …«, er setzte das Stethoskop an eine andere Stelle, »und tief einatmen …« Langsam arbeitete er Maartens Rücken ab, das Stethoskop immer an einer anderen Stelle. »Sie können sich wieder hinlegen«, sagte er schließlich. Er sah Nicolien an, sein Gesicht wirkte besorgt. »Kann ich hier irgendwo telefonieren? Denn ich möchte dazu gern Blom befragen.«
»Im Wohnzimmer«, sagte Nicolien.
»Haben Sie etwas gehört?«, fragte Maarten.
»Irgendetwas ist nicht in Ordnung.«
Nicolien ging mit ihm ins Wohnzimmer und kam wieder zurück. Er hörte ihn in der Ferne sprechen.
»Was könnte es denn sein?«, fragte Nicolien beunruhigt.
»Ich habe keine Ahnung.«
»Er ist auf dem Weg zum Universitätsklinikum, aber er wird angepiepst«, sagte Bals, als er wieder ins Zimmer kam. »Er wird wohl gleich zurückrufen.« Er setzte sich auf einen der Stühle am Tisch.
»Wie geht das denn?«, fragte Maarten neugierig.
»Dann ruft er von unterwegs aus einer Telefonzelle an«, antwortete Bals, als sei dies die normalste Sache der Welt. Im selben Moment klingelte das Telefon. »Da ist er.« Er stand auf und ging zurück ins Wohnzimmer. Sie lauschten seiner Stimme in der Ferne, ohne ihn verstehen zu können.
»Er hat sich noch an Sie erinnert«, sagte Bals, als er wieder ins Zimmer kam. »›Ist das nicht der Ethnologe?‹, hat er gefragt. Sind Sie Ethnologe?«
»Das bin ich auch«, er vermutete, dass er Blom erzählt hatte, dass er Ethnologe sei, »aber es ist bestimmt drei Jahre her, dass ich bei ihm war.«
Es schien Bals nicht zu wundern. »Können Sie morgen halb zehn?« Er sah Maarten musternd an.
»Ja, natürlich.« Er fand, dass das eine etwas merkwürdige Frage war.
»Aber haben Sie überhaupt ein Transportmittel? Denn Sie dürfen nicht Straßenbahn fahren.« Er erweckte den Eindruck, als überlege er, ihn selbst mit dem Auto zu bringen.
»Und mit einem Taxi?«
»Das geht.« Offenbar hatte er an diese Möglichkeit nicht gedacht. Maarten fand das sympatisch. Er holte einen Schreibblock aus seiner Tasche. »Dann werde ich schon mal ein Rezept ausstellen, damit müssen Sie heute sofort anfangen.« Er griff zu seinem Stift. »Das ist für Herrn …«
»M. Koning.«
»Richtig!« Er schrieb es auf. »Ich hatte es einen Moment vergessen.«
»Was ist das für ein Mittel?«, fragte Maarten, während Bals dasaß und schrieb.
»Das ist ein Antibiotikum. Sie bekommen eine Zehn-Tage-Kur. Die müssen Sie einhalten. Also nicht unterbrechen!« Er gab Nicolien das Rezept und stand auf. »Alles Gute«, sagte er herzlich und streckte die Hand aus. Er sah Maarten freundlich an.
Nicolien brachte ihn nach draußen. »Was hast du nun eigentlich?«, fragte sie, als sie zurückkam.
»Ich habe keine Ahnung.«
»Aber hättest du das nicht fragen können?«
»Das finde ich komisch«, sagte er verlegen. »Das müsste so ein Arzt doch eigentlich von selbst sagen?«
»Ja, aber wenn du nicht danach fragst«, sagte sie verstimmt. »Danach musst du natürlich fragen!«
»Das ist mir peinlich«, verteidigte er sich.
*
»Sie haben eine ordentliche Entzündung im linken Lungenflügel«, sagte Blom – er war ein noch junger, schnell sprechender, effizienter Mann. »Und eine Pleuritis, was man im Volksmund eine nasse Pleuritis nennt. Ich kann Ihnen das mal eben zeigen.« Er drückte auf einen Knopf. Auf einem Bildschirm an der Wand, neben seinem Arbeitstisch, wurde die Röntgenaufnahme von Maartens Brustkorb sichtbar. »Sehen Sie!« Er zeigte mit seinem Stift auf einen schwarzen Schatten über der linken Lungenspitze. »Sie können es deutlich sehen.«
Maarten und Nicolien beugten sich ein wenig vor. »Und die Pleuritis?«, fragte Maarten interessiert. Der Ansatz des Mannes, sich seinen Körper anzusehen wie eine Maschine, gefiel ihm.
»Das ist für Sie weniger deutlich. Man erkennt es daran, dass das Bild hier ein bisschen verschleiert ist«, er wischte mit dem Stift über die Aufnahme, »aber ich kann es auch hören. Ich könnte vielleicht auch noch ein bisschen Flüssigkeit abzapfen.« Er sah Maarten interessiert an, durch das Gespräch auf eine Idee gebracht. »Das mache ich!« Er stand auf. »Sie bekommen eine Spritze in den Rücken. Davon merken Sie nicht viel.« Er holte eine ziemlich große Spritze aus der Schublade eines Schränkchens neben seinem Arbeitstisch. »Wenn Sie kurz Ihren Oberkörper frei machen …« Er wartete mit der Spritze in der Hand, bis Maarten sein Hemd und Unterhemd ausgezogen hatte. »Und stellen Sie sich etwas vornübergebeugt hin, den Rücken krumm, so, prima, kurz stillhalten …« – Maarten spürte einen kräftigen Stich in seinem Rücken – »Noch einen Moment …« – die Spritze wurde zurückgezogen. »Warten Sie noch einen Moment.« Er reinigte die Wunde, legte einen Wattebausch darauf und hielt die Spritze zufrieden gegen das Licht. »Sehr schön!«
Maarten sah zu, während er sein Unterhemd und das Hemd wieder anzog. Im Glaskolben der Spritze befand sich ungefähr ein Deziliter einer durchsichtigen Flüssigkeit.
»Wir werden mal schauen, ob noch was drin ist«, sagte Blom. »Seit wann nehmen Sie das Antibiotikum?«
»Seit gestern Nachmittag.«
»Dann könnte es durchaus sein, dass das Ganze schon tot ist, aber das sehen wir ja.« Er legte die Spritze zur Seite und setzte sich wieder an seinen Arbeitstisch. »Normalerweise würde ich Sie aufnehmen lassen«, er sah von Maarten zu Nicolien, »aber wenn ich Ihre Frau sehe, glaube ich, dass Sie eigentlich auch zu Hause bleiben können, falls sie davor nicht zurückschreckt.«
»Ach was«, sagte Nicolien. Sie lachte verlegen. »Ich finde das ganz schön.«
»Dann machen wir das«, entschied Blom. »Und ich sehe Sie hier in drei Wochen wieder.« Er schlug seinen Terminkalender auf. »Auch wieder morgens halb zehn?« Er sah ihn fragend an.
Maarten nickte. »Haben Sie irgendeine Idee, wie lange es dauert?«
»Sie müssen das wie eine mittelschwere Operation betrachten«, sagte Blom sachlich. »Rechnen Sie also mal mit mindestens sechs Wochen, bis Sie wieder arbeiten können, und danach werden Sie sich bestimmt noch ein paar Monate schonen müssen.«
*