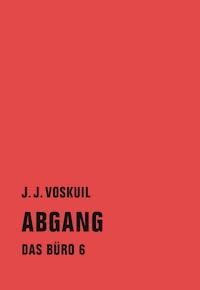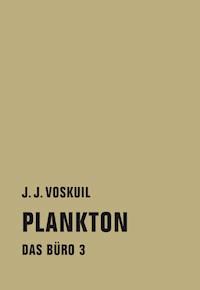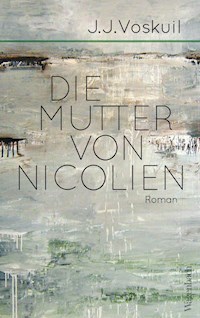Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verbrecher Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Das Büro
- Sprache: Deutsch
Wie ein langer, ruhiger Fluss plätschern im Amsterdamer Büro für Volkskunde die Jahre 1965-1972 dahin: die Zeit der Studentenrevolte und des revolutionären Aufbruchs. Doch davon ist im Büro selbst nicht viel zu spüren. Nicht einmal ein Umzug bringt merkliche Veränderungen - nachdem die unvermeidlichen Raumverteilungskämpfe erst einmal ausgefochten sind. Man werkelt weiterhin still vor sich hin - oder tut lieber gleich gar nichts. Der frühere Direktor Beerta kommt auch nach seiner Pensionierung noch täglich zur Arbeit, um sich der Wissenschaft zu widmen, was in seinem Falle vor allem bedeutet: Briefe zu schreiben und sich bei Konflikten auf die Seite des voraussichtlichen Siegers zu schlagen. Maarten und Nicolien Koning beziehen eine hochherrschaftliche Mietwohnung an der Herengracht und schämen sich für ihren neuen Luxus. Das Büro wächst derweil - und die Probleme wachsen mit, etwa in Gestalt der beiden neuen "wissenschaftlichen Beamten" Ad Muller und Bart Asjes: ewig "krank" der eine, ein Quertreiber der andere, personelle Totalausfälle beide. Und auch mit dem Großprojekt des "Europäischen Atlas" läuft es gar nicht gut "Das Büro" ("Het Bureau") war in den Niederlanden mit über 400.000 verkauften Exemplaren ein Riesenerfolg. Auch hierzulande wurde Band 1 (erschienen im Verlag C.H. Beck) begeistert aufgenommen. Weitere Informationen unter das-büro-der-roman.de
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 906
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
J. J. Voskuil
Das Büro 2
Schmutzige Hände
Aus dem Niederländischen von Gerd Busse
Mit einem Nachwort von Pieter Steinz
1965
Er öffnete die Eingangstür. Dahinter war es dunkel. Im Flur und in der Hausmeisterloge brannte kein Licht. In diesem Moment klingelte das Telefon. Er schloss die Tür, eilte zum Verschlag, der vom Hinterhof durch das Licht aus der darüberliegenden Wohnung vage beleuchtet wurde, stellte die Tasche ab und nahm den Hörer ab. »Koning hier.«
»Ebenfalls einen schönen guten Morgen«, sagte der Telefonist des Hauptbüros. »Ich habe hier Frau Wigbold für Sie.«
»Vielen Dank.« Er wartete auf das Klicken. »Koning«, wiederholte er.
Es schellte an der Tür.
»Hia is’ Frau Wigbold«, sagte eine klagende Stimme in breitem Amsterdamer Platt am anderen Ende der Leitung. »Mein Mann is’ krank.«
Maarten langte zum Türöffner und drückte auf den Knopf. »Ach«, er sah um die Ecke, »was fehlt ihm denn?« Van Ieperen trat ein. Er zuckte mit den Achseln, als er Maarten sah, und blieb am Eingang zur Hausmeisterloge stehen.
»Furchtbare Kopfschmerzen.«
»Das hört sich nicht gut an.« Er nickte van Ieperen zu.
Van Ieperen spreizte die Finger. »Die Gassentür war nicht offen«, sagte er, seine Worte stark betonend und nahezu tonlos, als spräche er zu einem Tauben.
»Ja«, sagte sie.
Es schellte erneut an der Tür. Maarten drückte den Knopf, legte seine Hand auf den Hörer und sah van Ieperen an. »Wigbold ist krank. Würden Sie eben aufmachen?« Er sah nach, wer hereinkam. Schaafsma. Der grüßte ihn mit einem kurzen, verlegenen Nicken und ging kerzengerade hinter van Ieperen her in den dunklen Flur, als wäre der immer dunkel.
»Können Sie das ausrichten?«, fragte Frau Wigbold.
»Ich werde es ausrichten.« Er langte um den Türpfosten herum und schaltete das Licht im Flur an.
»Er wird morgen wohl wieder da sein, oder sonst Montag.«
»Gut.« Ihm war klar, dass Wigbold lieber keine Kontrolle wollte. »Wünschen Sie ihm gute Besserung.«
Die Eingangstür wurde mit einem Schlüssel geöffnet. Balk trat ein, eine karierte Mütze auf dem Kopf.
»Vielen Dank. Tschüss, Herr Koning.«
»Tschüss, Frau Wigbold.« Er legte den Hörer auf die Gabel.
Balk blieb in der Tür stehen. »Was ist los?«, fragte er verstimmt.
»Wigbold ist krank.«
»Was hat er?«
»Kopfschmerzen.«
»Kopfschmerzen!« – Er presste die Lippen zusammen. »Sag Bavelaar, wenn sie da ist, dass sie Hindriks anrufen soll, und wenn der nicht kann, soll sie sich bei mir melden. Um zehn Uhr kommt der erste Bewerber für die Stelle von de Gruiter.« Er wandte sich ab und ging.
Es schellte. Maarten drückte auf den Türöffner. Slofstra trat ein, Ohrenwärmer aufgesetzt, einen Wintermantel über dem Arm. »Tag, Herr Koning«, sagte er ohne das geringste Zeichen von Überraschung.
»Tag, Herr Slofstra«, sagte Maarten amüsiert. »Haben Sie zwei Mäntel dabei?«
»Der hier ist für Schaafsma. Das ist mein alter Mantel.«
»Aber Schaafsma hat doch einen Mantel.« Es schien ihm keine besonders gute Idee zu sein.
»Nein, nur so ein dünnes Jäckchen«, sagte Slofstra geringschätzig. »Das nützt ihm doch nichts, bei dieser Kälte!«
Während Slofstra in den Flur ging, zog Maarten seinen Mantel aus und legte ihn über einen Stuhl. Es war kalt in dem kleinen Raum. Er sah sich um, zog eine Schachtel Streichhölzer aus seiner Tasche und hockte sich vor den Ölofen. Es schellte. Er stand auf und drückte den Türöffner. Bosman kam herein. Er trug ebenfalls Ohrenwärmer und machte, obwohl er ein paar Jahre jünger war als Maarten, mit seiner hochgewachsenen, etwas gebeugten Gestalt einen früh verschlissenen Eindruck.
»Tag, Herr Bosman«, sagte Maarten.
»Eigentlich heiße ich Wim«, sagte Bosman mit einem Lachen.
Die Bemerkung überraschte Maarten. »Ich heiße Maarten«, sagte er ohne weiteres Nachdenken. Er wandte sich ab, hockte sich wieder vor den Ofen, zündete ein Streichholz an, öffnete den Ölhahn und steckte das Streichholz in das dafür vorgesehene Loch. Nichts geschah. Das Streichholz brannte bis zu seinen Fingern ab, sodass er es ausmachen musste.
»Kann ich dir vielleicht helfen?«, fragte Bosman beflissen. Er war in der Tür stehen geblieben und stellte sein Täschchen an den Pfosten, bereit, ihm zu Hilfe zu eilen.
»Nein, aber wenn du vielleicht bei dir die Öfen anmachen könntest?«
Es schellte. Bosman drückte den Türöffner. Maarten zündete ein neues Streichholz an. »Tag, Bart«, hörte er Bosman sagen.
»Hey. Tag, Wim«, sagte Bart.
»Ich werde mal einen Gang durchs Gebäude machen«, sagte Bosman zu Maarten. Er nahm sein Täschchen und ging.
Maarten steckte das brennende Streichholz in das Loch. Es gab einen kleinen dumpfen Knall, doch der Ofen brannte. »Gut«, sagte er zufrieden und stand auf.
»Warum musst ausgerechnet du das machen?«, fragte Bart besorgt. Er war in der Tür stehen geblieben. Sein rundes Gesicht mit der dicken Brille war von der Kälte tief rosafarben angelaufen.
Maarten lachte. »Ehrlich gesagt ist das der einzige Ort in diesem Büro, an dem ich mich zu Hause fühle.« Es klang falsch, eigentlich ärgerte er sich.
»Soll ich das nicht übernehmen?« Bart schenkte seiner Bemerkung keine Beachtung.
»Nein, wirklich nicht. Wenn du in deinem und meinem Zimmer schon mal die Öfen anmachen könntest?« Er setzte sich, um deutlich zu machen, dass es ihm ernst war, musste jedoch gleich wieder aufstehen, weil es schellte. Fräulein Bavelaar.
»Ist Wigbold denn schon wieder krank?«, fragte sie entrüstet. Mit einem Taschentuch wischte sie sich die Tränen, die ihr durch die Kälte in die Augen gestiegen waren, aus dem Gesicht. »Das ist jetzt schon das dritte Mal in diesem Monat.«
»Er hat Kopfschmerzen. Balk hat gefragt, ob Sie Hindriks anrufen können.«
»Gut, dass wir den wenigstens noch in der Hinterhand haben, nicht wahr?«
»Ja«, gab er zu. Es schellte. Er drückte den Türöffner. Der Postbote trat ein. »Die Post!«, rief er laut, während er auf sie zukam. Er händigte Maarten ein dickes Päckchen aus, drehte sich um und zog die Tür wieder hinter sich zu.
»Geben Sie nur her«, sagte Fräulein Bavelaar. Sie ging mit dem Päckchen unter dem Arm, ihr Täschchen am anderen Arm, auf den Flur.
Maarten setzte sich und sah auf seine Armbanduhr. Viertel vor neun. Er stand wieder auf, weil es erneut schellte, und blieb in der Tür stehen, während Frau Moederman langsam die Tür hinter sich schloss. »Tag, Herr Koning. Pfui, wie kalt es doch ist!«
»Ja, es ist kalt.« Es amüsierte ihn, dass sie seine Anwesenheit auf Wigbolds Platz ohne das geringste Zeichen von Verwunderung hinnahm.
»Und es ist erst November.« Sie wackelte leicht mit dem Kopf. »Da fragt man sich dann doch, was uns noch bevorsteht.«
»Sind Sie deshalb nicht mit dem Fahrrad gekommen?«
»Nein, mein Fahrrad ist kaputt. Ich habe einen Platten, und mein Mann hatte gestern keine Zeit mehr, den Reifen zu flicken.« Sie ging weiter.
Von hinten aus dem Flur kam Slofstra auf ihn zu, den Wintermantel für Schaafsma über dem Arm. Er und Frau Moederman grüßten einander im Vorbeigehen. Maarten wartete auf ihn. »Fräulein Bavelaar sagt, dass ich Sie ablösen soll«, sagte Slofstra.
»Will Schaafsma ihn nicht?«
»Er ist ihm zu klein! Er geht ihm nur bis hier!« Er zeigte auf seinen Arm und lachte kurz.
»Obwohl Sie doch beide Friesen sind.«
»Das sagt gar nichts.«
»Und was machen Sie jetzt damit? Sie werfen ihn doch nicht weg?«
»Er geht an die Heilsarmee. Die finden schon einen Abnehmer.« Er nickte, in sich gekehrt, wie um noch einmal deutlich zu machen, dass er davon überzeugt war.
*
»Sollen wir Frans besuchen?«, schlug er vor, als sie das Djokja verließen.
»Das wollte ich auch vorschlagen«, sagte sie.
Sie bogen im Dunkeln links ab, gleich darauf noch einmal links und gingen durch eine der hohen schmalen Straßen der Pijp. Es war still. Aus einem Café an der Ecke des Gerard Douplein drangen die Klänge einer Musikbox. Im Inneren befand sich nur ein einziger Mann, der vor einem Spielautomaten stand. Sie gingen am Sarphatipark vorbei, überquerten die Ceintuurbaan, spazierten unter den hohen Bäumen des Van der Helstplein dahin und bogen links in die Dujardinstraat ein.
Frans war zu Hause.
»Maarten und Nicolien«, rief Maarten ins Treppenhaus, als die Tür aufgesprungen war. Sie kraxelten die vier Treppen hoch. »Immá schteigén, immá schteigén«, murmelte er, als er hinter ihr auf der vierten Treppe ankam, »un dann sachstu: Jetzt hört’s auf.«
Frans kam aus dem Wohnzimmer, als sie seinen kleinen Flur betraten.
»Ha«, sagte er.
»Wir haben indonesisch gegessen, und da dachten wir, dass es vielleicht nett wäre, dir einen Besuch abzustatten«, sagte Nicolien.
»Ja«, sagte Frans.
Sein Zimmer lag, abgesehen von dem Lichtkegel unter der Lampe auf dem Schreibtisch und den Flammen hinter der runden Scheibe des Ölofens, im Dunkeln. Sie setzten sich. Auf einem Hocker neben dem Sessel von Frans lag ein Schachbrett mit einer unterbrochenen Partie.
»Dann habt ihr sicher schon Kaffee gehabt?«, fragte Frans.
»Ich würde gern noch eine Tasse trinken«, sagte Nicolien. »Und du?«
»Ich auch«, sagte Maarten.
»Dann werde ich ihn mal aufsetzen.« Er verließ das Zimmer. Sie hörten ihn in der Küche reden. Hinter den Vorhängen raschelte Papier. Maarten stand auf. Er zog den Vorhang etwas zur Seite und betrachtete das weiße Schrankpapier, mit dem Frans seine Fenster verblendet hatte. Aus den Bewegungen des Papiers schloss er, dass das kleine Fenster rechts oben offen stand. Die Geräusche von draußen drangen ins Zimmer. Nur hören, aber nicht sehen. Das gab ihm das Gefühl, eingeschlossen zu sein.
»Ich will ja nichts sagen«, sagte er, als Frans wieder den Raum betrat, und setzte sich wieder hin, »aber wenn du Gardinen nehmen würdest, könnte man dich nicht sehen, aber du selbst könntest etwas sehen.«
»Aber ich will auch nichts sehen.« Er stellte drei Untertassen hin.
»Merkwürdig. Und wenn man dann bedenkt, dass es auch noch Menschen gibt, die nichts sehen wollen, aber wohl gesehen werden möchten.«
»Das sind die Normalen. Bestimmt sind das fünfzig Prozent.«
»Fünfzig Prozent ist nicht normal.«
»Doch, in dem Fall schon, denn man hat Leute, die sehen und gesehen werden wollen, Leute, die sehen, aber nicht gesehen werden wollen, und Leute, die … und so weiter, also vier Gruppen. Wenn also eine dieser Gruppen fünfzig Prozent ausmacht, dann ist das normal.« Er sah Nicolien an.
»Neunzig Prozent ist normal«, beharrte Maarten, »oder notfalls achtzig, aber nicht weniger.«
»Nein, da bin ich anderer Meinung.«
»Und wenn zwei der vier Gruppen aus nicht mehr als einem halben Prozent bestehen? Das scheint mir nicht einmal so unwahrscheinlich.«
»Gut, lass uns daraus keine große Sache machen.«
»Nein, weil du sie verlierst«, sagte Maarten zufrieden.
Frans ging in die Küche. Maarten betrachtete die Stellung der Figuren auf dem Schachbrett. »Wer von euch beiden gewinnt?«, fragte er, als Frans das Zimmer mit zwei Tassen betrat.
»Ich glaube Weiß.«
»Danke«, sagte Nicolien.
Frans verließ den Raum wieder und kam mit der dritten Tasse zurück. »Neulich hat Schwarz ein paarmal gewonnen, und das hat mich ziemlich beunruhigt. Das darf natürlich nicht sein.«
»Ich glaube, dass ich michgerademit Schwarz identifizieren würde«, überlegte Maarten. »Weiß ist mir zu rein.«
»Vielleicht ist das ja typisch für mich«, sagte Frans. »Ich möchte gerne rein sein.« Er sah rasch zu Nicolien hinüber.
»Aber du bist es nicht«, stellte Maarten fest.
Frans lachte. »Nein.«
Sie schwiegen und tranken ihren Kaffee.
»Der Kaffee ist lecker«, fand Nicolien.
»Ja, nicht wahr?«, sagte Frans. »Den habe ich bei Wijs geholt.«
Sie schwiegen erneut.
»Beerta hat seinen Abschied genommen«, erzählte Maarten.
»Oh«, sagte Frans. »Ja, das passiert natürlich auch.« Er machte nicht den Eindruck, als würde es ihn besonders interessieren. »Seit dem letzten Mal habe ich nichts mehr von ihm gehört.« Er sah Maarten an. »Das finde ich eigentlich nicht so nett.«
»Nach dem letzten Mal hört man nie etwas.«
Frans lächelte matt. »Ja, aber so meine ich es nicht.«
Sie schwiegen. Frans stand auf. Er machte eine zweite und dritte Lampe an. Das Licht der drei Lampen schien so weit unten auf den Boden, dass sie mit ihren Köpfen im Halbdunkel saßen.
»So ist es besser«, bemerkte Maarten.
»Oh ja«, erinnerte sich Frans, »ich habe einen Hausgenossen, mit dem müsst ihr noch Bekanntschaft machen.« Er stand auf.
»Über Beerta gesprochen«, sagte Maarten.
Frans schmunzelte. »Ja, daran habe ich natürlich auch gedacht.« Er verließ das Zimmer und kam mit einem großen Marmeladenglas zurück, in dem sich ein paar Blätter befanden. »Sieh doch mal«, sagte er zu Nicolien.
Nicolien hielt den Behälter gegen die Lampe. »Eine Schnecke«, sagte sie überrascht. Sie reichte Maarten das Glas. Zwischen den grünen Blättern saß eine braune Schnecke mit Schneckenhaus.
»Woher hast du sie?«, fragte Maarten.
»Aus den Waterleidingduinen.«
»Aber ob ihr das gefällt?«, fragte Nicolien.
»Glaubst du nicht?« Frans sah sie unsicher an.
»In so einem kleinen Glas?«
»Aber sie darf auch schon mal raus.«
Sie sah ihn skeptisch an.
»Nicolien mag Schnecken sehr«, sagte Maarten.
»Nicht nur Schnecken!«, protestierte sie.
»Alle Tiere«, verbesserte Maarten, »aber vor allem Schnecken. Wenn wir spazieren gehen oder Fahrrad fahren, holt sie immer alle Schnecken von der Straße.«
»Das machst du genauso.«
»Ja, ich mache das auch«, sagte Frans.
»Aber wenn es sehr viele sind, wird es mir manchmal zu viel«, sagte Maarten. »Neulich hatte es gerade geregnet, da saßen sie zu Hunderten auf der Straße, auch Schnecken ohne Häuser, von denen die Finger hinterher so kleben, dann denke ich an die Millionen, die überall auf den Straßen liegen, und an die, die hinter einem einfach wieder auf die Straße zurückkriechen, und dass wir noch fünfundzwanzig Kilometer vor uns haben, aber Nicolien denkt nicht so.«
»Du auch nicht«, sagte sie entschieden.
»Ich lasse es mir nicht anmerken, aber im Stillen denke ich: Rutscht mir doch den Buckel runter.«
»Das wird wohl die Kultur sein«, meinte Frans.
»Ach was. Das ist reiner Eigennutz. Das Aufsammeln von Schnecken ist Kultur.«
»Ich dachte, dass das nun gerade ein primitiver Trieb und seine Beherrschung Kultur ist.« Er sah rasch zu Nicolien.
»Aber du glaubst doch wohl nicht, dass es auch nur einen primitiven Blödmann gibt, der Schnecken aufsammelt? Primitiv ist es doch gerade, wenn man sie tottritt.«
»Das denke ich eigentlich nicht«, sagte Frans vorsichtig. »Ich habe mal gehört, dass echte Primitive nicht mehr Tiere töten, als sie zum Leben brauchen.« Er sah erneut zu Nicolien hinüber.
»Ja, weil ihre Religion es ihnen verbietet!«, sagte Maarten entschieden. »Aber wenn sie eine Schnecke sehen, treten sie sie tot, wenn sie nicht gerade was Besseres zu tun haben.«
»Vielleicht ist die Trennung zwischen Natur und Kultur doch nicht so scharf«, sagte Frans versöhnlich.
»Es ist anders«, sagte Maarten. »Bei Nicolien ist es der Widerstand gegen die Gesellschaft, die Autos und die Autofahrer. Nicolien identifiziert sich mit den Schnecken. Bei mir ist das weniger ausgeprägt.«
»Jeder Trieb ist Natur«, sagte Frans, »und Kultur ist, wenn man damit aufhört, weil man sonst stirbt.«
»Dann haben Pflanzen und Tiere auch Kultur«, wandte Maarten ein.
»Ja, vielleicht ist das auch so. Warum nicht?«
»Geschwätz!«
Sie schwiegen, beide reichlich verstimmt. Frans sah musternd zu Nicolien hinüber, die einen Zigarillo rauchte und vor sich auf den Boden sah, eine Augenbraue etwas hochgezogen. In der Stille hörte man das Ticken der Pendeluhr, die Frans aus dem Hausrat seiner Großmutter erhalten hatte, als diese in ein Pflegeheim musste, ein langsames Ticken.
»Wie geht es deiner Großmutter jetzt?«, fragte Maarten.
»Ganz gut, aber sie erkennt nur noch meinen Vater und streitet immer, weil sie ihn verdächtigt, dass er mit den Pflegerinnen in die Kiste steigt.«
»Dafür wird sie dann wohl ihre Gründe haben.«
»Das denke ich auch immer. Selbst in den schlimmsten Phantasien muss doch ein Körnchen Wahrheit stecken.«
»Oder sie ist unmenschlich eifersüchtig«, überlegte Maarten. »Das kann natürlich sein. Sie kann auch deine Mutter nicht leiden.«
»Habe ich das erzählt?«, fragte Frans erstaunt.
»Vor einiger Zeit.« Er sah zu Nicolien. »Erinnerst du dich nicht daran?«
»Nein, daran erinnere ich mich nicht«, sagte sie.
»Ich glaube, dass ich mich an so etwas auch nicht erinnern würde«, sagte Frans.
»An die Beziehungen zwischen Menschen erinnere ich mich immer in allen Einzelheiten, mehr als an die Menschen selbst. Wie das kommt, weiß ich nicht.«
»Nein«, sagte Frans. »Ich erinnere mich gerade an die Leute selbst, ob sie breite Finger haben und wie sie ihren Fuß bewegen. Jemand auf der Arbeit beispielsweise, der bewegt seinen Fußso,wenn er Schach spielt.« Er bewegte seinen Fuß unter dem Licht der Lampe auf und ab. Alle drei sahen sie zu. Er trug große, braune Clogs.
»Das mache ich auch«, sagte Maarten.
»Nein, du machst das anders«, sagte Nicolien.
»Schau!« Er bewegte seinen Fuß hin und her.
»Nein«, sagte Frans, »jetzt bewegst du deinen Fuß hin und her, ich meineso!« Er bewegte ihn auf und ab.
Maarten versuchte es ebenfalls, doch es gelang ihm nicht. »Ich kann es nicht«, stellte er fest, »oder fast nicht.«
Frans versuchte, seinen Fuß hin und her zu bewegen. »Und ich kann ihn nicht hin und her bewegen.«
»Komisch«, fand Maarten, »Hin und her ist kein Problem. Schau!« Er bewegte den Fuß schnell hin und her, so schnell, dass es fast ein Viertel-Fußkreis wurde.
Die beiden anderen beobachteten es aufmerksam. Sie lachten, als Maarten aufhörte.
»Die Frage ist natürlich, was das über unsere Charaktere aussagt«, sagte Maarten.
»Wollt ihr noch eine Tasse Kaffee?«, fragte Frans. Er stand auf und ging in die Küche.
Maarten legte seine Arme auf die Lehnen seines Sessels und sah sich im Halbdunkel des Zimmers um. An der Decke neben dem Sessel, in dem Nicolien saß, hing ein Lederriemen. An einer Leine, die quer durch den Raum gespannt war, baumelte ein großer Ball aus Silberpapier oder Glas. In der Küche hörte er Frans leise reden. Er lachte Nicolien an. »Ha.«
»Ha«, sagte sie.
Er drehte den Kopf zur Seite. Anstelle des Plastiksoldaten befanden sich auf dem Kaminsims nun vier Pferde und zwei Schafe sowie ein Häufchen Muscheln. Daneben stand ein Foto mit zwei kleinen Kindern am Strand. Der alte französische Bauer, den sie ihm aus Frankreich geschickt hatten, war verschwunden.
»Ich habe auch wieder Probleme auf der Arbeit«, sagte Frans, als er das Zimmer betrat.
»Nämlich?«, fragte Maarten.
»Mit einer Frau natürlich«, sagte Frans verlegen. »Wenn ich irgendwo arbeite, kriege ich immer Probleme mit Frauen. Das hatte ich in der Valeriusklinik und in Wolfheze auch. Wenn eine Frau in Weiß auftaucht, bin ich schon ganz begeistert.« Er verließ das Zimmer wieder und kam mit einer dritten Tasse zurück.
»Was ist das für eine Frau?«
»Sie arbeitet in der Verwaltung. Ada Koppejan. Sie hat schon zwei Kinder, aber sie ist nicht verheiratet.«
»Klein, schwarz?«
»Nein, eher blond.«
»Nicht besonders hübsch, ein bisschen schmuddelig, dick, fettiges Haar«, phantasierte Maarten weiter.
Frans lachte. »Ja, fettiges Haar hat sie schon. Ich bin jedenfalls immer wieder froh, wenn sie es gewaschen hat.«
»Und auch nicht hübsch«, beharrte Maarten.
»Nein, hübsch ist sie nicht. Und sie ist eigentlich auch nicht nett.«
»Gibt es denn keine anderen Frauen?«
»In der Bibliothek gibt es noch eine, aber die ist schon so alt.«
»Nein, das ist nichts«, gab Maarten zu.
Sie schwiegen und tranken ihren Kaffee.
»Es fing natürlich damit an, dass ich Phantasien über sie hatte«, erzählte Frans, »und das habe ich ihr auch gestanden. Das hätte ich natürlich nicht tun sollen, aber so bin ich nun einmal. Daraufhin sagte sie, dass sie das gerade von mir nicht erwartet hätte.«
»Du enttäuschst mich, Frans«, sagte Maarten mit ein wenig höherer Stimme.
Frans erschrak. Er sah Maarten argwöhnisch an. »Wie meinst du das?«
»Ich habe sie nur nachgemacht«, beruhigte ihn Maarten.
»Oh«, sagte Frans verblüfft.
»Und dann?«
»Dann habe ich natürlich Tage gebraucht, um darüber hinwegzukommen, und im Augenblick laufe ich wieder hinter ihr her, obwohl ich weiß, dass das nicht gut ist, und ich kaufe kleine Geschenke, die sich dann in meiner Wohnung stapeln, weil ich mich gerade noch beherrschen kann.« Er lachte verlegen. »Ich habe für sie sogar einen Tag lang nicht geraucht, um ein Opfer zu bringen. Das hat sie natürlich nicht verstanden, denn sie raucht selbst auch.« Er lachte jetzt lauthals.
»Kurzum, sie ist dumm!«
»Ja. Ich habe einmal einen Streit mit ihr angefangen, und da ist sie sofort zu van Kruysbergen gelaufen, und der hat dann zu mir gesagt: ›Ich begreife nicht, was du in Frau Koppejan siehst, denn ich finde, dass sie so ein nacktes Gesicht hat.‹«
Sie lachten.
»Dieser van Kruysbergen scheint ein netter Mann zu sein«, sagte Maarten.
»Ja, das ist er auch.«
»Beerta könnte auch so reagieren.«
»Ja, vielleicht schon.«
Sie schwiegen.
»Ich habe einen netten Traum über Beerta gehabt«, erinnerte sich Maarten. »Er saß am Schreibtisch, und da kam de Gruiter herein, das ist der Nachfolger von Wiegel, den kennst du nicht. Als Beerta sich zu ihm umdrehte, hatte er ein Kondom auf der Nase, und das sollte de Gruiter mit seinem Mund herunterholen.« Er musste darüber lachen, erst ein bisschen, dann aber, als sie mitlachten, lauter.
»Ja, ein sehr hübscher Traum«, fand Frans, nachdem sie aufgehört hatten zu lachen. »Hast du ihn auch Beerta erzählt?«
»Nein, Beerta erzähle ich keine Träume.«
»Ich habe neulich auch einen schönen Traum gehabt«, erinnerte sich Frans seinerseits.
»Jetzt, wo wir doch schon dabei sind«, stellte Maarten fest.
»Ja, ich habe geträumt, dass ich mit meiner Mutter auf den Schultern in die Valeriusklinik kam.« Er lachte. »Meine Mutter musste zur Frauen- und ich zur Männerabteilung. Dort bot mir ein Mann einen Blattkaktus an.«
»Hast du ihm eine aufs Maul gegeben?«
»Nein, aber ich habe sehr empört reagiert. ›Mit Homosexualität ist mir nicht gedient‹, habe ich gesagt.« Er lachte erneut, etwas verlegen.
»Sehr gut«, fand Maarten. »Ein schöner Traum.«
»Ja, ich war damit zumindest sehr zufrieden«, sagte Frans.
*
»Herr Koning!«, sagte Slofstra, als er das Zimmer betrat. »What about the birds?«
Maarten und Bart saßen am Mitteltisch und redeten miteinander.
»Oh ja«, sagte Maarten und sah auf, »die Vögel.«
»Vielleicht möchte Herr Asjes mitmachen, jetzt, wo Herr Ansing nicht mehr da ist«, schlug Slofstra vor.
»Wobei wollen Sie mich mitmachen lassen, Herr Slofstra?«, fragte Bart.
»Futter! Für die Vögel! Herr Koning, Herr Ansing und ich kümmern uns hier immer um die Vögel!«
»Herr Slofstra kauft Körner und Meisenknödel, und die bezahlen wir gemeinsam«, erklärte Maarten.
»Ich weiß nicht, ob mir das so recht ist«, sagte Bart zögernd.
»Bei dieser Kälte?«, fragte Slofstra erstaunt.
»Weil ich gelesen habe, dass wir das besser der Natur überlassen sollten.«
»Aber die Tiere haben Hunger! In der Natur finden sie jetzt nichts.«
»Das finde ich auch schrecklich, Herr Slofstra, aber wenn wir die Schwachen am Leben erhalten, geht das auf Kosten der Art.«
»Das ist ein knallharter Standpunkt«, fand Maarten. »Wenn man das bei den Menschen auch so sehen würde.«
»Mit den Menschen geht das nun mal nicht mehr.«
»Soll ich dann mal wieder was kaufen?«, fragte Slofstra Maarten.
»Wie viel brauchen Sie?«, fragte Maarten und zog sein Portemonnaie aus der Tasche.
»Fünf Gulden reichen.«
Maarten gab ihm einen Fünfguldenschein.
»Ich danke Ihnen«, sagte Slofstra förmlich und verließ den Raum.
»Es ist nicht so, dass ich kein Mitleid mit den Vögeln habe«, sagte Bart. »Ich finde es auch ganz schrecklich, wenn sie Hunger haben.«
»Ja, natürlich«, sagte Maarten. »Ich kenne den Standpunkt.«
»Aber wenn man die Schwachen auf diese Weise am Leben erhält, geht das letztendlich auf Kosten der Art. Wenn man der Natur ihren Lauf lässt, bleiben nur die Starken übrig.«
»Ja, das weiß ich.«
»Davor warnt auch der Vogelschutz immer.«
»Aber der Vogelschutz sagt auch, dass man in strengen Wintern zufüttern soll«, sagte Maarten ungeduldig.
»Damit bin ich dann doch nicht einverstanden«, sagte Bart. »Es geht ums Prinzip! Ich finde, dass man darin prinzipiell sein muss!« Er sprach das Wort »prinzipiell« sehr präzise aus, dabei jede Silbe betonend.
*
»Du warst gestern Nachmittag nicht da!«, sagte Balk, als er den Raum betrat.
»Nein, ich war in der Bibliothek«, entschuldigte sich Maarten. Sofort ärgerte er sich darüber, doch es war schon heraus, bevor er darüber nachgedacht hatte.
»Unter den Bewerbern war ein Mann, der sehr geeignet für dich ist«, er schenkte Maartens Worten keinerlei Beachtung, »ein tüchtiger Kerl! Ich wollte ihn zu dir schicken, aber dann habe ich gesagt, dass er morgen wiederkommen soll. Bist du morgen da?«
»Ja, aber ich habe keine Stelle frei.«
»Das ist unwichtig. Wenn du den Mann brauchen kannst, gibt es auch eine Stelle für ihn! Du bist hier der Einzige, der noch keinen Dokumentar hat, und der hier bringt genau das mit, was du brauchst! Ich hole dir seinen Brief!« Entschlossen verließ er den Raum.
Maarten sah in den Garten hinaus, ohne jedoch etwas zu sehen. Er empfand das überrumpelnde Auftreten Balks als bedrohlich, weil er sich nicht dagegen wehren konnte. Dass Balk imstande wäre, jemanden auszusuchen, mit dem er zurechtkäme, schien ihm unwahrscheinlich, aber es war abzusehen, dass er Balk nicht davon überzeugen würde, ohne zu streiten, und vor Streit fürchtete er sich. Diese Erkenntnis machte ihn von einem Moment auf den anderen tief unglücklich. Die Tür ging wieder auf. Balk marschierte herein und legte den Brief mit einer kraftvollen Geste vor ihn hin. »Bitte sehr! Morgen früh, zehn Uhr! Der Mann wohnt in Rozenburg, aber er sagt, das wäre kein Problem. Bring ihn anschließend noch kurz zu mir, dann können wir die formalen Details besprechen!« Er drehte sich um und war bereits wieder aus dem Zimmer gegangen, bevor Maarten ihm hatte antworten können.
Maarten las den Brief mit Widerwillen. Der Name war Jan Boerakker, neunundzwanzig Jahre, wohnhaft in Rozenburg und in der Verwaltung eines Labors von Shell tätig. Er besaß das Bibliotheksdiplom C, eine Frau und zwei Kinder und würde gern für die Stelle eines Bibliothekars in Betracht gezogen werden. Der Brief war in einer schülerhaften, etwas kantigen Handschrift geschrieben und weckte bei Maarten keinerlei Sympathie. Deprimiert stand er auf, nahm den Brief und ging durch den zweiten Raum ins Hinterzimmer. Sein gesamter Mitarbeiterstab war anwesend: Heidi Bruul, die nun also Heidi Muller hieß, die Damen Schot-van Heusden und Boomsma-Varkevisser, die als studentische Hilfskräfte für Kees und Ad Muller gekommen waren, sowie Bart. Er begrüßte Heidi und Bart mit ihren Vornamen, die beiden anderen mit Nachnamen, und setzte sich Bart gegenüber auf die andere Seite des Schreibtisches. »Morgen kommt ein Bewerber.« Er schob Bart den Brief hin.
Bart las ihn mit verwundert hochgezogenen Augenbrauen, das Papier dicht vor seinen Augen, da er selbst mit Brille Schwierigkeiten beim Lesen hatte. »Das ist doch sicher für die Stelle von Herrn de Gruiter?«, sagte er und sah hoch.
»Nein, der will zu uns. Balk kam damit an.«
»Darüber wäre ich dann doch gern vorher informiert worden.«
»Ich auch, aber Balk hat es so entschieden, er glaubt, dass er sich für uns eignet.«
»Aber wir haben doch gar keine offene Stelle.«
»Die hat er für uns geschaffen.«
»Das finde ich sehr nett von Herrn Balk, aber ich würde das, glaube ich, trotzdem nicht akzeptiert haben.«
»Dafür sehe ich keine Argumente. Sollen wir ihn zusammen empfangen?«
»Darüber muss ich erst noch mal nachdenken«, sagte Bart verhalten.
Eine Stunde später kam er, um zu sagen, dass er nicht bei dem Gespräch anwesend sein wolle, weil er dann die Mitverantwortung für eine Entscheidung tragen würde, über die er nicht informiert worden sei.
*
»Und du hast versprochen, dass du nicht noch jemanden einstellen würdest!«, sagte sie empört.
»Das habe ichnichtversprochen.«
»Das hast duwohlversprochen! Asjes würde der Letzte sein! Das hast du selbst gesagt! Asjes war ein Irrtum, aber daran könntest du nun einmal nichts mehr ändern, aber jetzt sei es vorbei, jetzt würdest du keinen mehr dazuholen!«
»Wie kann ich das denn versprochen haben? So etwas verspricht man doch nicht!«
»So etwas verspricht manwohl!Ich weiß sicher, dass du es versprochen hast! ›Ich tue es nicht mehr‹, hast du gesagt. Das hast du selbst gesagt!«
»Daran kann ich mich nicht erinnern.«
»Aberichkann mich daran erinnern! Reicht das etwa nicht, dass ich mich daran erinnern kann? Du würdest niemanden mehr einstellen, weil du es selbst auch für Unsinn hältst!«
Er schüttelte den Kopf.
»Glaubst du mir nicht? Müssen wir in Zukunft etwa unsere Gespräche auf Tonband aufnehmen? Soll ich etwa schwören? Willst du, dass ich schwöre, dass du es gesagt hast?«
»Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe«, sagte er widerwillig.
»Nun, dann sage ich es dir! Du hast gesagt, dass du nicht noch jemanden einstellen würdest! Das hast du versprochen! Und wenn du dich daran nicht mehr erinnerst, musst du in Zukunft eben aufschreiben, was du versprichst! Dann brauche ich nicht mehr böse zu werden!«
»Aber ich will diesen Mann überhaupt nicht einstellen«, sagte er verzweifelt. »Balk kam mit ihm an! Ich hatte nicht einmal eine freie Stelle!«
»Und wenn Balk mit so jemandem ankommt, nimmst du ihn! Dann sagst du nicht: ›Rutsch mir doch den Buckel runter, nimm ihn doch selbst!‹ Nein, dann sagst du: ›Ja, Herr Balk! Ich werde es tun, Herr Balk! Vielen Dank, Herr Balk!‹«
»Ich nenne ihn Jaap«, korrigierte Maarten.
»Dann eben Jaap! Noch schlimmer! Warum sagst du nicht: ›Scher dich hier raus! Ich entscheide, wen ich einstelle! Damit hast du nichts zu schaffen! Ich leite hier die Abteilung!‹«
»Balk ist der Direktor.«
»Und wenn der Direktor es sagt, dann tust du es! Wenn der Direktor sagt: ›Jetzt mach mal einen Kopfstand‹, machst du einen Kopfstand! Denn er ist der Direktor! Dass ich nicht lache! So etwas entscheidest du doch selbst! Das lässt du doch Balk nicht entscheiden!«
»Wenn ich keine Argumente habe, kann ich so einem Mann nichts abschlagen.«
»Dann lass dir eben Argumente einfallen! Oder du lässt dir überhaupt keine Argumente einfallen, sondern sagst einfach: ›Ich mache es nicht! Punkt, aus!‹ –Daswäre das richtige Auftreten! Davor hätte ich Respekt! Aber nicht, wenn du wie ein Hündchen hinter Balk herläufst, weil er zufällig der Direktor ist! Er kann mir mit seinem Direktor den Buckel runterrutschen! Direktor! Dass ich nicht lache! Du bist doch sicher derjenige, der entscheidet, was in deiner Abteilung gemacht werden soll? Doch nicht Balk? Damit hat Balk doch rein gar nichts zu schaffen! Wenndufindest, dass du niemanden mehr brauchst, brauchst du auch niemanden mehr! Und dann kann Balk im Dreieck springen, aber es wird keiner mehr eingestellt! So sieht’s aus und nicht anders!«
»Gut.« Das Gespräch deprimierte ihn.
»Stell dir vor, Balk würde entscheiden, dass du noch jemanden brauchst! Das wäre ja verkehrte Welt! Als ob Balk beurteilen kann, was du zu tun hast! Nichts musst du tun! Gar nichts! Lass sie doch zum Teufel gehen mit ihrer Wissenschaft!«
»Ja.«
»Dann weigere dich, wenn du meiner Meinung bist!«
»Ich werde sehen. Jedenfalls muss ich mit diesem Menschen sprechen, denn Balk hat mit ihm einen Termin gemacht.«
»Und wenn du mit ihm gesprochen hast, sagst du einfach, dass es dir leid tut, aber dass du ihn nicht brauchst.«
»Ich werde sehen«, wiederholte er. »Ich werde schon selbst entscheiden, was ich tue. Ich kann mich doch nicht anders verhalten, als ich bin.«
»Wenn dir nur klar ist, dass ich es nicht akzeptiere, wenn du wieder jemanden einstellst!«, sagte sie heftig.
*
»Herr Koning, schauen Sie mal, was ich gefunden habe!«, sagte Slofstra, als er den Raum betrat.
»Die Frage ist, ob es eine Tradition ist«, sagte Maarten zu Bart und drehte sich um.
Slofstra hielt einen Besenstiel und ein quadratisches Brettchen hoch.
»Was wollen Sie damit?«, fragte Maarten.
»Für die Vögel! Ein Vogelhäuschen! Da können die Katzen nicht ran.«
Maarten stand auf und nahm Slofstra Stock und Brett ab. Er stellte den Stock senkrecht hin und legte das Brett darauf. »Und wie wollten Sie das miteinander verbinden?«, fragte er skeptisch.
»Mit einem Nagel!«
Bart sah zu. Beerta tippte weiter, ohne sich umzudrehen.
Maarten schüttelte den Kopf. »Das kippt.«
»Oh.«
»Haben Sie nicht noch so einen Stock?«
»Ich glaube schon. Der hier lag im Fahrradabstellraum.«
»Sehen Sie dann erst einmal nach, ob da noch ein Stock ist, und dann brauchen wir natürlich auch einen Hammer und ein paar Nägel.«
»Ich werde mal schauen«, sagte Slofstra gleichmütig und verließ den Raum. Er ließ den Stock und das Brett auf Maartens Schreibtisch zurück.
»Ein Straßenfest ist keine Tradition«, fuhr Maarten fort, während er sich wieder hinsetzte.
»Doch«, sagte Bart, »denn hier steht«, er beugte sich tief über den Ausschnitt, der zwischen ihnen lag, und las mit Betonung vor: »›das Fest, das nunmehr zum zwanzigsten Mal stattfindet‹.«
»Ja gut, aber zwanzig Jahre sind für mich noch keine Tradition.«
»Wann ist denn etwas eine Tradition?«
»Dreihundert Jahre«, sagte Maarten aufs Geratewohl.
Beerta hatte aufgehört zu tippen. Er richtete sich auf und lauschte, ihnen den Rücken zugewandt.
»Das finde ich doch sehr willkürlich.«
»Es interessiert uns erst, wenn wir die Verbreitung rekonstruieren können«, erklärte Maarten. »Diese Feste sind kein Zweck an sich, sie sind ein Mittel, um Kulturgrenzen festzustellen. Bei einem Straßenfest kann davon schon mal gar keine Rede sein.«
Beerta beugte sich wieder über seine Schreibmaschine und tippte weiter.
»Aber diese Rubrik heißt doch ›Feste‹!«, sagte Bart. »Das bedeutet, dass wir Daten über Feste sammeln!«
»Nur, wenn wir diese Feste für unsere Forschung brauchen können.«
»Da bin ich dann doch anderer Meinung. Wenn so eine Rubrik ›Feste‹ heißt, erwarte ich als Benutzer, dass ich darin Angaben über alle Feste finde, auch über solche, die noch keine lange Tradition haben.«
»Das nähme aber kein Ende.«
»Das kann doch niemals ein Grund sein, uns selbst zu beschränken!«
Die Tür öffnete sich erneut. Slofstra trat ein. »Ich habe es!« Er hatte einen zweiten Stock bei sich, in der anderen Hand hielt er einen Hammer und eine Packung Nägel.
Maarten stand auf. Er nahm Slofstra den Stock ab und hielt ihn neben den anderen. Sie waren ungefähr gleich lang. »Schön. Halten Sie sie mal fest?«
Slofstra hielt die Stöcke gerade nebeneinander, während Maarten das Brett vom Schreibtisch nahm.
»Etwas weiter zusammen«, sagte Maarten und richtete das Brett auf den Stöcken aus.
Slofstra versetzte die Stöcke ein wenig. Er schaute an Maarten vorbei in den Raum, so als habe er mit der Sache weiter nichts zu tun.
»So!«, entschied Maarten. »Schlagen Sie die Nägel ein?«
»Wie denn?« Er lachte kurz. »Ich halte doch die Stöcke fest?«
»Bart, kannst du kurz helfen?«, fragte Maarten.
Bart stellte sich zu ihnen. »Was genau soll ich tun?«
»Das hängt davon ab, wer die Nägel einschlägt.«
»You are the boss«, fand Slofstra.
»Könntest du das Brettchen festhalten?«, fragte Maarten Bart. Während Bart das Brett von ihm übernahm, holte er einen Nagel aus der Packung und griff zum Hammer. »Vielleicht kann Herr Beerta auch noch helfen?«, sagte er ironisch.
»Wobei soll ich helfen?«, fragte Beerta, ohne mit dem Tippen aufzuhören.
»Nein, das war ein Scherz.« Er bückte sich, bis er sich mit dem Brett auf Augenhöhe befand, setzte den Nagel auf das Brett über den Stock und trieb ihn mit ein paar Schlägen durch das Holz in den Stock.
»Das haben Sie nicht zum ersten Mal gemacht«, meinte Slofstra.
»Doch. Das ist mein erstes Vogelhäuschen.«
Den zweiten Nagel schlug er denn auch neben den Stock, doch nachdem Slofstra ihn ein wenig versetzt hatte, saß auch dieser fest. »Eine wacklige Konstruktion«, fand auch er, als er Slofstra die Stöcke abnahm.
»Die Vögelchen sind leicht«, sagte Slofstra.
»Ja, zum Glück.Siedürften sich nicht daraufsetzen.«
Slofstra hielt das für einen guten Witz. »Ich werde mich vorsehen!« Er lachte.
Sie gingen hintereinander her, Maarten mit dem Vogelbrett, durch den zweiten und den ersten Raum zur Gartentür. Als sie den Flur betraten, kam Balk gerade aus der Baracke.
»Herr Koning und ich haben ein Vogelhäuschen gebaut«, teilte Slofstra ihm mit. »Das stellen wir im Garten auf.«
»Schön«, sagte Balk abwesend. Er ging, ohne sie anzusehen, an ihnen vorbei und verschwand in der Turnhalle.
Sie kamen in den Garten. Unter einem grauen Himmel wehte ein harter, rauer Wind. Slofstra stellte den Kragen seiner Jacke auf. Maarten sah sich nach einer geeigneten Stelle um. Er blickte nach oben. Vor den grauen Wolken zogen Möwen vorbei. »Wir sollten es am besten unter die Japanische Blütenkirsche stellen«, entschied er, »als Schutz vor den Möwen.«
»Auch gut«, sagte Slofstra.
Hinter dem Fenster des zweiten Raums stand van Ieperen, grinste sie an und bewegte seine Schultern.
Maarten ignorierte ihn. Er stellte die beiden Stöcke nebeneinander auf den Boden, sodass sie parallel zueinander waren, und ließ dann den einen los. »Wenn Sie nun den anderen nehmen und dann gleichzeitig drücken. Ich zähle bis drei.« Slofstra ergriff den Stock. »Eins, zwei, drei!« Sie drückten gleichzeitig, doch viel Wirkung hatte es nicht. »Wir müssen ein bisschen stoßen«, kommandierte Maarten, »aber nicht zu stark.« Dicht nebeneinander stießen sie die Stöcke ganz langsam in den Boden.
Während sie damit beschäftigt waren, wurde das Fenster des ersten Raums geöffnet, und Fräulein Bavelaar sah nach draußen. »Herr Koning! Der Bewerber ist da!«
»Ich komme!«, rief Maarten zurück. »Stoßen!«, sagte er zu Slofstra. »Und stoßen!«
Slofstra keuchte vor Anstrengung.
»So, das reicht jetzt.« Er befühlte das Brettchen. Es bewegte sich hin und her, aber nicht besorgniserregend.
Slofstra sah zu, die Hände in die Seiten gestützt. »Ist es so gut?«
»So ist es gut«, sagte Maarten zufrieden.
»Dann werde ich gleich ein paar Körner darauf streuen.«
Sie gingen zurück zur Gartentür, stampften, bevor sie eintraten, auf die Steine, um die Erde von ihren Schuhen zu entfernen, und gingen in den ersten Raum.
»Typisch Herr Koning!«, sagte Frau Moederman schmunzelnd, als sie eintraten.
Maarten lächelte. Er fühlte sich gut und scheinheilig – das hohe Tier, das trotzdem so einfach geblieben war –, aber er hatte nicht viel Zeit, es zu genießen, denn Boerakker erwartete ihn bereits an Bavelaars Schreibtisch. »Herr Boerakker?«, fragte er.
»Jan Boerakker«, sagte der junge Mann und reichte ihm die Hand, eine kräftige, etwas feuchte Hand. Er hatte kurzgeschnittenes, rotes Haar und ein rechthaberisches Gesicht, das durch Aknepickel ziemlich verunstaltet war.
»Koning«, sagte Maarten. »Kommen Sie mit.«
»Komisches Büro ist das hier«, sagte der junge Mann amüsiert, als sie auf dem Weg zu Maartens Zimmer waren.
»Ja?«, fragte Maarten abwesend.
»Wo ich jetzt arbeite, wäre so etwas jedenfalls nicht möglich.«
»In diesem Labor …« Er öffnete die Tür zu seinem Zimmer. »Treten Sie ein.«
Als sie hereinkamen, stand Bart auf. Beerta tippte einfach weiter. »Dann gehe ich also mal«, sagte Bart. Er nickte Boerakker zu. »Auf Wiedersehen, Mijnheer.« Er verließ den Raum.
»Das ist Herr Beerta«, sagte Maarten zu Boerakker mit einem Kopfnicken in Richtung Beertas Rücken. »Er ist unser früherer Direktor, er arbeitet hier noch. Setzen Sie sich.«
Boerakker setzte sich auf Maartens Stuhl, hinter die Stapel mit Ausschnitten. Er stellte seine Tasche neben sich auf Barts Stuhl und sah sich amüsiert um.
Maarten zog seinen Schreibtischstuhl an die kurze Seite des Tisches und legte Boerakkers Brief vor sich hin. »Sie arbeiten in der Verwaltung eines Labors.«
»Ja, und je eher ich da weg bin, umso besser, denn da ist es stinklangweilig! Kein Buch weit und breit!« Er lachte und schüttelte den Kopf. »Ziemlich dumm!«
»Und deshalb wollen Sie Bibliothekar werden.«
»Ja, so ist es.«
»Aber die Arbeit, die Sie bei mir machen würden, ist nicht die eines Bibliothekars.«
»Ach, Bibliothekar! Das ist doch nur ein Begriff! Ich hatte dem Herrn, mit dem ich das letzte Mal gesprochen habe, noch gesagt …«
»Balk«, half Maarten.
»Balk! Ja, das ist merkwürdig, aber wenn es nicht klappt, habe ich so einen Namen sofort wieder vergessen.« Er lachte amüsiert. »Balk! Ein komischer Name übrigens.«
»Es ist ein Dorf in Friesland.«
»Ja, verdammt. Natürlich! Daran denkt man nur nicht gleich! Balk! Dorf in Friesland! Aber gut, ich habe zu diesem Herrn Balk gesagt: ›Letztendlich will ich natürlich auf Ihren Stuhl.‹ – Fand er nicht so gut, glaube ich. Aber, na ja, so bin ich nun mal!« Er lachte vergnügt. »Komischer Kerl«, urteilte er über sich selbst.
Beerta hörte auf zu tippen. Er drehte sich um und sah Boerakker über seine Brille hinweg an.
Maarten schmunzelte. Der junge Mann amüsierte ihn. Gleichzeitig dämmerte es ihm, dass es sehr schwer sein würde, ihn zu entmutigen.
»Also gut«, sagte Boerakker, »dann kein Bibliothekar.« Er sah Maarten abwartend an.
»Wir machen hier einen Atlas«, erklärte Maarten. »Herr Beerta und ich« – Beerta wandte sich ab und nahm seine Arbeit wieder auf – »und dafür schicken wir Fragebogen herum und sammeln Volkserzählungen. Die Antworten in den Fragebogen und die Erzählungen kommen mit den Daten aus der Literatur in dieses Karteisystem.« Er zeigte auf die Karteikästen neben seinem Schreibtisch und auf die im Bücherregal hinter Boerakker eingebauten. »Das machen studentische Hilfskräfte, und diese Arbeit müssten Sie koordinieren, dazu gibt es noch ein Ausschnittarchiv, an dem Sie ebenfalls arbeiten würden.«
Während er dasaß und sprach, hatte sich Boerakker zu dem Teil des Karteisystems umgedreht, der hinter ihm stand, und nickte beeindruckt. »Das ist die Mühe wert! Wie viele Karteikarten sind das wohl?«
»Eine Viertelmillion.«
»Na bitte! Und wie ist das katalogisiert?« Er stand auf. »Darf ich kurz schauen?« Er zog ein Schubfach auf und ließ die Karteikarten durch seine Finger gleiten. »Ein Schlagwortkatalog! Genau wie in Delft!«
»Gibt es da einen Schlagwortkatalog?«
»Ja, das weiß ich aber auch nur, weil ich da mein Praktikum gemacht habe, aber es gibt ein kleines Buch darüber, von einem Herrn Voogd. Das werde ich Ihnen mal mitbringen. Ein gutes System!«
»Wir haben vor, daraus auf Dauer ein Wörterbuch zu machen.« Die Begeisterung seines Gegenübers riss ihn mit.
»Sehr gut! Rausholen, was drinsteckt! Scheint mir eine interessante Arbeit!«
»Aber Sie wohnen in Rozenburg«, wandte Maarten ein.
»Kein Problem. Wann fangen Sie an?«
»Halb neun.«
»Das wäre dann die Fähre um sechs Uhr, halb fünf aufstehen. Das kriegen wir schon hin! Und das Ausschnittarchiv? Darf ich das auch noch eben sehen?«
»Das ist im Raum hinter uns.«
Als sie das Hinterzimmer betraten, waren dort nur Bart und Elsje Schot.
»Das ist Herr Boerakker«, sagte Maarten, »er wird hier vielleicht anfangen zu arbeiten. Und das sind Frau Schot und Herr Asjes.«
»Jan Boerakker«, korrigierte Boerakker. Er gab ihnen die Hand und sah sich um. »Keine Bücher«, stellte er fest.
»Das sind die Fragebogen«, sagte Maarten und wies auf die Kästen an der Wand unter den Fenstern.
»Das ist eine ziemliche Menge.«
»Ungefähr vierzigtausend.«
»Darf ich mal sehen?«
Maarten zog einen Kasten aus dem Regal und stellte ihn auf Heidis Schreibtisch. »Das ist der letzte Fragebogen, über die Bräuche beim Tod.«
Boerakker blätterte in den Fragebogen. »Und dass ich davon nichts wusste! Sie müssen dafür viel mehr Reklame machen! Sie müssen die Presse dazuholen!«
»Um Himmels willen. Je weniger Leute davon wissen, umso lieber ist es uns.«
»Oh ja?« Er lachte. »Komisches Büro!«
»Und hier würden Sie also sitzen.« Er sah sich um. »Es muss dann nur noch ein Schreibtisch dazugestellt werden.«
»Nicht schlecht«, fand Boerakker. »Ich bin dabei.«
»Ich habe ihn nicht entmutigen können«, sagte Maarten. Er war an Barts Schreibtisch stehen geblieben und sah ihn an.
»Das habe ich schon befürchtet, als ich ihn hereinkommen sah«, sagte Bart. Er lachte. »Obwohl ich noch kurz gehofft hatte, dass es so gehen würde wie im Büro meines Vaters.« Die Erinnerung bereitete ihm großes Vergnügen.
»Was war denn da?«, fragte Maarten neugierig.
»Da gab es auch so einen Mann, und als sie ihm den ganzen Betrieb gezeigt hatten, fragte er, ob er noch eben sein Fahrrad wegstellen dürfe.« Er lachte nun lauthals, sodass ihm Tränen in die Augen stiegen. »Er ist nie wieder zurückgekommen.«
Maarten lachte. »Das wird bei dem hier nicht der Fall sein, fürchte ich.«
»Nein«, sagte Bart, noch immer lachend, »das fürchte ich auch.«
»Was war das für ein Bursche?«, fragte Beerta. Er drehte sich um und sah Maarten über seine Brille hinweg an.
»Das war eine neue Kraft, mit der Balk ankam.«
»Hättest du das nicht der Kommission vorlegen müssen?«
»Muss das sein?«
»Natürlich muss das sein.«
»Aber es geht um einen Dokumentar. Bei den studentischen Hilfskräften fragen wir doch auch nie um Erlaubnis!«
»Das ist ein Argument«, gab Beerta zu. Er wandte sich ab und begann, wieder zu tippen. »Ich bin gespannt«, sagte er skeptisch.
*
Sie brachte ihn zur Tür. »Hast du heute noch irgendetwas?«
»Ich glaube nicht.«
Sie gaben sich einen Kuss.
Er entriegelte das Schloss und öffnete die Tür. »Grüß deine Mutter schon mal.«
Es war dunkel. An der Gracht war es still. Unter dem Baum an der Ecke zur Egelantiersgracht hüpften fünf oder sechs Spatzen im Lichtschein der Laterne herum. Sie pickten im Sand und zwischen den Steinen. Er bog rechts ab in die Egelantiersstraat. Die Straße wirkte verlassen im Schein der Lampen, der links und rechts bis zu den Hausgiebeln hinaufreichte. Am Rand des Bürgersteigs parkte hier und da ein Auto. Durch das Fenster eines Wohnzimmers, dessen Vorhänge offen standen, sah man einen Weihnachtsbaum, an dem die Lämpchen noch brannten. Vor dem Fenster eines anderen Zimmers hing eine Traube silberfarbener Weihnachtskugeln an einer roten Schleife. Ein Fahrrad mit einem wispernden Dynamo näherte sich ihm von hinten und warf einen nervösen Lichtkegel vor sich her. Als es ihn überholt hatte, konnte Maarten das rote Rücklicht über die letzte Seitenstraße hinweg verfolgen. Ein Mann verließ sein Haus, wischte die Frontscheibe seines Autos sauber, stieg ein und versuchte zu starten. Der Motor röchelte, ging wieder aus, röchelte erneut und setzte wieder aus. Es war kalt, eine schneidende Kälte, die durch seinen Mantel bis in den Körper drang.
Wigbold war in seinem Verschlag. Er trat an die Tür, als Maarten durch die Eingangstür kam. »Tag, Koning«, sagte er kumpelhaft.
»Tag, Herr Wigbold«, sagte Maarten, seinen Widerwillen gegen diesen Mann unterdrückend.
»Ich wollte heute Nachmittag eigentlich etwas früher nach Hause, weil meine Frau krank ist.«
»Da müssen Sie Herrn Balk fragen«, antwortete Maarten und setzte seinen Weg fort, »und sonst Frau Haan.«
»Ja, aber die sind nicht da«, rief Wigbold ihm hinterher.
»Die kommen schon noch«, gab Maarten zurück.
Missgelaunt hängte er seinen Mantel an die Garderobe und ging hintenherum durch den zweiten Raum in sein Zimmer. Es war noch niemand da. Er legte sein Brot und den Apfel in die linke Schublade des Schreibtisches, nahm den Stecker der Lampe und steckte ihn in die Steckdose. Einen Augenblick lang blieb er stehen, in Gedanken, bevor er sich zum Mitteltisch umdrehte. Er legte die Unterlagen für den Jahresbericht neben die Schreibmaschine, machte die Deckenlampe an, setzte sich, spannte ein Blatt Schmierpapier in die Maschine, sah in seine Notizen und in den Jahresbericht vom letzten Jahr und tippte dann: »Kommission«. Er schob den Wagen zurück zum Seitenrand, rückte ein, dachte kurz nach und fuhr in einem Rutsch fort: »Herr Beerta hat am 30. September seine Tätigkeit als Direktor des Büros beendet. Im Zusammenhang damit hat er zugleich sein Amt als Kassenwart und Schriftführer der Kommission niedergelegt und wurde von dieser zum Mitglied ernannt. An seiner Stelle wurden als Kassenwart der neu ernannte Direktor, Dr. J. C. Balk, und als Schriftführer der Leiter der Abteilung Volkskultur, Herr Koning, berufen.« Er zögerte, mit einem Finger über der Tastatur, und dachte nach.
Die Tür ging auf. Balk kam herein. »Morgen«, sagte er kurz. Er streckte den Finger in Richtung Maarten aus. »Würdest du in den Jahresbericht auch eine Klage über die Raumnot hier aufnehmen?« Es klang eher nach einem Befehl als nach einer Bitte. »Dagegen werde ich etwas unternehmen.«
»Ja.« Die Bitte überrumpelte ihn.
»Schön.« Er wandte sich ab und wollte den Raum wieder verlassen.
»Halten wir eigentlich noch eine Personalversammlung über den Jahresbericht ab?«, fragte Maarten. Das Auftreten Balks machte ihn unsicher. Er musste sich zwingen, deutlich und ruhig zu artikulieren.
»Nein«, sagte Balk ungeduldig. »Warum?«
»Weil wir es immer so gehalten haben.«
»Ich habe nicht vor, damit weiterzumachen. Wenn ich etwas zu sagen habe, werde ich es schon mitteilen.« Er verließ den Raum wieder und schloss die Tür.
Maarten beugte sich über seine Schreibmaschine und las, was er getippt hatte, doch er war mit seinem Kopf nicht bei der Sache. Balks Vorstoß blieb in seinen Gedanken hängen und wiederholte sich. Einem solchen Verhalten gegenüber fühlte er sich wehrlos. Er hörte die Tür des Hinterzimmers. Jemand war eingetreten. Ein Stuhl wurde verrückt, und kurze Zeit später hörte er eine Schreibmaschine. Gleich darauf hörte er erneut die Tür sowie die Stimmen Barts und Frau Boomsmas. Er beugte sich wieder über die Schreibmaschine und las ein weiteres Mal, was dort stand.
»Kaffee!«, sagte Wigbold. Er stellte das Tablett auf den Mitteltisch, neben die Unterlagen für den Jahresbericht.
Maarten schaute zur Seite. Auf dem Tablett stand auch ein Teller mit einigen Stücken Weihnachtskranz. »Von wem ist der Weihnachtskranz?«, fragte er.
»Von Bavelaar«, antwortete Wigbold, während er eine Tasse Kaffee einschenkte.
»Das ist nett.«
»Vom Weihnachtsessen übriggeblieben«, scherzte Wigbold.
Maarten erinnerte sich an dessen Bitte vom Morgen beim Betreten des Büros. »Was hat Ihre Frau eigentlich?«
»Grippe. Also kann ich auch noch den Haushalt erledigen.« Er hielt Maarten den Teller hin.
Maarten brach ein Stück vom Weihnachtskranz ab und legte es auf die Untertasse. »Lecker.«
»Das bleibt abzuwarten.« Er hob das Tablett wieder hoch und verließ den Raum.
Maarten nahm das Stück Weihnachtskranz von der Untertasse und ging hinter ihm her. Fräulein Haan war nicht da. Wim Bosman und Herr de Roode, der jedes Mal in den Ferien kam, um an seiner Doktorarbeit zu arbeiten, saßen am Mitteltisch. »Tag, Wim, Tag, Herr de Roode«, sagte er.
»Tag, Maarten«, sagte Bosman.
»Tag, Herr Koning«, sagte de Roode. Er hatte eine feine, sehr exakt klingende Stimme, ein rotes Gesicht mit einem kleinen Mund, ein Schnurrbärtchen sowie kurzgeschnittenes, rotes Haar. Die Ironie in seiner Stimme erinnerte Maarten jedes Mal an Beerta, obwohl er sonst keine Ähnlichkeiten sah.
Maarten ging weiter zum ersten Raum, den Weihnachtskranz zwischen den Fingern.
Fräulein Bavelaar saß an ihrem Schreibtisch. Sie sah auf, als Maarten eintrat.
»Nett von Ihnen, uns zum Weihnachtskranz einzuladen«, sagte Maarten und hielt das Kuchenstück in die Höhe.
»Ja, ich dachte, es muss doch etwas Festliches geben?«
»Und zu Silvester gibt es Oliebollen!«, rief Slofstra aus dem hinteren Teil des Raums.
»Ach, Herr Slofstra, das sollen Sie doch nicht verraten!«, sagte Frau Moederman und drehte sich zu ihm um.
»Das wissen sowieso schon alle.«
»Herr Koning wusste es jedenfalls noch nicht.«
»Kann sein«, sagte Slofstra gleichmütig, »aber was macht das schon?«
Maarten lachte. »Jedenfalls finde ich den Weihnachtskranz lecker«, sagte er und hielt den Kuchen noch einmal hoch. Er wandte sich ab und ging schmunzelnd zurück in sein Zimmer. Als er die Tür öffnete, erstarb das Lächeln auf seinem Gesicht. Er nahm den Kaffee mit an Beertas Schreibtisch, zog einen Stuhl heran und wählte seine eigene Telefonnummer. Während er auf die Verbindung wartete, rührte er gedankenverloren im Kaffee.
»Hier Frau Koning.«
»Ha«, sagte er.
»Oh, du bist es? Ist Beerta nicht da?«
»Nein. Ist Mutter schon angekommen?«
»Ja, wir kommen gerade zur Tür herein.«
»Tag, Maarten!«, hörte er seine Schwiegermutter im Hintergrund rufen.
»Grüß Mutter von mir.«
»Ich soll Sie grüßen«, sagte sie. »Ich soll dich zurückgrüßen.«
»Danke.«
»Was machst du gerade?«
»Den Jahresbericht.«
»Kommst du voran?«
»Noch nicht so richtig.«
»Aber du kannst doch sicher einfach den Jahresbericht vom letzten Jahr abschreiben?«
»Nein, das geht nicht. Er muss anders werden.«
»Warum muss denn immer alles anders werden?«
»Ja, so bin ich nun mal.«
Sie schwiegen.
»Wir haben ein Stück Weihnachtskranz bekommen«, erzählte er.
»Von Balk?«, fragte sie ungläubig.
»Nein, von Fräulein Bavelaar.«
»Oh, ich dachte schon.« Sie lachte.
»Das wäre schon komisch«, gab er zu. »Fast gruselig.«
»Ja«, sagte sie belustigt.
Seine Schwiegermutter sagte etwas, das er nicht verstehen konnte.
»Mutter will dich auch eben sprechen.«
»Tag, Maarten!«, sagte seine Schwiegermutter dicht an seinem Ohr. Am Telefon redete sie immer sehr laut.
»Tag, Mutter.«
»Wirst du auch brav sein?«
»Das hatte ich vor.«
»Sehr schön.«
»Hatten Sie eine gute Reise?«
»Ja! Das Kind stand am Bahnhof, das war also alles in bester Ordnung.«
»Gut so.«
Sie schwiegen.
»Das Kind wollte dich auch noch eben sprechen. Tschüss dann!«
»Tschüss, Mutter.«
»Da bin ich wieder«, sagte Nicolien. »Gibt es sonst noch was bei dir?«
»Nein, sonst gibt es nichts.«
In Gedanken versunken trank er seinen Kaffee und aß sein Stück Weihnachtskranz. Er schaute auf das Karteisystem neben seinem Schreibtisch, ohne es zu sehen, und lauschte auf die Geräusche im anderen Zimmer, ohne dass ihre Bedeutung zu ihm durchdrang. Danach setzte er sich wieder an den Mitteltisch und las noch einmal, was er getippt hatte.
Bart kam herein. »Bist du am Arbeiten?«, fragte er, als er Maarten hinter der Schreibmaschine sah.
»Ja«, sagte Maarten und lehnte sich zurück, »aber schieß los.«
»Ich habe noch einmal darüber nachgedacht, und ich bin bereit, den Betrag füreinenMeisenknödel zur Aktion für die Vögel beizusteuern«, er griff in seine Gesäßtasche, »nicht, weil ich damit einverstanden bin, sondern weil ich es nett finde, dass Herr Slofstra sich so dafür einsetzt.«
»Rechne es dann direkt mit ihm ab.«
»Aber du hast doch auch mitbezahlt?«
»Stimmt, aber sonst wird es zu kompliziert, und Slofstra hat weniger als ich.«
»Gut«, er steckte sein Portemonnaie wieder ein, »das werde ich dann machen. Und zweitens wollte ich noch mal über den Inhalt der Mappe ›Feste‹ reden, denn ich kann mich einfach nicht mit dem Standpunkt anfreunden, dass darin lediglich Informationen über alte Feste gesammelt werden.«
»Darüber können wir gern reden, aber nicht jetzt. Ich muss erst meinen Jahresbericht schreiben.«
»Denn wenn man nur Informationen über alte Feste sammelt, findet man demnächst keine mehr über neuere Feste, sobald die für unsere Arbeit interessant geworden sind.«
»Das werden sie nicht, weil ihre Verbreitung derzeit ganz anders verläuft.«
»Das möchte ich dann doch erst mal bewiesen haben.«
»Gut, wir werden darüber reden, aber erst kommt der Jahresbericht.«
»Im Prinzip gibt es nämlich keinen Unterschied zwischen einem alten und einem neuen Fest.«
»Nein, aber erst der Jahresbericht.«
»Dann lege ich die Ausschnitte vorläufig noch zur Seite.«
»Gut.« Er beugte sich wieder über den Text, während Bart den Raum verließ. Während er so dasaß, schweiften seine Gedanken ab. Er lauschte. In seinem Kopf bildeten sich die Worte eines Liedes: Ich will bei dir sein, / ich lass dich nicht los, / doch du darfst nicht schrei’n, / ich bin ja bei dir / du bist schon groß, / du bist schon groß. – Die letzten Zeilen sang er mit, jedoch ohne Ton, und wurde dabei von einem Gefühl der Sehnsucht überflutet.
*
»Balk hat etwas dagegen, dass ich noch Neujahrskarten verschicke, jetzt, wo ich hier nicht mehr arbeite«, sagte Beerta. Er stand an seinem Schreibtisch und sah Maarten bestürzt an.
»Weil sie dann nicht wissen, wer hier Direktor ist«, vermutete Maarten.
»Ja, so etwas in der Art, denke ich.«
Maarten zog seinen Stuhl unter dem Schreibtisch hervor und setzte sich.
»Was soll ich jetzt machen? Denn ich kriege immer noch Neujahrskarten, und die werde ich doch beantworten müssen.«
»Wie viele verschicken Sie sonst immer?«
»Sicher achtzig, vielleicht sogar hundert. Ich sitze natürlich noch in einer ganzen Reihe von Kommissionen, und die Karten des Büros sind gerade dafür so praktisch, denn da steht auch der Name des Büros drauf, sonst weiß man ja noch nicht einmal, von wem sie kommen.«
Maarten dachte nach. »Wie viele von diesen Leuten fallen unter meine Abteilung?«
»Die meisten.«
»Schreiben Sie die dann auf jeden Fall und geben Sie sie mir, dann setze ich meinen Namen auch darunter.«
»Würde Balk nichts dagegen haben?«, fragte Beerta unsicher.
»Nein, natürlich nicht. Ich darf doch wohl Neujahrskarten verschicken?«
»Na dann, auf deine Verantwortung«, sagte Beerta erleichtert. Er wandte sich ab und setzte sich hin. »Ich bin natürlich froh darüber.«
Beertas Angst vor Balk ließ Maarten wieder zweifeln, doch da er es nun einmal entschieden hatte, konnte er nicht mehr zurück. Dennoch wurde er den ganzen weiteren Vormittag das Gefühl nicht los, dass da etwas Unangenehmes war, doch da er nicht darüber nachdenken wollte, was es sein könnte, klang es allmählich ab.
*
1966
Frans hob seine Umhängetasche auf den Schoß und löste die Schnallen. »Ich habe hier noch etwas zu deinem Geburtstag.« Er zog eine Karte in einem Plastikumschlag aus der Tasche und überreichte sie Nicolien.
Maarten sah von der Couch aus zu.
»Wie schön!«, sagte sie überrascht. Sie gab Maarten die Karte. »Frans’ Schnecke.«
Es war eine Abbildung der Schnecke in Aquarell, mit einer Apfelschale auf einem blauen chinesischen Teller vor einem schwarzen Hintergrund.
»Findest du sie schön?«, fragte Frans unsicher. Er war rot geworden.
»Ich finde sie unheimlich schön.«
»Verdammt hübsch«, fand Maarten. Er gab Nicolien die Karte zurück. »Mag sie Apfelschalen?«
»Ja, Apfelschalen findet sie lecker.« Er sah noch einmal in seine Tasche und zog ein Taschenbuch heraus:Ist das ein Mensch?von Primo Levi. »Und das gebe ich mal wieder zurück.« Er zögerte kurz, unsicher, wem er es geben sollte.
Maarten nahm es ihm ab.
»Wie fandest du es?«, fragte Nicolien.
»Um ehrlich zu sein: Ich habe es nicht gelesen.« Er errötete.
Maarten blätterte ein wenig in dem Buch und legte es dann zwischen ihnen auf den Tisch.
»Fandest du es zu schlimm?«, fragte Nicolien.
»Ja, eigentlich schon. Ich habe schon genügend Elend mit mir selbst, nicht wahr?« Er sah sie unsicher an und richtete seinen Blick dann auf Maarten.
»Ja, verrückt, nicht?«, sagte sie.
»Ja, so bin ich nun mal.« Frans streckte die Hand aus und drehte das Buch um, die Abbildung des Muselmanen auf dem Umschlag nach unten, wobei er erneut rot wurde.
»Und du willst es auch lieber nicht sehen«, vermutete sie.
Er erschrak. »Nein … ach, er hat natürlich schon ein Recht darauf, aber …« Er zögerte.
»Aber du denkst, dass du es deshalb noch lange nicht zu sehen brauchst«, ergänzte sie.
»Ja«, sagte er zögernd, »ja, vielleicht ist das so.« Er sah sie hilflos an. »Findest du das ungehörig?«
Sie lachten, und er lachte selbst nun auch.
»Wenn ich so etwas lese, macht es mich gerade stärker«, sagte sie.
»Nein, das ist bei mir nicht so. Es macht mich nur traurig.«
»Noch trauriger«, vermutete Maarten.
»Ja«, sagte er unsicher, »aber das ist natürlich nicht richtig.«
»Ach«, sagte Maarten, »jeder hat seine eigenen Therapien.«
»Ja, so denke ich eigentlich auch darüber«, sagte er dankbar.
Sie schwiegen.
»Möchtest du Kaffee?«, fragte Nicolien. Sie stand auf und ging in die Küche.
»Wie geht es dir jetzt?«, fragte Maarten. Er griff zum Tabak und begann, seine Pfeife zu stopfen.
»Ganz gut.«
Maarten lachte. »Nicoliens Mutter sagt dann: ›Danke, ich soll dich grüßen.‹«
»Ja, so ungefähr.« Er lachte ein wenig. »Ich bin wieder mal bei van der Meer gewesen.«
»Warum?«
»Wegen dieser Frau Koppejan.«
Maarten zog den Kopf zurück, die Hälfte eines Nickens.
»Ich habe Tabletten bekommen, um meine Libido zu steuern.«
»War das nötig?«
»Sonst komme ich nie von ihr los.« Er sah Maarten flüchtig an. »Findest du das verkehrt?«
»Ach, verkehrt …«
»Wenn ich keine Tabletten nehme, sitze ich den ganzen Tag da und denke an sie«, entschuldigte sich Frans. »Schon der Anblick ihres Fahrrads bringt mich durcheinander. Wenn ich ihre Schreibmaschine höre, werde ich völlig verrückt. Und wenn sie auch nur ein Wort zu mir sagt, geht mir das den ganzen Tag im Kopf herum.«
»Wenn du so eine Tablette nimmst, hast du das nicht?«, fragte Maarten skeptisch.
»Nein, obwohl … Neulich hatte ich eine Tablette genommen, und da habe ich trotzdem noch halb und halb mit ihr vereinbart, zu zweit einen Garten zu nehmen, und dann habe ich sofort wieder allerlei Phantasien über nachts zusammen schlafen und so …«
»In der freien Natur.«
Frans lächelte. »Ja, aber das ist natürlich nicht gut.« Er sah Maarten unsicher an. »Findest du nicht auch?«
»Ich habe nichts dagegen«, versicherte Maarten schmunzelnd, »aber ich bin nicht der liebe Gott.«
»Nein, das bin ich selbst«, gab Frans zu.
Nicolien kam mit dem Kaffee herein.
»Frans nimmt wieder Tabletten«, erzählte Maarten, »gegen seine Libido.«
»O ja?«, fragte sie erstaunt.
»Gegen Frau Koppejan«, erklärte Frans. »Es fing an, mir wieder alles ein bisschen über den Kopf zu wachsen.«
»Und funktioniert das denn?«
»Ja, wenn ich eine Tablette nehme, kann ich ruhig ihr Fahrrad stehen sehen, ohne dass etwas passiert.«
»Komisch.«
»Ja, komisch«, fand auch Maarten.
»Ach, wenn es denn hilft, habe ich damit keine Probleme. Ich hatte schon vor, mich sonst mal wieder krankzumelden.«
»Krankmelden ist auch so was«, fand Maarten.
»Ja, dagegen hast du etwas, nicht wahr?«, fragte Frans.
»Wir haben jetzt einen Hausmeister, der sich alle naselang krankmeldet«, erzählte Maarten, »und wenn er nicht selbst krank ist, will er früher nach Hause, weil es seiner Frau nicht gut geht. Der Mann müsste jeden Tag, gleich beim Aufstehen, eine Tracht Prügel bekommen, mit einem Stock.« Der letzte Satz klang sehr rachsüchtig.
»Das finde ich, um ehrlich zu sein, ziemlich faschistisch«, sagte Frans und sah rasch zu Nicolien.
»Ja, ich auch«, sagte sie scharf. »Und ich bin auch nicht deiner Meinung!«
»In diesen Dingen bin ich ein Faschist«, sagte Maarten zufrieden. »Das ist mir völlig egal. Darin bin ich schon etwas komisch!«
»Na ja, ich kann es mir schon vorstellen«, sagte Frans. »Ich habe das auch manchmal.«