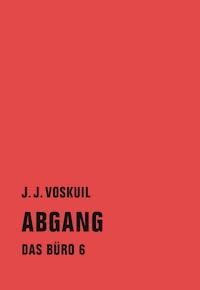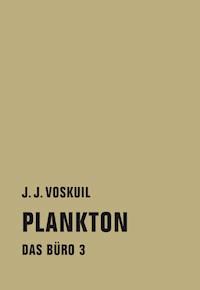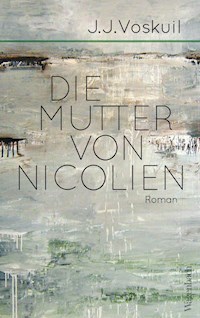Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Klaus Wagenbach
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nicolien begrüßt den Zuzug der neuen Nachbarn ins Mehrparteienhaus überschwänglich. Ihr Mann Maarten hingegen beschließt nach nur einer Begegnung, die beiden Männer völlig uninteressant zu finden. Der Kontakt zu Petrus und Peer ist zunächst bemüht freundlich, nimmt dann zusehends groteske Formen an. Die Auseinandersetzungen zwischen Maarten und Nicolien über die Nachbarn im Speziellen und Außenseiter im Allgemeinen werden immer fundamentaler. In fulminanten Streitszenen schafft J.J. Voskuil das bewegende und vor allem urkomische Porträt einer Ehe im Zeichen einer unlösbaren Frage. Dieses Puzzlestück aus Voskuils literarischem Universum, wie immer kongenial übersetzt von Gerd Busse, durfte erst nach dem Tod des Autors veröffentlicht werden. Zu groß war die Sorge, das Porträt der misslingenden Freundschaft könnte die realen Vorbilder verdrießen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In der Erkundung des Lebens von Maarten und Nicolien lotet J. J. Voskuil jede Ecke und vor allem jede Kante aus. Ihre Auseinandersetzungen über die Nachbarn im Speziellen und Außenseiter im Allgemeinen sind fundamental. Ein wahnwitziges Ehedrama, ein Drahtseilakt ohne Publikum.
»Jeder hadert schon mal mit den Nachbarn, aber niemand kann darüber ein so treffsicheres, erschütterndes und dennoch humorvolles Buch schreiben wie J. J. Voskuil.« Gerbrand Bakker
J.J. Voskuil
Die Nachbarn
Roman
Aus dem Niederländischen von Gerd Busse
Verlag Klaus Wagenbach Berlin
Vorwort
Im Jahr 2001 hatte mein Mann die Arbeit an Die Nachbarn abgeschlossen und wollte den Roman nun veröffentlichen. Ich las das Manuskript und war nicht so begeistert. Es wurde darin wieder einmal sehr viel gestritten, doch mein größter Einwand war, dass es die Gefühle eines der Hauptprotagonisten verletzen würde. Also sah mein Mann von einer Veröffentlichung ab.
Als er im Jahr 2008 starb, lebte dieser Hauptprotagonist noch. Vor Kurzem, im Jahr 2011, starb er. Mein stärkster Einwand war damit hinfällig geworden. Ich fühle mich meinem verstorbenen Mann gegenüber deshalb dazu verpflichtet, mich über meinen schwächeren Einwand, die Streitereien zwischen ihm und mir, hinwegzusetzen und das Buch doch noch zu veröffentlichen. Es ist natürlich ein wunderbares Buch.
Amsterdam, 12. Juli 2011
Lousje Voskuil-Haspers
Im Hinterhaus gab es einen Großhandel mit Toilettenschüsseln. Nur ein Mann arbeitete dort. Er kam immer um neun Uhr, wenn ich schon auf der Arbeit war, und ging um fünf, bevor ich wieder nach Hause zurückkehrte. Nicolien hörte ihn beim Spülen. Er ging dann über den kleinen Flur, stieg die neun Stufen zum Hinterhaus hinauf, öffnete die Eingangstür und schloss sie leise. Den Rest des Tages bekam sie nichts von ihm mit, bis er wieder ging. Es fanden sich auch keine Besucher ein.
»Es ist ein alter Mann, glaube ich«, sagte sie.
»Hast du ihn denn mal gesehen?«, fragte ich.
»Nein, das kann ich hören.«
*
Es klingelte. Ich öffnete, und dort stand ein alter Mann mit grauem gewelltem Haar in einem schlecht sitzenden, etwas zu großen grauen Anzug.
»Ich bin der Geschäftsführer von Fecalo, von hier hinten«, sagte er. »Darf ich Sie was fragen?«
Ich bat ihn herein. Er stellte sich vor, aber ich vergaß seinen Namen gleich wieder. Wir waren gerade dabei, einen Schnaps zu trinken, und ich bot ihm auch einen an. Er lehnte das nicht ab.
»Die Sache ist die, dass wir umziehen«, sagte er, nachdem er einen Schluck genommen hatte, »und da wollte ich Sie fragen, ob Sie mir vielleicht die Post nachschicken könnten, falls etwas eintreffen sollte.«
»Sie ziehen um!«, sagte ich überrascht.
Er nickte. »Ende des Monats.«
»Das ist schade.«
»Finde ich auch, aber es ging nicht anders.«
»Weil wir in Ihnen immer einen guten Nachbarn gehabt haben.« Ich sah, Bestätigung suchend, zu Nicolien hinüber.
»Ja«, sagte sie.
»Und ich in Ihnen«, erwiderte er höflich.
Es entstand eine Pause, in der ich die Nachricht verarbeitete.
»Wo ziehen Sie hin?«, fragte ich.
»Nach Krommenie.«
»Krommenie!«
»Dort sind wir für unsere Kunden besser erreichbar.«
»Haben Sie denn viele Besuche von Kunden?«
Er zögerte. »Ziemlich.« Er zögerte erneut. »Aber wir regeln natürlich auch viel telefonisch.«
»Wie konntest du das bloß fragen?«, sagte sie, als er weg war. »Das ist doch furchtbar peinlich. Er hat nie Besuche von Kunden.«
»Es ist mir rausgerutscht, bevor ich überlegt hatte.«
»Du musst wirklich besser überlegen, bevor du mit solchen Dingen herausplatzt.«
Sie hatte recht. Ich fühlte mich schuldig.
*
Nachdem er ausgezogen war, stand seine Wohnung ein paar Monate leer. Eines Morgens, ich rasierte mich gerade im Badezimmer, setzte im Haus plötzlich Lärm ein: eilige Schritte auf der Treppe, laute Stimmen, Geschleppe von Holz. Durch die Mattglasscheibe in unserer Wohnungstür sahen wir, dass Tageslicht in den Flur fiel durch die geöffnete Tür, hinter der sich Fecalo befunden hatte. In diesem Licht gingen Schemen ein und aus, stiegen die Treppe hinauf und hinunter. Eine Dreiviertelstunde später war es wieder still, doch die Tür stand noch offen.
»Sind sie weg?«, fragte Nicolien und hielt mir die Wohnungstür auf.
»Sie werden wohl wieder zurückkommen«, prophezeite ich und sah nach oben.
Sie rief mich auf der Arbeit an. »Sie sind wieder da.« Im Hintergrund hörte ich gewaltigen Lärm.
»Was machen sie denn?«
»Sie hämmern und sägen. Und haben das Radio auf volle Lautstärke gestellt. Hörst du das nicht?«
»Doch, ich höre es.«
»Furchtbar! Ich weiß einfach nicht, wo ich noch hin soll.« Ihre Stimme klang verzweifelt.
»Mach doch die Wohnzimmertür zu.«
»Und was ist mit den Katzen? Die müssen doch rein und raus? Wie stellst du dir das vor? Ich kann ihnen doch nicht ständig die Tür aufmachen? Dann werde ich verrückt.«
»Es wird schon nicht so lange dauern.«
Es dauerte ungefähr drei Wochen. Danach wurde es erneut still, bis wir eines Samstagabends, als wir gerade im Bett lagen, auf der Treppe ein Poltern hörten.
»Hörst du das?«, fragte sie.
»Ich höre es.«
»Was könnte das sein?«
»Keine Ahnung.«
»Willst du mal nachschauen?«
Ich stieg aus dem Bett, ging ins Wohnzimmer und sah aus dem Fenster. Vor dem Haus, im Licht der Laterne, stand ein kleiner Wagen der Fahrzeugvermietung Ouke Baas. Drei oder vier Männer und eine Frau zogen Möbel und Kartons heraus und trugen sie ins Haus. Ich ging zur Wohnungstür. Das Licht im Flur war an. Man hörte sie keuchend die Treppe hinaufkommen, hin und wieder kurz innehalten, gedämpft miteinander reden und herumpoltern. Ich sah ihre Schemen durch die offene Tür ins Hinterhaus gehen.
»Sie ziehen ein«, berichtete ich, als ich wieder ins Schlafzimmer kam.
»Samstagnachts?«, fragte sie verwundert.
»Vielleicht, weil es dann auf der Gracht ruhig ist?«
»Waren das denn keine Möbelpacker?«
»Es waren drei oder vier Männer und eine Frau.«
»Da wird doch wohl kein Ehepaar einziehen?«
»Ich habe keine Ahnung.«
»Denn ich habe keine Lust, hier einen Hausfrauenclub zu eröffnen.«
»Ach.«
»Um sich dann sicher gegenseitig zum Kaffee oder Tee einzuladen. Ich denke gar nicht dran!«
»Das hast du doch selbst in der Hand?«
»Schrecklich würde ich das finden!«
»Warte doch erst mal ab«, beschwichtigte ich. »Wenn es so weit ist, kannst du ja immer noch schauen, was du machst.«
Am Montag darauf rief sie mich wieder auf der Arbeit an. »Sie haben auch ein Klavier mitgebracht.«
»Dieselben Leute?«, fragte ich ungläubig.
»Nein, diesmal waren es echte Möbelpacker, aber sie haben das Treppengeländer aus der Wand gerissen. Das hängt jetzt völlig lose daneben.«
»Und die neuen Nachbarn?«
»Die habe ich nicht gesehen.«
Die bekamen wir auch nicht zu sehen. Aber ich entdeckte am nächsten Morgen, als ich zur Arbeit ging, neben der Türklingel ein Namensschild: drs. P. Stallinga. Außerdem hatte jemand das Treppengeländer repariert, ohne dass wir etwas davon mitbekommen hatten. Der Name Stallinga kam mir vage bekannt vor, aber ich konnte ihn nicht einordnen.
»Er ist auf jeden Fall Friese«, sagte ich.
»Woher willst du das denn wissen?« Solche wilden Vermutungen irritierten sie.
»Weil sein Name auf ein A endet.«
»Das heißt doch nichts. Deswegen muss er doch kein Friese sein?«
»Und der Anfangsbuchstabe seines Vornamens ist ein P. Also wird er wohl Pier heißen. Pier Stallinga. Und er ist Doctorandus, also Akademiker.«
*
Je mehr Zeit verging, desto sicherer waren wir uns, dass drs. P. Stallinga allein war. Das versöhnte Nicolien mit seiner Anwesenheit. Alleinstehende Männer genossen von vornherein ihre Sympathie.
»Er wird doch wohl mal vorbeikommen, um sich vorzustellen?«, merkte sie an, als wir nach drei Wochen noch immer nichts von ihm gehört hatten.
Aber er kam nicht, um sich vorzustellen. Im Gegenteil, wenn er zufällig zeitgleich die Wohnung verlassen wollte und einen von uns im Flur hörte, zog er sich eilends zurück und wartete, bis er unsere Tür zuschlagen hörte. Das war nicht immer einfach, weil er morgens ungefähr zur gleichen Zeit wie ich das Haus verließ und abends auch um dieselbe Uhrzeit heimkam. Außerdem nahm er für den Weg zur Arbeit das Fahrrad, und wenn er es morgens aus dem Souterrain holte, bevor ich die Wohnung verlassen hatte, konnte es geschehen, dass er es gerade auf die Straße stellte, wenn ich die Haustür aufmachte oder mich schon auf der Straße umdrehte, um Nicolien zuzuwinken. In diesen Fällen zog er sich hastig mitsamt seinem Fahrrad zurück, aber nicht schnell genug, um bei mir nicht den Eindruck eines alternden Wichtelmännchens mit dünnem Bärtchen – nicht mehr als ein paar lose Haare – und auffallend schiefem Blick zu hinterlassen. Nachdem das ein paarmal passiert war, wartete er fortan hinter seiner Wohnungstür, bis er mich weggehen hörte. Dieses Verhalten, das mich köstlich amüsierte, verstärkte Nicoliens Sympathie und versöhnte sie mit der neuen Situation.
*
In den Jahren, die Stallinga allein im Hinterhaus wohnte, sah ich ihn nur ein einziges Mal aus der Nähe. Ich kam von der Arbeit und kaufte, so wie jeden Tag, im Athenaeum Nieuwscentrum die Zeitung. Da sah ich Stallinga draußen stehen und sein Fahrrad abschließen, ein kleines, grünes Sportrad. Er sah mich nicht, ging mit steifen, krummen Schritten hinein, hantierte ungeschickt mit seinem Portemonnaie, drehte sich mit der Zeitung in der Hand um und stand plötzlich direkt vor mir. Ich grüßte ihn lächelnd, mit einem leichten Nicken. Er reagierte nicht. Als ich hinter ihm aus der Halle ging, sah ich, wie er, das Fahrrad mit beiden Händen festhaltend, den Nieuwezijds Voorburgwal überquerte, umständlich aufstieg und langsam davonfuhr, tief über den Lenker gebeugt, die Ellbogen weit von sich abgespreizt. Er fuhr so langsam, dass ich eine Weile auf dem Bürgersteig auf der anderen Seite mit ihm Schritt halten konnte. Erst als wir uns dem Königlichen Palast näherten und ich vor der Ampel an der Raadhuisstraat warten musste, gewann er einen Vorsprung und verschwand im Verkehr. Aus der Tatsache, dass ich ihm nie wieder im Nieuwscentrum begegnete, schloss ich, dass er mich wohl gesehen hatte und, um ein zweites Aufeinandertreffen zu vermeiden, fortan irgendwo anders seine Zeitung kaufte.
*
Ich stand in der Küche und bereitete mein Müsli für den nächsten Morgen zu, als ich hörte, wie sich bei Stallinga die Tür öffnete. Das Licht auf dem Treppenabsatz ging an.
»Na denn, tschüss!«, sagte jemand.
»Tschüss«, sagte eine andere, jüngere Männerstimme. Worauf ein paar schmatzende Küsse folgten. Schritte auf der Treppe nach unten.
»Tschüss«, sagte die erste Stimme noch einmal, von oben.
»Tschüss«, antwortete die zweite, dicht vor unserer Wohnungstür. Kurz darauf schlug die Eingangstür des Hauses zu, danach wurde Stallingas Tür leise geschlossen.
»Stallinga hatte Besuch«, berichtete ich, als ich ins Wohnzimmer kam.
»O ja?«, fragte sie verwundert. »Den hat er doch sonst nie.«
»Nein.« Dass sie sich zum Abschied geküsst hatten, behielt ich für mich.
Als ich nach Hause kam, saßen Freek und sein Freund im Schatten des Hauses vor den offenen Türen des Souterrains, einen kleinen Tisch mit Nüssen und Käse zwischen sich, und tranken ein Glas Wein. Ich blieb stehen. Sie boten mir auch ein Glas an, das ich jedoch ausschlug, weil Nicolien oben wartete, um einen Schnaps zu trinken. Während ich dastand, traf ein junger Mann mit einer Matratze auf dem Rücken ein. Er nickte verlegen, stieg die Treppe zur Eingangstür hinauf und klingelte. »Das geht gut«, sagte Freek, der ihn mit Interesse beobachtet hatte. Der junge Mann lachte ein wenig, durch die Matratze über seinem Kopf in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Ich schätzte ihn auf zwischen dreißig und vierzig. Er hatte ein ausdrucksarmes Gesicht mit ungesunder, blasser Haut. »Petrus!«, rief er in den Gegensprecher. Die Tür sprang auf, und er ging ins Haus.
»Wer ist das?«, fragte ich.
»Ich glaube, der neue Freund von Stallinga«, antwortete Freek.
»Ich wusste gar nicht, dass er einen Freund hat«, sagte ich erstaunt.
»Nein, eine gesunde Situation ist es da nicht.«
Sein Freund musste darüber genüsslich lachen.
»Stallinga hat einen Freund«, erzählte ich.
»Wie kommst du darauf?«, fragte sie.
»Da ist ein junger Mann nach oben gegangen, der eine Matratze auf dem Rücken trug.«
»Aber das muss doch noch kein Freund sein?«
»Freek zufolge ist das sein Freund.«
»Ja, Freek! Der findet das natürlich lustig, so was zu sagen. Der glaubt, dass jeder homosexuell ist. Das hätte er gern.«
»Was denn dann?«
»Das kann genauso gut ein Neffe sein, der eine Stelle in Amsterdam bekommen hat und jetzt bei ihm wohnt, bis er ein Zimmer gefunden hat?«
»Das ist möglich, scheint mir aber nicht wahrscheinlich.«
»Immer gleich zu sagen, dass einer homosexuell ist«, sagte sie. »Auf mich wirkt er überhaupt nicht wie ein Homosexueller. Er ist ein alleinstehender Mann, so wie Frans Veen. Über den sagst du doch auch nicht, dass er homosexuell ist?«
Vielleicht war es also sein Neffe, aber eine Stelle hatte er sicher nicht. Er verließ die Wohnung selten. Und wenn er rausging, meist nachmittags und nur für kurze Zeit, wartete er an der Wohnungstür, genauso wie Stallinga, bis es still war. Das einzige Mal, an dem Nicolien etwas bemerkte, hörte sie ihn fast geräuschlos vorbeilaufen, so als würde er auf Pantoffeln gehen.
Dass er kein Logiergast war, zeigte sich nach ein paar Monaten unzweideutig. Als ich nach Hause kam, fand ich an der Klingel und dem Postfach Stallingas neue Namensschilder vor: Petrus Stallinga – Peer de Graaf.
»Siehst du jetzt, dass er überhaupt nicht Pier heißt?«, sagte Nicolien. »Er ist also gar kein Friese.«
*
Wir kamen spät nach Hause. Als wir gerade die Wohnung betreten hatten und ich die Betten aufschlug, klingelte es.
»Wer kann das denn so spät noch sein?«, fragte Nicolien.
Ich öffnete die Wohnungstür und sah Stallinga und seinen Freund vor mir auf dem Treppenabsatz stehen. Beide trugen eine große, flache Mütze auf dem Kopf, so dass ich sie nicht gleich erkannte. In ihren Jacken, Stallinga mit einem Täschchen, das an einem Lederriemen quer über seiner Brust hing, ähnelten sie zwei etwas zu groß geratenen Wichtelmännchen. Sie grinsten.
»Die Schlüssel«, sagte Stallinga und zeigte auf die Tür. Mein Schlüsselbund steckte noch im Schloss. »Das ist gefährlich.«
»Sehr gefährlich«, echote sein Freund.
»Vielen Dank«, sagte ich verblüfft und zog die Schlüssel aus dem Schloss.
Stallinga hatte sich bereits abgewandt und stieg die Treppe hoch zu seiner Wohnungstür.
»Schlafen Sie gut«, sagte der Freund noch.
»Was war das?«, fragte Nicolien, die in den Flur kam.
»Die Stallingas. Ich hatte den Schlüssel im Schloss stecken lassen.«
»Wie nett«, fand sie. »Du hast dich hoffentlich bei ihnen bedankt?«
*
Sie rief mich am späten Nachmittag auf meiner Arbeit an. »Du rätst nie, wo ich gewesen bin!« Ihre Stimme klang aufgeregt.
»Nein«, gab ich zu.
»Bei Stallinga und seinem Freund. Ich habe da Tee getrunken.«
»Hey.«
»Du sagst das so uninteressiert. Überrascht dich das nicht?«
»Doch, schon. Natürlich.«
»Warum reagierst du dann nicht anders?«
»Tja, das weiß ich nicht.« Ich war nicht allein im Raum und versuchte so neutral wie möglich zu antworten.
»Na, dann leg ich mal wieder auf«, sagte sie verstimmt. »Dann erzähle ich es eben nicht, wenn du kein Interesse daran hast.«
»Gut, dann bis später.«
»Bis später«, sagte sie böse.
Ich legte den Hörer auf, wartete ein paar Minuten und verließ dann den Raum. Aus einem leeren Arbeitszimmer rief ich sie zurück. »Du weißt doch, dass ich nicht reagieren kann, wenn ich nicht allein bin. Das würde dir genauso gehen. Das habe ich doch bestimmt schon hundertmal gesagt.«
»Deine Arbeit ist sicher wieder wichtiger.«
»Meine Arbeit ist nicht wichtiger, aber wenn jemand in der Nähe ist, kann ich nun mal nicht über persönliche Dinge reden.«
Sie schwieg.
»Was war denn nun?«
»Jetzt habe ich keine Lust mehr, es zu erzählen.«
»Erzähl schon. Es interessiert mich.«
»Ich habe Peer auf dem Flur getroffen«, sagte sie unwillig, »und er fragte, ob ich auf eine Tasse Tee vorbeikommen wolle. Das ist alles.«
»Und Stallinga?«
»Der war natürlich auch dabei.«
»War er denn nicht auf der Arbeit?«
»Nein, er ist vorigen Monat in Rente gegangen.« Die Worte kamen nur widerwillig heraus.
»In Rente!«
»Es sind unheimlich nette Leute!«
»Das ist schön.« Es klang pflichtschuldig, aber ich wusste nicht, wie ich es anders sagen sollte.
Einen Augenblick lang herrschte Schweigen. »Ich habe gefragt, ob sie heute Abend vorbeikommen wollen, um etwas zu trinken«, sagte sie daraufhin, »weil sie dich dann auch kennenlernen können. Ist das für dich in Ordnung?« An ihrer Stimme konnte ich hören, dass sie sich nicht sicher war.
»Natürlich ist das für mich in Ordnung!« Ich hatte zwar wenig Lust darauf, fand, dass es nicht zu ihr passte, und nach dem, was ich von den beiden gesehen hatte, hatte ich auch kein Bedürfnis, ihre nähere Bekanntschaft zu machen. Aber es war nicht der Moment, mir das anmerken zu lassen.
»Petrus Stallinga«, sagte er und streckte die Hand aus, noch bevor er einen Fuß über die Schwelle gesetzt hatte. Ohne irgendetwas um ihn herum zu beachten, ging er vor mir her durch den Flur, während Peer neugierig betrachtete, was im Flur und im Wohnzimmer an der Wand hing.
Nicolien war aufgestanden. »Schön, dass ihr da seid«, sagte sie verlegen und gab ihnen die Hand.
»Setzt euch«, sagte ich.
»Dann werde ich mich mal hierhin setzen«, beschloss Stallinga. Er nahm den größten Sessel, in dem Nicolien vorher gesessen hatte, legte seine Schultertasche ab und stellte sie neben sich auf den Boden.
»Ihr Wohnzimmer ist größer als unseres, nicht wahr, Petrus?«, bemerkte Peer.
»Natürlich!«, sagte Stallinga. »Sie wohnen nach vorne raus!«
»Wollt ihr Kaffee?«, fragte Nicolien.
Während sie in der Küche war, sprachen wir über das Haus. Stallinga hatte dazu, wie er angab, eine Literaturrecherche durchgeführt. Umständlich erzählte er, was er herausgefunden hatte. Sein Ton war so trocken und unbeteiligt, als würde er ein Referat vorlesen. Zusätzlich hatte er ein unangenehmes, etwas mürrisches Gesicht mit merkwürdig schrägen Augen; sein gelber Teint gab ihm etwas Asiatisches. Dieser Eindruck wurde durch ein dünnes Ho-Chi-Minh-Bärtchen noch verstärkt. Unter dem Bart trug er eine Fliege sowie eine Strickjacke mit Taschen über einem gestreiften Hemd. Peer war in ein T-Shirt und eine weite Pluderhose gekleidet. Erneut fiel mir auf, dass er eine fahle, ungesunde Hautfarbe hatte, auch wenn er sicher zwanzig Jahre jünger war als Stallinga. Jetzt, wo ich ihn besser sehen konnte, machte ich auch etwas Unreinliches an ihm aus und einen seltsam unstetigen Blick. Während Stallinga dasaß und redete, sah er sich um, ohne zuzuhören.
»Bist du eigentlich Friese?«, fragte ich, als Nicolien wieder im Raum war.
»Natürlich bin ich Friese!«, sagte Stallinga, als würde allein die Vermutung, dass dem nicht so wäre, seine Empörung wecken.
Das amüsierte mich – ein kleiner Triumph. Weil du nicht Pier heißt, wollte ich noch sagen, aber diesen teuflischen Gedanken behielt ich für mich. »Aus welchem Teil Frieslands?«
»Nein, ich bin nicht in Friesland geboren.«
»Wo denn?«
Er zögerte. »In Den Haag.«
»Da kommen wir auch her«, sagte ich überrascht.
»Ich komme aus Rotterdam!«, protestierte Nicolien.
»Nicolien ist in Rotterdam geboren«, korrigierte ich. »Als sie drei war, sind ihre Eltern nach Den Haag gezogen.«
»Aber ich bin eine Rotterdamerin!«
Stallinga reagierte nicht darauf. Er machte nicht den Eindruck, dass es ihn interessierte.
»Wo in Den Haag hast du gewohnt?«, fragte ich.
Wieder zögerte er.
»Wir haben in der Vruchtenbuurt gewohnt«, half ich.
»Im Bezuidenhout«, sagte er unwillig.
»Dann hast du die Bombardierung mitgemacht.«
»Nein«, er schüttelte träge den Kopf, »denn zu dem Zeitpunkt saß ich im Versteck.«
»In Brabant, nicht wahr Petrus?«, sagte Peer. »Wo ich herkomme.«
»Ja, aber da warst du noch nicht geboren.« Sein Gesicht hatte sich plötzlich verändert. Der Blick, mit dem er Peer ansah, war freundlich.
»Nein, ich war noch nicht geboren.« Er lachte genüsslich.
»Wo warst du untergetaucht?«, fragte ich.
Er sah mich an. Die Freundlichkeit verschwand aus seinem Gesicht. Meine Fragen weckten seinen Argwohn. »Dazu müsste ich Namen nennen, und das tue ich lieber nicht.«
»Ich meine: bei Bauern oder in einem Dorf?«
»Auf dem Land.«
»Deswegen geht Petrus auch immer noch zur Totengedenkfeier auf dem Dam«, sagte Peer.
»Nicht deswegen«, korrigierte Stallinga. »Das würde ich sowieso machen.«
»Nein, wegen des Krieges natürlich«, kam ihm Peer entgegen.
»Hältst du das nicht für ein Kasperletheater?«, fragte ich.
Petrus sah mich verständnislos an. »Warum sollte ich das für ein Kasperletheater halten?«
»Wenn man sieht, wer da alles hingeht.«
»Mit anderen habe ich nichts zu schaffen.«
»Ärgerst du dich nicht über die Sensationsmacherei?«
Verärgert schüttelte er den Kopf. »Ich finde, dass es unsere Pflicht ist, der Opfer zu gedenken.«
»Das ginge auch anders.«
»Wenn sie nicht für unsere Freiheit gekämpft hätten, würden wir jetzt nicht hier sitzen.«
»Ich bin auch früher nicht gegangen«, sagte Peer, »aber jetzt denke ich genauso darüber.«
Ich sah ihn amüsiert an. »Aber du bist doch nicht befreit worden? Du warst noch nicht mal geboren.«
Darüber musste er herzhaft lachen. »Nein, ich tue es auch für Petrus.«
»Du tust es nicht für mich«, verbesserte ihn Stallinga. »Du tust es, weil du erkannt hast, was wir ihnen zu verdanken haben.«
»Ja, natürlich«, sagte Peer. »Das natürlich auch.«
»Du musst Petrus nicht so viel fragen«, sagte Nicolien, als sie gegangen waren. »Ich glaube nicht, dass ihm das angenehm ist.«
»Aber ich muss das Gespräch doch am Laufen halten.«
»Das geht auch, ohne solche persönlichen Fragen zu stellen?«
»Ich fand das nicht persönlich.«
»Du kannst doch auch über etwas anderes reden?«
»Worüber denn?«
»Über Gott und die Welt.«
»Das kann ich nicht.«
»Bei mir zu Hause wurde immer über alltägliche Dinge geredet. Das fand ich gerade so gemütlich.«
»Dein Vater hat ansonsten nie etwas gesagt.«
»Nein, aber er saß immer mit dabei und hat dann gelacht. Ganz anders als dein Vater. Der hat einem ständig das Gefühl gegeben, dass man etwas Falsches gesagt hätte. Der hat nie ein Sterbenswörtchen gesagt.«
»Meine Mutter hat geredet.«
»Ja, über Liebe. Das war das Einzige, was deine Mutter interessiert hat. Na, meine Mutter war zum Glück nicht so.«
»Meine Mutter hat auch mal über etwas anderes geredet.«
»Nicht, wenn ich dabei war.«
Ich schwieg.
»Jedenfalls hatte ich den Eindruck, dass es Petrus nicht angenehm war.«
*
Eine Woche später statteten wir einen Gegenbesuch ab. Wir stiegen die Treppe hinauf. Nicolien drückte auf die Klingel. Man hörte den Klingelton. Als die Tür aufging, standen die beiden nebeneinander in einer kleinen, schwach beleuchteten Diele, um uns zu begrüßen.
»Erst mal die Wohnung ansehen«, sagte Peer, nachdem wir ausgiebig unsere Hände geschüttelt hatten – als hätte er sich schon darauf gefreut. Die Diele hatte vier Türen, er öffnete eine der beiden in der Mitte: ihr Schlafzimmer.
»Musst du das auch zeigen?«, fragte Petrus verschämt.
»Natürlich! Das ist doch das Wichtigste?«
Es war ein kleiner Zwischenraum, der fast zur Gänze von einem riesigen, niedrigen Doppelbett in Beschlag genommen wurde. Neben dem Kopfende war an der Wand eine Leselampe befestigt, darüber befand sich ein kleines Bücherregal. Vor dem Fenster hing ein schwerer, dunkler Vorhang. Es roch muffig, als würde der Raum nicht gelüftet werden.
»Gesehen!«, sagte ich.
»Und das ist mein Zimmer.« Peer öffnete die Tür daneben und machte das Licht an: Leuchtstoffröhren.
Das Erste, was mir auffiel, war ein Klavier. Vor dem Fenster stand eine Werkbank, an der Wand ein Regal mit Werkzeugen. Ein Fahrrad hing an Haken von der Decke herab.
»Spielst du Klavier?«, fragte ich. Ich erinnerte mich jetzt, dass man bei Petrus’ Einzug ein Klavier hereingetragen hatte.
»Nein, Petrus. Nicht wahr, Petrus? Es ist ein Erbstück seiner Mutter.«
»Seit Peer da ist, nicht mehr so viel«, relativierte Petrus.
Wir standen mitten im Raum und sahen uns um. Hier war ein gewaltiges Gelump zusammengetragen worden: eine Couch, Holzreste, Kartons, ein Schrank, Fischernetze, Bilderrahmen, ein großer Ballen Vorhangstoff und in einer Ecke, dicht zusammengestellt, ein antiker Schrank und einige alte Möbel, die wahrscheinlich vor Peers Einzug das Zimmer verschönert hatten.
»Schön«, sagte ich.
»Ja«, sagte Nicolien.
»Und dann habe ich noch eine Dunkelkammer.« Er öffnete eine dritte Tür, die zur Dusche.
»Peer macht wunderbare Fotos«, erklärte Petrus.
»Ich werde euch gleich welche zeigen«, versprach Peer.
»Und wo duscht ihr dann?«, fragte ich, während ich ins Zimmer schaute. Unter der Dusche stand eine Spüle mit zwei Becken.
»Wenn man duschen will, kann man genauso gut ins Badehaus gehen«, fand Peer. »Ich habe mich immer unter dem Kran gewaschen. Das reicht.«
»Ach, wir auch«, pflichtete ihm Nicolien bei. »Als wir noch an der Lijnbaansgracht wohnten, haben wir uns auch in der Küche gewaschen. Das geht gut.«
»Hattet ihr zu Hause eine Dusche?«, fragte ich Petrus.
»Wir hatten ein Bad«, antwortete er trocken. »Aber ich brauche das nicht so.«
Sein eigenes Zimmer bildete das Gegenstück zu dem von Peer. Die einzigen Lichtquellen bestanden aus einer altmodischen Schreibtischlampe auf einem großen Diplomatenschreibtisch in der Ecke vor dem Fenster und einer alten Schirmlampe, die kleine Leuchtpunkte auf einen Schrank an der Seitenwand warf. Mitten im Zimmer stand eine mit grünem Leder bezogene Couch vor einem kleinen Tisch mit Perlmuttintarsien, an der anderen Wand ein Glasschrank mit Porzellan und Kristall. Nicolien und ich setzten uns auf die Couch, Petrus neben den Schreibtisch und Peer auf einen Stuhl mitten im Raum. Die Sofalehne war zu hoch, um meinen Arm daraufzulegen. Ich ließ mich etwas nach unten rutschen, um zu demonstrieren, dass ich mich behaglich fühlte. Direkt vor mir an der Wand neben dem Fenster hing ein Vogelkäfig, aus dem ein paar lange, dünne Stöcke ins Zimmer ragten. Auf einem der Stöckchen vor dem Käfig saß ein kleiner Vogel und schlief.
»Habt ihr einen Vogel?«, fragte ich.
»Das ist Pierewiet, unser Mitbewohner«, sagte Petrus. »Den hat Peer mitgebracht.«
»Es ist ein mosambikanischer Kanarienvogel«, fügte Peer hinzu. »Junge, der singt vielleicht schön. Unglaublich!«
»Aber ist das nicht langweilig für so einen Vogel, immer drinnen zu sein?«, fragte Nicolien besorgt.
»Nein, warum? Er hat doch zu fressen und zu trinken? Und er kann frei im Zimmer herumfliegen.«
»Und selbst wenn er es langweilig finden würde: Solange Peer seinen Spaß daran hat, ist es in Ordnung«, fand Petrus.
Es entstand eine unbehagliche Pause. Auf dem glatten Leder rutschte ich langsam immer tiefer. Ich zog mich wieder hoch und versuchte, mich an der Rückenlehne abzustützen.
»Habt ihr auch einen Brief vom Makler bekommen, dass sie die elektrischen Leitungen erneuern wollen?«, fragte Peer. »Petrus denkt darüber nach, ob er seine Zustimmung verweigern soll.«
»Warum?«, fragte ich.
»Er hat Angst, dass seine Antiquitäten gestohlen werden. Nicht wahr, Petrus?«
»Ich mag es nicht, wenn Fremde meine Wohnung betreten«, bestätigte Petrus.
»Aber du bist doch dabei?«, merkte Nicolien an.
»Sie werden es ja nicht gleich mitnehmen, sondern warten, bis man mal nicht da ist.«
»Das glaube ich kaum«, sagte ich.
»Wir sind schon ein paarmal von jemandem angerufen worden, der den Hörer sofort wieder aufgelegt hat«, fügte Peer hinzu. »Na, das scheint mir nicht koscher.«
»Das haben wir auch schon mal erlebt«, sagte Nicolien. »Das sind einfach Leute, die sich verwählt haben.«
»Die gibt es auch«, gab Peer zu, »aber ich würde an eurer Stelle trotzdem aufpassen.«
Nicolien lachte.
»Ich lass sie nicht rein!«, sagte Petrus entschlossen. »Ich werde dem Makler sagen, dass Peer die Leitungen selbst erneuern wird.«
»Kann Peer das?«, fragte ich.
»Peer kann alles.«
»Alles, was man mit den Händen machen kann«, präzisierte Peer.
Ich lachte. »Ich kann mit meinen Händen gar nichts.«
»Doch, natürlich«, sagte Nicolien. »Wenn was kaputt ist, reparierst du es meistens selbst.«
Ich schüttelte den Kopf. »Nein, ich kann nichts.«
»Ich kann eine ganze Menge«, sagte Petrus, »aber nicht so viel wie Peer. Das muss ich zugeben.«
Ich sah ihn an. Unvorstellbar, dass dieser Mann etwas anderes konnte als lesen.
»Mein Vater war Lehrer an der Handwerksschule«, erzählte Nicolien. »Der hat auch alles Mögliche selbst gemacht. Eigentlich war er Bauzeichner.«
»Nein, ich war auf der Kunstakademie«, sagte Peer. »Ich war Maler, also Kunstmaler.«
»Aber das gefiel dir nicht mehr«, stellte ich fest.
»Na ja, gefallen … Es war eher so, dass ich feststeckte. Frickelei. Nichts für mich. Verdammt noch mal!«
»Und du konntest deinen Stil nicht ändern?«
»Wenn man immer von links aufs Fahrrad gestiegen ist, kann man nicht mehr von rechts aufsteigen.«
Ich lachte. Er amüsierte mich.
»Und ich hatte Depressionen. Das kam noch dazu. Ich bin sogar eine Weile in einer Einrichtung gewesen.«
»Solltest du das wirklich erzählen?«, warnte Petrus.
»Warum nicht? Das dürfen sie doch wohl wissen?«
»Weil man damit besser nicht hausieren geht.«
»Na, das werden sie doch nicht ausnutzen? Ach was, dafür schäme ich mich kein Stück.«
»Wir haben einen Freund, der auch in einer Einrichtung gewesen ist«, erzählte ich, um deutlich zu machen, dass wir nicht ganz unbeleckt von diesen Dingen waren, »zwei sogar! Ich meine, zwei Freunde. Ja, im Übrigen auch zwei Einrichtungen.« Ich lachte.
»Siehst du«, sagte Peer zur Petrus. »Es ist nichts Besonderes.«
»Warst du depressiv oder panisch?«, fragte ich.
»Depressiv. Ich lief immerzu in der Straße auf und ab und konnte nichts mehr machen.«
»Ja, das ist depressiv. Und warum war das so?« Ich erinnerte mich an Nicoliens Warnung und fragte mich, ob ich zu weit ging. Aber so war ich nun mal. Außerdem interessierte es mich.
»Ja, warum war das so?« Er schien kein Problem damit zu haben. »Eigentlich kam alles zusammen. Ich hatte mit einem Ehepaar zusammengewohnt, doch die beiden zogen plötzlich weg. Und ich war in einen Jungen verliebt, aber meine Liebe wurde nicht erwidert. Da ist was zerbrochen. Es war Einsamkeit, glaube ich. Ich konnte plötzlich die Einsamkeit nicht mehr ertragen.« Er sah mich geradewegs an.
Ich nickte. »Hast du das nie erlebt, dass du einsam warst?«, fragte ich an Petrus gewandt.
Er schüttelte den Kopf. »Nein, ich kann es sehr gut ertragen, allein zu sein, wenn ich das so sagen darf.«
»Petrus kann unheimlich gut allein sein«, pflichtete ihm Peer bei.
»Es hat mich nur ziemlich bedrückt, immer bei irgendwelchen Zimmerwirtinnen zu wohnen«, fügte Petrus hinzu. »Darum habe ich auf Anraten von Freunden diese Wohnung hier genommen. Sie dachten, dass es mir dann besser gehen würde.« Während des Sprechens glitten seine Augen von mir ab, und er sah schräg zu Boden. Doch bei den letzten Worten richtete er den Blick wieder auf mich, als hätte er dort unten die Kraft gefunden, dem fremden Eindringling ins Antlitz zu blicken.
»Aber damals hast du dich doch schon manchmal allein gefühlt«, erinnerte ihn Peer.
Petrus zögerte. »Ja«, gab er zu. Es kostete ihn Mühe. Er sah Peer an. »Aber es ging mir wieder besser, als dieser lästige Junge hier in mein Leben trat.« Er legte, plötzlich zärtlich, die Hand auf Peers Knie. Sein Gesichtsausdruck hatte sich schlagartig verändert, war mit einem Mal ganz freundlich.
Es entstand ein etwas verlegenes Schweigen, als ob wir Zeuge eines Vorfalls waren, den wir eigentlich nicht hätten sehen dürfen.
»Hast du bei dieser Zimmerwirtin auch gegessen?«, fragte ich, um das Gespräch auf ein etwas neutraleres Thema zu lenken.
»Soll ich euch mal ein paar von meinen Gemälden zeigen?«, fragte Peer im selben Augenblick. Er stand auf.
»Aber bitte nicht alle auf einmal«, sagte Petrus trocken.
»Hast du bei der Zimmerwirtin auch gegessen?«, wiederholte ich.
»Lass Peer doch erst mal seine Gemälde zeigen«, mischte sich Nicolien ein.
»Nein, ich habe jeden Abend im Restaurant gegessen.«
»Da sind wir uns auch das erste Mal begegnet«, sagte Peer aus der Ecke des Zimmers. »Nicht wahr, Petrus?«
»Ja, da sind wir uns das erste Mal begegnet.«
Peer kam mit zwei Gemälden zur Lampe und stellte sie vor uns auf den Boden, ins Licht. Auf dem größeren war ein nackter Mann zu sehen, der uns den Hintern zuwandte und einen Arm seitlich ausstreckte. Das andere zeigte ein männliches Geschlecht.
»Du zeigst uns gleich deine skandalösesten Sachen«, sagte Petrus verschämt.
»Das macht doch nichts?«, sagte Peer unbekümmert. »Das werden sie doch schon öfter gesehen haben? Ich habe übrigens noch etwas ganz anderes.«
»Nein, das besser nicht«, sagte Petrus.
»Klar doch, warum nicht?« Er war schon unterwegs und kam mit einer Holzskulptur zurück, einem ungefähr einen Meter großen Phallus, der verblüffend schön geschnitzt war. »Fühl mal, wie weich er ist«, sagte er und strich über die Eichel. Er hielt ihn mir hin.
»Ich glaube dir aufs Wort«, antwortete ich, ohne das Angebot anzunehmen.
»Du dann?«, fragte Peer Nicolien.
»Nein«, sagte sie. Sie lachte.
»Leg ihn wieder weg. Das reicht jetzt«, fand Petrus.
»Hast du immer nur Nackte gemalt?«, fragte ich, als Peer wieder auf seinem Stuhl saß.
»Sehr viele.« Sein Gesicht war abwesend. »Ich glaube, dass es eine Möglichkeit war, um mich zu beweisen.« Er sah mich an, als würde er mich jetzt erst bemerken. Seine Stimme war tonlos. »Davor auch tote Insekten.«
»Weil dich der Tod stark fasziniert hat?« Ich dachte an Frans Veen, der auch tote Insekten zeichnete.
»Nein«, er lachte genüsslich, »weil sie nicht wegfliegen. Ich fotografiere auch immer tote Tiere, die auf der Straße liegen.«
»Glaubst du wirklich, dass es deswegen ist?«, fragte ich ungläubig.
»Ja, sicher.« Er sah Petrus an. »Sollen wir uns jetzt Fotos ansehen?«
»Solltest du nicht erst mal einen Wein einschenken? Du kannst deine Gäste doch nicht den ganzen Abend auf dem Trocknen sitzen lassen?«
Sie hatten einen marokkanischen Wein in einer Zweiliterflasche. Während Peer die Gläser vollschenkte, alte Gläser aus Kristallglas, war es so still, dass man das Gluckern des Weins hörte. Ich sah zu dem Vogel hinüber, der auf seinem Stock am Fenster saß, das die Schwärze der Nacht einfing, und auf die Leuchtpunkte, die das Licht der Schirmlampe auf die antiken Möbel warf. Neben dem Schrank, hinter Petrus, hing ein Gemälde mit einer, wie es schien, Strandszene aus dem ausgehenden neunzehnten oder dem Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts, aber es war zu dunkel, um das Bild richtig betrachten zu können. Der Raum atmete eine heitere Ruhe.
»Du bist in Rente, nicht wahr?«, fragte ich Petrus.
Er nickte, fast unmerklich. »Ja, ich bin in Rente.«
»Gehst du ab und zu noch zu deiner alten Arbeitsstelle?«
Er zögerte. »Ja, aber ich sehne mich nicht danach zurück.«
»Du machst auch nichts mehr?«
Er zögerte erneut, doch allmählich verstand ich, dass das wohl seine normale Art zu reden war. »Nein.« Er dachte nach. »Aber ich werde noch irgendwas machen, sonst würde ich es nicht aushalten.«
»Was denn zum Beispiel?« Es interessierte mich, weil ich selbst auch in nicht allzu ferner Zukunft in Rente gehen würde.
Er schüttelte den Kopf. Die Frage war zu direkt.
»Klavier spielen, zeichnen, malen?«, unternahm ich einen Versuch.
»Ich möchte noch was schreiben«, sagte er murmelnd.
Die Antwort überraschte mich. »Einen Roman?«
»Nein, Philosophie natürlich«, antwortete er gereizt.
»Erst mal anstoßen!«, mahnte Peer. Er hatte die Gläser vor uns hingestellt, erhob sein Glas und stieß mit Petrus an, worauf ein allgemeines Anstoßen einsetzte, ein Ritual, an dem ich bisher nie teilgenommen hatte, woran Peer jedoch ein kindliches Vergnügen zu haben schien.
»Wo hast du gewohnt, bevor du bei Petrus eingezogen bist?«, fragte Nicolien.
»In einem kleinen Dachgeschosszimmer in der Hazenstraat. Ui, wenn ich daran denke!«
»War es nicht gut dort?«
»Überhaupt nicht! Da gab es nicht mal ein Klo!«
»Wie hast du das denn gemacht?«, fragte ich.
»Auf einer Zeitung. Und die habe ich dann draußen weggeworfen. Ich habe mich nicht mal getraut, Petrus zu mir einzuladen, so was von nichts war das.«
»Aber ich bin trotzdem gekommen«, sagte Petrus. »Und ich habe es nicht bereut.«
»Du fandst es sogar gemütlich«, erinnerte sich Peer.
»Überall, wo du bist, wird es gemütlich.«
»Hattest du da auch Leuchtstoffröhren?«, fragte ich kritisch.
»Ja, aber die habe ich, weil man unter so einer Schirmlampe keine Kontraste sieht.«
»Ich glaube, dass es an Peers Augen liegt«, sagte Petrus. »Er müsste eigentlich mal zum Augenarzt, aber das will er nicht.«
»Bist du verrückt? Meine Augen sind prima.« Er stand auf. »Aber jetzt schauen wir uns Fotos an!«
»Fotografierst du auch?«, fragte ich Petrus.
Er nickte. »Aber meine sind nicht so gut wie die von Peer.« Er sah an mir vorbei.
»Ich mache sie in schwarz-weiß und Petrus in Farbe«, sagte Peer von hinten im Raum.
»Ja, ich mache sie in Farbe. Das liegt mir mehr. Und ich muss sagen, dass das Ergebnis meist sehr schön ist.« Er sah zu Peer hinüber. »Nicht so viele, Peertje.«
»Warum nicht?« Er kam mit einem Riesenstapel an Fotos zurück und legte sie vor uns auf den Tisch, worauf er seinen Stuhl heranschob.
»Aber nicht länger als eine Stunde.«
»Wenn sie genug haben, werden sie es schon sagen.«
»Ja, dann sagen wir Bescheid«, versprach ich.
Wir begannen guten Mutes. Es zeigte sich, dass er eine Vorliebe für Gegenlicht, hässliche Gebäude, kaputte Autos und Zäune hatte.
»Schon wieder ein Zaun«, stellte ich fest.
Er lachte. »Und weißt du, was das bedeutet, zumindest nach Meinung des Psychiaters?«
Ich schüttelte den Kopf. »Keine Ahnung.«
»Dass ich eine Blockade habe.«
»Also bitte!«, sagte Petrus.
»Petrus hasst Psychiater«, sagte Peer amüsiert, mit einem Nicken in seine Richtung.
»Du hasst Psychiater?«, fragte ich.
»Alles Seelenfänger«, sagte Petrus wütend. »Ich will nicht, dass darüber in meinem Haus gesprochen wird.«
»Und, hast du eine Blockade?«, fragte ich Peer, Petrus’ Bemerkung ignorierend.
»Das weiß ich nicht. Es ist mir auch nicht mehr so wichtig, glaube ich.«
»Na, jetzt ist aber gut!«, mahnte Petrus.
»Lass uns damit aufhören. Petrus hat es nicht so gern«, sagte Peer zu mir.
Inzwischen hatte ich, der Müdigkeit und dem Wein geschuldet, Kopfschmerzen bekommen. Um Viertel vor zwölf schlug ich vor aufzubrechen, doch Nicolien wollte nichts davon hören, so dass es halb eins wurde.
»Jetzt bist du kleben geblieben«, sagte ich, sobald wir wieder bei uns in der Wohnung waren, »sonst wirfst du mir das immer vor«.
»Das lässt sich doch nicht vergleichen«, sagte sie entrüstet. »Du bleibst kleben, wenn es Arschlöcher sind. Und ich bleibe kleben, wenn ich es wirklich nett finde. Für mich sind es nette Jungs.«
»Aber ich hatte Kopfschmerzen. Das war ein Signal.«
»Es ist also meine Schuld, dass du Kopfschmerzen hast! Ich hätte nicht auf Besuch gehen dürfen!«
»Das habe ich nicht gesagt.«
»Aber es klang so!«
Sie wurde immer wütender und kroch schließlich böse ins Bett.
*
Als ich sie von der Arbeit aus anrief, hatte sie gerade die Post von unten geholt. »Es ist auch eine Neujahrskarte von Peer und Petrus dabei«, sagte sie. »Was sollen wir jetzt machen?«
»Das ist doch kein Problem?«
»Denn ich hatte zwei Beerenkringel vorbeibringen wollen. Aber das geht jetzt natürlich nicht mehr, weil es dann so aussieht, als würden wir auf die Karte reagieren.«
»Das macht doch nichts?«
»Das macht wohl was! Dann ist es doch keine Aufmerksamkeit mehr?«
»Das sehe ich nicht so.«
»Und was machen wir mit der Karte? Wenn sie eine Karte schicken, müssen wir doch eine Karte zurückschicken?«
»Dann leg eine Karte dazu.«
»Aber was für eine?«
»Das kann ich natürlich von hier aus auch nicht sagen. Du kannst doch eine aussuchen? Wir haben Unmengen von Karten.«
»Und wie soll ich das dann machen? Soll ich sie abgeben? Oder auf die Fußmatte legen?«
An ihrer Stimme hörte ich, dass die Unsicherheit sie in Panik versetzte. »Lass uns die Sache mal für einen Moment ruhen lassen«, schlug ich vor.
Ein paar Stunden später rief ich sie erneut an. »Weißt du es jetzt?«
»Und du?«
»Es scheint mir am besten, wenn du die Kringel zusammen mit einer Karte vorbeibringst.«
»Das habe ich mir auch überlegt.«
»Wenn du jetzt damit anfängst, eine Karte auszusuchen?«
Das wollte sie tun.
Als ich nach Hause kam, lag mein Schreibtisch voller Karten. Sie hatte eine ausgesucht, eine Karte von Amnesty International, und ihren Namen schon draufgeschrieben. Ausgezeichnet. Ich setzte meinen Namen daneben. Weil ich den Platz unterschätzt hatte, überschnitt sich mein n mit ihrem N. Das machte sie wütend, aber es hielt nicht lange an. So etwas konnte passieren.
»Heute Nacht habe ich überlegt, ob diese Karte vielleicht komisch ist«, sagte sie am nächsten Morgen beim Aufstehen.
»Warum?«
»Weil sie einen Vogel haben.«
Wir studierten die Karte eingehend: die Zeichnung eines in einem Käfig eingesperrten Vogels, der sehnsüchtig auf einen Schwarm Vögel blickt, die in einem Baum sitzen. Ich zögerte, ließ mir aber nichts anmerken. Unsicherheit würde sie nicht ertragen. Es lag mir auf der Zunge zu sagen, dass das ein Problem sein könnte, konnte mich aber gerade noch bremsen. »Ich finde das überhaupt kein Problem.«
»Du findest es also nicht komisch?«
»Nein, ich finde es nicht komisch.«
Wir legten die Karte zurück und setzten uns an den Tisch.
»Ich finde es eigentlich doch komisch«, sagte sie. »Würdest du es nicht komisch finden, wenn du selbst einen Vogel hättest?«
»Nein, fände ich nicht.«
»Aber sie vielleicht schon.«
»Das weiß ich natürlich nicht.«
»Du glaubst also, dass sie es vielleicht doch komisch finden würden!«
»Ich sagte, dass ich es nicht weiß.«
»Aber es besteht die Möglichkeit, dass sie es komisch finden würden.«
»Die Möglichkeit besteht immer.«
»Dann können wir die Karte nicht nehmen.«
»Warum nicht?«
»Weil du sagst, dass sie es komisch finden würden.«
»Das habe ich nicht gesagt.«
»Das hast du wohl gesagt!«
»Ich habe gesagt, dass sie es vielleicht komisch finden würden.«
»Also bist du dir nicht sicher.«
»Wie kann ich mir denn da sicher sein? Bei jemand anderem?«
»Warum schreist du so? Was ist in dich gefahren? Hast du vielleicht irgendwas? Schwierigkeiten im Büro?«
»Ich schreie nicht.«
»Du schreist wohl! Du solltest mal deine Stimme hören! So wie du mich ansiehst! Als wolltest du mich auffressen! Was ist in dich gefahren?« Der Vorwurf machte mich wütend. Ich war davon überzeugt, dass ich nicht schrie. Wenn ich in die Enge getrieben wurde, und darin war Nicolien eine Meisterin, fing ich lediglich an, lauter zu sprechen. Aber ich beherrschte mich. »Ich schreie nicht, und da ist nichts«, sagte ich. »Ich finde es nur ärgerlich, dass du mir das ständig unterstellst.«
»Ich habe doch wohl nicht damit angefangen?«
Ich stand auf und ging zum Schreibtisch. »Lass uns eine andere Karte aussuchen.« Es war zehn nach acht. Ich musste zur Arbeit. Ich blätterte die Karten durch und machte ein paar Vorschläge. Sie lehnte sie allesamt ab. Zum Schluss fiel die Wahl auf eine Abbildung des Bahnhofs in Utrecht. Vorläufig! Eine Verbindung zum letztendlichen Zweck des Ganzen gab es nicht, aber es war die Reproduktion eines hübschen Gemäldes. Ich setzte meinen Namen auf die Rückseite. Als ich die Tür hinter mir schloss, vermutete ich bereits, dass sie im Laufe des Vormittags mit einer anderen Karte zum Büro kommen würde. Noch ein wenig verstimmt wegen des Drucks, unter dem ich zu einer Entscheidung getrieben worden war, winkte ich im Nieselregen zu ihr hinauf.
Um zehn Uhr kam sie in mein Zimmer. Nur Ad war da.
»Guten Morgen, meine Herren«, sagte sie fröhlich. Sie hatte ein Rosinenbrot für die Abteilung sowie vier Karten dabei, die sie in einer Kunsthandlung an der Prinsengracht gekauft hatte: zwei mit einem Vogel, eine mit einem durch eine verregnete Scheibe fotografierten Radfahrer und eine mit einer Katze. Ich war für den einen Vogel, ein etwas krank aussehender Spatz auf einer weißen Fläche, und unterschrieb zum dritten Mal.
*
Nicolien stand in der Küche und machte Fondue, als es klingelte. Ich war im Wohnzimmer gerade dabei, den Tisch zu decken, und hörte, wie sie die Tür öffnete und Peer etwas sagte. Da sich die Unterhaltung in die Länge zog, ging ich in den Flur. Peer trug ein weißes Unterhemd, das sich straff um seinen ziemlich dicken Körper spannte. Sein Blick war freudig und arglos.
»Ich höre von Nicolien, dass ihr keinen Weihnachtsbaum habt?«
»Peer ist gekommen, um sich unseren Weihnachtsbaum anzusehen«, erklärte sie.
»Habt ihr einen?«, fragte ich.
»Ja, aber sicher. Kein Weihnachten ohne Weihnachtsbaum.«
»Ich hätte erwartet, dass ihr eine Krippe habt«, frotzelte ich.
»Die hatten wir früher zu Hause. Junge, war das schön! Joi!«
»Und warum habt ihr dann jetzt einen Weihnachtsbaum?«
»Weil Petrus protestantisch ist, natürlich. Aber ein Weihnachtsbaum ist auch schön!«
Ich nickte. »Wie groß ist er?«
»Ungefähr so.« Er hielt die Hand circa einen Meter über den Boden.
»Dann muss man sich auf den Bauch legen, um ihn zu sehen.«
Er musste herzhaft darüber lachen. »Nein. Er steht auf einem Tischchen. Ihr müsst mal kommen, um ihn euch anzusehen!«
»Jetzt?«, fragte ich zweifelnd.
»Nein, nicht jetzt«, sagte Nicolien, die weiterhin im Fonduetopf rührte. »Jetzt müssen wir essen.«
»Nein, natürlich, wenn die Kerzen brennen. Und morgen liegen auch Pakete unter dem Baum. Junge, herrlich ist das. Juhu! Ich bin gespannt, was ich kriege.«
»Was esst ihr zu Weihnachten?« Ich trat einen Schritt zurück und lehnte mich an den Türrahmen der Küche.
»Erbsensuppe! Petrus isst immer Erbsensuppe. Und am zweiten Weihnachtstag essen wir auswärts.«
Auf dem Treppenabsatz wurde eine Tür geöffnet. Petrus! Ich hatte den Eindruck, dass Peer erschrak. Wir hörten Petrus langsam die Treppe herunterkommen. Es klingelte und ich öffnete die Tür.
Petrus stand vor mir, in einem grünen Hemd. Er machte ein verärgertes Gesicht und riss sich die Brille vom Kopf. »Kommst du noch?«, fragte er drohend, ohne uns zu begrüßen.
»Ja, ich komme.«
»Das will ich auch meinen, sonst ist die Rinderbrust alle.«
»Na, dann gehe ich mal«, sagte Peer zu uns.
Petrus hatte sich bereits umgedreht und stieg wieder hinauf zu seiner Wohnung. Peer folgte ihm verlegen.
»Jetzt bleibt zu hoffen, dass er ihn nicht totschlägt«, bemerkte ich, als sie die Tür hinter sich geschlossen hatten.
»Könnte es so schlimm sein?«, fragte sie erschrocken.
»Wir werden es schon hören, wenn er heute Nacht den leblosen Körper die Treppe hinunterschleift.«
Sie fand das zu schaurig.
Später am Abend holte sie Käse und Nüsse und ich Gläser und Portwein. Wir saßen bei den Kerzen, ich hielt ein Holzschälchen auf dem Schoß für die Schalen.
Ich sah sie an. »Warum bist du traurig?«
»Ich weiß es nicht.« Sie kämpfte mit den Tränen.
»Was ist denn los?«
»Ich weiß nicht, was los ist. Ich bin so betroffen.« Sie begann ein wenig zu weinen.
»Aber was beschäftigt dich denn so?«
»Ich weiß es nicht. Ich glaube, die Jungs. Weil es Underdogs sind.«
»Aber richtige Underdogs sind es doch auch wieder nicht?« Wenn sie das Thema Underdogs aufbrachte, neigte ich jedes Mal dazu, es zu relativieren. Es irritierte mich. Ich versuchte es zu unterdrücken, aber gänzlich zurückhalten konnte ich mich nicht.
»Es sind sehr wohl Underdogs! Und ich will nicht, dass du das herunterspielst! All die Menschen, die auf Homos herabsehen, so wie deine Mutter. Ich finde es sehr mutig, wie sie leben. Es berührt mich.«
»Das bedeutet doch nicht, dass alle Underdogs nett sind. Unter ihnen gibt es auch Profiteure.«
»Das weiß ich, aber trotzdem kann ich es nicht haben, wenn du so redest. Dann will ich für sie eintreten. So wie bei den Hausbesetzern. Auch wenn ich Hausbesetzer einmal nicht nett finden sollte, werde ich sie trotzdem verteidigen, wenn irgendein Wichtigtuer über sie herzieht.«
»Ich auch.«
»Du längst nicht immer.«
»Es liegt daran, wer es ist.«
»Ich verteidige sie immer.«
Ich schwieg. Wie oft hatten wir dieses Gespräch schon geführt?
»Es wird wohl mit meinem Vater zu tun haben. Dass die Gesellschaft ihn mit Füßen getreten hat und ich ihn nicht verteidigt habe. Ich fühle mich furchtbar schuldig. Allen Underdogs gegenüber.«
»Das geht mir nicht so.«
»Nein, dir geht es nicht so. Und deshalb wird es immer ein Reibungspunkt zwischen uns bleiben.«
»Für mich gibt es keine Underdogs. Nur Menschen, die für oder gegen mich sind, die ich nett finde oder nicht.«
»Ja, so bist du.«
»Leute wie Peer und Petrus finde ich zwar nett, aber nicht interessant. Sie sagen mir nichts.«
»Ich will nicht, dass du so über sie sprichst.«
»Ich darf doch wohl herausfinden, wo die Unterschiede zwischen uns liegen?«
»Nein! Ich ertrage es nicht, dass du so über die Jungs sprichst! Ich ertrage es nicht!« Sie begann erneut zu weinen. »Ich kann es nicht ertragen, dass die Gesellschaft auf solche Menschen herabsieht!«
*
Von Peer hatte sie gehört, dass er und Petrus darüber nachdächten, sich einen Hund anzuschaffen. Sie erzählte es gleich, als sie wach wurde.
»Einen Hund? In einer Obergeschosswohnung?«
»Einen kleinen Hund.«
»Warum schaffen sie sich nicht lieber eine Katze an?«
»Petrus mag keine Katzen.«
Bei jedem anderen wäre das für Nicolien ein Beweis gewesen, dass er nichts taugte, aber das behielt ich für mich.
»Sie wollen nur einen Rassehund.« An ihrer Stimme hörte ich, dass sie damit ein Problem hatte.
»Das geht natürlich nicht.«
»Nein.«
»Wenn man sich einen Hund anschafft, holt man den doch aus dem Tierheim?«
»Das habe ich auch gesagt, aber sie haben Angst, dass solche Hunde falsch sind oder eine Krankheit haben.«
Das übliche Vorurteil beschränkter Menschen.
»Vielleicht könntest du Tjitske fragen, ob sie in ihrem Tierheim einen Hund hat, den sie empfehlen kann?«, sagte sie zögernd. »Vielleicht lassen sie sich leichter dazu bewegen, einen Hund aus dem Tierheim zu nehmen, wenn ich einen konkreten Hund vorschlage.«
»Das mache ich.« Diese ausgesprochene Vorliebe für einen Rassehund wunderte mich. »Im Übrigen schon komisch«, sagte ich mit einiger Schadenfreude, »dass Underdogs eine Vorliebe für Rassehunde haben«.
Sie reagierte nicht darauf, aber als ich unter der Dusche stand, riss sie plötzlich die Tür auf. »Was meintest du eigentlich mit deiner Bemerkung?«, fragte sie böse. »Willst du etwa behaupten, dass Homos nichts taugen? So wie deine Mutter?«
Ihr Ausbruch überraschte mich. »Natürlich gibt es Homos, die nichts taugen«, antwortete ich. »Ich kann dir gleich ein paar nennen.«
»Aber ich akzeptiere das nicht länger! Es muss endlich mal vorbei sein mit dem Homohass! Ich will über die Jungs kein Wort mehr hören!« Sie schlug die Tür mit Wucht wieder zu.
Jungs! Fünfundsechzig beziehungsweise zwei- oder dreiundvierzig. Das war für mich wiederum diskriminierend.
Als ich zehn Minuten später ins Wohnzimmer kam, war sie noch immer wütend. »Es muss jetzt mal vorbei sein mit diesen Bemerkungen über Homos! Ich habe keine Lust, deine Mutter hier im Haus zu haben!«
»Ich habe nichts gegen Homos.« Jetzt wurde ich auch wütend. »Und mit meiner Mutter hat das nichts zu tun! Ich habe nur gesagt, dass ich es komisch finde, dass Underdogs eine Vorliebe für Rassehunde haben. Und das war ein Scherz!«
»Und warum hast du deiner Mutter nie eins aufs Dach gegeben, wenn sie gesagt hat, dass ihr vor solchen Männern grauen würde? Warum hast du das nie getan?«
Ich zuckte mit den Achseln. »Deine Mutter hatte etwas gegen Juden.«
»Aber dafür habe ich ihr auch eins aufs Dach gegeben! Und nicht nur einmal! Jedes Mal!«
»Ich eben nicht. Ich finde so etwas sinnlos.«
»Weil du genauso darüber denkst!«
»Ich denke überhaupt nicht genauso darüber. Ich mache nur einen Unterschied zwischen netten und weniger netten Homos.«
»Und warum nicht zwischen netten und weniger netten Menschen? Na? Na?«
»Weil du unbesehen alle Underdogs nett findest.«
»O nein, mein Freund!« Vor Wut spannten sich ihre Lippen und legten die Zähne frei. »Weil du Homos hasst! Weil du genauso denkst wie deine Mutter! Du hast selbst gesagt, dass du sie erkennst, weil sie hüftschwingend auf dich zukommen!«
Das machte mich rasend. Ich erkannte mich darin absolut nicht wieder. »Das ist eine Hundsgemeinheit! Du weißt genau, dass ich so etwas nicht sage!«
Sie stand mit einem Ruck auf, lief wütend ins Schlafzimmer und schlug mit einem Knall die Tür hinter sich zu. Gleich darauf hörte ich sie laut weinen. Ich ließ sie weinen, schmierte mir mein Brot und ging zur Arbeit.
Eine Stunde später rief ich an, um ihr zu sagen, dass Tjitske einen Hund hätte. Ihre Stimme klang deprimiert, aber ich hatte keine Lust, mich zu entschuldigen. Ich war immer noch wütend über die Karikatur, die sie aus mir gemacht hatte.
Als ich abends nach Hause kam, hatte sich ihre Stimmung aufgeheitert. Sie sei gerade bei Peer und Petrus gewesen, und es bestünde die reelle Chance, dass sie Tjitskes Hund nehmen würden. Sie setzte sich zu mir und schlang ihre Arme um mich. »Du bist so lieb. Du bist ein so lieber Mann. Du musst dir nichts daraus machen, wenn ich diese Dinge sage. Ich bin in den Wechseljahren.«
»Wie lange schon?«, konnte ich nicht unterlassen, sie zu fragen.
»Das ist nicht nett.«
»Seit gestern?«
»Ja, seit gestern.« Sie ließ sich ihre gute Laune nicht verderben.
»Und wie lange dauern sie noch?«
»Das weiß ich nicht. Aber du musst dir nichts draus machen. Denn ich liebe dich doch?«
»Tjitske fragt, ob Peer und Petrus den Hund tatsächlich haben wollen«, sagte ich, als ich sie am Telefon hatte. »Es gibt noch andere Interessenten.«
Am späten Nachmittag rief sie zurück, um zu sagen, dass sie verzichteten.
»Sie schaffen sich doch lieber einen Rassehund an«, präzisierte ich.
»Nein, sie schaffen sich überhaupt keinen Hund an. Petrus hat Angst um seine Möbel. Ich glaube, dass es Peers Idee war.«