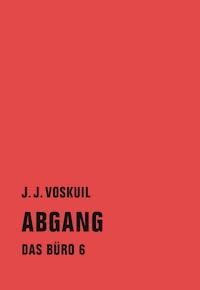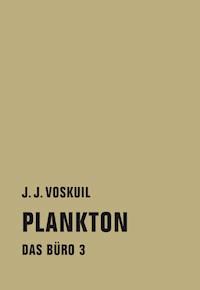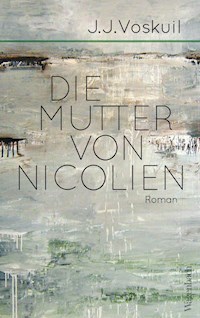Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verbrecher Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Das Büro
- Sprache: Deutsch
1957. Maarten Koning, ein etwas schüchterner Akademiker, heuert in einem Institut zur Erforschung niederlädischer Volkskultur in Amsterdam an, ebenjenem "Büro", das von Direktor Beerta geleitet wird. "Ich werde meine Sache so gut machen, wie es mir möglich ist. So wie ein Tischler einen Schrank macht", versichert Maarten, doch eigentlich ödet ihn die Arbeit schnell an. Trotzdem erstellt er mit Akribie Landkarten, auf denen verzeichnet wird, in welcher Region man welchem Aberglauben anhängt. Zugleich schildert Voskuil mit großer Detailfreude den Büroalltag, in dem nach Herzenslust gemobbt und gefaulenzt wird. Daheim erwartet ihn seine Frau Nicolien, die nicht verstehen kann, warum man sein Leben mit Erwerbsarbeit verschwendet. Maartens Leben ist eine einzige Sinnkrise, er verzweifelt an seinem Tun – und kehrt dennoch Tag um Tag ins Büro zurück. Sein Alltag ist für uns ein Lesevergnügen! Der siebenbändige Romanzyklus "Das Büro" ("Het Bureau") war in den Niederlanden mit über 400.000 verkauften Exemplaren ein Riesenerfolg. Er wurde bei einer Internetabstimmung auf Platz 7 der wichtigsten niederländischen Romane aller Zeiten gewählt! Am Erstverkaufstag der Bände standen in Amsterdam Schlangen vor den Buchläden, auch hierzulande hat sich eine stetig wachsende Fangemeinde gebildet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1231
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
J. J. Voskuil
Das Büro 1
Direktor Beerta
Aus dem Niederländischen von Gerd Busse
1957
»Tag, Herr Beerta«, sagte er.
Herr Beerta stand in der halb geöffneten Tür und blickte ihn unbewegt an, als kämen sie ungelegen. Dann spitzte er die Lippen und nickte kurz. »Tag, Maarten.« Er zwinkerte, ein nervöser Tick.
»Das ist Nicolien«, sagte Maarten.
Herr Beerta nickte ein weiteres Mal und reichte ihr die Hand. »T-tag,Frau Koning.« Beim T stotterte er kurz. Er richtete sich auf, schien für einen kurzen Moment zu zögern und trat dann zur Seite.
»Kommt rein.«
»Wir kommen doch nicht ungelegen?«, fragte Maarten, während Beerta die Tür hinter ihnen schloss.
»Ihr kommt nicht ungelegen«, antworteteBeerta kurz angebunden. »Ich gehe mal vor.«
Beertas Zimmer wurde von einer Stehlampe mit rot geblümtem Pergamentschirm sowie einer kleineren Lampe auf dem Kaminsims erleuchtet, deren roter Schirm am unteren Rand mit Perlenschnüren verziert war. Im Schein der Stehlampe standen ein Sessel und ein Hocker, auf dem eine aufgeschlagene Zeitung lag. Das Licht reichte bis zum unteren Rand der schweren, dunklen Vorhänge, die den Raum vom Fußboden bis zur Decke von der Außenwelt abtrennten. Die seitlichen Wände sowie die Flächen beiderseits der Schiebetür standen voll mit Büchern, in tiefen, braunen Regalen, die ebenfalls bis zur Decke reichten und halb im Dunkeln lagen.
»Setzt euch«, sagte Beerta.
Sie setzten sich auf ein Sofa, das ein wenig schräg in einer Ecke des Raumes stand, während Beerta ihnen gegenüber in einem Sesselaußerhalb des Lichtscheins Platz nahm. Von der Stelle, an der Maarten saß, konnte er im vorderen Zimmer einen großen Tisch erkennen, vollgestapelt mit Büchern, zwischen denen eine von einer Schreibtischlampe beleuchtete Schreibmaschine stand. In der Maschine steckte ein Blatt Papier, daneben lag ein aufgeschlagenes Buch.
»Waren Sie gerade am Arbeiten?«, fragte er.
»Ich bin immer am Arbeiten«, antwortete Beerta. Er sah Maarten unbewegt an. »Ich hab’ dich lange nicht gesehen.« Es klang vorwurfsvoll.
»Wir haben ein Jahr in Groningen gewohnt«, sagte Maarten. »Ich war dort Lehrer.«
Beerta nickte. »Ich war auch Lehrer«, erwiderte er, als ob das die Sache besser machte. »Und was tust du jetzt?«
»Nichts.«
»Nichts!«, wiederholte Beerta. Er spitzte seine Lippen, halb erstaunt, halb ironisch. »Ich glaube, ich wäre darüber nicht so begeistert.« Er stand auf. »Wollt ihr vielleicht eine Tasse Tee?«
»Ob es ihm passt, dass wir hergekommen sind?«, fragte Nicolien, als Beerta das Zimmer verlassen hatte.
»Natürlich passt es ihm«, sagte Maarten entschieden, aber er war sich seiner Sache nicht sicher. Er ließ seinen Blick über die große, eingerahmte Zeichnung eines Bauernjungen schweifen – ein Werk von Toorop oder von van Konijnenburg –, betrachtete das Batiktuch, das dahinter über den Kaminsims drapiert war, sowie die dunklen Möbel und bestickten Kissen, die dem Raum etwas Unvergängliches gaben, ein Eindruck, der durch das langsame Ticken einer Pendeluhr im vorderen Zimmer noch verstärkt wurde. Es hing ein leichter, etwas drückender Parfümgeruch im Raum, der ihn vage an das Zimmer seiner Großmutter erinnerte, in den letzten Jahren vor ihrem Tod.
»Von Klaas de Ruiter höre ich auch nichts mehr«, sagte Beerta, als er wieder in den Raum kam. Vorsichtig hantierte er mit einer Teekanne, die in einem gestrickten Kannenwärmer in den Farben Rosa, Braun und Blau steckte, aus dem nur der Griff und die Tülle herausragten.
»Der ist auch Lehrer«, sagte Maarten.
»Das weiß ich«, entgegnete Beerta trocken. »Aber ist das ein Grund, mich nicht mehr zu besuchen?«
»Vielleicht hat er viel zu tun«, wandte Nicolien ein. Sie lachte nervös.
»Wir haben alle viel zu tun«, sagte Beerta und verzog dabei ironisch seine Mundwinkel, »außer Maarten natürlich. Möchtet ihr Milch und Zucker?«
Sie bekamen einen Keks aus einer alten Blechtrommel, deren Blümchenmuster bereits an mehreren Stellen verschlissen war.
»Und jetzt schreibst du sicher an einer Doktorarbeit«, sagte Beerta. Er sah Maarten forschend an, führte den Keks zum Mund und biss ein kleines Stück ab.
»Ich schreibe keine Doktorarbeit.«
»Du schreibst keine Doktorarbeit?« Es klang erstaunt, doch Maarten hatte den Eindruck, hinter diesem Erstaunen auch ein wenig Ironie herauszuhören. »Ich dachte immer, das Erste, was einer macht, wenn er mit seinem Studium fertig ist, ist das Schreiben einer Doktorarbeit.«
»Aber Sie haben das doch auch nicht gemacht.«
Beerta lächelte. Nun trat die Ironie deutlich zutage. »Ich bin ein ganz schlechtes Beispiel. Ich würde es gar nicht gern sehen, wenn du mich zum Vorbild nehmen würdest.«
Maarten lachte. »Ich hasse Leute, die eine Doktorarbeit nur wegen des Doktortitels schreiben. Wenn man etwas zu sagen hat, kann man das auch ohne Doktorarbeit tun. Und ich habe nichts zu sagen.«
»Und was meint deine Frau dazu?«
»Ich finde, er hat recht«, sagte Nicolien. »Ich würde nicht wollen, dass er eine Doktorarbeit schreibt.« Sie lachte nervös.
Ihre Antwort überraschte Beerta sichtlich. Er zog seine Augenbrauenhoch und sah sie kurz an, bevor er sich wieder Maarten zuwandte. »Ich habe in meinem ganzen Leben noch keine einzige originelle Idee gehabt«, sagte er mit Nachdruck. »Trotzdem habe ich eine Doktorarbeit geschrieben, ein bisschen spät zwar, und ich glaube auch nicht, dass sie jemand gelesen hat, außer meinem Doktorvater natürlich, aber ich danke unserem lieben Herrgott noch immer Tag für Tag, dass ich sie habe beenden dürfen.«
Maarten lauschte amüsiert, ohne darauf einzugehen. Über sich hörte er Schritte und fragte sich, ob es Karel Ravelli war. Er hatte, wie immer, den Eindruck, dass Beerta seinen Besuch zum Anlass nahm, die ganze Welt an der Nase herumzuführen. In seinen Augen war Beerta der lebende Beweis dafür, dass man sich so weit von der Außenwelt abschirmen konnte, dass man unangreifbar blieb. Das zog ihn an.
»Irgendwann werde ich wohl wieder eine Arbeit annehmen müssen«, antwortete er auf eine Frage Beertas, »aber ich glaube nicht, dass ich wieder unterrichten werde.«
Beerta schien einen Augenblick zu zögern. »Ich habe«, sagte er mit einer kurzen Kopfbewegung, um sein Stottern unter Kontrolle zu bringen, »eine Stelle für dich.« Er sah ihn ernst an. »Wenn du willst, kannst du sie haben.« Das Angebot überraschte Maarten.
»Ich kann für die Arbeiten am Atlas der Volkskultur einen wissenschaftlichen Beamten einstellen«, sagte Beerta, langsam und präzise.
Maarten erinnerte sich vage aus seiner Studienzeit, dass es sich dabei um eines der Projekte handelte, die Beerta schon vor dem Krieg ins Leben gerufen hatte. Danach war es dann auf die lange Bank geschoben worden, weil es zu sehr an das Interesse der Nazis für das niederländische Volkstum erinnerte. Unter den Studenten wurde denn auch verächtlich darüber gesprochen. Nun, da Maarten selbst Arbeit suchte, sprach es ihn an. Wenn es noch irgendwo im niederländischen Wissenschaftssystem einen Winkel ohne auch nur den geringsten Anspruch auf irgendetwas gab, dann ließ er sich hier finden. »Ich könnte es versuchen«, sagte er, ohne lange zu überlegen.
Beerta nickte. »Dann solltest du noch mal darüber nachdenken und mich nächste Woche im Büro besuchen, um mir zu erzählen, warum du es versuchen willst.«
Dieser Vorbehalt wirkte ernüchternd auf Maarten. Er bedauerte, auf das Angebot eingegangen zu sein, und verspürte für einen Augenblick den Drang, seine Worte wieder zurückzunehmen. Unglücklich hörte er Beerta zu, der sich Nicolien zugewandt hatte, und registrierte ihre Antworten, ohne dass die Bedeutung ihrer Worte zu ihm durchdrang. Erst als Beerta den Genever brachte, kam er allmählich wieder zu sich. Als sie sehr viel später das Haus verließen, wusste er zwar noch, dass irgendetwas Unangenehmes gesagt worden war, doch was genau, wusste er nicht mehr.
»Nennen Sie mich ruhig Nicolien«, sagte sie, als Beerta sie erneut mit »Frau Koning« ansprach.
»Tag, Nicolien«, sagte Beerta feierlich. »Ich hoffe, dass ich euch bald einmal wiedersehe«, er machte eine kurze Pause, »wenn Maarten erst einmal im Büro ist.«
»Warum hast du bloß gesagt, dass du es tun willst?«, fragte sie, nachdem sie die erste Seitenstraße überquert hatten.
»Ich muss doch eine Arbeit haben!«, antwortete er verstimmt.
»Aber doch nicht unbedingt in der Wissenschaft!«
»Was macht das schon aus, ob man in der Wissenschaft arbeitet oder woanders.«
»Ich dachte, du kannst Wissenschaft nicht ausstehen.«
»Nein, nur Wissenschaftler, die ihren Status daraus ableiten! Die glauben, dass es von Bedeutung ist!«
»Du brauchst nicht so zu schreien!«
Er beherrschte sich. »Ich schreie nicht.« Er fühlte sich durch ihre Worte in die Enge getrieben und sah keinen Ausweg.
»Ich habe dich doch nur etwas gefragt!«
»Was soll ich sonst tun? Wieder Lehrer werden?«
»Es wird ja wohl auch noch etwas anderes geben.«
»Was denn?«
»Jetzt schreist du schon wieder!«
»Was denn?«, wiederholte er übertrieben ruhig. »Wir haben jetzt doch wohl gesehen, dass ich das nicht kann, Leute um Arbeit bitten und die Hand aufhalten.«
»Und wennichmir wieder Arbeit suche?«
»Für dich ist das noch schlimmer als für mich.«
Sie blieb die Antwort darauf schuldig. Dies gab ihm Sicherheit genug, um seine Gedanken zu ordnen. »Beerta nimmt es selbst auch nicht ernst«, sagte er. »Er kann jedenfalls relativieren. Und sein Büro genießt keinerlei Ansehen. Alle finden es nur lächerlich.«
»Warum existiert es dann?«
»Weil er Grips hat«, sagte er überzeugt. »Er tut gerade so viel, um sich zu halten. Und was einmal da ist, wird so schnell nicht wieder abgeschafft.« Er blickte zur Seite, weil sie nicht reagierte. »Wenn es mir nicht gefällt, kann ich es doch wieder aufgeben. Ich habe doch auch das Lehrerdasein aufgegeben.«
»Ja«, sagte sie zögernd.
*
Er kannte das Büro durch ein Praktikum während seines Studiums. Es befand sich im Hof des Hauptbüros, dem es auch organisatorisch angehörte, und bestand aus drei Räumen. Beerta saß im hinteren Raum, der in zwei Hälften geteilt war; ihm gehörte die Hälfte, die zum Hof hin lag. Das Mobiliar bestand aus einem außergewöhnlich großen Schreibtisch mit einem Aufsatz, der vor langer Zeit einmal einem berühmten Sprachwissenschaftler gehört hatte, einer Sitzgruppe aus drei Sesseln sowie einem langen Tisch, der zum größten Teil mit Stapeln von Büchern und Papieren bedeckt war. An den drei Wänden waren Bücherregale angebracht. Die Tür befand sich in der Ecke neben dem Fenster und hatte in der oberen Hälfte sechs Glasscheiben, von denen die beiden untersten von der anderen Seite mit einem rosafarbenen Vorhang zugehängt waren, sodass Beerta keinen Einblick in den mittleren Raum hatte, den sich Fräulein Haan und der Zeichner teilten. Im ersten Raum war der Rest des Personals untergebracht, abgesehen vom Hausmeister, der in einer Pförtnerloge am Anfang des Flurs bei der Eingangstür saß. Er stand auf der Schwelle seines kleinen Verschlags, als Maarten die Tür aufstieß und den Flur betrat.
»Tag, Herr de Bruin«, sagte Maarten.
»So, der Koning«, antwortete der Mann erfreut in plattestem Amsterdamer Dialekt. »Junge, das ist lange her.«
Es überraschte Maarten, dass man ihn wiedererkannte und er offenbar immer noch dazugehörte. »Verdammt lange«, sagte er mit einem Lächeln. »Ich bin mit Herrn Beerta verabredet.«
»Und wie geht’s deinem Vater?«, fragte de Bruin vertraulich, während sie sich durch den langen Flur zu Beertas Raum begaben, denn wie sein Vater war auch de Bruin ein alter Sozialist. Das schuf ein Band, von dem Maarten in diesem Fall profitierte. Außerdem war de Bruin ein waschechter Amsterdamer, was ihm in den Augen Maartens die Überlegenheit eines Mannes verlieh, der hier zu Hause ist. Er ging voran, betrat den ersten Raum, in dem Maarten im Vorbeigehen unter den Leuten, die dort an den Schreibtischen saßen, auf den ersten Blick kein bekanntes Gesicht entdecken konnte. Den Zeichner in seinem weißen Kittel, der im mittleren Raum auf einem hohen Hocker hinter seinem Zeichenbrett am Fenster saß, erkannte er jedoch sofort, und dieser ihn ebenfalls.
»Ha, der Koning!«, rief der, eine Spur zu laut. »Schaust du auch mal wieder vorbei?« Er begann, wiehernd zu lachen, ein verkrampftes Lachen, bei dem sein Gesicht für einige Augenblicke zu einer Grimasse erstarrte, und streckte die Hand aus.
Maarten lächelte reserviert. Der Mann irritierte ihn. »Tag, Herr van Ieperen«, sagte er und drückte ihm die Hand.
De Bruin hatte inzwischen die letzte Tür geöffnet, nachdem er zuvor angeklopft hatte. »Herr Beerta, hier ist der Herr Koning.«
»Lass ihn nur eintreten«, hörte er Beerta aus der Ferne antworten. Verglichen mit der flachen, tonlosen Stimme de Bruins klang die von Beerta äußerst nuanciert und ein wenig feminin. Er stand neben seinem Stuhl, als Maarten den Raum betrat, kam ihm mit steifen Bewegungen entgegen und reichte ihm die Hand. »Setz dich«, sagte er ernst, mit einem Nicken in Richtung der Sitzgruppe.
Sie setzten sich an den kleinen runden Tisch, beide mit einem Bücherregal im Rücken.
»Möchtest du rauchen?«
»Nein, danke«, sagte Maarten.
Sie schwiegen einige Augenblicke. Beerta sah ihn unbewegt und ein wenig ironisch an. Er verzog den Mund und spitzte die Lippen. »Und, weißt du schon, weshalb du hier arbeiten willst?«
»In erster Linie, weil es keinen Anspruch auf irgendetwas erhebt.«
Seine Antwort überraschte Beerta. Er zog die Augenbrauen hoch. »Das bedeutet doch hoffentlich nicht, dass du dir hier kein Bein ausreißen willst?« Er stotterte kurz.
»Nein, so war das nicht gemeint.«
Beerta sah ihn prüfend an, als frage er sich, was Maarten damit meinte.
Der lächelte schuldbewusst. »Ich werde meine Sache so gut machen, wie es mir möglich ist. So, wie ein Tischler einen Schrank macht.«
»Und was spricht dich dann so besonders daran an? Denn ein Schrank ist es nicht.«
»Das weiß ich natürlich noch nicht, aber wenn es das ist, was ich denke, dann interessiere ich mich vor allem für die Frage,warumMenschen diese Dinge glauben und tun, also für die Psychologie.«
Beerta nickte. »Das hat mich auch immer interessiert.« Es klang aufrichtig, doch wie bei so vielem, was Beerta sagte, hatte Maarten zugleich das Gefühl, dass es sich um nicht mehr als einen Schritt in einem rituellen Tanz handelte. Das amüsierte ihn.
Sie schwiegen eine Weile.
»Hast du schon darüber nachgedacht, was du verdienen möchtest?«
Die Frage durchbrach die Vertraulichkeit. »Das weiß ich nicht«, wehrte er ab. »Das sollten Sie einfach bestimmen.«
Beerta nickte bedächtig. »Ich werde der Kommission vorschlagen, dich einzustellen.«
Auf dem Rückweg traf Maarten im ersten Raum auf Koert Wiegel, den Bibliothekar. Er kannte ihn noch aus seiner Studienzeit.
»He, was machst du denn hier?«, fragte Wiegel erstaunt. Es klang nicht besonders freundlich. Auch früher schon hatte er Maarten das Gefühl vermittelt, als hätte dieser ihm ein unverzeihliches Unrecht zugefügt.
»Ich werde hier vielleicht arbeiten«, antwortete Maarten. Er bemerkte, dass ein älterer Mann, der hinter Wiegel an einem Schreibtisch saß und arbeitete, den Kopf hob und ihn ansah.
»Das ist nicht dein Ernst«, sagte Wiegel, ohne eine Spur von Freude. »Komm mal mit.« Er ging mit kleinen, stolzierenden Schritten voran in den hinteren Teil des Raumes, der hinter einem Bücherregal verborgen lag, das den Raum teilte. Seine Art zu gehen erinnerte an die von Beerta, und unter den Studenten ging man davon aus, dass es einst als Imitation angefangen hatte, wie so vieles bei Wiegel, der ein Meister im Imitieren war. »Kennst du Herrn Veerman?«, fragte er mit einer Kopfbewegung hin zu einem dicken Mann, der mit dem Rücken zu ihnen vor einer Reihe von Registraturschränken saß und damit beschäftigt war, Zeitungsausschnitte einzusortieren.
»Ach, Herr Wiegel«, sagte der Mann, ohne Maarten zu beachten. »Hier habe ich so einen merkwürdigen Ausschnitt, man könnte sogar sagen, einen sehr merkwürdigen.« Mühsam richtete er sich aus seiner hockenden Stellung auf und reichte Wiegel einen Ausschnitt. Sein Kopf war feuerrot. Er trug ein ebenfalls rotes Oberhemd, das am Hals offen stand, sowie eine weite, unförmige Hose.
»Gleich, Herr Veerman«, wehrte Wiegel ab, »ich habe gerade Besuch.«Er schob einen Stuhl an seinen Schreibtisch. »Setz dich«, forderte erMaarten auf. »Hätte dir nicht etwas Besseres einfallen können?«
»Nein«, antwortete Maarten. Weil er nie wusste, was dieser Mann wirklich meinte und wann er einen Scherz machte, fühlte er sich in seiner Gegenwart unbehaglich.
Wiegel lachte freudlos. »Der eine weiß nicht, wie er hier wegkommen soll, und der andere kommt freiwillig zum Arbeiten her. Gab es keine Stelle an der Universität?«
»Ich möchte nicht mal daran denken!« Hinter sich hörte er Veerman herumkramen und stöhnen. Sollte er tatsächlich eingestellt werden, dann wollte er lieber nicht in dieser Ecke arbeiten müssen.
»Oder als Lehrer?«, fuhr Wiegel fort.
»Du bist doch auch Lehrer gewesen und hast es aufgegeben.«
Wiegel lachte. »Kennst du die Geschichte von dem Lehrer aus Makkum?«
Maarten schüttelte den Kopf.
»Schade, ich auch nicht.« Der Scherz bereitete ihm einen Heidenspaß, doch plötzlich wurde er ernst. »Aber mal ehrlich: Es lässt sich hier aushalten. Zumindest, wenn du Sinn für Humor hast.«
Nicolien war beim Staubsaugen. Als er das Haus betrat, schaute sie auf und schaltete mit dem Fuß den Staubsauger aus. »Und, wie war es?«
»Er wird es der Kommission vorschlagen.« Er lächelte schuldbewusst.
»Aber hat er denn nichts gefragt?«
»Ich glaube, ihm wäre jede Antwort recht gewesen.«
»Aber du hast ihm doch sicher gesagt, dass du die Wissenschaft verabscheust?«
»Ich habe gesagt, es würde mich ansprechen, dass diese Arbeit keinen Anspruch auf irgendetwas erhebt.« Er hatte den Eindruck, dass diese Antwort sie nur halb zufriedenstellte, doch sie sagte nichts. Sie brachte den Staubsauger weg und ging in die Küche, um Kaffee zu machen. Er setzte sich auf die Couch und blickte vor sich hin. Er fühlte sich leer und vielleicht auch ein wenig bedroht, er konnte es nicht eindeutig bestimmen. Unsinn, dachte er missmutig, ebenso gut könnte man damit zufrieden sein. Er schaute hoch. Sie kam mit dem Kaffee ins Zimmer. »Warum weinst du?«, fragte er verstimmt.
»Ich weine nicht«, antwortete sie mit erstickter Stimme. Die Tränen liefen über ihre Wangen.
»Und ob du weinst.«
»Ich hatte so gehofft, du würdest es nicht tun. Ich fand es so schön, zusammen mit dir.«
Es rührte ihn. Er hockte sich neben ihren Stuhl und ergriff ihre Hand. »Aber jeder hat doch eine Stelle.« Er bewegte ihre Hand, die schlaff in der seinen hing, hin und her. »Aber Knöllchen! Jeder hat doch eine Stelle!«
»Bis auf uns«, sagte sie schniefend. »Gib mir mal dein Taschentuch.«
Er reichte ihr sein Taschentuch und wartete, während sie sich die Nase schnäuzte.
»Und arbeiten ist doch ein Kompromiss«, sagte sie. »Du hast es selbst gesagt.«
»Aber ich habe nie gesagt, dass ich diesen Kompromiss nicht schließen würde.«
»Das hatte ich aber gehofft! Ich hatte gehofft, dass wir für immer zusammenbleiben und gemeinsam sterben würden.« Sie begann, laut zu schluchzen.
Er lachte, weil es so pathetisch klang. »Das können wir doch immer noch.«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein! Nicht, wenn du den ganzen Tag auf der Arbeit bist! Ich fand es schrecklich, als du Lehrer warst! Ich war so froh, als du gekündigt hast und wir wieder nach Amsterdam zurückgegangen sind.«
Er kämpfte seine Rührung nieder, stand auf und setzte sich wieder auf die Couch. »Man muss nun mal Geld verdienen. Und immer wieder eine andere Stelle, das kann ich nicht. Das hat sich doch jetzt gezeigt. Außerdem kann ich jederzeit wieder kündigen.« Es klang nicht sehr logisch. Er war auch nicht in der Lage, logisch zu denken.
»Du bist lieb.« Sie streckte ihre Hand aus. »Vergiss es, es war nicht fair. Natürlich musst du eine Arbeit annehmen. Ich kann es nur nicht ertragen, dass unser Leben zu Ende sein könnte.«
»Aber unser Leben ist doch nicht zu Ende«, sagte er lachend.
»Du verstehst schon, was ich meine.« Es ärgerte sie, dass er sie nicht verstehen wollte. »Natürlich das Leben, das wir jetzt führen.«
Er verstand, doch der Gedanke ängstigte ihn so sehr, dass er ihn gar nicht erst aufkommen lassen wollte.
*
Zwei Wochen später kam ein Brief vom Büro, adressiert an Herrn M.Koning. Er lautete: »Ich habe die Ehre, Ihnen die gestrige Entscheidung der Kommission mitzuteilen, wonach Sie zum 1. Juli d. J. zum wissenschaftlichen Beamten im unteren Rang berufen werden. Über eine kurze Mitteilung, ob Sie die Stelle annehmen, würde ich mich freuen. Der Schriftführer der Kommission, A. P. Beerta.«
Vielleicht hätte Maarten der förmliche Charakter des Briefes erschreckt, wenn ihm nicht sofort aufgefallen wäre, dass Beerta bei Maartens und bei seinem eigenen Namen die Titel weggelassen hatte, als ob er ihm damit zuzwinkern wollte. Außerdem befand sich im Umschlag ein zweiter Brief, der jede Spur von Misstrauen beseitigte: »Lieber Maarten, nach demoffiziellenBrief, den ich dir schrieb, möchte ich dir etwas weniger formell in kurzen Worten sagen, das es für mich eine sehr angenehme Vorstellung ist, das du deinen 31. Geburtstag in unserem Büro feiern wirst. Ich gehe am kommenden Samstagmorgen in die Ferien und werde ungefähr einen Monat wegbleiben, doch ich freue mich schon darauf, dich an deinem ersten Arbeitstag begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, es wird dir gefallen. Bis dahin verbleibe ich mit herzlichen Grüßen, auch an deine Frau, dein A. P. Beerta.«
»Er scheint den Unterschied zwischendassunddasnicht zu kennen«, sagte Nicolien verwundert, als sie den Brief gelesen hatte. »Das hätte ich nicht von Herrn Beerta erwartet.«
Maarten wunderte es ebenfalls, aber er fand es menschlich. Es verriet eine Nonchalance, die seinen Eindruck, dass es zwei Beertas gäbe, noch verstärkte.
*
Er hatte zuerst seine Mutter am Telefon.
»Tag, Maarten«, sagte sie herzlich. »Ich werde Klaas eben rufen.«
Während er wartete, hörte er ganz in der Nähe das Singen des Vogels und, weiter entfernt, aus der Tiefe des Hauses, Klaas’ Stimme. Die Zimmertür quietschte, seine Schritte kamen näher, es rumorte im Hörer. »Hoi!«
»Ha!«, sagte Maarten. »Wie geht’s?«
»Beschissen. Aber das wusstest du ja schon, sonst hättest du nicht gefragt. Ich kenne dich.«
»Das glaubst du zumindest.«
»Kenne ich dich etwa nicht?«, fragte Klaas mit gespielter Bosheit. »Was gibt’s?«
»Ich habe einen Job. Bei Beerta.«
Es war einen Moment still. »Bei Beerta?«, seine Stimme klang plötzlich matt. »Warum in Gottes Namen?«
»Weil unser Geld alle war.«
»Dann muss man doch nicht gleich eine Stelle bei Beerta annehmen!«
Seine Reaktion überraschte Maarten. Von Klaas hatte er eher Zustimmung erwartet. »Wir waren zufällig bei ihm zu Besuch, und da stellte sich heraus, dass er einen Job hatte, für den Atlas für Volkskultur.« Es klang wie eine Entschuldigung.
»Warum bist du dann nicht lieber Lehrer geblieben? Es gibt im Augenblick genügend freie Stellen.«
»Weil ich das eine Katastrophe fand. Als ob ich bei lebendigem Leib begraben würde.«
»Ich finde es im Gegenteil sehr inspirierend.«
»Ja, du! Du glaubst an den Umgang mit der Jugend.« Klaas’ Reaktion ärgerte ihn. Er hatte das Gefühl, dass sie dieses Gespräch bereits hundertmal geführt hatten, mehr oder weniger mit denselben Argumenten. Von der Illusion, dass man jung bleibt, indem man einem durch und durch unkritischen Publikum erbauliche Vorträge über dessen Zukunft hält, war nach dem Jahr, in dem er Lehrer gewesen war, nichts übrig geblieben – wenn er diese Illusion denn überhaupt jemals gehabt hatte. Außerdem war er zu der Überzeugung gelangt, dass die pflichtgemäße Verabreichung maßgeschneiderten, programmierten Wissens mehr Schaden als Nutzen bringt, ein Standpunkt, der bei Klaas jedes Mal, wenn er ihn in ihren Gesprächen zu erläutern versuchte, großen Ärger verursachte.
»Sonst wäre ich nicht Lehrer geworden.«
»Und deshalb will ich kein Lehrer mehr sein.«
»Dann mal tschüss«, sagte Klaas launisch. »Mach’s gut.« Der Hörer wurde aufgelegt.
»Was hat er gesagt?«, fragte Nicolien.
»Er meint, dass ich wieder Lehrer hätte werden sollen.« Er versuchte, Klaas’ Reaktion einzuordnen, doch es gelang ihm nicht. Von seinen Freunden war gerade Klaas derjenige, der den Kontakt mit Beerta gepflegt hatte. Er erinnerte sich, dass er ihm noch hatte erzählen wollen, dass Beerta nach ihm gefragt hatte. Durch die unerwartete Wendung des Gesprächs war daraus nichts geworden. »Da war etwas, was ihm nicht passte«, sagte er nachdenklich.
»Telefongespräche mit Klaas gehen immer daneben. Man kann mit Klaas nicht telefonieren.«
Das schien ihm eine annehmbare Erklärung zu sein.
*
»Du kannst über Mittag wohl nicht nach Hause kommen?«, fragte sie.
Das erschien ihm unwahrscheinlich. Er hatte vergessen, wie lange er mittags frei hatte, aber bestimmt nicht mehr als eine Stunde, und von ihrer Wohnung zum Büro waren es mindestens zwanzig Minuten.
»Wie viele Brote willst du dann mitnehmen?«
»Vier Stullen«, entschied er, »und ein Stück Kuchen.«
Sie schnitt sie ab, belegte sie mit Käse und bestrich sie mit Apfelsirup und steckte sie in kleine Tüten.
»Und einen Apfel.« Er stand auf und nahm einen Apfel aus der Obstschale auf dem Kaminsims.
»Wie willst du sie eigentlich mitnehmen? In deiner Schultasche?«
Das war für ihn das Allerletzte. Mit einer Aktentasche in der Hand zur Arbeit, das war zu deprimierend. »Ich stecke sie in meine Taschen.«
»Beult das nicht aus?«
Er fand, dass es so ging, auch wenn es keine ideale Lösung war. Den Apfel musste er in der Hand tragen.
»Und wie machst du es mit dem Trinken?«
Das wusste er auch nicht. Das Problem irritierte ihn. »Ich werde es dann ja sehen«, schnitt er das Gespräch ab.
Sie ging mit ihm zur Tür. Ein bisschen verlegen standen sie sich gegenüber. Er lachte. »Tschüss, Knöllchen.« Er tippte kurz auf ihren Kopf und gab ihr einen Kuss. Sie hatte Tränen in den Augen. »Nicht weinen, hörst du.«
»Nein, ich weine ja nicht. Ich finde es nur für dich so schrecklich. Und auch noch an deinem Geburtstag.«
»Das macht es nur noch festlicher.« Doch als er die Tür hinter sich schloss und sich abwandte, war ihm traurig zumute. Geistesabwesend und ohne etwas zu sehen lief er durch den Jordaan, wo sie wohnten, kreuzte die vier Grachten, überquerte den Voorburgwal und den Dam und bog in die Damstraat ein. Es war Hochsommer. So früh am Morgen, einem Montagmorgen, war es noch still in den Straßen, eine sommerliche Stille, der er sich vage bewusst war.
De Bruin öffnete ihm die Tür. Im ersten, dem vorderen Raum, war noch niemand, im zweiten auch nicht, doch die Tasche von Fräulein Haan stand auf ihrem Schreibtisch, und als er auf Beertas Tür zulief, kam sie gerade aus dessen Zimmer. Als sie ihn sah, ließ sie die Tür halb offen. »Tag, Fräulein Haan«, sagte er.
»Tag, Herr Koning«, sagte sie, ohne eine Spur von Freundlichkeit.
»Maarten Koning«, verbesserte er, in einem ungeschickten Versuch, ihr das Du anzubieten. Sie ignorierte es und ging an ihm vorbei zu ihrem Schreibtisch. Verwirrt, erniedrigt durch seine eigene Freundlichkeit, die er als Unterwürfigkeit empfand, betrat er Beertas Zimmer.
Beerta stand aufrecht neben seinem Schreibtisch und sah ihn streng an. »Ich gratuliere dir zum Geburtstag«, sagte er, während er ihm die Hand gab. »Und ich hoffe, dass dieser Tag für dich der erste einer Befriedigung verschaffenden wissenschaftlichen Karriere sein wird.«
Maarten lächelte. »Das hoffe ich auch.« Er hatte das Gefühl, dass mit diesen Worten sein Schicksal besiegelt wurde. Er sah sich um, unsicher, was nun von ihm erwartet wurde.
»Ich hatte mir über-l-legt, dass du in den ersten Wochen bei mir im Zimmer sitzen solltest«, sagte Beerta, bevor Maarten etwas fragen konnte, »dann kann ich dich einarbeiten. Ich habe dafür einen Platz am T-tisch freigemacht.« Er nickte in Richtung des Tisches, auf dem zwischen den Stapeln von Büchern und Schriftstücken eine freie Fläche geschaffen worden war. Hinter dieser freien Fläche stand ein einfacher, altmodischer Stuhl mit einem durchgesessenen Plüschpolster. Maarten ging zögernd zu seinem Platz und legte seinen Apfel an den Rand der Arbeitsfläche.
Beerta holte eine silberne Taschenuhr aus der Brusttasche seines Jacketts und zog sie zu Rate. »Aber erst werde ich dich dem übrigen Personal vorstellen.«
Fräulein Haan und van Ieperen kannte er bereits. Van Ieperen zwinkerte ihm zu, als er hinter Beerta vorbeikam, und zog mit einer Bewegung seines Kopfes eine Grimasse, um deutlich zu machen, dass er das alles für Unsinn hielt. Maarten ignorierte es und folgte Beerta in den ersten Raum. Dort befand sich zu dem Zeitpunkt lediglich ein hochgewachsener, magerer junger Mann. Er stand bei einem der vier Schreibtische, die jeweils zu zweit im vorderen Teil des Raums standen, vor dem Bücherregal, das als Trennwand diente. Beerta ging mit kleinen Schritten auf ihn zu und blieb vor ihm stehen. Der Mann war sicher einen Kopf größer. »Wo ist Meierink?«, fragte er.
Der junge Mann sah ihn unverschämt an. Er hatte glattes, blondes Haar und ein mageres, fanatisches Gesicht mit hohlen Wangen. »Woher soll ich das wissen?«, fragte er gleichgültig. »Bin ich der Hüter meines Bruders?«
Die Antwort schien Beerta zu amüsieren. Er schmunzelte und verzog seinen Mund. »Nein, das würde mich wundern.« Er wandte seinen Kopf in Maartens Richtung. »Darf ich dir Herrn Koning vorstellen? Herr Koning fängt heute bei uns an zu arbeiten. Er wird sich um den Atlas für Volkskultur kümmern.«
Der Mann reichte Maarten achtlos die Hand: »Teun Nijhuis.«
In diesem Augenblick ging die Tür zum Flur auf, und ein schon etwas älterer Mann trat ein. Maarten erkannte ihn und begriff, dass es Meierink sein musste. Der Mann erschrak, als er Beerta sah.
Beerta hatte sich aufgerichtet und sah ihn streng an. »Tag, Herr Meierink«, sagte er in gemessenem Tonfall. »Sie sind zu spät.«
»Es tut mir leid, Herr Beerta«, er hatte eine etwas quengelige Stimme, als ob er zu müde wäre, um zu reden, »aber es ist gestern Abend wieder spät geworden, und da hatte ich Mühe, aus dem Bett zu finden.«
»Bei mir ist es auch spät geworden«, sagte Beerta kühl, »aber ich bin trotzdem pünktlich.«
»Ja, Sie können das vielleicht aushalten, aber ich habe Probleme damit.«
Beerta ignorierte das. »Wann haben Sie Ihr mündliches Examen?«
»In drei Wochen. Aber ich fürchte, dass es schon wieder nicht klappen wird, denn ich habe gestern gehört, dass das Schriftliche nicht so gut war.«
»Sie sollten mal etwas früher zu Bett gehen und etwas mehr Selbstvertrauen haben«, befand Beerta. Er machte eine Geste in Richtung Maarten. »Das ist Herr Koning.«
»Angenehm, Ihre Bekanntschaft zu machen«, sagte Meierink, während sie einander die Hand reichten.
»Herr ter Haar ist krank, und Balk ist im Urlaub«, sagte Beerta, ohne Maarten Zeit zu lassen, das Kennenlernen zu vertiefen. »Das muss also noch warten.« Er ging weiter zu dem Raum hinter dem Bücherregal, in dem Wiegel und Veerman saßen. Veerman saß, ebenso wie beim letzten Mal, hinter dem hölzernen Registraturschrank und las Zeitungsausschnitte, Wiegel blätterte in einem Buch. Er stand auf, als Beerta und Maarten um die Ecke kamen, und grüßte sie – Beertahöflich, Maarten mit seinem Vornamen. »Ihr kennt euch schon«, stellte Beerta fest.
»Wie den gestrigen Tag«, scherzte Wiegel. »Wenngleich ich damit nicht sagen will, dass Herr Koning von gestern ist.«
»KennenSieHerrn Koning schon?«, fragte Beerta Veerman.
Veerman sah zerstreut hoch, mit seinen Gedanken woanders. »Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich die Ehre hatte.«
»Herr Veerman kümmert sich um das Ausschnittarchiv«, erklärte Beerta. »Und das macht er vorzüglich.«
»Darüber muss ich noch mal mit Ihnen sprechen, Herr Beerta«, sagte Veerman. Er hatte eine etwas feuchte Aussprache, und es schien, als würde sein großer, roter Kopf noch weiter anschwellen, als unterdrückte er nur mit Mühe eine aufkommende Wut.
»Das wird geschehen, sobald ich die Gelegenheit dazu finde«, wehrte Beerta ab.
»Herr Veerman ist seinerzeit ein begabter Läufer gewesen«, erzählte er, als sie über den Flur durch die Hintertür wieder in den Raum von Fräulein Haan kamen. »Ich nehme an, dass er damals schlanker war.«Sie betraten sein Zimmer. »Einmal im Jahr droht er mir mit dem T-tod.Man muss also ein bisschen freundlich zu ihm sein.«
Maarten schloss die Tür hinter sich. »Was ist das für ein Examen, an dem Meierink sitzt?«
»Meierink ist ein Dussel. Aber er sitzt wenigstens jeden Sonntag unter der Kanzel. D-darum habe ich ihn eingestellt.«
»Ist das eine Voraussetzung?«
Beerta drehte sich zu ihm um und sah ihn mit hochgezogenen Augenbrauen an. »Es gibt ihm einen V-vorsprung. Und dabei ist er auch noch Mitglied der sozialdemokratischen Partei. Das sind Dinge, die schwer bei mir wiegen.«
Maarten lachte. Er konnte nicht genau bestimmen, was Beerta wirklich dachte, doch die Ironie war nicht zu verkennen.
»Aber nun zu deiner Arbeit.« Er zog eine Schublade seines Schreibtisches auf und überreichte Maarten einen Stapel von mit kleinen Zeichen bedruckten Karten der Niederlande und Flämisch-Belgiens. »Deine erste Aufgabe ist es, diese Karten mit einem Kommentar zu versehen, mit Ausnahme des Kommentars zu den Karten des Irrlichts, darum werde ich mich kümmern. Ich mache mich nun an die Arbeit. Wenn du Fragen hast, darfst du mich unterbrechen.« Er wandte sich ab und setzte sich an seinen Schreibtisch, mit dem Rücken zu Maarten. Während dieser die Karten mit zu seinem Platz nahm, zog Beerta seine Schreibmaschine zu sich heran, spannte ein paar Blätter, mit Kohlepapier dazwischen, ein, machte eine kurze Pause und begann dann, mit einem Finger verblüffend schnell zu tippen. Dass Maarten hinter ihm saß, schien ihn nicht im Geringsten zu stören.
Maarten schuf auf dem Tisch etwas mehr Platz, stand wieder auf, um die Brotbeutel aus seinen Taschen zu holen, und sah mechanisch die Karten durch. Bei den ersten drei ging es tatsächlich um das Irrlicht, bei den folgenden um andere, sehr unterschiedliche Themen aus dem Umkreis des Volksaberglaubens, doch er war zu abwesend, um die Bedeutung des Ganzen zu begreifen. Außerdem wurde er durch die Nähe Beertas abgelenkt. Während er geistesabwesend die letzte Karte betrachtete, wurde er sich zum ersten Mal an diesem Tag einer bodenlosen Traurigkeit bewusst, die nun wie eine Flutwelle aufstieg und in der er zu ertrinken drohte. Er nahm sich zusammen, indem er sich zwang, hinter die Bedeutung der Kartenbeschriftung zu kommen. Sie gab eine Übersicht über die Verbreitung des Wichtelmännchenglaubens in den Niederlanden und Flämisch-Belgien und war bedeckt mit rot und grün ausgefüllten Kreisen, Dreiecken, Quadraten, Kreuzen und Strichen, hinter denen sich die Antworten aus den Fragebogen verbargen, die er aus seiner Studienzeit kannte. Er betrachtete die Zeichen und versuchte, ein Muster in dem Chaos zu finden, ohne Erfolg. Der einzige Rückhalt im Raum war das hastige Tippen und das regelmäßig wiederkehrende Klingeln der Schreibmaschine von Beerta. Das Tippen wurde erst etwas langsamer, als de Bruin mit dem Kaffee hereinkam.
»Kaffee, Herr Beerta?«, fragte de Bruin.
Das Tippen hörte abrupt auf. »Ja, wahrhaftig«, sagte Beerta. »Kaffee von de Bruin! Nicht auszudenken, wenn ich den ausfallen lassen würde!«
De Bruin kicherte. »Der Kaffee von de Bruin ist braun«, scherzte er. Während er das Tablett zwischen die Bücherstapel schob, drehte sich Beerta mitsamt seinem Stuhl zur Seite und sah vergnügt zu.
»Zwei Löffel Zucker?«, fragte de Bruin. Er zwinkerte Maarten zu. Maarten begriff, dass dieses Spiel häufiger gespielt wurde.
»Noch einen dazu«, sagte Beerta. Er spitzte die Lippen. »Der Löffel muss darin stehen bleiben.«
De Bruin gab noch einen vollen Löffel dazu und goss einen großen Schuss Milch hinein. »Herr Beerta will immer Blümchenkaffee. Nicht wahr, Herr Beerta?«
»Wie meine Mutter ihn machte«, sagte Beerta genüsslich.
»Du auch, Koning?«, fragte de Bruin.
»Keinen Blümchenkaffee!«, mahnte Maarten.
Es war eine graue Brühe, die er nur mit Mühe hinunterbekommen konnte. Nicht gerade etwas, wonach man sich sehnte.
»Wer hat die Karten eigentlich gemacht?«, fragte er, als de Bruin den Raum wieder verlassen hatte.
Beerta saß mit der Tasse in der Hand da und ließ sie sanft kreisen, bevor er einen Schluck nahm. »Ein paar Studenten, unter meiner Anleitung.« Er schnalzte mit den Lippen. »Einen von ihnen wirst du noch treffen. Der ist im Urlaub. Hein de Boer, ein Bauernsohn.« Er sprach das letzte Wort sehr präzise aus, mit deutlicher Ironie. »Ein netter Junge, aber ein kleiner Schwerenöter.«
Es war Maarten nicht klar, was er sich darunter vorstellen musste. »Und gibt es auch ein Beispiel, wie so ein Kommentar gemacht werden muss?«
Beerta blickte ihn von der Seite mit hochgezogenen Augenbrauen an. »Nein, dafür bist du ja gerade angestellt worden.«
Um Punkt halb eins hörte Beerta auf zu tippen. Er hob die Schreibmaschine auf den Tisch, holte eine Serviette, einen kleinen Teller, ein Messer, eine Butterdose und ein Päckchen Schokoladenstreusel aus einer Schublade seines Schreibtisches, breitete die Serviette aus und machte es sich bequem. Das Brot kam aus einer Dose in seiner Aktentasche.
»Wie lange haben wir eigentlich Mittagspause?«, fragte Maarten.
»Eine Dreiviertelstunde«, antwortete Beerta.
»Und darf ich die auch draußen verbringen?«
»Die darfst du verbringen, wo du willst, wenn du nur rechtzeitig wieder da bist.«
Er ging zur Amstel und aß sein Brot und den Apfel auf einer Bank am Wasser. Es war warm. Das Wasser glänzte in der Sonne. Auf der gegenüberliegenden Seite fuhr eine Straßenbahn vorbei. Das Ganze drang kaum zu ihm durch. Es war, als ob er sich in einem abgeschlossenen Raum befände, abgeschieden von der Außenwelt, nicht fähig, auch nur zu einem einzigen vernünftigen Gedanken.
Wiegel und Nijhuis standen hinter dem Bücherregal und redeten. Veerman war nicht da, sein Stuhl war zurückgeschoben, seine Tasche, eine alte Einkaufstasche, stand daneben. Sie beachteten ihn nicht. Wiegel erzählte einen gewagten Witz, Nijhuis lehnte am Regal und hörte träge zu. »Cherchez la femme«, schloss Wiegel. Nijhuis lächelte müde, während Wiegel sich Maarten zuwandte. Maarten lächelte ebenfalls, obwohl er den Witz nicht mitbekommen hatte. »Haben wir auch Literatur über die Wichtelmännchen?«, fragte er.
Wiegel richtete sich etwas auf, führte die Hände zum Rücken und wippte auf den Zehen. »D-die W-wichtelmännchen«, sagte er mit erhobenem Kinn und sah Maarten dabei streng an. Er zwinkerte. Maarten lachte. Die Imitation war perfekt.
»N-natürlich haben wir L-literatur über die Wichtelmännchen«, fuhr Wiegel fort. »Ich gehe mal eben mit dir mit«, sagte er dann in normalem Tonfall, »sie steht in Beertas Zimmer.«
Beerta war beim Tippen und sah nicht einmal hoch, als sie den Raum betraten und zum Bücherregal an der Rückwand gingen. Ohne einen Augenblick zu zögern zog Wiegel einen Band desHandwörterbuchs des deutschen Aberglaubensaus dem Regal, blätterte kurz darin und reichte ihn Maarten. »Fang erst einmal hiermit an, d-damit bist du fürs Erste beschäftigt.« Er stotterte erneut, doch dieses Mal war nicht klar, ob er es mit Absicht tat. Während Wiegel den Raum wieder verließ, setzte Maarten sich auf seinen Stuhl. Er betrachtete das Titelblatt, schlug die Stelle auf, die Wiegel ihm gezeigt hatte, schaute nach, wie viele Seiten der Artikel hatte, und begann zu lesen. Was er las, war neu für ihn und versetzte ihn in Staunen. Für den Autor oder die Autoren – denn der Aufsatz bestand aus einer großen Zahl von Abschnitten, jedes Mal mit einer langen Liste von Hinweisen auf weiterführende Literatur – waren Wichtelmännchen-Erzählungen keine Kindermärchen, wie er immer geglaubt hatte, sondern Erinnerungen an eine vorchristliche Vergangenheit, die bis auf den heutigen Tag mündlich von einer Generation zur nächsten überliefert worden waren. Über die Art der Erinnerungen schienen die Autoren sich nicht einig zu sein. Manche sahen darin die Reste einer vorchristlichen Ahnenverehrung, andere suchten nach einem Volk kleiner, dunkler Menschen, die von unseren Vorfahren unterworfen oder in die entlegensten Winkel Europas vertrieben worden waren, wo sie sich, auf ungastliche Landstriche verteilt, möglicherweise bis auf den heutigen Tag hatten behaupten können. Er las es mit wachsendem Erstaunen und Unverständnis, behindert durch Vagheiten und Unklarheiten im Text, die er zum Teil seinem mangelhaften Wissen über das Thema, zum Teil seinen unzureichenden Deutschkenntnissen zuschrieb. Als er den Aufsatz zu Ende gelesen hatte, hatte er nicht einmal ein Zehntel davon verstanden. Er lehnte sich zurück und blickte gedankenverloren vor sich hin, in dem Gefühl, ohne Karte und Kompass am Rand eines unwirtlichen Gebiets zu stehen. Beerta hatte aufgehört zu tippen. Maarten sah, wie er einen Federhalter in ein Tintenfässchen tauchte und sich zu seinem Papier beugte. Die Feder kratzte. Er richtete sich auf, faltete das Papier auf ein Viertel seiner Größe, steckte es in einen Umschlag, leckte an seinen Fingern und klebte den Umschlag zu. Während er das tat, drehte er sich langsam um und blickte über seine Brille hinweg zu Maarten. »Du weißt, dass du an deinem Geburtstag eine Stunde früher nach Hause darfst?«, sagte er.
Seine Schwiegermutter saß im vorderen Zimmer, in einem Streifen Sonne, der durch die Gardinen hereinfiel. Nicolien saß im Stuhl vor der Zwischentür zum hinteren Zimmer und sah ihn schon, als er die Außentür aufstieß. »Ha, die Jansen«, sagte er zu seiner Schwiegermutter.
»Ha, der Pietersen«, antwortete sie, während er sich zu ihr hinüberbeugte und ihr einen Kuss gab. »Noch meine herzlichen Gratuladingsbums.«
Er lachte und gab Nicolien ebenfalls einen Kuss.
»Du bist früh«, sagte sie. »Wie war es?«
»Weil ich Geburtstag habe.«
»Wie war es?« wiederholte sie.
»Erst mal umziehen.« Er zog die Zwischenvorhänge zu, zog sich um und wusch sich die Hände.
»Und du hast auch eine Stelle, nicht?«, fragte seine Schwiegermutter, als er wieder in das Zimmer kam.
Er nickte.
»Ach Junge, wie schön! Darauf nehmen wir doch sicher einen?«
Er lachte.
»Und, wie war es?«, fragte Nicolien gespannt.
Er setzte sich auf das Sofa. »Idiotisch.«
»Idiotisch?« In ihrer Stimme lag Entrüstung. »Nicht schrecklich?«
»Ach – schrecklich.« Das Wort war ihm zu groß. Wenn es schrecklich wäre, wäre der Gedanke, dort morgen wieder hinzumüssen, völlig unerträglich.
»Und was musst du da jetzt machen?«, fragte seine Schwiegermutter.
Er sah sie an. »Ich muss einen Text über die Wichtelmännchen schreiben.«
»Über die Wichtelmännchen?« Sie lachte ungläubig. »Du verkohlst mich.«
»Ich verkohle Sie niemals.«
»Über Wichtelmännchen! Ein erwachsener Mann!«
Er lachte verlegen, aber auch amüsiert. »Glauben Sie nicht an Wichtelmännchen?«
»Ach, du verrückter Junge, hör doch auf. Wichtelmännchen!«
»Aber als Sie noch jung waren, saßen da keine Wichtelmännchen in den Scheveninger Bosjes?«
Sie lachte, ohne zu antworten. Es war deutlich, dass sie dachte, er würde sie auf den Arm nehmen.
»In den Wäldern von Pex gab es sie schon«, beharrte er. »Da war ein Baum mit einem Loch darin, und wenn wir daran vorbeikamen, habe ich in das Loch gerufen« – er machte die Stimme eines Kindes nach – »›Wichtelmännchen, Wichtelmännchen!‹ Später haben sie Maschendraht davor gespannt. Da sind sie verschwunden.«
»Ach, Kindergeschwätz.«
»Und wenn Kinder und Verrückte nun die Wahrheit sagen?«
»Quälgeist. Das darfst du nicht.«
»Deine Mutter glaubt nicht mehr an Wichtelmännchen«, sagte er zu Nicolien, die gerade wieder den Raum betrat.
»Solltest du nicht lieber mal einen Schnaps einschenken?«, entgegnete sie. Er merkte, dass sie sich ärgerte. Er vermutete, dass die Anwesenheit ihrer Mutter sie irritierte, aber dennoch vermittelte es ihm ein vages Gefühl von Schuld. Als ob er etwas getan hätte, was nicht in Ordnung war.
*
Gegen elf Uhr schob Beerta seinen Stuhl zur Seite und stand auf. Er holte einen kleinen Spiegel und einen Kamm aus seiner Tasche, wandte sich dem Licht zu, kämmte sein Haar und warf noch einen kurzen Blick auf sein Gesicht. Er packte seine Tasche, eine dünne, braune Aktentasche, und drehte sich, die Tasche steif an seiner Seite haltend, zu Maarten um. »Ich fahre jetzt zu einer Sitzung nach Arnheim«, er blinzelte mit einem Auge, presste die Lippen zusammen und stotterte kurz, bevor er seinen Satz fortführte, »ich werde wohl nicht vor Dienstschluss zurück sein, aber wenn jemand anruft, kannst du sagen, dass ich heute Abend zu Hause zu erreichen bin.«
Maarten nickte. »Ich werde es ausrichten.«
»Das sei dir geraten.« Er ging mit kleinen Schritten zur Tür. »Bis morgen.«
»Tschüss, Herr Beerta.«
Beerta schloss die Tür hinter sich. »Ich fahre jetzt zu einer Sitzung nach Arnheim«, hörte Maarten ihn sagen. »Ich werde wohl nicht vor Dienstschluss zurück sein.«
»Und wenn jemand für dich anruft?« – die Stimme Fräulein Haans.
»Dann kannst du sagen, dass ich heute Abend zu Hause zu erreichen bin.«
Maarten hörte, wie seine Schritte sich entfernten und dann die Tür des ersten Raums.
Als Beerta fort war, wurde es sehr still. Nur ein unbestimmbarer Lärm von der Straße drang durch das offen stehende Fenster. In der hinteren Hälfte des Raums, hinter dem Bücherregal und der Glaswand, wurde ein Stuhl verrückt. Dort war jemand, aber er wusste nicht wer. Weil es der Mitarbeiter eines anderen Büros war – eines Ein-Mann-Büros, das im Büro von Beerta untergebracht worden war, zu dessen Missfallen, wie Maarten bemerkt hatte –, war er ihm nicht vorgestellt worden. Er beugte sich wieder über den Wichtelmännchen-Aufsatz, den er in den Griff zu bekommen versuchte. Nun, da er allein war, entspannte er sich halbwegs, doch es gelang ihm nur schlecht, sich zu konzentrieren, als läge der Text hinter dickem Glas.
Um zwölf Uhr rief er nach einigem Zögern von Beertas Schreibtisch aus Nicolien an.
»Ist Beerta nicht da?«, fragte sie.
»Der ist zu einer Sitzung.«
»Und bist du jetzt allein?«
»Ja.« Er spürte, dass keiner von ihnen wusste, was er sagen sollte. »Wie geht’s Mutter jetzt?«
»Gut. Wir gehen gleich in die Stadt.«
»Bestell ihr schöne Grüße von mir.«
»Ja.« Es war für einen Moment still. »Womit bist du gerade beschäftigt?«
»Mit den Wichtelmännchen.«
Es entstand eine neuerliche Stille.
»Verrückt, nicht wahr?«, sagte sie dann.
»Ja, verrückt«, antwortete er.
Er aß sein Brot auf dem Papier, in dem es eingewickelt gewesen war, neben dem Buch, schälte seinen Apfel, steckte das Papier wieder ein und warf die Schalen in den Mülleimer bei der Eingangstür, bevor er hinausging. Er spazierte erneut zur Amstel und setzte sich auf dieselbe Bank, doch die Stadt war ihm fremd, als wohne er hier gar nicht.
Er war noch nicht lange an seinem Platz zurück, als das Telefon klingelte.
»Für Herrn Beerta«, sagte der Telefonist des Hauptbüros. »Können Sie es annehmen?«
»Koning«, sagte Maarten.
Es war einen Moment still. »Ich wollte Herrn Beerta sprechen«, sagte eine hohe, affektierte Stimme.
»Herr Beerta ist zu einer Sitzung.«
»Wissen Sie dann vielleicht, wo ich ihn erreichen kann? Sie sprechen mit ’t Mannetje.« Ebenso wie Beerta sprach er die Worte sehr präzise aus. »Ich bin Vorsitzender des Bauernwagenvereins und wollte mit Herrn Beerta einen Termin für die Vorstandssitzung machen.«
Die Stimme und der Name des Vereins amüsierten Maarten. Sie suggerierten eine verborgene Welt heimlicher Perversionen.
»Sie können ihn heute Abend zu Hause erreichen«, antwortete er freundlich. Ich bin in einem Bordell gelandet, dachte er, während er den Hörer wiederauflegte. Er schmunzelte. Der Bauernwagenverein! Kaum zu glauben. In diesem Augenblick öffnete sich die Tür hinter ihm. »War das ein Telefonat für Herrn Beerta?«, hörte er Fräulein Haan sagen. Er drehte sich um. Sie stand in der Türöffnung, die Klinke in der Hand. »Ja«, sagte er, »ein Herr ’t Mannetje, wegen einer Verabredung für eine Vorstandssitzung des Bauernwagenvereins.«
»Würden Sie dann in Zukunft das Telefonat an mich durchstellen!«, sagte sie zornig. »Ichbin seine Stellvertreterin! Nicht Sie!« Ihr Gesicht verzog sich vor Wut. Bevor er antworten konnte, schlug sie die Tür mit Wucht wieder zu.
Er brauchte einige Zeit, um diesen Angriff zu verarbeiten. Erst als er wieder auf seinem Stuhl saß, durchlief ihn eine Welle der Wut. Er fühlte sich erniedrigt und bedroht, und es dauerte lange, bevor er diese Gefühle wieder im Griff hatte. Er versuchte zu arbeiten, doch es gelang ihm nicht, seine Gedanken auf den Aufsatz zu konzentrieren. De Bruin brachte Tee. Er trank seine Tasse geistesabwesend aus. Schließlich stand er auf. Fräulein Haan saß hinter ihrem Schreibtisch und arbeitete. Sie sah nicht auf. Van Ieperen zwinkerte ihm zu, worauf er mit einem matten Lächeln reagierte. Im ersten Raum war nur Meierink. Er las die Zeitung. »Ist Nijhuis nicht da?«, fragte Maarten.
»Ich weiß nicht, wo Nijhuis ist«, antwortete Meierink mit schleppender Stimme, ohne von seiner Zeitung aufzusehen.
Nijhuis stand im Flur und unterhielt sich mit de Bruin. Er lehnte am Türpfosten des Verschlags, in dem de Bruin residierte. Dieser stützte sich mit einer Hand auf dem Tischchen neben dem kleinen, grünen Gasherd ab, auf dem ein Wasserkessel für die zweite Tasse Tee stand. Es war ein großer, verbeulter Aluminiumkessel. »Un’ dass du nu man nich’ denkst, dass man da auch nur ein’ Pfennig mehr für kriegt«, meckerte de Bruin, »obwohl man doch auch noch sonntags den ganzen Weg zum Büro kommt!« Er brach ab, weil er Maarten neben Nijhuis ankommen sah. »So, Koning«, sagte er vergnügt. »Du kommst bestimmt wegen deiner zweiten Tasse Tee! Du wirst noch eben warten müssen, mein Freund.«
Maarten lächelte. »Habt ihr auch Papier und Karteikarten?«, fragte er Nijhuis.
Nijhuis hob sein Kinn und sah ihn von oben herab an. Das vage, farblose Licht, das durch das Mattglas in den Verschlag fiel, akzentuierte seine eingefallenen Gesichtszüge. »Wie viele brauchst du?«
»Hundert?«, versuchte es Maarten.
Das Magazin für Büromaterialien befand sich in einer Ecke des Flurs, in einem kleinen Raum mit einem hohen, schmutzigen Fenster. Nijhuis gab ihm einen Schreibblock und drei Packungen Karteikarten. »Noch mehr?«, fragte er.
»Hast du auch einen Karteikasten?«
Nijhuis durchsuchte die Schränke, sah jedoch keinen Karteikasten. »Komm mal mit.«
Sie gingen weiter in den ersten Raum, zu Nijhuis’ Schreibtisch. Am Rand standen drei doppelte Karteikästen übereinandergestapelt. Nijhuis machte den obersten leer, stapelte die Papiere und Karteikarten, die sich darin befanden, auf seinen Schreibtisch und gab Maarten den Kasten.
»Brauchst du den nicht?«
»Das ist nur altes Zeug. Isteinergenug?«
Die ganze Zeit über hatte Meierink ungerührt seine Zeitung gelesen, seinen Mund dabei ein wenig geöffnet und die Brille etwas nach vorne geschoben.
Als Maarten mit seinem Karteikasten und den Karten durch den mittleren Raum zurückging, saß Fräulein Haan nicht mehr hinter ihrem Schreibtisch. Van Ieperen machte mit seinem Ellbogen eine Geste, als ob er Maarten einen Stups geben wollte. »Unser Fräulein Haan war mal wieder richtig in Fahrt, was?« Er kicherte. »Mach dir nichts draus. Das geht auch vorbei.«
»Ja, ich weiß.« Der Mann war ihm zuwider.
Sicher wieder in sein Zimmer zurückgekehrt, schob er die Stapel Bücher und Zeitschriften von Beerta noch dichter zusammen, stellte den Karteikasten auf den frei gewordenen Platz und stellte die Päckchen mit Karteikarten aufrecht hinein. Er setzte sich, ohne seinen Stuhl heranzuziehen, und sah aus einiger Entfernung auf das Buch, in dem er gelesen hatte. Er fühlte sich mutlos.
*
»Wenn Sie nicht da sind, wer nimmt dann das Telefon an?«, fragte Maarten.
Beerta hörte auf zu arbeiten und drehte sich mit hochgezogenen Augenbrauen zu ihm um. »Du.«
»Weil Fräulein Haan sich darüber beklagt.«
Beerta stand auf, ging zur Tür, öffnete sie und sah behutsam in den anderen Raum. »Fräulein Haan ist eine besondere Frau«, sagte er, nachdem er die Tür wieder geschlossen hatte, »aber sie hat einen etwas schwierigen Charakter. Du musst dir nichts daraus machen. Das haben Frauen häufiger.« Er war neben dem Tisch stehen geblieben und sah ihn an. »Du wirst von den Schwierigkeiten gehört haben, die ich mit ihr gehabt habe?«
»Ja.« Während seiner Studienzeit hatten gesalzene Geschichten darüber die Runde gemacht.
»Das ist in letzter Zeit etwas besser geworden, aber dein Kommen hat sie wieder ein wenig aus dem Gleichgewicht gebracht. Du darfst ihr das nicht übelnehmen.«
Maarten schüttelte vage den Kopf, ohne zu antworten.
»Du hast von Nijhuis einen Karteikasten bekommen?«, fragte Beerta mit einem Nicken in Richtung des Kastens.
»Ich habe angefangen, Literatur zu sammeln.«
»Gibt das keine Kratzer?«
»Nein.« Er hob den Kasten hoch.
Beerta beugte sich nach vorne und rieb mit seinem Zeigefinger über die Stelle, auf der der Kasten gestanden hatte, ein schmaler, knochiger Finger. »Ich wäre trotzdem vorsichtig damit.« In der Gebärde und im Klang seiner Stimme lag eine verborgene Sinnlichkeit. »Du legst besser ein Stück Pappe darunter.« Er ging zu seinem Schreibtisch und kam mit ein paar Stückchen Pappe zurück, die er aus einem der vielen Fächer geholt hatte.
Etwas irritiert, aber auch amüsiert legte Maarten die Pappen unter den Kasten und fuhr fort, die Literatur zu übertragen, die in den Anmerkungen zu dem Artikel erwähnt wurde. Beerta holte die Schreibmaschine vom Tisch, stellte sie auf seinen Schreibtisch und fing an zu tippen. De Bruin brachte den Kaffee. Wiegel kam mit einem kleinen Stapel Bücher herein. Er blieb an Beertas Schreibtisch stehen und wartete, doch Beerta tippte in wütendem Tempo weiter, ohne ihn zu beachten. »Ich habe hier ein paar neue Bücher, Herr Beerta«, sagte Wiegel schließlich. »Ich nehme an, dass Sie sie selbst einstellen wollen?«
»Legen Sie sie einfach da hin«, antwortete Beerta, ohne das Tippen zu unterbrechen.
»Und ich wollte Ihnen noch sagen, dass ich ab morgen für drei Wochen im Urlaub bin.«
Beerta hörte abrupt auf zu tippen und sah ihn über seine Brille hinweg an, eine dünne, randlose Brille. »Urlaub!« – als ob es sich um eine unverschämte Mitteilung handelte. »Wo fahren Sie hin?«
»Wir fahren mit den Kindern in die Veluwe.«
»Und auch noch in die Veluwe! Ich fahre nie in Urlaub.«
Wiegel presste wie Beerta seine Lippen aufeinander und stotterte kurz. »Ich d-dachte, Sie wären erst kürzlich im Urlaub gewesen.«
Beerta sah ihn an, als würde er überlegen, ob er ihn zurechtweisen sollte, verzichtete aber darauf. »D-das war kein Urlaub, das war eine Sch-studienreise.«
»Ich könnte es auch eine Sch-studienreise nennen.« Wiegel lachte, doch es lag auch Gift in seiner Stimme.
Beerta ignorierte es. »Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß«, sagte er trocken und beugte sich wieder über seine Schreibmaschine.
Eine Viertelstunde später ging die Tür erneut auf. »Tag, Herr Beerta«, sagte eine dunkle, kokette Stimme.
Beerta hörte sofort auf zu tippen und drehte sich mitsamt seinem Stuhl um. »Schau mal an«, sagte er amüsiert. »Wer hätte das gedacht.«
Der junge Mann lachte, ein Lachen, das tief aus seiner Kehle kam. Er schien etwa sechs Jahre jünger zu sein als Maarten und hatte ein grob geformtes, gebräuntes Gesicht, bei dem vor allem auffiel, dass es ganz und gar aus Fleisch war. Unter seiner Jacke trug er eine weit offen stehende karierte Bluse.
Beerta musterte ihn amüsiert vom Kopf bis zu den Füßen. »Du bist nicht angezogen.«
»Nicht?« Kokett legte er seinen Kopf zur Seite. »Wieso, Herr Beerta?«
Beerta schob lächelnd seinen Stuhl etwas weiter zur Seite und stand auf. »Hier!« Er strich mit den Fingerspitzen an seiner Krawatte entlang.
Der junge Mann lachte erneut, ein glucksendes Lachen. »Aber Herr Beerta. Das ist dochaltmodisch! Es ist dochUrlaubszeit!« Er redete mit vielen Betonungen und einem Akzent, den Maarten nicht so recht zuordnen konnte.
»Gerade habe ich zu Herrn Wiegel gesagt, dass ich nie Urlaub habe«, sagte Beerta trocken. »Und ich bin mir sicher, dass deine Mutter es nicht gut finden würde. Darf ich dir Herrn Koning vorstellen?«
»Hein de Boer«, sagte der Junge. Er reichte Maarten eine feuchte Hand.
»Maarten Koning«, sagte Maarten. Der Junge ähnelte jemandem, aber er kam nicht darauf, wem.
»Sie sind also mein neuer Chef«, sagte der junge Mann.
Weil Maarten das so noch gar nicht gesehen hatte, ignorierte er die Bemerkung.
»Und was machst du jetzt hier?«, fragte Beerta. »Doch hoffentlich keinen Urlaub?«
»Arbeiten«, sagte der junge Mann.
Plötzlich wusste Maarten, wem er ähnelte: dem Bauernjungen von van Konijnenburg, über Beertas Kaminsims. Er schmunzelte.
Beerta hatte seine Augenbrauen hochgezogen. »Arbeiten?« Als sei es das Letzte, wozu er diesen Jungen für imstande hielt.
»Das ist doch wohl erlaubt, Herr Beerta?«
»Wenn es beim Arbeiten bleibt«, sagte Beerta doppeldeutig. »Aber gut, ich werde dich nicht aufhalten.« Er wandte sich ab und rückte seinen Stuhl an den Schreibtisch heran.
Der junge Mann sah Maarten an.
»Wo sitzt du?«, fragte Maarten.
»Neben Herrn Meierink.« Seine Stimme hatte etwas Gefallsüchtiges, ebenso die Art, wie er seinen Kopf hielt.
Maarten zögerte.
»Komm mal eben mit«, sagte der junge Mann.
Sie verließen den Raum, an Fräulein Haan und van Ieperen vorbei.
»Welche Aufgabe hast du?«, fragte Maarten.
»Ich soll die Kommentare zu den Karten des Irrlichts schreiben. Ich bin studentische Hilfskraft.«
»Aber wollte Beerta das nicht selbst machen?«
»Ich glaube, dass er nur seinen Namen druntersetzt.« Er sagte es ohne Bösartigkeit.
Meierink sah ihnen schläfrig zu. Es störte Maarten, doch weil es nirgendwo sonst einen Platz gab, an dem nicht schon jemand saß, fiel ihm nichts Besseres ein, als es zu ignorieren.
»Und was tust du?«, fragte der Junge. Zu Maartens Erleichterung ging er von selbst zum Du über.
»Ich soll die Kommentare zu den Wichtelmännchen schreiben, aber wenn ich mir die Karten anschaue, sehe ich keine Linie darin.«
Der junge Mann lachte. »Und ich habe mich noch darauf gefreut, dass du kommen würdest. Weil du mir dann erzählen könntest, wie ich es machen muss, denn du bist wenigstens mit deinem Studium fertig.«
»Mit dem Studium fertig!«, sagte Maarten lachend. »Das hat doch nichts zu bedeuten.«
*
»Ach, Koning«, sagte de Bruin, als Maarten morgens hereinkam, »kannst du kurz auf die Klingel aufpassen? Ich muss mal eben nach drüben.« Drüben, das war das Hauptbüro, ein monumentales Gebäude mit vier Stockwerken. De Bruin hatte dort gearbeitet, bevor er zu Beerta versetzt worden war. Beerta hatte dort, als Maarten noch studierte, ebenfalls ein Zimmer gehabt, später zwei, bis das alte Schulgebäude im Garten für ihn und seine sich ausdehnende Belegschaft freigemacht worden war. Maarten hatte ihm noch beim Umzug geholfen, weil er damals gerade studentische Hilfskraft war.
Während de Bruin sich durch den Flur entfernte, setzte Maarten sich auf einen Stuhl in dem Verschlag und wartete. Der Raum hatte ein Fenster aus Milchglas. Außer dem kleinen Gasherd mit dem Aluminiumkessel standen dort ein Küchentisch, zwei alte Stühle und ein Schränkchen. Über dem Tisch hing ein Bürokalender und daneben, etwas höher, die Abbildung eines Segelschiffs auf hoher See, mit geblähten Segeln. Das Bild erinnerte Maarten an eine ähnliche Abbildung, die er als Junge an der Wand seines Zimmers gehabt hatte. Sehr viel tiefer, knapp über dem Tisch, war das ziemlich vergilbte Zeitungsfoto einer Fußballmannschaft angeheftet worden. Auf dem Tisch lag ein aufgeschlagenes Buch mit einem Falzbein. Eine der Aufgaben de Bruins war das Aufschneiden neuer Bücher. Es stand dort auch noch ein Leimtopf, daneben lagen eine Schere, eine Schachtel Heftzwecken, eine Rolle Klebeband und eine Ausgabe der sozialdemokratischen ZeitungHet Vrije Volk. Neben dem Gasherd standen eine Flasche Kaffee-Extrakt, die mit einem Pfropf aus Papier verschlossen war, sowie eine geöffnete Dose Buisman-Zuckerextrakt. Im Schränkchen waren Tassen und Teller gestapelt. Maarten betrachtete sie und lauschte zugleich den gedämpften Geräuschen der Straße, hinter der Eingangstür: Schritte, die vorbeigingen, der Lärm eines Motorrads. Von all dem ging eine große Ruhe aus, und er spürte ein vages Verlangen nach einem Leben wie dem von de Bruin, einfach, klar, ohne Ansprüche. Obwohl er darauf wartete, erschrak er, als es schellte. Gleichzeitig wurde gegen die Tür gepoltert. Während er auf den Türöffner drückte, schaute er um die Ecke des Verschlags und sah einen Schatten hinter der Scheibe aus Milchglas. Als die Tür aufging, stand dort ein gekrümmter, missgestalteter Mann, der sich an beiden Pfosten festhielt, seine Beine schräg auseinander. »Ist Cor nicht da?«, fragte er.
»Der ist drüben.«
»Willst du meinen Rollstuhl dann eben reinbringen?« Seine Stimme war heiser. Es klang wie ein Befehl.
Während Maarten ihm entgegeneilte, zog sich der Mann in den Flur hinein, griff mit ausholenden Bewegungen nach den Seitenteilen des Bücherregals, das von der Tür bis zum Ende des Ganges reichte, und setzte, mit den Armen rudernd und sich vorwärts ziehend, dabei überall Halt suchend, seinen Weg fort.
Maarten fand vor der Tür einen Rollstuhl und holte ihn herein. »Wo soll ich ihn lassen?«, fragte er.
»Ist mir schnuppe«, antwortete der Mann grob, er keuchte vor Anstrengung. »Schmeiß ihn da mal irgendwohin.«
Maarten ließ den Rollstuhl in der Ecke neben dem Bücherregal stehen und ging langsam hinter ihm her, unsicher, was von ihm nun erwartet wurde. Gerade in dem Moment, als der Mann am Ende des Flurs die Gartentür erreicht hatte, kam de Bruin herein.
»So, Corretje«, sagte der Mann.
»So, Jantje«, antwortete de Bruin. »Wie geht’s, alter Schwede?«
Der Mann verzog seinen Mund zu einem schiefen Lächeln, doch ohne Freude. »Beschissen«, keuchte er. Er blieb in der geöffneten Tür des ersten Raums stehen, um zu Atem zu kommen, und krallte sich dabei wie ein Affe mit ausgestreckten Armen links und rechts fest. Danach arbeitete er sich zu seinem Schreibtisch vor, hinter dem von Meierink, und ließ sich auf seinen Stuhl fallen. Die Sitzfläche des Stuhls, der speziell für ihn gemacht worden war, ächzte. Er streckte seine Arme vor sich über den Schreibtisch, richtete sich wieder auf und reichte Maarten die Hand. »Jan ter Haar.« Er hatte ein abgeklärtes, verletzliches Gesicht, aber auch etwas Unzufriedenes, das dazu im Widerspruch stand.
Maarten blieb zögernd stehen. »Machst du momentan die Fragebogen?« Als er studentische Hilfskraft war, hatte ein anderer auf dem Platz von ter Haar gesessen.
»Ich mache die Korrespondenz. Das ist das Einzige, was ich mit meinem Körper noch kann. Zumindest, wenn ich nicht krank bin.«
Es klang bitter. Er schien sich dessen selbst bewusst zu sein, denn er verzog den Mund. »Aber mach dir nichts draus.«
Maarten schwieg. Er wusste nicht so recht, was er mit diesem Mann anfangen sollte. Zu seiner Erleichterung betrat Meierink in diesem Moment den Raum. »Wir sehen uns noch«, sagte er und machte sich davon, mit sich selbst unzufrieden.
»Was hat ter Haar eigentlich gehabt?«, fragte er, nachdem er Beerta begrüßt hatte.
»Ter Haar hatte Kinderlähmung«, antwortete Beerta, ohne von seiner Arbeit aufzusehen.
»Das scheint mir kein einfaches Leben zu sein.«