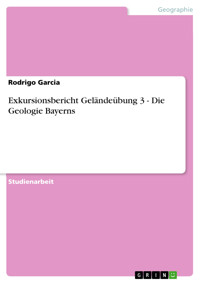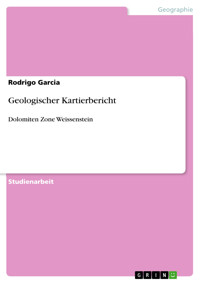18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»So ist das eben mit Ihrem Vater«, sagt seine Sekretärin zu mir. »Er kann sogar über Hässliches schön sprechen.« Als Gabriel García Márquez von seinen Ärzten im März 2014 ins Krankenhaus eingewiesen wird, setzt sofort ein riesiger Rummel ein, denn es gibt im Krankenhaus kaum jemanden, der nicht plötzlich dringend in seinem Zimmer etwas zu erledigen hätte. Nach der Untersuchung kommt die niederschmetternde Nachricht: Wahrscheinlich sei es Lungenkrebs, er habe nicht mehr lange zu leben. Die Familie beschließt, ihn nach Hause zu holen, wo sich die Situation schnell zuspitzt: Aus der ursprünglich prognostizierten Lebenserwartung von Monaten werden Wochen, dann nur noch 24 Stunden. Mit großer Wärme, in vielen Rückblicken und einer fast schon schelmischen Haltung zum Tod erinnert sich der Sohn, ein Filmemacher, in diesem wunderbaren Text an den Tod und das Leben seines Vaters, die außergewöhnlich symbiotische Beziehung seiner Eltern und den späteren Tod seiner Mutter, um beiden ein Denkmal zu setzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 108
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Rodrigo García
Abschied von Gabo und Mercedes
Erinnerungen an meinen Vater Gabriel García Márquez
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Rodrigo García
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Rodrigo García
Rodrigo García, geboren 1959 in Bogotá, Kolumbien, ist Filmemacher und Kameramann. Bekannt wurde er durch seinen Film »Nine Lives«. Er lebt mit seiner Familie in Los Angeles, USA.
Elke Link hat in München und Canterbury Anglistik, Neuere deutsche Literatur und Linguistik studiert. Seither hat sie zahlreiche Romane, Kurzgeschichten, Biografien und Essays aus dem Englischen übersetzt. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Sabine Roth wurde sie für ihre Übersetzung des Romans »Silas Marner« von George Eliot mit dem Bayerischen Literaturförderpreis ausgezeichnet.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
»So ist das eben mit Ihrem Vater«, sagt seine Sekretärin zu mir. »Er kann sogar über Hässliches schön sprechen.«
Als Gabriel García Márquez von seinen Ärzten im März 2014 ins Krankenhaus eingewiesen wird, setzt sofort ein riesiger Rummel ein, denn es gibt im Krankenhaus kaum jemanden, der nicht plötzlich dringend in seinem Zimmer etwas zu erledigen hätte. Nach der Untersuchung kommt die niederschmetternde Nachricht: Wahrscheinlich sei es Lungenkrebs, er habe nicht mehr lange zu leben. Die Familie beschließt, ihn nach Hause zu holen, wo sich die Situation schnell zuspitzt: Aus der ursprünglich prognostizierten Lebenserwartung von Monaten werden Wochen, dann nur noch 24 Stunden.
Mit großer Wärme, in vielen Rückblicken und einer fast schon schelmischen Haltung zum Tod erinnert sich der Sohn, ein Filmemacher, in diesem wunderbaren Text an den Tod und das Leben seines Vaters, die außergewöhnlich symbiotische Beziehung seiner Eltern und den späteren Tod seiner Mutter, um beiden ein Denkmal zu setzen.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Titel der Originalausgabe: A Farewell to Gabo and Mercedes
© RODRIGO GARCÍA, 2021
Aus dem Englischen von Elke Link
© 2024, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © privat
ISBN978-3-462-31015-3
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Förderhinweis
Widmung
Teil eins
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
Teil zwei
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
Teil drei
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
Teil vier
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
Teil fünf
32. Kapitel
Danksagung
Fotografien
Chronologie
Zitate
Bildnachweise
Die Übersetzerin bedankt sich bei der BKM und der VG Wort für die Übersetzungsförderung im Rahmen von Neustart Kultur.
Meinem Bruder
Teil eins
Entonces fue al castaño, pensando en el circo, y mientras orinaba trató de seguir pensando en el circo, pero ya no encontró el recuerdo. Metió la cabeza entre los hombros, como un pollito, y se quedó inmóvil con la frente apoyada en el tronco del castaño. La familia no se enteró hasta el día siguiente, a las once de la mañana, cuando Santa Sofía de la Piedad fue a tirar la basura en el traspatio y le llamó la atención que estuvieran bajando los gallinazos.
– Cien años de soledad
Dann ging er an den Zirkus denkend zur Kastanie und versuchte beim Urinieren, weiter an den Zirkus zu denken, fand aber schon keine Erinnerung mehr. Er steckte den Kopf zwischen die Schultern, wie ein Küken, und blieb reglos stehen, die Stirn an den Kastanienstamm gelehnt. Die Familie erfuhr erst am nächsten Tag davon, als Santa Sofía de la Piedad um elf Uhr vormittags Müll in den Hinterhof brachte und ihr auffiel, dass die Hühnergeier herabstießen.
– Hundert Jahre Einsamkeit
1
Als Kinder mussten mein Bruder und ich Vater versprechen, Silvester 2000 mit ihm zu feiern. In unserer Jugend erinnerte er uns mehrfach daran. Diese Hartnäckigkeit war mir unangenehm, aber irgendwann begriff ich sie als seinen Wunsch, diesen Tag noch erleben zu dürfen. Er würde dann zweiundsiebzig sein, ich vierzig, das zwanzigste Jahrhundert würde zu Ende gehen. Für mich als Teenager waren solche Wegmarken Lichtjahre entfernt. Im Erwachsenenalter erwähnte er diese Vereinbarung meinem Bruder und mir gegenüber nur noch selten. Aber als es schließlich so weit war, verbrachten wir die Jahrtausendwende tatsächlich alle zusammen, in Cartagena de Indias, der Lieblingsstadt meines Vaters. »Ihr zwei und ich, wir hatten ja eine Abmachung«, sagte mein Vater verlegen zu mir; womöglich war ihm seine Beharrlichkeit von damals auch etwas peinlich. »Stimmt«, meinte ich nur, danach erwähnten wir es nie mehr. Er lebte noch weitere fünfzehn Jahre.
Als er Ende sechzig war, fragte ich ihn, woran er nachts denke, wenn er das Licht ausgeschaltet habe. »Dann denke ich, dass alles so gut wie vorbei ist.« Lächelnd fügte er hinzu: »Aber noch habe ich Zeit. Noch muss ich mir keine allzu großen Sorgen machen.« Sein Optimismus war echt, er wollte mich nicht nur aufmuntern. »Eines Tages wachst du auf und bist alt. Einfach so, ohne Vorwarnung. Unglaublich«, fügte er hinzu. »Vor Jahren habe ich einmal gehört, dass im Leben eines Schriftstellers irgendwann der Zeitpunkt gekommen ist, an dem er nicht mehr in der Lage ist, einen langen literarischen Text zu schreiben. Der Kopf kann die komplexe Konstruktion nicht mehr fassen, sich nicht mehr auf dem trügerischen Terrain eines umfangreichen Romans bewegen. Und es ist wirklich so. Ich spüre das jetzt. Von nun an werden meine Texte also kürzer.«
Als er achtzig war, fragte ich ihn, was das für ein Gefühl sei.
»Die Perspektive ist wirklich verblüffend. Und das Ende ist nah.«
»Hast du Angst?«
»Es macht mich unermesslich traurig.«
Wenn ich mich an diese Momente zurückerinnere, rührt mich seine Offenheit zutiefst, vor allem, wenn man bedenkt, wie grausam meine Fragen waren.
2
Im März 2014 rufe ich an einem Vormittag mitten in der Woche meine Mutter an. Mein Vater liege seit zwei Tagen mit einer Erkältung im Bett, sagt sie. Das kommt bei ihm gelegentlich vor, doch sie ist sicher, diesmal sei es anders. »Er mag weder essen noch aufstehen. Er ist nicht er selbst. Er ist teilnahmslos. Bei Álvaro hat es auch so angefangen«, fügt sie hinzu. Sie bezieht sich damit auf einen Freund aus der Generation meines Vaters, der im Jahr zuvor gestorben ist. »Das wird nicht mehr«, lautet ihre Prognose. Das Telefonat beunruhigt mich nicht weiter, die Vorhersage meiner Mutter ist sicher nur ihrer Sorge geschuldet. In ihrem Leben ist längst eine Phase angebrochen, in der mit einer gewissen Häufigkeit alte Freunde von ihr gehen. Vor Kurzem erst erlitt sie einen schweren Verlust, als zwei ihrer Geschwister starben, ihre jüngsten und liebsten. Trotzdem setzt der Anruf meine Fantasie in Gang. Sieht so der Anfang vom Ende aus?
Meine Mutter, die schon zwei Krebserkrankungen überstanden hat, muss sich in Los Angeles medizinischen Untersuchungen unterziehen. Deshalb soll mein Bruder von Paris aus, wo er lebt, nach Mexico City fliegen, um bei unserem Vater zu bleiben. Ich kümmere mich unterdessen in Kalifornien um unsere Mutter. Als mein Bruder ankommt, eröffnet ihm der Kardiologe und behandelnde Arzt meines Vaters, dass mein Vater an einer Lungenentzündung leide und es dem Team die Arbeit sehr erleichtern würde, wenn sie ihn zu weiteren medizinischen Tests ins Krankenhaus bringen könnten. Anscheinend hat er das meiner Mutter bereits mehrfach nahegelegt, aber sie sträubte sich. Vielleicht hatte sie Angst davor, was eine umfassende körperliche Untersuchung ans Licht bringen würde.
3
Durch die Telefonate mit meinem Bruder kann ich mir im Lauf der nächsten Tage ein Bild vom Krankenhausaufenthalt machen. Als mein Bruder bei der Anmeldung den Namen meines Vaters nennt, wird die zuständige Mitarbeiterin ganz aufgeregt. »Du lieber Himmel, der Schriftsteller? Darf ich meine Schwägerin anrufen und es ihr erzählen? Sie muss das unbedingt erfahren.« Widerwillig lässt sie von ihrem Vorhaben ab, als er sie dringend bittet, darauf zu verzichten. Mein Vater wird in einen einigermaßen abgeschirmten Raum am Ende eines Gangs gebracht, um seine Privatsphäre zu schützen, aber schon nach einem halben Tag laufen Ärzte, Schwestern, Pfleger, Techniker, andere Patienten, Wartungs- und Reinigungspersonal und womöglich auch die Schwägerin der Empfangsdame an seiner Tür vorbei, um einen Blick auf ihn zu erhaschen. Vor dem Haupteingang des Krankenhauses versammelt sich bereits die Presse, und die Nachrichten melden, dass sein Zustand ernst sei. Die Botschaft ist klar: Die Krankheit meines Vaters wird zu einer öffentlichen Angelegenheit werden. Wir können ihn nicht völlig abschotten; immerhin beruht ein Großteil des Interesses auf Sorge, Bewunderung und Zuneigung. Als wir klein waren, bezeichneten unsere Eltern meinen Bruder und mich stets als die artigsten Kinder der Welt. Ob es nun stimmte oder nicht: Wir mussten den Erwartungen gerecht werden. Auf die Herausforderung, die nun vor uns liegt, müssen wir höflich und dankbar reagieren, unabhängig davon, ob wir die Kraft dazu haben. Gleichzeitig müssen wir unserer Mutter versichern, dass die Grenze zwischen dem Öffentlichen und dem Privaten streng eingehalten wird – wo auch immer wir sie unter den gegebenen Umständen festlegen. Das war ihr immer enorm wichtig, obwohl, oder vielleicht auch weil, sie eine wahre Leidenschaft für die schlimmsten Klatschsendungen im Fernsehen hatte. »Wir sind keine Personen von öffentlichem Interesse«, ermahnt sie uns gerne. Diese Erinnerungen werde ich erst veröffentlichen, wenn sie sie nicht mehr lesen kann, das weiß ich.
Mein Bruder hat meinen Vater seit zwei Monaten nicht mehr gesehen und stellt fest, dass er verwirrter als gewöhnlich ist. Mein Vater erkennt ihn nicht und ist verunsichert, weil er nicht weiß, wo er sich befindet. Es beruhigt ihn ein wenig, wenn sein Fahrer oder seine Sekretärin ihm Gesellschaft leisten. Sie besuchen ihn abwechselnd, und einer von ihnen oder die Köchin oder die Haushälterin verbringen die Nacht bei ihm im Krankenhaus. Es hätte keinen Sinn, wenn mein Bruder bliebe. Mein Vater muss in ein ihm vertrauteres Gesicht blicken, wenn er mitten in der Nacht aufwacht. Der Arzt fragt meinen Bruder, welchen Eindruck unser Vater verglichen mit ein paar Wochen zuvor auf ihn macht, denn sie wissen nicht, ob seine Geistesverfassung von der Demenz herrührt oder von seiner derzeitigen Schwäche. Er gibt kaum sinnvolle Äußerungen von sich und kann selbst einfachste Fragen nicht schlüssig beantworten. Mein Bruder bestätigt, dass sich sein Zustand zwar ein wenig verschlechtert zu haben scheint, er sich aber seit mittlerweile einigen Monaten kaum verändert hat.
Er liegt in einem der bedeutendsten Lehrkrankenhäuser des Landes, und so kommen am ersten Morgen prompt ein Arzt mit einem Dutzend Ärzten und Ärztinnen im Praktikum im Schlepptau in sein Zimmer. Sie drängen sich um das Fußende des Bettes und lauschen dem Doktor, der die Diagnose und die Therapie erklärt. Für meinen Bruder ist es offensichtlich, dass die jungen Leute keine Ahnung haben, in wessen Zimmer sie sich befinden. Einem nach dem anderen ist anzusehen, dass es ihnen langsam dämmert, während sie ihn mit kaum verhohlener Neugierde mustern. Als der Arzt sich erkundigt, ob es noch Fragen gibt, schütteln alle den Kopf und folgen ihm wie Entenküken hinaus.
Immer wenn mein Bruder am Krankenhaus ankommt oder es verlässt, was mindestens zweimal am Tag der Fall ist, rufen ihm die versammelten