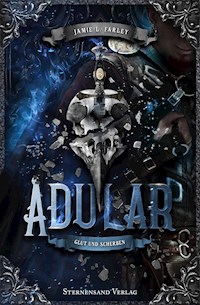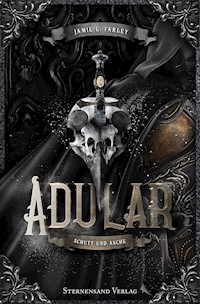
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sternensand Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Adular
- Sprache: Deutsch
Als Dunkelelf im Kaiserreich Adular zu leben, bedeutet, weniger wert zu sein als Straßendreck. Dûhirion ist einer von ihnen und musste früh lernen, dass das Leben nicht fair spielt, insbesondere dann nicht, wenn man mit grauer Haut geboren wird. Menschen, Zwerge, Waldelfen und Hochelfen blicken auf ihn und seinesgleichen herab wie auf Ungeziefer. Als Kind wurde er an die Assassinengilde Umbra verkauft und dort unter grausamen Bedingungen zum Meuchelmörder ausgebildet. Eigentlich hatte er nicht geplant, sich in die beginnenden Aufstände seitens der Dunkelelfen einzumischen, auch wenn er die Unterdrückung seines Volkes nicht gutheißt. Doch da ist seine verbotene Liebe zur Waldelfin Elanor. Die Beziehung zu ihr lässt Dûhirion unfreiwillig ins Zentrum der Unruhen rücken – und dabei wird nicht nur sein Leben in Gefahr gebracht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 401
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Titel
Informationen zum Buch
Impressum
Widmung
Landkarte
Prolog - Elanor
Kapitel 1 - Dûhirion
Kapitel 2 - Dûhirion
Kapitel 3 - Elanor
Kapitel 4 - Dûhirion
Kapitel 5 - Elanor
Kapitel 6 - Dûhirion
Kapitel 7 - Dûhirion
Kapitel 8 - Elanor
Kapitel 9 - Dûhirion
Kapitel 10 - Dûhirion
Kapitel 11 - Elanor
Kapitel 12 - Dûhirion
Kapitel 13 - Dûhirion
Kapitel 14 - Elanor
Kapitel 15 - Dûhirion
Kapitel 16 - Elanor
Kapitel 17 - Dûhirion
Kapitel 18 - Elanor
Epilog - Dûhirion
Glossar
Dank
Jamie L. Farley
ADULAR
Band 1: Schutt und Asche
Fantasy
Adular (Band 1): Schutt und Asche
Als Dunkelelf im Kaiserreich Adular zu leben, bedeutet, weniger wert zu sein als Straßendreck. Dûhirion ist einer von ihnen und musste früh lernen, dass das Leben nicht fair spielt, insbesondere dann nicht, wenn man mit grauer Haut geboren wird. Menschen, Zwerge, Waldelfen und Hochelfen blicken auf ihn und seinesgleichen herab wie auf Ungeziefer. Als Kind wurde er an die Assassinengilde Umbra verkauft und dort unter grausamen Bedingungen zum Meuchelmörder ausgebildet.
Eigentlich hatte er nicht geplant, sich in die beginnenden Aufstände seitens der Dunkelelfen einzumischen, auch wenn er die Unterdrückung seines Volkes nicht gutheißt. Doch da ist seine verbotene Liebe zur Waldelfin Elanor. Die Beziehung zu ihr lässt Dûhirion unfreiwillig ins Zentrum der Unruhen rücken – und dabei wird nicht nur sein Leben in Gefahr gebracht.
Der Autor
Jamie L. Farley wurde 1990 in Rostock geboren. 2010 zog er nach Leipzig und machte dort eine Ausbildung zum Ergotherapeuten. Schnell merkte er jedoch, dass das nicht der richtige Job für ihn ist, weshalb er sich entschlossen hat Pokémontrainer zu werden. Er ist in Leipzig geblieben und wohnt zusammen mit seiner besten Freundin Anika, einer Ente namens Dave und dem Haus-zombie Bradley in einer WG. Neben der Schreiberei gehören Vi-deospiele zu seiner liebsten Freizeitbeschäftigung. Nach dem Veröffentlichen von zwei Kurzgeschichten, erschien sein Debüt ‚Adular (Band 1): Schutt und Asche‘ Anfang 2019 im Sternen-sand Verlag.
www.sternensand-verlag.ch
1. Auflage, März 2019
© Sternensand Verlag GmbH, Zürich 2019
Umschlaggestaltung: Alexander Kopainski
Lektorat: Sternensand Verlag GmbH | Martina König
Korrektorat: Sternensand Verlag GmbH | Jennifer Papendick
Illustration S. 362: Judith C. Pleiner
Satz: Sternensand Verlag GmbH
Druck und Bindung: Smilkov Print Ltd.
ISBN (Taschenbuch): 978-3-03896-036-2
ISBN (epub): 978-3-03896-037-9
Alle Rechte, einschließlich dem des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten.
Dies ist eine fiktive Geschichte. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Für Franzi,
Heldin von Ferelden, Champion von Kirkwall,
Inquisitorin sowie
langjährige Freundin und treue Begleiterin durch
fantastische Welten
Danke für alles. Du hast mehr für mich getan,
als ich hier aufzählen kann.
Ohne dich würde es den Roman in dieser Form sicher
nicht geben.
Prolog - Elanor
Zehn Jahre zuvor …
Der Duft des nahenden Sommers lag in der Luft. Elanor wollte an diesem Tag Einkäufe auf dem Markt erledigen, hatte sich aber aufgrund des schönen Wetters zu einem Spaziergang hinreißen lassen.
»Halt! Wohin des Weges, Grauhaut?«
Ein Dunkelelf stand am oberen Ende der breiten Treppe, die hinab in die Aschegrube führte. Zwei Wachen aus der Oberstadt versperrten ihm den Weg.
Drei Dinge fielen ihr an ihm auf. Zuerst die Ohrringe, die silbern im Sonnenlicht glänzten. Sie zählte insgesamt sieben Stück; drei rechts, vier links. Dann das blinde Auge und die wulstige Narbe auf seiner Wange. Zum Schluss der getrimmte Vollbart. Dunkelelfen waren die einzigen Elfen, die einen anständigen Bartwuchs hatten und sich auch nicht davor scheuten, sich einen stehen zu lassen. Wenn sie bedachte, welchen Aufwand sich ihr Onkel machte, um die geringe Körperbehaarung, die er vorzuweisen hatte, auszumerzen – da war es deutlich einfacher, den Umstand zu akzeptieren. Elanor konnte nicht behaupten, dass sie einen Bart unattraktiv fand.
»Ich will auf den Markt.« Der Dunkelelf zeigte einen Papierfetzen vor.
Die linke Wache, ein Hochelf, griff danach und las skeptisch. »So? Und woher sollen wir wissen, dass du dieses Schreiben nicht gefälscht hast?«
Elanor sah sich prüfend auf der Straße um. Außer ihr nahm niemand Notiz von der Unterhaltung. Sie entfernte sich einige Schritte, um unbemerkt zu bleiben, und tat für die vorbeiziehenden Passanten so, als würde sie etwas in ihrem Korb suchen.
»Gefälscht?«, wiederholte der Dunkelelf und schnaubte. »Natürlich, ein nachvollziehbarer Gedanke. Jeder würde Umbras Zeichen missbrauchen, nur um in Eure kostbare Stadt zu gelangen. Davon abgesehen, denkt Ihr, ich könnte mir Papier und Tinte leisten, geschweige denn dieses Schreiben überhaupt verfassen, wenn ich kein Mitglied der Gilde wäre?«
Elanor schmunzelte und zählte die Silbermünzen in ihrem Geldbeutel. Der Mann gefiel ihr. Er war also ein Assassine. Es war nicht ungewöhnlich, eine Schattenklinge aus der Aschegrube steigen zu sehen. Dieser hier schien gerade nicht im Dienst zu sein, zumindest war er nicht in die charakteristische Kluft gekleidet.
Der Dunkelelf zog den fingerlosen Lederhandschuh von seiner rechten Hand und wies die Tätowierung vor, die lediglich Schattenklingen unter ihrer Haut trugen. Die Wachen tauschten einen Blick.
»Nun«, sagte der Waldelf zur Rechten, »wenn du in die Oberstadt willst, solltest du anständig darum bitten. Auf die Knie, Grauhaut!«
Die linke Wache lachte dreckig. »Ha, genau. Auf die Knie und küss uns die Füße!«
Das Gesicht des Assassinen verfinsterte sich. »Oh nein, in diese Richtung wollt Ihr nicht gehen.«
Elanor war alarmiert. Es sah aus, als könnte die Situation jederzeit kippen, und das konnte nur zum Nachteil des Dunkelelfen ausgehen. Ob Schattenklinge oder nicht, ein Mann allein kam nicht gegen zwei bewaffnete Wachen in schweren Stahlrüstungen an.
Will ich einem Meuchelmörder helfen?, schoss es ihr durch den Kopf. Nicht jeder Dunkelelf verdient es, geschützt zu werden. Dieser hier tötet für Gold. Was, wenn er einen Auftrag verfolgt und ich ihm helfe, zu seinem Opfer zu kommen?
»Macht es Euch leicht und lasst mich durch«, fuhr der Dunkelelf fort. Er sprach betont ruhig, deeskalierend, und suchte den Blick der Wachen. »Ihr wollt eine Schattenklinge nicht verärgern.«
»Willst du mir drohen, Gossenratte?«, knurrte der Hochelf. »Pass auf, was du sagst! Ein falsches Wort und ich lasse dich in Ketten legen und in den Kerker werfen. Runter in den Dreck mit dir, los!«
Elanor hielt den Atem an. Die Silbermünzen in ihrer Hand rieselten in den Geldbeutel zurück.
Der Dunkelelf schien abzuwägen, ob er die Diskussion weiterführen wollte, und entschied sich dagegen. »Vergesst es«, sagte er und machte kehrt. »Einen schönen Tag noch, die Herren.«
»Hiergeblieben!«
Der Dunkelelf wurde an der Schulter gepackt und reagierte unglaublich schnell. Mit einer simplen, aber durchaus eleganten Drehung seines Körpers wich er der gepanzerten Faust aus, die auf seine Magengrube gezielt hatte.
»Du hast dich gefälligst von mir schlagen zu lassen«, fauchte die Wache.
»Ihr seid herzlich eingeladen, es weiter zu versuchen«, entgegnete der Dunkelelf.
Der Hochelf hielt seinen Kameraden davon ab. »Lasst es lieber, bevor Ihr Euch vor einer Grauhaut lächerlich macht! Was hast du in der Oberstadt zu suchen, Dunkelelf?«
»Wein, Weib und Gesang«, antwortete der Assassine trocken. »Nein, ich will den Tempel der Göttin Viriditas in die Luft jagen. Nein, wartet! Den Statthalter des Kaisers ermorden. Oder will ich einfach meine dunkelelfischen Keime überall verbreiten? Könntet hier oben mal eine ordentliche Seuche gebrauchen. Interesse an der Pest?«
Die Wachen fanden seinen kleinen Scherz alles andere als komisch. Als der Hochelf Anstalten machte, sein Kurzschwert zu ziehen, hielt Elanor ihre Untätigkeit nicht länger aus. Sie wollte keine Verletzten und erst recht keine Toten sehen. Zügig schritt sie auf die Gruppe zu.
»Da bist du ja«, rief sie scharf. »Wo hast du dich rumgetrieben?«
Sie drängte sich zwischen die Wachen und verschränkte die Arme vor der Brust. Der Dunkelelf starrte sie mit einer Mischung aus Feindseligkeit und Misstrauen an. Sie zwinkerte ihm zu und hoffte, dass er das Zeichen richtig deutete.
»Was soll das hier? Habe ich dir nicht gesagt, dass du am unteren Ende der Treppe auf mich warten sollst? Verzeiht, meine Herren! Hat mein Sklave Euch belästigt?«
Der Hochelf wirkte irritiert. »Sklave? Ich denke, er ist eine Schattenklinge …«
Elanor lachte abfällig. »Das wäre er gern. Hat er sich wieder das Zeichen auf den Handrücken gemalt? Glaubt ihm kein Wort! Er hat keine Hemmungen, Umbras Zeichen zu missbrauchen. Er erhofft sich dadurch Privilegien. Irgendwann wird die Gilde ihn dabei erwischen und ihn umbringen.«
Der Dunkelelf senkte zerknirscht den Kopf und sie war froh, dass er mitspielte. »Verzeiht, Herrin«, murmelte er. »Ich dachte …«
»Es interessiert mich nicht, was du gedacht hast«, unterbrach Elanor ihn harsch. »Komm her und nimm mir den Korb ab! Ich hoffe, er hat Euch keine Umstände gemacht?«
»Nein«, sagte der Waldelf langsam. »Vielleicht solltet Ihr Euren Sklaven an die Leine nehmen, meine Dame?«
Elanor schnaufte leise. »Ja, vielleicht. Ihr entschuldigt uns?«
Der Dunkelelf trottete ergeben hinter ihr her, ihren Korb für die Einkäufe in der Hand. Als sie sich weit genug von der Treppe entfernt hatten, blieben sie stehen.
Elanor nahm ihren Korb wieder an sich. »Entschuldigt meinen seltsamen Auftritt.«
»Kein Grund, sich zu entschuldigen. Es hat hervorragend funktioniert. Danke übrigens. Aber warum habt Ihr das getan?«, fragte der Assassine.
»Sie haben nicht das Recht, Euch so zu behandeln.«
»Das Gesetz sieht das anders.«
»Und ich sehe es anders als das Gesetz«, erwiderte Elanor. »Ich habe ohnehin viel zu lange zugesehen. Nur …«
»Nur habt Ihr lange genug zugehört, um zu wissen, dass ich ein Mörder bin, und das hat Euch gehemmt«, vervollständigte der Dunkelelf. Es lag kein Vorwurf in seinen Worten. »Ich kann Euch versichern, dass ich nichts Mörderisches oder Illegales in der Oberstadt plane. Ich möchte bloß auf den Markt und ein paar Dinge kaufen. Für die Elfen in der Aschegrube.«
Das überraschte Elanor. »Es ist gut, zu hören, dass Ihr den Dunkelelfen dort helfen wollt.«
Es könnte alles gelogen und er ein ausgezeichneter Schauspieler sein. Bei einer Schattenklinge würde es sie nicht verwundern. Aber ihr Instinkt sagte ihr, dass der Dunkelelf ehrlich war. Selbst wenn es naiv war, sie wollte ihm glauben.
Er wird auf dem Markt mit dem Gold bezahlen, das er durch seine Morde verdient hat, dachte sie. Da hilft es auch nicht, dass er für den guten Zweck hier ist.
»Verzeihung, ich habe mich Euch nicht vorgestellt«, sagte er und verneigte sich höflich. »Mein Name ist Dûhirion.«
»Sehr erfreut. Elanor ist mein Name«, erwiderte sie.
Sich als Dunkelelf über den Markt zu bewegen, war ein Spießrutenlauf, wie Elanor feststellte. Bohrende Blicke trafen ihn von allen Seiten, hektisches Geflüster erklang hinter seinem Rücken. Elanor musste sehr vorsichtig sein. Etwas hielt sie in seiner Nähe. Einerseits wollte sie sich versichern, dass er tatsächlich nichts Böses im Sinn hatte. Ob sie ihn, einen professionellen Auftragsmörder, von etwas abhalten konnte, stand auf einem anderen Blatt. Andererseits wollte sie bereitstehen, sollte er Hilfe brauchen.
Äußerlich ließ Dûhirion sich nichts anmerken, doch sie konnte sich vorstellen, wie angespannt er war. Dass er sich darauf gefasst machte, angegriffen zu werden. Noch waren die Einwohner der Oberstadt ruhig, aber das würde sich bald ändern. Er war ein Dunkelelf auf dem Gebiet von Wald- und Hochelfen. Für viele war er wie eine pestkranke Ratte, die sich in die Speisekammer verirrt hatte.
Dûhirion machte am Stand eines Bäckers halt und betrachtete die Auslage. Elanor blieb an einem benachbarten Stand stehen.
»Das Brot ist nicht zu haben«, murrte der Bäcker prompt. »Es ist reserviert.«
Der Dunkelelf ließ ein sarkastisches Lachen hören. »Wirklich? Entschuldigt, ich muss etwas verpasst haben. Meines Wissens wird reservierte Ware nicht mehr in die Auslage gelegt, aber ich will Euch nicht in Eure Tätigkeit hineinreden. Ich nehme auch jedes andere Brot, das Ihr anzubieten habt.«
Vorsichtig drehte Elanor den Kopf etwas, um besser beobachten zu können.
Der Standbesitzer kam zu ihm herum und baute sich vor ihm auf. Er war ein Waldelf, einen Kopf kleiner als er und ihm körperlich weit unterlegen. Furcht und Verachtung lagen wie ein Schatten über seinem Gesicht. »Dein Gold ist hier nichts wert, Dunkelelf. Ich kenne dein Volk und weiß, dass Blut an diesen Münzen klebt. Wie viele Leben hast du dafür auslöschen müssen? Und wer hat dich überhaupt die Grenze passieren lassen?«
»Ob Ihr es glaubt oder nicht: Ich bin legal hier. Ich habe eine Genehmigung«, erwiderte Dûhirion ruhig. »Tatsächlich hat mich mein Gold weniger gekostet, als Ihr vermutet. Lediglich eine tote Königstochter. Da Ihr mein Volk kennt, wird das nichts Neues für Euch sein: Ich habe sie nachts aus ihrem Bett gestohlen, meinen falschen Göttern geopfert und würde nun gern ihre Leiche verspeisen. Dafür fehlt mir noch ein Laib Brot.«
Dem Spott zum Trotz schreckten seine Worte den Bäcker.
Kinder, die nicht artig sind, werden von den Dunkelelfen geholt und gefressen, dachte Elanor, sich an die Schauermärchen erinnernd, die sie aus ihrer Kindheit kannte. Bei Vollmond halten sie blutige Opferrituale ab, in denen sie Dämonen beschwören und Krankheiten über das Land verteilen. Als ich ein Kind war, habe ich das geglaubt. Dass es ein erwachsener Mann immer noch tut, finde ich bedenklich.
»Scher dich weg, Grauhaut«, zischte der Bäcker.
»Verkauft mir das Brot und ich bin weg!«
»Nur über meine …« Der Waldelf verstummte.
»Nur über Eure Leiche?«, vervollständigte Dûhirion mit schiefem Lächeln.
Die Lippen des Bäckers wurden zu einem schmalen Strich. »Verschwindet!«
Dûhirion gab nach. Mit einem Seufzen wandte er sich ab und ging.
Elanor warf einen Blick in ihren Korb, in dem sich Obst und eine Flasche Wein befanden. Kurz entschlossen ging sie zum Stand des Bäckers, kaufte zwei Laib Brot und beeilte sich dann, den Dunkelelfen einzuholen.
»Dûhirion, wartet!«
Er stoppte und drehte sich um. Sie blieb vor ihm stehen.
»Bitte nehmt den Korb.«
»Das … Das könnt Ihr nicht ernst meinen«, sagte er verwundert.
»Es ist für die Kinder in der Aschegrube. Sie werden sich vor allem über das Obst freuen«, erwiderte Elanor. »Es ist eine Schande, wie meine Leute Euch behandeln. Erst die Wachen, dann der Bäcker. Ich habe mitbekommen, wie er Euch vertrieben hat.«
Dûhirion zog die Braue über seinem blinden Auge hoch. »Ihr habt auch mitbekommen, dass ich den Bäcker provoziert habe? Und die Wache ebenfalls.«
»Verdient provoziert«, entgegnete Elanor. »Es war nicht so, als hättet Ihr keinen Grund dazu gehabt.«
»Was wollt Ihr für den Korb haben?« Dûhirion langte bereits nach dem Beutel an seinem Gürtel.
»Nichts. Es ist ein Geschenk.«
Der Dunkelelf schüttelte ungläubig mit dem Kopf. »Seid Ihr Euch sicher? Irgendetwas müsst Ihr dafür haben wollen.«
»Das Versprechen, dass es den Richtigen zugutekommt.«
Dûhirions Lächeln sah ehrlicher aus, als er den Korb entgegennahm. »Ich danke Euch vielmals.«
»Gern geschehen. Passt auf Euch auf.«
Er verabschiedete sich und verschwand in Richtung Aschegrube. Elanor sah ihm einen Moment lang nach, ehe sie ebenfalls den Rückweg antrat.
Später hatte sie von Dûhirion erfahren, dass er damals auf Valions Geheiß Lebensmittel für die Dunkelelfen der Aschegrube gekauft hatte. Von allein wäre er nicht darauf gekommen. Erst sein regelmäßiger Kontakt zur Weißen Feder hatte ihn sensibler für die Bedürfnisse der Dunkelelfen aus dem Elendsviertel gemacht.
Wenn sie sich an diesen Tag erinnerte, konnte sie nicht fassen, wie leichtsinnig sie beide gewesen waren. Heute würde Elanor sich nicht mehr derart unüberlegt in einen Streit einmischen. Ihre Idee hätte entsetzlich schiefgehen können. Dûhirion würde heute auch nicht mehr so provokant Wachen gegenüber sein. Er hatte gelernt, seine Zunge zu zügeln, und wusste, wann er besser den Mund hielt.
Kapitel 1 - Dûhirion
Er wartete. Die Stille presste sich von allen Seiten gegen ihn. Dûhirion lauschte konzentriert in sie hinein, suchte nach verräterischen Geräuschen. Doch alles, was ihm antwortete, war das Rauschen seines eigenen Blutes in den Ohren. Dunkelheit umhüllte ihn zäh wie heißer Teer, verklebte seine Atemwege und Augenlider. Er atmete flach in den Schmerz hinein, der in seinen überspannten Muskeln pochte. Sein Versteck war zu klein für einen Mann seiner Größe, sodass er in eine unbequeme Haltung gezwungen war.
Er hielt absolut still, als die Schritte lauter wurden. Durch den schmalen Spalt zwischen den Schranktüren fiel das warme Licht einer Kerze, die soeben entzündet worden war.
»Ihr könnt Euch beruhigen«, sagte eine männliche Stimme. »Denkt daran, dass nicht ich Euer Feind bin.«
Vorsichtig lehnte Dûhirion sich vor und spähte durch den Spalt. Es waren zwei Personen, die das Haus betreten hatten. Ein Hochelf setzte sich an den Tisch und bewegte seinen Zeigefinger langsam durch die Kerzenflamme, während er sprach. Ein Waldelf schritt vor ihm auf und ab, gestikulierte, rieb sich den Nacken. Seinen Kopfbewegungen nach zu urteilen huschten seine Augen durch den Raum wie Kakerlaken, die vor dem Licht flohen.
»Es war ein Fehler«, sagte der Waldelf.
»Es ist ein bisschen spät, um umzukehren«, erwiderte der Hochelf gelassen und stippte seine Fingerspitze ins flüssige Wachs. »Man sollte meinen, Ihr hättet nicht darüber nachgedacht. Habt Ihr einfach blindlings zugestimmt und Euch ist erst hinterher eingefallen, dass unser Vorhaben Risiken birgt? Nicht nur für Euch, wenn ich daran erinnern darf.« Sacht blies er gegen das Wachs, bis es abkühlte.
»Nein. Nein, natürlich nicht. Ich …« Der Waldelf zog mit den Zähnen einen kleinen Hautfetzen von seiner Unterlippe. »Hört zu, ich verachte Hastor ebenso sehr, wie Ihr es tut. Wie viele es tun. Aber …«
Er leckte sich das Blut von der Lippe und entlockte dem Hochelfen ein missbilligendes Naserümpfen.
»Wir sollten das nicht tun«, zischte der Waldelf so leise, dass Dûhirion ihn kaum verstehen konnte. »Ich werde verfolgt. Schaut mich nicht so an! Ich spüre es. Jemand ist hinter mir her. Hastor weiß, wie viele Feinde er hat und dass er um seine Position beneidet wird. Was ist, wenn er längst bemerkt hat, was wir planen?«
Der Hochelf zerrieb das harte Wachs zwischen Zeigefinger und Daumen. »Ich bin mir sicher, diejenigen, die Euch angeblich verfolgen, sind nur harmlose Passanten, die zufällig denselben Weg gewählt haben.«
»Tut nicht so, als wäre ich verrückt«, rief der Waldelf und schlug mit der Faust auf den Tisch.
Ein Ausdruck von Abscheu fiel wie ein Schatten über das scharf geschnittene Gesicht des Hochelfen. Er presste die Lippen aufeinander und tiefe Falten zerfurchten seine glatte Stirn. »Selbst wenn Hastor ahnt, dass es jemand auf ihn abgesehen hat, warum sollte er uns im Verdacht haben?«, fragte er im geduldigen Tonfall eines Erwachsenen, der mit einem dummen Kind sprach. »Wie Ihr selbst sagtet: Für ihn ist es nichts Neues, dass ihm jemand nach dem Leben trachtet. Er wird eher damit rechnen, dass jemand versucht, Umbra anzuheuern, um ihn zu töten.«
»Das wäre meiner Meinung nach der effektivere Weg«, schnaubte der Waldelf. »Es würde den Verdacht von uns lenken.«
»Keiner von uns kann genug Gold zusammentragen, um Umbra dazu zu bringen, ihren Schutzvertrag mit Hastor aufzulösen und sich gegen ihn zu wenden. Ihr seid kurzsichtig, Freund«, entgegnete der Hochelf.
»Ich bin nicht Euer Freund.«
Der Hochelf unterbrach ihn mit einer unwirschen Handbewegung. »Still! Muss ich wieder Euer Argument gegen Euch verwenden? Hastor rechnet damit, dass ein Assassine von Umbra ihn töten wird, nicht damit, dass jemand aus seinen Reihen ihm eigenhändig einen vergifteten Kelch reicht.«
»Es war ein Fehler, mich darauf einzulassen.« Der Waldelf fuhr sich durchs kurze Haar und verschränkte die Arme vor der Brust. »Ich steige aus.«
»Oh?«, machte der Hochelf spöttisch.
»Das Gold, das Ihr mir im Voraus gezahlt habt, bekommt Ihr zurück.«
»Ihr wisst, dass Ihr dann alles verliert, oder? Wollt Ihr Eure Familie tatsächlich in die Gosse treiben?«
Der Waldelf biss sich auf die beschädigte Unterlippe. »Ich finde einen anderen Weg, meine Schulden zu begleichen. Keine Sorge! Euer Gold liegt unangerührt in seinem Versteck. Ich bringe es Euch noch heute Nacht vorbei. Geht jetzt, bitte!«
»Nun gut.« Der Hochelf stand langsam auf. »Aber lasst Euch gesagt sein: So einfach kommt Ihr nicht aus der Sache raus. Ihr steckt bereits zu tief drin.« Er schlenderte betont gelassen um den Tisch herum und blieb neben dem deutlich kleineren Waldelfen stehen. Das schwache Kerzenlicht warf ihre Schatten blass und riesenhaft an die Wand, als er sich ein Stück zu ihm hinunterbeugte und seine Stimme senkte. »Ein Wanderer, der einmal das Moor betreten hat, wird es nicht mehr verlassen. Ihr habt Euer Schicksal besiegelt, als Ihr Euren Stiefel auf den Morast gesetzt habt. Denkt Ihr, das Moor lässt Euch gehen, wenn Ihr schon bis zur Hüfte darin versunken seid?«
Ruckartig streckte der Waldelf seinen Arm aus und wies zitternd auf die Tür. »Geht!«
Der Hochelf lächelte. »Behaltet das Gold, Freund! Eine Nacht Schlaf wird Euren Kopf klären. Denkt morgen beim Frühstück noch einmal über die Sache nach. Ich erwarte Euch am Abend an unserem gewohnten Treffpunkt.«
Er ging und der Waldelf ließ sich plump auf einen Stuhl fallen. Er stützte die Ellenbogen auf die Tischplatte und barg das Gesicht in seinen Händen. »Verdammt«, murmelte er lauter werdend. »Verdammt, verdammt, verdammt.«
Dûhirion schob sacht die Türen auf und glitt aus dem Schrank. Langsam näherte er sich dem Waldelfen, seine Schritte waren geschmeidig und lautlos wie die einer Katze. Als er hinter ihm stand, ließ der Waldelf seine Hände sinken.
»Verdammt, wo bin ich da nur hineingeraten?«
In eine Sache, die nicht ausgeführt werden darf, antwortete Dûhirion ihm still.
Seine Zielperson hatte keine Zeit, zu reagieren. Ein kurzes Aufblitzen der Klinge im Kerzenlicht und der Dolch durchtrennte seine Kehle. Rote Sprenkel verteilten sich über den Tisch und das weiße Wachs. Die Flamme zischte leise, als einige Blutstropfen den Docht trafen.
Der Waldelf krümmte sich, umklammerte fassungslos seinen Hals. Er rutschte seitlich vom Stuhl, stützte sich zitternd auf Knie und Ellenbogen. Seine schreckensweiten blauen Augen richteten sich auf Dûhirion.
»Umbra entsendet Euch ihre Grüße«, sagte der Dunkelelf leise. Sein Gesicht war emotionslos. Mitleid oder Reue verspürte er längst nicht mehr.
Der Waldelf öffnete den Mund, statt Worte quoll ein nasses Gurgeln aus seinem Rachen. Langsam gab sein Körper nach. Er sank gänzlich zu Boden, rollte sich mit letzter Kraft zu einem blutigen Bündel zusammen und starb.
Dûhirion holte den Vertrag, den der Auftraggeber mit seiner Gilde geschlossen hatte, aus seiner Gürteltasche und ging neben dem Toten in die Hocke. Es war üblich, ihn beim Opfer zu hinterlassen, damit jeder wusste, dass Umbra verantwortlich war. Eine einfache wie effektive Methode, um Angst zu schüren und an die Macht der Assassinengilde zu erinnern.
Er drehte den Toten auf den Rücken, befestigte den Kontrakt mit dem Dolch an seiner Brust und verließ das Haus.
Die milde Nachtluft vertrieb den schweren Blutgeruch aus seiner Nase.
»Kommt schon, es ist nicht mehr weit«, zischte jemand. »Ihr schafft es. Vorwärts, Bleichgesicht, vorwärts!«
Ein erstickter, kaum hörbarer Schrei erklang. Dûhirion erkannte die Stimmen und folgte ihnen alarmiert.
Er fand den dunkelelfischen Assassinen, der ihn begleitet hatte, in einer schmalen Gasse zwischen zwei Häusern. Dûhirion arbeitete zum ersten Mal mit ihm zusammen. Er wusste weder seinen Namen noch sein Alter oder wie lange er schon für Umbra tätig war. Es interessierte ihn auch nicht sonderlich, denn er konnte diesen Kerl seit ihrer ersten Begegnung nicht leiden.
Der Hochelf, der Minuten zuvor herablassend mit dem Waldelfen gesprochen hatte, lag bäuchlings auf dem Boden. Seine Glieder waren eigenartig steif und gekrümmt. In unregelmäßigen Abständen verkrampften sich die Muskeln in seinem Rumpf und pressten ein gequältes Stöhnen aus ihm heraus. Da war eine winzige Wunde in seiner Schulter, kleinste Blutflecken zeichneten sich dunkel vom hellroten Stoff seiner Kleidung ab.
Gift, dachte Dûhirion. Deshalb kann er nicht schreien.
Er blickte angewidert zum Assassinen, der mit einem breiten Grinsen neben dem Kopf des Hochelfen hockte. »Gebt nicht auf«, animierte er flüsternd. »Wie versprochen: Wenn Ihr es bis zum Ende der Gasse schafft, lasse ich Euch leben.« Er wedelte mit einem blutigen spitzen Ohr. »Vielleicht bekommt Ihr das auch wieder. Mit Glück kann ein fähiger Heiler es annähen.«
Der Hochelf gab einen Laut von sich, der irgendwo zwischen Keuchen und Schluchzen lag. Seine Finger krallten sich am Pflasterstein fest. Ächzend zog er sich die nächsten Zentimeter vorwärts.
Dûhirion sah sich rasch um, machte einen lautlosen Satz vor und ließ die versteckte Klinge aus seiner rechten Armschiene fahren. Das Leben des Hochelfen endete durch einen gezielten Stich in den Rücken. Der scharfe Stahl drang durch Haut, Knochen und einen Lungenflügel ins Herz.
Der Assassine sprang frustriert auf. »Was habt Ihr angerichtet?«
»Eure Arbeit erledigt«, erwiderte Dûhirion gedämpft. »Setzt Euch in Bewegung, wir müssen zurück!«
»Ich war noch nicht fertig mit ihm.«
»Ruhe!«
Das Letzte, was er wollte, war, von einer Wachpatrouille erwischt zu werden, weil sein Kamerad sadistische Gelüste der Sicherheit vorzog.
Dûhirion nutzte die nächtlichen Schatten, um ungesehen die Oberstadt zu durchqueren. Der andere Assassine blieb ihm dicht und glücklicherweise schweigend auf den Fersen. Sie stiegen ins Elendsviertel der Dunkelelfen hinab.
»Ich war nicht fertig mit ihm«, wiederholte sein Begleiter. »Ihr habt meinen Auftrag gestohlen.«
Dûhirion wirbelte herum. »Ihr solltet ihn töten, nicht mit ihm spielen.«
»Ich weiß, was ich tue. Ich hätte ihn am Ende der Gasse getötet«, entgegnete der Assassine mit verständnisloser Miene.
Dûhirion streifte beiläufig die schwarzen Handschuhe ab und betrachtete seine Finger. Es war kein Blut durch den Stoff auf seine Haut gedrungen. »Wenn Euch bis dahin keine Patrouille entdeckt und zur Flucht gezwungen hätte.«
»Das wäre nicht passiert«, entgegnete sein Gegenüber augenrollend.
Dûhirion stopfte die Handschuhe schnaubend in seine Gürteltasche und ging weiter. »Der Auftrag ist erledigt, egal von wem.«
»Wo wollt Ihr hin? Zur Gilde geht es dort entlang.« Der andere Assassine holte ihn ein und lief rückwärts vor ihm her. »Oder habt Ihr andere Pläne? Verratet es mir! Ich habe immer ein offenes Ohr für Euch.« Er hielt das abgetrennte Ohr des Hochelfen in die Höhe und lachte über seinen schlechten Witz.
Dûhirion verzog den Mund, er schmeckte etwas Bitteres im hinteren Teil seines Rachens.
»Zieht nicht so ein Gesicht«, sagte sein Begleiter. »Ihr erinnert Euch, was Hochelfen und Waldelfen mit unsereins machen? Wie viele Dunkelelfen müssen mit verstümmelten oder abgetrennten Ohren leben? Das hier ist bloß ausgleichende Gerechtigkeit.«
»Redet Euch das nur weiter ein«, murmelte Dûhirion trocken. »Lasst mich vorbei!«
Sie passierten den alten Brunnen, der das Zentrum des Viertels bildete. Der Assassine wandte sich ab und wollte gehen, doch er hielt inne und stoppte Dûhirion. »Seht mal! Was haben wir denn da?«
Ein dunkelelfisches Mädchen kauerte vor dem Brunnen auf dem schlammigen Boden. Sie war wahrscheinlich nicht älter als zwölf Jahre. Ihr Kleid war zerschlissen und schmutzig, Ruß bedeckte ihre hohlen Wangen. Strähnen ihres verfilzten schwarzen Haares hingen wirr vor den tief eingesunkenen Augen. Sie hielt eine Puppe im Arm und wippte apathisch vor und zurück.
»Kinder sollten um die Zeit nicht mehr draußen sein«, bemerkte Dûhirions Begleiter grinsend. Er schlenderte auf sie zu. »Hallo, Kleines. Hast du dich verlaufen? Komm, ich bringe dich an einen schönen Ort.«
Dûhirion zog ihn grob zurück. »Ihr werdet sie nicht anrühren!«
»Umbra kann neue Rekruten stets gebrauchen«, erwiderte sein Begleiter. »Ihr habt meinen Auftrag gestohlen, aber ich lasse mir bestimmt nicht die Belohnung entgehen, die das Balg mir einbringen wird.«
Das Mädchen drückte seine Puppe fester an die Brust und sah ängstlich zu ihnen auf.
Dûhirion stellte sich zwischen sie und den anderen Dunkelelfen. »Oh doch, das werdet Ihr. Ich lasse nicht zu, dass dieses Mädchen in Umbras gierige Hände fällt.«
Der andere Assassine verschränkte abfällig die Arme vor der Brust. »Und warum sollte ich auf Euch hören?«
Dûhirion senkte seine Stimme drohend. »Weil ich unserem Gildenmeister sonst erzählen werde, was ich gesehen habe. Eure sadistische Fahrlässigkeit wird bei Taremia auf keine Gegenliebe stoßen. Ihr wisst, was das für Euch bedeuten kann.«
Das Gesicht des Assassinen verfinsterte sich. »Das würdet Ihr nicht wagen.«
»Lasst das Mädchen in Ruhe«, forderte Dûhirion.
Der Assassine warf die Arme in die Luft. »Von mir aus. Behaltet das Dreckskind!«
Dûhirion wartete, bis er außer Sichtweite war, und wandte sich dann dem Mädchen zu. Er ging in gebührendem Abstand vor ihr in die Hocke. Sie presste die trockenen Lippen aufeinander und zog die dünnen Beine näher an ihren Körper.
»Wo sind deine Eltern?«, fragte er.
»Tot«, antwortete sie tonlos. »Alle sind tot.«
Dûhirion runzelte nachdenklich die Stirn. »Ist dein Haus in der Nähe?«
Sie schüttelte den Kopf. Abwesend zeichnete sie das Gesicht der Puppe mit dem Zeigefinger nach. Ihr linker Fußknöchel war geschwollen und dunkel verfärbt, sie hatte aufgeschlagene Knie und leichte Verbrennungen am Oberarm.
Was war ihr zugestoßen?
»Mein Name ist Dûhirion«, setzte er neu an und seine raue Stimme klang ungewohnt sanft. »Wie du siehst, bin ich auch ein Dunkelelf.«
Sie musterte ihn vorsichtig und er beobachtete sie aufmerksam dabei. Sie sah dunkelgraue Haut wie die ihre. Ihr Blick wanderte langsam über seine schwarze Assassinenkluft in sein Gesicht; streifte den getrimmten Vollbart, die wulstige Narbe unter seinem erblindeten Auge und die zahlreichen silbernen Ringe in seinen Ohren. Sekundenlang stoppte sie bei seinem schwarzen Haar, welches er im Irokesenschnitt trug, und kehrte dann zu seinem dunkelroten Auge zurück. Unverblümt betrachtete sie das rechte Auge, das ihr Starren milchig-trüb und leer erwiderte.
»Du musst nicht sprechen, wenn du nicht willst«, fuhr er fort. »Es reicht, wenn du nickst oder mit dem Kopf schüttelst. Wohnst du in Malachit?«
Kopfschütteln.
»Hast du Verwandte hier?«
Kopfschütteln.
»Bist du weggelaufen, nachdem deinen Eltern etwas zugestoßen ist?«
Das Mädchen nickte zittrig.
»Wie ist dein Name?«
»Faylen«, flüsterte sie brüchig. »Mein Bein tut weh.«
»Ich kenne einen Heiler, der sich um deine Wunden kümmern kann«, erwiderte Dûhirion.
»A-Aber ich bin ein Dunkelelf.«
»Das kümmert ihn nicht. Er hilft jedem.« Er richtete sich auf und reichte ihr die Hand. »Kannst du aufstehen?«
Zögerlich ließ sie sich von ihm hochziehen. Sie balancierte unsicher auf dem gesunden Bein.
»Um zu meinem Freund zu kommen, müssen wir durch die Oberstadt.«
Faylens Augen weiteten sich und sie zuckte zusammen, als hätte er gegen ihren verletzten Knöchel getreten. »D-Da dürfen wir nicht hin.«
»Um zum Heiler zu gelangen, müssen wir da durch«, erwiderte Dûhirion.
»Aber …«
»Hör zu«, unterbrach er sie. »Du hast zwei Möglichkeiten: Entweder kommst du mit mir oder du bleibst hier sitzen und wartest auf ein Wunder.«
Faylens Unterlippe bebte.
»Willst du Hilfe oder nicht?«
Sie nickte schniefend.
Probeweise ging er einige Schritte mit ihr. Faylen humpelte unbeholfen und biss die Zähne zusammen, sichtlich bemüht, nicht zu weinen.
Dûhirion seufzte innerlich und blieb stehen. »Komm, ich trage dich!«
Er hob sie hoch und sie legte reflexartig die Arme um seinen Hals. Sie war derart leicht, dass er glaubte, lediglich ihre Knochen würden ihr Gewicht bestimmen.
Kapitel 2 - Dûhirion
Aschegruben wurden die Elendsviertel der Dunkelelfen im Volksmund genannt. In jeder Stadt im Kaiserreich Adular war ein solches zu finden. Diejenigen, die den Namen in den Mund nahmen, spuckten ihn aus, als hätten sie in schlechtes Obst gebissen. Hier in Malachit trennte eine hohe Mauer die Aschegrube von der Oberstadt, in der hauptsächlich Waldelfen und Hochelfen lebten. Die Treppe, die hinaufführte, wurde zu jeder Tages- und Nachtzeit bewacht.
Ein widerwärtiger Gestank lag wie dichter Rauch in der Luft. Er setzte sich aus den faulen Lebensmitteln und verrottenden Möbelstücken zusammen; dem Abwasser und sämtlichem Schmutz der Oberstadt. Bei jedem Atemzug hatte man das Gefühl, sich daran zu vergiften. Die Bäume waren kohlschwarz, zwischen toten Ratten und Fäkalien ragten ein paar vertrocknete Grasbüschel empor.
An diesem Ort war alles grau, als würde jegliche Farbe davor zurückschrecken; selbst der Himmel schien niemals blau zu werden.
Grau war der schlammige Boden, der mit schimmelnden Holzplanken ausgelegt war.
Grau waren die schäbigen Holz- und Lehmhütten.
Und grau war die Haut der Einwohner, die hier ihr Dasein fristen mussten.
Tagsüber sah man die fahlen Gestalten, wie sie mutlos und apathisch ihrer Routine folgten. Sie bewegten sich wie Marionetten durch ihr Viertel, die von einem Puppenspieler ungeschickt gelenkt wurden. Sie waren das verstoßene Elfenvolk. Zusammengepfercht auf engem Raum und jeglicher Rechte beraubt.
Nachts war es angenehmer, sich durch das Viertel zu bewegen. Die Dunkelheit überdeckte gnädig alles Hässliche und wenigstens für ein paar Stunden war man blind für die allgegenwärtige Trostlosigkeit. In der Stille der Nacht schliefen Elend, Angst und Hoffnungslosigkeit. Diejenigen, die sie am Tage plagten, versanken im seligen Vergessen. Nur vereinzelt hörte man ein Wehklagen, das jedoch leicht mit dem Heulen des Windes verwechselt werden konnte.
Dûhirion durchquerte mit der kleinen Faylen das Viertel und führte sie zu einer Hütte nahe der Mauer. Nachdem er die Tür hinter sich verschlossen und das Mädchen abgesetzt hatte, klappte er die Holzpritsche an der hinteren Hauswand hoch und löste einige Dielen aus dem Boden.
Neugierig spähte Faylen über seine Schulter. Auf den ersten Blick legte er bloß graue Erde frei. Dûhirion holte einen kleinen silbernen Ring aus seiner Gürteltasche, deren Innen- und Außenseiten mit feinen verschlungenen Zeichen versehen waren. Als er den Ring über den Boden hielt, löste sich die Illusion auf und eine Luke wurde sichtbar.
Faylen japste hinter ihm. »Ist das M-Magie?«, flüsterte sie ehrfürchtig.
Dûhirion nickte lediglich. Für ihn gehörte es bereits zur Gewohnheit. Stumm blickte er in die tintenschwarze Finsternis hinter der Luke. Sie ließ den Tunnel endlos tief erscheinen. Ohne den kleinsten Funken Restlicht erblindeten selbst die nachtsichtigen Augen eines Dunkelelfen. Missmutig bemerkte Dûhirion, dass er keine Fackel dabeihatte.
»Dieser Tunnel führt in die Oberstadt«, begann er. »Bist du so weit? Kletter auf meinen Rücken und ich trage dich die Leiter runter.«
Faylen schüttelte mit dem Kopf und presste ihr Gesicht in die Puppe. »Kann der Heiler nicht herkommen?«
»In seiner Klinik ist es sauberer und er kann deine Wunden besser versorgen«, erwiderte Dûhirion. »Dir wird nichts passieren.«
»Es ist zu dunkel dort unten«, nuschelte sie.
»Ich sagte bereits, dass ich dich tragen werde. Schließ die Augen, wenn wir unten sind. Dann bekommst du nichts von der Dunkelheit mit.«
Das war die falsche Antwort. Faylen begann zu zittern.
Dûhirions Ungeduld wuchs. Er dachte kurz darüber nach, sie zu packen und sich schlicht über die Schulter zu werfen, doch er verwarf die Idee schnell. Daher ging er erneut vor ihr in die Hocke und setzte ein erlerntes Lächeln auf, von dem er wusste, dass es freundlich auf andere wirkte. »Wenn wir beim Heiler sind, bekommst du etwas Warmes zu essen«, sagte er in sanfterem Tonfall. »Es gibt dort neue Kleidung für dich und sicherlich könntest du auch ein heißes Bad nehmen.«
»Mit warmem Wasser und duftender Seife?«, fragte Faylen zögerlich.
Dûhirion nickte. »Und du könntest heute Nacht in einem sauberen Bett schlafen.«
Sie rang mit sich. Nervös kaute sie auf ihrer Unterlippe.
»Es ist nicht weit«, versprach er.
»In Ordnung«, erwiderte Faylen kaum hörbar.
»Halt dich gut fest.«
Nachdem er sie auf seinen Rücken gehoben hatte, stieg er in den Tunnel hinab. Er schloss die Luke über sich und undurchdringliche Schwärze fiel über sie her. Faylen presste sich wimmernd an ihn.
Dûhirion bewegte sich an der Wand entlang, die freie Hand nach vorn ausgestreckt. Er zählte die Abzweigungen, an denen sie vorbeikamen, und bog in die dritte ein. Die Stille war unerträglich und ihm fiel nichts ein, worüber er sich mit dem Mädchen unterhalten konnte.
Lass mich dir aus dem lustigen Leben eines Assassinen berichten, dachte er. Heute habe ich einem Waldelfen mit einem Streich die Kehle aufgeschlitzt. Die Blutspritzer auf dem Tisch haben ein interessantes Muster ergeben. Soll ich es dir näher beschreiben?
Faylen begann leise zu summen. Die Melodie war langsam und harmonisch. Anfänglich noch von einem Zittern in ihrer Stimme durchzogen, beruhigte sie sich zunehmend. Schließlich wurde aus ihrem Summen ein Singen und Dûhirion glaubte, ein Schlaflied zu erkennen. Es hielt an, bis sie das Ende des Ganges erreicht hatten.
»Wir sind da. Wenn wir oben sind, müssen wir uns schnell und leise bewegen«, erklärte er. »Verstehst du?«
»Mhm«, erwiderte sie und verstummte dann.
Dûhirion kletterte die Sprossen hinauf und stieg aus dem Tunnel. Er hatte sie in eine entlegene Ecke der Oberstadt geführt, direkt hinter einen dichten Brombeerstrauch.
Nachdem er sich vergewissert hatte, dass keine Wachpatrouille in der Nähe war, schloss er die Luke. Obgleich sich der Illusionszauber sofort wieder darüberlegte, deckte er sie sorgfältig mit Laub und Gestrüpp ab.
Ein heller Schein drang aus den Fenstern des örtlichen Gasthauses. Musik und Gelächter wehten mit dem Geruch von Essen und Alkohol auf die Straße. Dûhirion wartete mit Faylen hinter einer Häuserecke, bis die beiden Waldelfen vor der Tür ihr Gespräch beendet hatten und endlich eintraten. Dann lief er eilig weiter.
Faylen erschreckte sich vor jedem Schatten, zuckte bei Geräuschen zusammen, als würde sie sich an ihnen verletzen. Wie ein Mantra murmelte sie die Regeln vor sich her, die ihr beigebracht worden waren.
»Ein Dunkelelf gehört in die Aschegrube. Schmutz gehört in den Schmutz. Einem Dunkelelfen aus der Aschegrube ist es nicht gestattet, die Oberstadt zu betreten. Es sei denn, sein Meister ist bei ihm. Ein Dunkelelf gehört in die Aschegrube …«
Während Dunkelelfen in den meisten Teilen der Welt frei waren, wurden sie im Kaiserreich Adular immer noch wie vor zweitausend Jahren behandelt. Nur hier gab es die strikte Unterteilung von Oberstadt und Aschegrube.
Das Erste, was einem dunkelelfischen Kind beigebracht wurde, war, dass jeder tollwütige Straßenköter mit mehr Respekt behandelt wurde als man selbst. Das Nächste waren Verhaltensregeln für die Oberstadt.
Werft euch vor Waldelfen, Hochelfen und Menschen auf die Knie und fresst Dreck! Lasst euch von ihnen treten und bedankt euch, wenn sie euch die Rippen brechen! Sollte einer euer Erstgeborenes verlangen, weil er es wahlweise zur Prostitution zwingen, als persönlichen Sklaven erziehen oder an Umbra verkaufen will, dann brecht vor Dankbarkeit gefälligst in Tränen aus!
Dûhirion rümpfte verächtlich die Nase.
»Einem Dunkelelfen ist es nicht gestattet, die Oberstadt zu betreten. Es sei denn …«, nuschelte Faylen monoton.
Dûhirion blieb abrupt stehen und duckte sich hinter einen verlassenen Marktstand. Eine Wachpatrouille stand unweit von ihnen. Es waren zwei; aufgrund der schweren Rüstungen und dichten Helme konnte er nicht bestimmen, welchem Volk oder Geschlecht sie angehörten.
Jedes Elfenvolk besaß charakteristische Merkmale, an denen seine Zugehörigkeit leicht zu erkennen war. Größe, Haut- und Haarfarbe waren sehr spezifisch. Wenn auch nur einer von ihnen ein Waldelf war, hatten sie ein Problem. Waldelfen hatten das feine Gehör einer Raubkatze. Ein zu lautes Geräusch und sie würden entdeckt werden. Dann war es nur eine Frage des Augenblicks, bis die Wachen erkannten, wer sie waren, und beginnen würden, sie zu jagen.
»W-Was ist?«, wisperte Faylen.
»Wachen«, antwortete Dûhirion knapp. »Wir müssen …«
Er realisierte seinen Fehler zu spät.
»Ich will nicht mitgenommen werden«, rief Faylen panisch aus. Sie wand sich und zerrte an seinem Kragen. »Sie werfen uns in den Kerker. Ich will nicht mitgenommen werden. Einem Dunkelelfen ist es nicht gestattet, die Oberstadt zu betreten. Schmutz gehört in den Schmutz.«
Dûhirion setzte sich zügig in Bewegung. Das Mädchen war zu laut, die Wachen würden sie hören.
»Wer ist da?«, rief eine männliche Stimme. Sie klang blechern und warf ein seltsames Echo.
Dûhirion fluchte stumm und rannte schneller.
»Meine Puppe.« Faylens Schrei stach wie eine heiße Nadel in sein Innenohr. »Ich hab meine Puppe fallen lassen.«
»Hey«, brüllte die Wache ihnen hinterher. »Stehen bleiben!«
»Meine Puppe!«
»Halt den Mund«, knurrte Dûhirion.
Sein harscher Tonfall ließ Faylen hemmungslos in Tränen ausbrechen. Sie zappelte heftig auf seinem Rücken. »Hol sie zurück! Ich darf sie nicht allein lassen.«
Es war riskant, es war dumm, aber notwendig. Sie würde sich erst beruhigen, wenn sie ihr Spielzeug wiederhatte.
Er hastete zwischen einigen Häusern entlang und schlug einen weiten Bogen, bis er dorthin zurückkam, wo er losgelaufen war. Von den Wachen war nichts mehr zu sehen, aber darauf wollte er sich nicht verlassen. Er hob die Puppe auf und reichte sie Faylen, während er bereits weiterrannte. Sie verstummte und weinte still in die Lumpenkleider.
Dûhirion blieb erst stehen, als er die Klinik erreicht hatte. Die kleine Laterne über der Tür leuchtete noch, also war Arik bereit, Patienten zu empfangen. Er klopfte hastig und es dauerte bloß wenige Sekunden, bis er eingelassen wurde.
Der Heiler setzte gerade zu einer Begrüßung an, als er Faylen erblickte. »Was ist passiert?«, fragte er rasch.
Arik war ein hochgewachsener, aber magerer Mann Anfang dreißig. Er hatte kurzes schwarzes Haar und dunkle Schatten lagen unter seinen braunen Augen.
Dûhirion gab ihm eine knappe Erklärung und setzte Faylen auf einem Bett ab. Es wunderte ihn, dass sie beim Anblick eines Menschen keine Reaktion zeigte.
Arik schenkte dem Mädchen ein freundliches Lächeln. »Hallo, Faylen. Mein Name ist Arik und ich werde mir deine Wunden ansehen. In Ordnung? Sag mir Bescheid, wenn ich dir wehtun sollte.«
Faylen sah flehend zu Dûhirion auf, der sich neben Arik gestellt hatte.
»Dûhirion, würdest du dich neben sie setzen?«, bat der Magier und krempelte die Ärmel seines weißen Leinenhemdes über die Ellenbogen.
Etwas verwundert kam er der Bitte nach. Faylens klamme Finger griffen nach seinem Arm. Er spürte ihr Zittern, die Kälte ihrer Haut, die durch den Stoff seiner Tunika drang. Arik nickte ihm ermutigend zu, sodass er beschloss, sich nicht zu rühren.
Während der Magier Faylens Wunden vorsichtig reinigte, nahm Dûhirion eine Bewegung im hinteren Teil des Raumes wahr. Instinktiv spannte er sich an und schärfte seine Sinne. Er hörte keine Schritte, doch ein vertrauter Duft wehte ihm in die Nase: Lavendel, Bergamotte und ein Hauch Thymian.
Eine zierliche Waldelfin trat an Ariks Seite und brachte ihm Verbände. Sie trug ein hellgrünes Kleid und hatte ihr ellenbogenlanges braunes Haar zu einem losen Dutt gebunden. Zwei vordere Strähnen hingen außerhalb des Zopfes. In eine von ihnen war ein weißes Band eingeflochten.
»Danke dir, Elanor«, sagte der Heiler.
»Gern geschehen. Hallo, Dûhirion«, grüßte sie. Der Dunkelelf nickte ihr mit einem leichten Lächeln zu. Sie spiegelte seine Geste freudig und wandte sich Faylen zu. »Und hallo, Faylen.«
Das Mädchen zuckte zusammen, als es von der Waldelfin angesprochen wurde. Es war kreidebleich geworden und presste sich fest an Dûhirions Seite. Mit vor Furcht weit aufgerissenen Augen starrte sie Elanor an.
Da war die panische Reaktion, die er bereits bei Arik erwartet hatte. Er kam zu dem Schluss, dass Faylen nie zuvor einem Menschen begegnet war und den Magier daher nicht einzuschätzen wusste. Mit Waldelfen hingegen schien sie sehr schlechte Erfahrungen gemacht zu haben. Vielleicht war sie auch schlichtweg erschrocken darüber, dass Elanor ihren Namen kannte. Dabei steckte kein Trick dahinter. Dûhirion hatte Arik den Namen des Mädchens genannt, der hatte ihn wiederholt und Elanor hatte ihn gehört und der richtigen Person zugeordnet. Ganz einfach.
Nicht so für Faylen, die im Moment nicht für logische Schlussfolgerungen empfänglich war. »E-Es tut mir leid«, presste sie heiser hervor und machte Anstalten, vom Bett zu springen.
Arik streckte seine Hände aus, doch Dûhirion war schneller und hielt sie fest.
Faylens Atem raste. »Verzeiht, dass ich Euer Haus betreten habe, Herrin«, stammelte sie eilig.
»Es ist alles in Ordnung«, erwiderte Elanor beschwichtigend. »Du brauchst dich nicht vor mir zu fürchten. Das hier ist nicht mein Haus, es gehört Arik.«
»E-Entschuldigt, Herrin!«
»Ich bin nicht deine Herrin«, sagte die Waldelfin betont sanft. »Mein Name ist Elanor und ich möchte dir helfen.«
Hellblaues Licht, das sich in Ariks Händen bündelte, hüllte die kleine Dunkelelfin ein. Faylen sank zitternd in Dûhirions Griff zusammen. Ihr Atem beruhigte sich und ihr Kopf kippte zur Seite.
»Alles ist gut, Faylen«, raunte Arik. »In diesem Haus wird dir nichts passieren. Niemand wird dir wehtun und niemand wird dich beschimpfen. Du musst keine Angst haben.«
Sie nickte träge.
»Bist du hungrig?«, fragte Elanor vorsichtig. »Es gibt Brot und Gemüseeintopf.«
Müde rieb Faylen sich die Augen. »Ja, ich habe großen Hunger.«
Elanor verschwand durch eine Tür in der Seite. Sie führte zum angrenzenden Haus, in dem Arik mit seiner Schwester Nara wohnte.
Der Magier verband Faylens Wunden und wirkte einen Heilzauber auf sie. Sie saß still und mit halb geschlossenen Augen an Dûhirion gelehnt und hielt seine Hand. Mit der anderen streichelte sie ihre Puppe.
Elanor kam bald darauf zurück und brachte eine Platte, auf der sich eine Schüssel mit Eintopf und ein großes Stück Brot befanden.
Während das Mädchen aß, zog Dûhirion Elanor beiseite. Auch wenn er davon ausging, dass sie sein Gespräch mit Arik mit angehört hatte, fasste er ihr die Ereignisse der Nacht zusammen.
»Vermutlich gehört sie weder in diese Stadt noch ins Elendsviertel«, sagte er schließlich schulterzuckend.
»Vielleicht ist sie einem dieser furchtbaren Waisenhäuser für ihresgleichen entkommen«, erwiderte Elanor und musterte Faylen mitleidig. »Oder sie ist eine entlaufene Sklavin? Die Götter allein wissen, was ihr angetan wurde. Hat sie dir etwas über ihre Eltern verraten?«
»Offenbar sind sie beide tot«, antwortete Dûhirion und ließ sich auf einem freien Bett nieder. Seine Beine waren schwer und kurz dachte er darüber nach, sich rücklings auf die Matratze fallen zu lassen. Er tat es nicht. Das war eine Klinik und keine Herberge. »Das war neben ihrem Namen die einzige Frage, die sie beantwortet hat.«
»Das arme Kind. Die Weiße Feder wird einen Platz finden, an dem sie bleiben kann.« Elanor beobachtete stirnrunzelnd, wie Faylen gierig ihr Essen verschlang. »Fürs Erste sollte sie ohnehin in der Klinik bleiben, denke ich.« Sie seufzte und blickte zu dem Dunkelelfen zurück. »Ich wünschte, Magie könnte auch seelische Wunden heilen.«
»Eines Tages vielleicht.« Dûhirion rückte den schwarzen Brustharnisch zurecht. Er konnte es kaum erwarten, in bequemere Kleidung zu schlüpfen. »Gib den Magiern dieser Welt Zeit, an ihren Formeln zu arbeiten. Irgendwann wird jemand den richtigen Zauber finden.« Er erhob sich und überbrückte die letzte Distanz zwischen ihnen. »Ich hätte nicht erwartet, dich so spät noch hier zu treffen.«
Elanor, die einen Kopf kleiner war als er, hob ihr Kinn leicht an, um ihm weiter ins Gesicht sehen zu können. »Ich könnte das Gleiche von dir sagen. Ich habe Arik alte Leinenhemden gebracht, die er zu Bandagen verarbeitet.«
Er nahm ihre Hand und küsste ihre Fingerknöchel. »Schön, dich zu sehen, Elanor.«
Ein warmer Funke leuchtete in ihren blauen Augen auf. Elanor sah gut aus; gesund und munter. Er war froh, sie wohlauf zu sehen.
»Es hat eine Weile gedauert, bis ich Faylen überreden konnte, mich zu begleiten«, erzählte er und rieb sich müde über das Gesicht. »Wir haben den Tunnel unter meiner Hütte genutzt und mussten uns durch völlige Finsternis bewegen. Hat ihr nicht gerade Mut gemacht, nachdem ich verkündete, dass wir in die Oberstadt gehen«, sagte er weiter. »Vorhin sind wir beinahe in eine Patrouille gelaufen. Der Weg hierher war … ereignisreich.«
»Deshalb habe ich dich durch den gesamten Raum keuchen gehört«, entgegnete Elanor und wischte ihm eine schwarze Haarsträhne aus der Stirn.
Er lächelte schief. »War ich wirklich so laut?«
»Nur für meine Ohren.« Sie zwinkerte. »Ich verrate es keinem.«
»Zu freundlich von dir.« Er strich mit seinem spröden Daumen über ihren Handrücken, bevor er sie losließ. »Ich denke übrigens nicht, dass die Wachen unsere Spur verfolgen können oder sich überhaupt die Mühe gemacht haben.«
»Ich werde zu Hause sehen, dass ich passende Kleidung für sie finde«, sagte Elanor. »Sieh dir an, wie gierig sie das Essen verschlingt! Sie ist bloß Haut und Knochen. Ob sie überhaupt sagen kann, wann sie das letzte Mal satt war?«
»Die bessere Frage ist, ob sie das Gefühl von Sättigung überhaupt kennt«, murmelte Dûhirion.
Arik nahm Faylen die Platte ab und bedeutete ihr, sich hinzulegen. Sie zog die Decke bis unters Kinn. Erneut ging sanftes Licht von seinen Händen aus und hüllte sie ein. Dann zog er eine Trennwand vors Bett und trat zu den Elfen. »Heute Nacht wird sie ruhig und ohne Albträume schlafen.«
»Das ist gut«, murmelte Elanor.
»Über ein Bad würde sie sich auch freuen«, fügte der Dunkelelf hinzu.
»Das soll sie morgen bekommen, wenn sie ausgeschlafen hat«, sagte Arik und dehnte seine Finger, bis sie vernehmlich knackten. »Ihre Wunden sind nicht schwerwiegend und werden über Nacht spurlos verheilen. Ich werde Nara darum bitten, ein vorübergehendes Zuhause in der Aschegrube für die Kleine zu finden.«
»So lange, bis sie über die Grenze von Adular in die freien Länder gebracht werden kann«, vervollständigte Dûhirion.
Arik ging zu einem Beistelltisch und wusch sich die Hände. »Ganz genau. Es wird aber noch ein paar Wochen dauern, bis ich Adular das nächste Mal verlassen kann. Wir müssen jemanden finden, der sich solange um sie kümmert.«
Als Magier gehörte er zu den Privilegierten, die Adular verlassen konnten, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Er hatte enge Kontakte zur Magierakademie Krähenfels und konnte seine Reisen mit Studien begründen.
»Es ist spät, Elanor.« Der Heiler schob seine Ärmel zurück nach unten zu seinen Handgelenken. »Du solltest allmählich nach Hause gehen. Die restlichen Bandagen schneide ich morgen zu. Danke nochmals.«
»Natürlich.« Sie machte einen eleganten Knicks. »Kümmere dich gut um sie, ja? Und sieh zu, dass du heute Nacht auch ein paar Stunden Schlaf bekommst!«
Arik gluckste trocken. »Du hörst dich schon an wie Nara. Ja, werde ich. Ich verspreche es!«