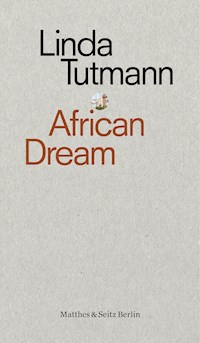
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: punctum
- Sprache: Deutsch
Offen für zufällige Begegnungen lässt sich Linda Tutmann neun Monate durch die unterschiedlichsten Viertel Kapstadts treiben. Die Migranten aus dem Kongo, Simbabwe und Kenia träumen in der Dudley Road von einer Rückkehr in ihre Heimat, während in der City Bowl die dünne schwarze Mittelschicht Karriere macht. An den Stränden für Hunde, Hipster und Gays organisiert sich ein Flashmob der Schwarzen zum Protest, während die Style Directorin der afrikanischen Glamour in der Bar La Perla ihren Abend gemeinsam mit Eskapisten der Oberschicht mit Champagner beschließt, bevor diese sich wieder hinter Mauern und elektronischen Zäunen verschanzen. In der Corner Bar bekämpfen derweil die weißen Apartheidsverlierer beim Castle-Lager Bier ihre Angst vor dem Aufstieg ihrer schwarzen Nachbarn und schwelgen in Erinnerungen an eine einst goldene Zeit. Tutmann fängt Lebensgeschichten und Haltungen, Orte und politische Ereignisse ein, die wie die Splitter eines Kaleidoskops die vielen Schattierungen der südafrikanischen Gesellschaft, ehemals Hoffnungsträger des gesamten afrikanischen Kontinents, ausmachen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 129
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Linda Tutmann
African Dream
Mit Fotografien von Olya Oleinic
punctum 011
Inhalt
African Dream
Dudley Road
Uitvlugt
Euro-Trash
Corner Bar
König Shaka
Sex
La Perla
Johannesburg
African Dream
Der kenianische Kioskbesitzer, der an der Main Road in Seapoint jeden Tag einzelne Klopapierrollen, chinesische Sneaker und geröstete Maiskörner an die Vorbeieilenden verkaufte, sagte mir, wenn ich auf dem Nachhauseweg in seinem Laden vorbeisah, immer schon gleich bei der Begrüßung, er werde Kapstadt bald verlassen. Diesen Plan wiederholte er bei jeder Begegnung. »Home is Home.« Dabei wiegte er seinen Kopf und ich verstand, dass er keinen Widerspruch duldete.
»Asante sana«, Danke, rief er mir gern zur Verabschiedung auf seiner Muttersprache Swahili hinterher, einer von den meisten Ostafrikanern gesprochenen Bantu-Sprache. Während eines viermonatigen Aufenthaltes im Herbst und Winter 2014 in Kenia hatte ich mir ein paar einfache Wörter gemerkt und es freute mich, dass er sich freute, wenn ich ihn mit »Jambo« begrüßte und mit »Kwaheri« verabschiedete. Er grinste dann breit und ich wusste, dass er in Gedanken bereits wieder durch die wuseligen Straßen Nairobis lief.
Sein kleiner Laden hatte auf einen ersten flüchtigen Blick nichts Außergewöhnliches an sich. Im hinteren Teil lagerten in einem Kühlregal ein wenig Joghurt und Sahne, daneben stapelten sich Packungen mit gekochtem Schinken oder Salami, im Regal rechts die Snacks, Chips und Erdnüsse, vorne links standen die eckigen Behälter mit Süßigkeiten, Lakritzschnecken und -stangen, und ein Glas mit mundgerechten Biltong-Stücken, die er mit einer Greifzange herausfischte. Das Besondere aber war, dass es hier fast alles gab, nicht nur die Leckereien, die auch in den Regalen der anderen Mini Supermarkets, Superretten oder Corner Shops standen, sondern auch das, was die Kunden eben auf die Schnelle für den Fernsehabend am Samstagabend oder den Morgen danach brauchten. Ich habe nie erlebt, dass er mir einen Wunsch nicht hatte erfüllen können. Wurde man in den vollgestopften Regalen im vorderen Teil des Geschäfts nicht fündig, kramte er in einer der unter der Theke gestapelten Kisten – und wenn er das Gesuchte auch dort nicht fand, verschwand er hinter einem schmuddeligen, beigefarbenen Vorhang und tauchte nach kurzer Zeit triumphierend mit Schuhcreme, Rohrreiniger oder einer Packung Kopfschmerztabletten wieder auf.
Ich hatte bei unserer ersten Begegnung sein Alter schwer schätzen können. Irgendwie war er alterslos, wie er da in seinem immer etwas zu großen, flatterigen Hemd hinter der Theke stand. Ein kleiner vitaler Mann mit Schnurrbart und kurzem krausen Haar. Ich vermutete, er sei um die 40, vielleicht auch 45. Und je öfter ich ihn traf, umso sicherer war ich, er müsse in der Mitte des Lebens stehen. Eine Zeit, in der man sein Leben Revue passieren lässt und sich der Frage stellt, ob man es dorthin gebracht hat, wohin man ursprünglich gewollt hatte, und wie es nun um die Träume steht, die man in den 20-ern, in der vollen Überzeugung, alles sei möglich, gehabt hatte. Vor 15 Jahren hatte er sich mit Ende 20 aus der völlig unkontrolliert wachsenden Hauptstadt Kenias aufgemacht nach Kapstadt, der Stadt am Meer, über die man sich in den Kneipen und Bars seinem Geburtsort Kibera, Nairobis größter Township, so viel Wundersames erzählte. Kapstadt war sein Traum, eine Stadt, die er sich, obwohl er noch nie in Europa oder Amerika gewesen war, irgendwie europäisch oder amerikanisch vorstellte. Kapstadt, dachte er, müsse sein wie London oder New York, nur eben in Südafrika.
Es war nicht viel, was der Kioskverkäufer im Herbst des Jahres 2003 – oder war es 2004 gewesen, so genau wusste er es nicht mehr – mitnahm: einen Beutel, ein paar Hemden und sein Rasiermesser. So erinnerte er das jedenfalls, und als er mir im Oktober 2016 hinter seiner Theke stehend die Geschichte seines Aufbruchs erzählte, glaubte ich ihm.
Interessanterweise ließ sich ausgerechnet im Jahr 1652 eine nennenswerte Anzahl niederländischer Siedler am Kap nieder – mehr oder weniger zu demselben Zeitpunkt, an dem eine andere Gruppe Niederländer »New Amsterdam« gründete, das spätere New York – eine weitere Parallele der beiden Städte außer der, dass sie seit ihrer Gründung Träumer aus der ganzen Welt anziehen.
Dass Kapstadt überhaupt zu einer weltbekannten Größe aufstieg und schon Menschen von überallher anzog, lange bevor der Kenianer sich aufmachte, verdankt es seiner Lage: Am äußersten südlichen Zipfel des afrikanischen Kontinents legten hier erschöpfte Seeleute – vermutlich Portugiesen im späten 15. Jahrhundert – auf der Suche nach einem alternativen Seeweg nach Indien eine Pause ein. Die arabische Halbinsel und das Mittelmeer waren durch die Entstehung des Osmanischen Reiches in diesen Jahren blockiert und so suchte man nach einer neuen Passage. Wenn auch die Portugiesen kein Bedürfnis verspürten, die Gegend zu kolonialisieren, so erhielt sie doch immerhin ihren Namen vom portugiesischen König Johann II.: Cabo da Boa Esperança, Kap der Guten Hoffnung, nannte er diesen äußersten Punkt der Kap-Halbinsel, voller Hoffnung, den Seeweg nach Indien entdeckt zu haben.
Ein anderer, wegen der ihm gestellten Aufgabe nicht unbedingt beneidenswerter, niederländischer Seemann, Johan Anthoniszoon »Jan« van Riebeeck, wurde 1652 damit beauftragt, in der rauen und stürmischen Region ein hölzernes Fort zu errichten, den Vorgänger des späteren Castle of Good Hope, dessen dicke Mauern noch heute von den Touristen bestaunt werden. Ich bin auf meinem Weg zur Stevenson Gallery – einer meiner liebsten Galerien in der Sir Lowry Road in Woodstock, die Arbeiten von südafrikanischen Fotografen und Fotografinnen wie Pieter Hugo und Zanele Muholi oder Künstlern wie Wim Botha zeigt – ein paarmal am Castle of Good Hope vorbeigelaufen. Es wurde während der Monate meines Aufenthaltes aufwendig restauriert, und immer wenn ich einen Blick in den Innenhof und die Gebäude werfen wollte, war er von Bauzäunen verstellt. So konnte ich nur von außen einen Eindruck von der Festung gewinnen, die vor allem vermittelte, wie stark das Bedürfnis der weißen Siedler gewesen sein muss, sich vor den Einheimischen zu schützen.
Die Festung war als Stützpunkt für die Versorgung der weiter gen Indien fahrenden Schiffe mit Lebensmitteln gedacht, besonders für die Seeleute des niederländischen Handelsunternehmens VOC, die Vereenigde Oost-Indische Compagnie. Die VOC war 1602 als Konkurrenz zur zwei Jahre zuvor entstandenen englischen East India Company gegründet worden. Die Niederländer hatten den Engländern den damals aufblühenden Welthandel nicht allein überlassen wollen.
Ein kleiner, akkurat angelegter Garten hinter dem Company’s Garden vor dem Iziko South African Museum erinnert daran, dass im 16. Jahrhundert dieser Ort die lange Überfahrt nach Indien oder andere asiatische Länder zu überstehen ermöglichte. Heute schlendern hier die Besucher zwischen den Beeten entlang, bewundern die Früchte und Stauden und können sich vorstellen, dass die Ernte einigen ausgehungerten Seemännern in früheren Zeiten den Magen füllte. Heute gehört der Garten zu dem angrenzenden Café und Restaurant der Company’s Gardens. Die Inhaber kümmern sich um die Beete und die Verarbeitung der Früchte für die Zubereitung der Gerichte. Ein Wächter, der die Pflanzen umkreist, um hungrige Obdachlose fernzuhalten, gab mir gewissenhaft Auskunft über alle hier angelegten Gemüsesorten: Es seien vor allem Kohl, verschiedene Salate oder Kräuter wie Petersilie und Minze, und auch Weinreben rankten an hölzernen Stäben. Die Trauben sehen mickrig aus, aber wie mir der kundige Sicherheitsmann verrät, sollen diese heute eher symbolisch darauf verweisen, dass in Zeiten der VOC eben auch Wein angebaut wurde, um die Stimmung der Seemänner mit Selbstgekeltertem etwas zu heben und ihr Heimweh zu lindern.
Ich stieß hier auf interessante, exotische Gewächse wie den Porkbush, Portulacaria afra, dessen kleine grüne Blätter essbar sind, wie ich auf dem Schild neben der Pflanze erfuhr. Die Blätter haben, las ich, einen säuerlichen Geschmack, und helfen klein gehackt bei Muskelverhärtungen und Entzündungen im Mund.
Die VOC kann man sich als eines der ersten weltweit agierenden Unternehmen vorstellen, das verschiedenste Waren von Kontinent zu Kontinent brachte. Der südafrikanische Historiker Herman Giliomee vergleicht den Einfluss der VOC in der damaligen Zeit mit dem eines Bill Gates oder Henry Ford. Und bedenkt man, dass allein zwischen 1602 und 1699 an die 1755 Schiffe von den Niederlanden aus nach Jakarta in Java segelten, scheint dieser Vergleich nicht weit hergeholt.
An Bord befanden sich viele Niederländer aus den untersten sozialen Schichten, die aus größter materieller Not bei der VOC angeheuert hatten. An Deck und auch nachdem sie an Land gegangen waren, wurden sie wie Sklaven behandelt und am Kap dazu abgestellt, das Land in der Nähe des Hafens zu beackern, um die Handelsmänner auf den VOC Schiffen mit frischem Obst und Gemüse zu versorgen. Diese armen Schlucker, die außerordentlich hart dafür hatten kämpfen müssen, sich aus den Klauen der VOC zu befreien und sich ein eigenständiges menschenwürdiges Leben in dieser rauen Gegend aufzubauen, waren die ersten europäischen Siedler, die Afrikaaner.
Viele Wissenschaftler lassen die Geschichte Südafrikas erst mit dieser Ansiedlung beginnen und gewähren den Khoikhoi, die schon lange vorher mit ihren Rindern auf der Suche nach Weideflächen über die Ebenen gezogen waren, keinen Platz in der Geschichtsschreibung des Landes. Die Khoikhoi nannten die Gegend um den Tafelberg wegen der unzähligen Süßwasserquellen und Flüsse, die vom Plateau des Berges aus in die gesamte Region hinabflossen und diese bewässerten, Camissa, »Ort des süßen Wassers«.
Und natürlich waren die Khoikhoi und andere Stämme der afrikanischen Urbevölkerung kein völlig verwildertes Grüppchen, als das sie gern über lange Zeit von den weißen Neuankömmlingen dargestellt wurden, sondern vielmehr eine streng hierarchisch aufgebaute Kultur, die lange bevor die Buren ihren Fuß auf das südafrikanische Festland setzten, an der Grenze zu Zimbabwe, am Limpopo Fluss im Nordosten des Landes, ein Königreich mit dem Namen Mapungubwe gründete. Immerhin würdigt man die Geschichte des Königreiches heute im Mapungubwe Museum in Pretoria.
Während meiner oft beiläufigen Besuche – meist kam ich von einem Spaziergang auf der Promenade zurück – redeten der Kioskbetreiber und ich immer ein wenig über dies und das. Oft schwärmte er von seinem Heimatland, von der Küste und dem Klima Kenias. Ich konnte ihn verstehen. In Kapstadt sind besonders die Wintermonate hart, es regnet viel und ein schneidender Wind treibt die Wolken am Kap vor sich her. Unsere Gespräche liefen immer nach dem gleichen Muster ab, nach einer ähnlichen Dramaturgie und mit einem vorhersehbaren Ende, wir waren wie ein eingespieltes Tennispaar, das voneinander wusste, wer welche Schläge aus welcher Richtung in welcher Härte spielen würde.
Meist eröffnete er mit einer Schimpftirade auf Südafrika. Ich beschwichtigte ihn dann immer, verteidigte Kapstadt und das Land, wies ihn auf Erfolge hin, zitierte Zeitungsartikel, die ich gelesen, und Gespräche, die ich geführt hatte. Er berichtete aus seiner Welt, die eines Migranten, eines Selfmade-Mannes mit ganz anderen Sorgen als ich sie hatte, der, so vermutete ich, von der Hand in den Mund lebte, und der, das wusste ich, keinen Sozialstaat im Rücken hatte. Südafrika hatte ihn enttäuscht, die Politiker hatten ihn enttäuscht, eigentlich war alles an diesem Land eine große Enttäuschung für ihn gewesen.
Unsere Gespräche schienen ihm Spaß zu machen, wie ein Athlet trippelte er in Gedanken auf der Stelle. Ich wusste, ich würde verlieren, sobald er begann, von Nairobi zu erzählen. Von den Start-ups und der technischen Revolution, von der ihm seine Verwandten berichteten, von seinem Neffen, der jetzt bei solch einem Start-up arbeitet – »Mit Computern!« (was genau der Neffe machte, wusste er nicht) – und dass der sich jetzt ein Auto gekauft habe. Dies war das wirklich Entscheidende. Streng genommen hatte er es noch nicht gekauft, sondern zahlte es in Raten ab. »Aber immerhin«, der Kioskbesitzer blickte mich triumphierend an, »ein VW-Golf, Baujahr 2000!« Jedes Match war damit verloren, meist endete das Spiel mit der Erwähnung einer materiellen Anschaffung, eines Umzug eines seiner Verwandten, einer Hochzeit – einer riesigen natürlich – oder eines neuen Jobs. Alles war dort besser als hier. Er strahlte, weil er wusste, dass ich dagegen nicht viel einwenden konnte. Ich konnte seinen Geschichten glauben oder auch nicht. Vielleicht waren sie nur Ausgeburten seiner Fantasie, vielleicht übertrieben seine Onkel und Tanten am Telefon hinsichtlich der Entwicklungen in der Heimat, um ihren verlorenen Neffen und Sohn wieder nach Hause zu locken? Aber ich ließ ihm gerne die Freude am Triumph.
Er war nicht ernsthaft verbittert darüber, dass Südafrika ihm nicht den erhofften Wohlstand verschafft hatte. Die Gewissheit von seiner Rückkehr ließ ihn den Alltag in Kapstadt meistern. Er flüchtete sich in seine Rückkehrerträume, die er als kitschige Postkarten mit Motiven aus Kenia an die Wand hinter sich pinnte.
Zu Beginn der 2000er, in denen er sich aufgemacht hatte, herrschte in Südafrika noch Hochstimmung und schien auf Einwanderer wie ihn gewartet zu haben. Nach dem Ende des Apartheidregimes und der damit einhergehenden wirtschaftlichen Öffnung gelang dem Land ein Aufschwung, der bald etliche Afrikaner und auch Idealisten aus anderen Teilen der Welt in euphorischer Goldgräberstimmung anzog. Gold und andere Bodenschätze gab es tatsächlich genug. Südafrika hatte sich unter Nelson Mandela in nur wenigen Jahren von einem Unrechtsstaat, der Schwarze diskriminiert und zu Menschen zweiter Klasse degradiert hatte, in ein gelobtes Land verwandelt, in dem alle Menschen ihren Platz zu finden versprochen schien.
Während ihre Heimatländer von Bürgerkriegen heimgesucht oder von größenwahnsinnigen Diktatoren in den Ruin getrieben werden, lockte Südafrika mit einer verheißungsvollen Zukunft voller Möglichkeiten.
Der südafrikanischen Regierung war dieser Ansturm mehr als recht. Hatten die weißen Nationalisten doch vor 1994 eine Ausbildung der Schwarzen (also von 80 Prozent der südafrikanischen Bevölkerung) schlicht verhindert. Während der Apartheid durften Schwarze vor allem als Nannys, Gärtner oder unter Tage in den Minen schuften, also Tätigkeiten ausüben, die den Weißen als für sie absolut angemessen erschienen. Für die Bildung eines weißen Kindes wurde damals achtmal mehr Geld ausgegeben als für die eines schwarzen. Angesichts der Tatsache, dass das Land plötzlich Arbeitskräfte für die neu entstehenden Tätigkeitsfelder im Zuge der voranschreitenden Industrialisierung brauchte, waren deshalb alle willkommen – und die Migrationspolitik nicht sonderlich restriktiv. Daran wird deutlich, dass das Ende der Apartheid nicht nur aus humanitären oder christlichen Motiven oder auf politischen Druck hin herbeigeführt wurde, sondern vor allem ökonomische Gründe ausschlaggebend waren: Die Regierung und insbesondere die weiße Oberschicht hatte einsehen müssen, dass Südafrika in einer zunehmend globalisierten Weltwirtschaft nicht würde mithalten können, wenn 80 Prozent der Bevölkerung weiterhin zu einem großen Teil von Ausbildungsberufen oder universitärer Bildung ausgeschlossen bliebe.
In dieser Zeit entstand auch der poetische Ausdruck »Regenbogennation« für ebenjene multinationale, offene Gesellschaft, die Südafrika fortan werden wollte. Es war der anglikanische Geistliche und damalige Erzbischof von Kapstadt Desmond Tutu, der diesen Begriff prägte und der bis heute an die Vision und das Versprechen von Männern wie ihn oder Mandela erinnert.
Ich bin nicht sicher, ob der enttäuschte Kenianer wusste, dass der Regenbogen seit jeher als Symbol verwendet wird, um den Menschen das Gefühl von Verbundenheit, Hoffnung und ein Bild von Vielfalt zu vermitteln. Im vorchristlichen Jahrtausend in Mesopotamien galt er als Liebeskette der Göttin Ischtar, einer oft vollbusig dargestellten Göttin des Himmels und der Liebe. Ihre übergroßen Brüste symbolisieren Sexualität und galten in ihrem Matriarchat als Zeichen der Fruchtbarkeit und Fortpflanzung. In der chinesischen Mythologie hingegen stellen zwei zusammen abgebildete Regenbögen die Verbindung des weiblichen Prinzips Yin und des männlichen Prinzips Yang und auf diese Weise die Ehe dar. (Der kräftigere Hauptregenbogen wird dem Yang zugeschrieben, der schwächere dem Yin.) Auch bei Homer findet sich der Regenbogen: In der Ilias erwähnt er den Himmelsbogen als die Göttin Iris, die Aphrodite aus dem Kampfgebiet auf den Olympus leitet.





























