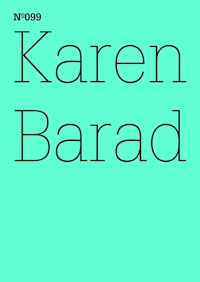15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Mit ihrem Konzept des »Agentialen Realismus« findet Karen Barad seit einigen Jahren große Aufmerksamkeit, insbesondere unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich mit Diskursanalyse, Techniksoziologie und Gender Studies beschäftigten. Barads Anliegen besteht darin, das Denken über Sprache, Diskurse und Dinge auf eine radikal neue Grundlage zu stellen. In ihrem vielbeachteten Essay, mit dem nun erstmals ein Text Barads auf Deutsch vorliegt, plädiert sie ausgehend von epistemologischen Überlegungen des dänischen Physikers Niels Bohr dafür, die Grenzen zwischen den Objekten, unseren Instrumenten, der Sprache und den menschlichen Beobachtern neu zu vermessen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 148
Ähnliche
Mit ihrem Konzept des »Agentiellen Realismus« findet Karen Barad seit einigen Jahren große Aufmerksamkeit, insbesondere unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich mit Diskursanalyse, Techniksoziologie und Gender Studies beschäftigten. Barads Anliegen besteht darin, das Denken über Sprache, Diskurse und Dinge auf eine radikal neue Grundlage zu stellen. In ihrem vielbeachteten Essay, mit dem nun erstmals ein Text Barads auf deutsch vorliegt, plädiert sie ausgehend von epistemologischen Überlegungen des dänischen Physikers Niels Bohr dafür, die Grenzen zwischen den Objekten, unseren Instrumenten, der Sprache und den menschlichen Beobachtern neu zu vermessen.
Karen Barad, geboren 1956, lehrt Feminist Studies, Philosophie und History of Consciousness an der University of California in Santa Cruz. Barad, die auch in theoretischer Physik promoviert hat, trat dort die Nachfolge Donna Haraways an.
Agentieller Realismus
Über die Bedeutung
materiell-diskursiver Praktiken
Karen Barad
Aus dem Englischen von Jürgen Schröder
Suhrkamp
Die edition unseld wird unterstützt durch eine Partnerschaft mit dem Nachrichtenportal Spiegel Online. www.spiegel.de
Karen Barads Aufsatz »Agential Realism: How material-discursive practices matter« wurde erstmals in der Zeitschrift Signs abgedruckt (28/32003, S. 803-831). 2007 wurde er in dem Band Meeting the Universe Halfway. Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning veröffentlicht, in dem einschlägige Essays der Autorin erschienen (Durham & London: Duke University Press, S. 132-185). Die deutsche Übersetzung folgt letzterer Fassung.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2012
© Karen Barad 2012
© der deutschen Übersetzung Suhrkamp Verlag Berlin 2012
Deutsche Erstausgabe
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Photographie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlaggestaltung: Nina Vöge und Alexander Stublić
eISBN978-3-518-77220-1
www.suhrkamp.de
Agentieller Realismus
Einleitung
»Wie kamen wir eigentlich auf die sonderbare Vorstellung, daß die Natur – im Gegensatz zur Kultur – ahistorisch und zeitlos sei? Wir haben uns viel zu sehr von unserer eigenen Klugheit und unserem Selbstbewusstsein beeindrucken lassen … Wir müssen damit aufhören, uns dieselben alten anthropozentrischen Bettgeschichten zu erzählen.«
Steve Shapiro, Doom Patrols
Der Sprache wurde zuviel Macht eingeräumt. Die sprachkritische Wende, die semiotische Wende, die interpretative Wende, die kulturelle Wende: Es scheint, daß in jüngster Zeit bei jeder Wende jedes »Ding« – selbst die Materialität – zu einer sprachlichen Angelegenheit oder einer anderen Form von kultureller Repräsentation wird. Die allgegenwärtigen Wortspiele mit »Materie« markieren leider keine neue Reflexion auf die Schlüsselbegriffe (Materialität und Bedeutung) und deren Wechselbeziehung. Vielmehr scheinen sie symptomatisch für das Ausmaß zu sein, in dem (sozusagen) »Tatsachen«-Fragen durch Bedeutungsfragen (ohne Anführungszeichen) ersetzt wurden. Es geht um die Sprache. Es geht um den Diskurs. Es geht um die Kultur. In einer wichtigen Hinsicht ist das einzige, worum es anscheinend nicht mehr geht, die Materie.*
* »Language matters. Discourse matters. Culture matters. There is an important sense in which the only thing that doesn’t seem to matter anymore is matter.« Die Autorin spielt hier im Original mit der Doppeldeutigkeit des englischen Wortes (to) matter, das sowohl Materie als auch (als Verb) eine Rolle spielen, wichtig sein bedeutet. Das Wortspiel ist nicht ins Deutsche übertragbar (Anmerkung des Übersetzers).
Die Materie ernst nehmen: Materialität und Performativität
Was zwingt eigentlich zu der Überzeugung, daß wir einen direkten Zugang zu kulturellen Vorstellungen und ihrem Inhalt haben, der uns im Hinblick auf die vorgestellten Dinge fehlt? Wodurch wurde die Sprache vertrauenswürdiger als die Materie? Warum gesteht man der Sprache und Kultur ihre eigene Kraft und Geschichtlichkeit zu, während die Materie als passiv und unveränderlich vorgestellt wird oder bestenfalls ein von der Sprache und Kultur abgeleitetes Potential zur Veränderung erbt? Wie stellt man überhaupt eine Untersuchung der materiellen Bedingungen an, die uns zu einer solchen brachialen Umkehrung naturalistischer Überzeugungen geführt haben, wenn die Materialität selbst immer schon innerhalb eines sprachlichen Bereichs als ihrer Bedingung der Möglichkeit vorgestellt wird?
Es ist schwer zu leugnen, daß die Macht der Sprache substantiell gewesen ist. Man könnte geltend machen, daß sie zu substantiell gewesen ist oder vielleicht besser noch zu substanzialisierend. Weder ein übertriebener Glaube an die Macht der Sprache noch die geäußerte Befürchtung, daß der Sprache zuviel Macht zugestanden wird, ist ein neuer Aspekt des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts. Beispielsweise warnte im 19. Jahrhundert Nietzsche vor der irrtümlichen Neigung, die Grammatik zu ernst zu nehmen: der sprachlichen Struktur zu gestatten, unser Weltverständnis zu prägen oder zu bestimmen, zu glauben, daß die Subjekt-Prädikat-Struktur der Sprache eine vorgängige ontologische Wirklichkeit von Substanz und Attribut widerspiegelt. Die Überzeugung, daß grammatische Kategorien die zugrundeliegende Struktur der Welt widerspiegeln, ist eine durchgängige, verführerische Gewohnheit des Geistes, die in Frage zu stellen sich lohnt.
Ist es schließlich nicht die dem gesunden Menschenverstand eigentümliche Auffassung des Repräsentationalismus – die Überzeugung, daß Vorstellungen eine Vermittlungsfunktion zwischen dem Erkennenden und dem Erkannten haben –, die ein tiefes Mißtrauen gegenüber der Materie aufweist, sie von sich weg hält, sie als passiv, unveränderlich, stumm und so vorstellt, als bräuchte sie den Einfluß einer äußeren Kraft wie Kultur oder Geschichte, um sie zu ergänzen? Tatsächlich ist der repräsentationalistische Glaube an die Macht der Wörter zur Widerspiegelung schon vorhandener Phänomene das metaphysische Substrat, das sowohl konstruktivistische als auch herkömmliche realistische Überzeugungen stützt und dadurch die endlose Wiederverwertung unhaltbarer Alternativen fortsetzt. Bezeichnenderweise ist der soziale Konstruktivismus Gegenstand intensiver Forschungen sowohl innerhalb von feministischen als auch von Kreisen der Wissenschaftsforschung gewesen, in denen beträchtliche und begründete Unzufriedenheit geäußert wurde.1
Ein performatives Verständnis diskursiver Praktiken stellt den repräsentationalistischen Glauben an die Macht der Wörter in Frage, schon vorhandene Dinge zu repräsentieren. Im Unterschied zum Repräsentationalismus, der uns über oder außerhalb der Welt ansiedelt, auf die wir angeblich nur reflektieren, hebt ein performativer Ansatz das Verständnis des Denkens, Beobachtens und der Theoriebildung als Praktiken der Auseinandersetzung mit der Welt, in der wir existieren, und als Teil dieser Welt hervor.
Die richtig verstandene Performativität ist keine Aufforderung, alles (unter anderem auch materielle Körper) in Wörter zu verwandeln; im Gegenteil, die Performativität bestreitet gerade die übermäßige Macht, die der Sprache zugestanden wurde, um zu bestimmen, was wirklich ist. Daher wird die Performativität in einem ironischen Gegensatz zu dem Mißverständnis, das sie mit einer Form von sprachlichem Monismus gleichsetzen würde, der die Sprache für den Stoff der Wirklichkeit hält, richtig verstanden als Infragestellung der unüberprüften Gewohnheiten des Geistes, die der Sprache und anderen Repräsentationsformen mehr Macht bei der Bestimmung unserer Ontologien zuzugestehen, als sie verdienen.2
Humanistische Umlaufbahnen
Mit dem Teleskop oder dem Mikroskop in der Hand in den Nachthimmel oder tief in die Struktur der Materie hinabblickend, bestätigt der Mensch erneut seine Fähigkeit, gewaltige Maßstabsunterschiede im Nu zu bewältigen. Während sie eigens für unseren Sehapparat entworfen wurden, bestehen Teleskope und Mikroskope aus Spiegeln und spiegeln wider, was es da draußen gibt. Nichts ist zu groß oder zu winzig. Obwohl er nur ein kleiner Fleck ist, ein leuchtender Punkt auf dem Radarschirm von allem Seienden, ist der Mensch der Mittelpunkt, um den sich die Welt dreht. Der Mensch ist die Sonne, der Kern, die Drehscheibe, die vereinheitlichende Kraft, der Leim, der alles zusammenhält. Der Mensch ist ein Individuum, das von allem Übrigen abgetrennt ist. Und genau diese Unterscheidung verleiht ihm das Erbe der Distanz, einen Ort, von dem aus er reflektieren kann – auf die Welt, seine Mitmenschen und sich selbst. Als abgesondertes Individuum, die Einheit allen Maßes, die fleischgewordene Endlichkeit, stellt seine Abgesondertheit den Schlüssel dar.
Der Repräsentationalismus, der metaphysische Individualismus und der Humanismus arbeiten Hand in Hand und halten diese Weltanschauung aufrecht. Diese Kräfte haben eine so mächtige Gewalt über zeitgenössische Denkmuster, daß selbst einige der wohlausgewogensten Bemühungen, sich dem Griff dieser anthropozentrischen Kräfte zu entziehen, gescheitert sind. Niels Bohrs Philosophie-Physik stellt nicht nur gegenüber der Newtonschen Physik und Metaphysik eine energische Herausforderung dar, sondern auch gegenüber dem Repräsentationalismus und gleichsinnigen Erkenntnistheorien wie zum Beispiel herkömmlichen Formen von Realismus und sozialem Konstruktivismus. Poststrukturalistische Theoretikerinnen und Theoretiker wie Michel Foucault und Judith Butler sprengen die Grundsätze des Humanismus und Repräsentationalismus bei dem Versuch, die Kraft dieser Explosion für die Sammlung eines hinreichend großen Impulses gegen die Schwelle der Fluchtgeschwindigkeit nutzbar zu machen. Jeder dieser wuchtigen Versuche schießt unsere kulturelle Vorstellungswelt aus einer ausgetretenen, stabilen Umlaufbahn heraus. Aber letztlich ist die Kraft dieser energischen Interventionen ungenügend, um diese Theorien völlig von dem verführerischen Kern zu befreien, der sie zusammenhält, und es wird deutlich, daß jede von ihnen erneut in einer anderen Umlaufbahn um denselben Kern gefangen wurde. Während diese Versuche hinreichend viel Energie besitzen, um bedeutende Störungen auszulösen, wird die hochgeschätzte Ionisierung dennoch in beiden Fällen von anthropozentrischen Überbleibseln vereitelt. Was wir brauchen, ist ein drastisches und gleichzeitiges Infragestellen aller Bestandteile dieser fesselnden, weitreichenden Kraft.3
In diesem Kapitel schlage ich einen posthumanistischen, performativen Ansatz zum Verständnis technisch-wissenschaftlicher und anderer natürlich-kultureller Praktiken vor, der insbesondere die dynamische Kraft der Materie anerkennt und berücksichtigt.4 Die Hinwendung zu performativen Alternativen zum Repräsentationalismus verlagert den Fokus von Fragen nach der Entsprechung zwischen Beschreibungen und der Wirklichkeit (z. B. spiegeln diese die Natur oder die Kultur wider?) auf Fragen nach Praktiken, Tätigkeiten und Handlungen. Ein solcher Ansatz stellt auch wichtige Fragen der Ontologie, Materialität und des Tätigseins in den Vordergrund, während die sozial-konstruktivistischen und traditionellen realistischen Ansätze sich in der geometrischen Optik der Widerspiegelung verstricken, wo zwar ebenso wie beim unendlichen Spiel von Bildern zwischen zwei einander gegenüberstehenden Spiegeln das Erkenntnistheoretische hin- und hergeworfen wird, aber nichts weiter zu sehen ist. Ich bewege mich von der repräsentationalistischen Falle der geometrischen Optik weg und verlagere den Fokus auf die physikalische Optik, auf Fragen der Streuung anstatt der Reflexion.5 Wenn man die Einsichten der poststrukturalistischen Theorie, der Wissenschaftsforschung und der Physik so liest, daß sie durch einander gestreut werden, dann ergibt sich daraus eine erhellende Vorstellung des Kulturellen und des Natürlichen. Was häufig als getrennte Entitäten (und getrennte Mengen von Anliegen) mit scharfen Rändern erscheint, impliziert in Wirklichkeit überhaupt keine Beziehung absoluter Äußerlichkeit. Wie die Streuungsmuster, die die unbestimmte Eigenart von Grenzen erhellen – wobei sie in Bezirken des »Lichts« Schatten aufweisen und helle Flecken in Bezirken der »Dunkelheit« –, ist die Beziehung des Kulturellen und des Natürlichen eine Beziehung der »inneren Äußerlichkeit«. Es handelt sich nicht um eine statische Bezüglichkeit, sondern um eine Tätigkeit – das Inkraftsetzen von Grenzen –, die stets konstitutive Ausschlüsse und daher auch unerläßliche Fragen der Zurechenbarkeit impliziert. Eines meiner Ziele besteht darin, einen Beitrag zur Schärfung des theoretischen Werkzeugs der Performativität für die Wissenschaftsforschung und Anstrengungen der feministischen Theorie zugleich zu leisten und ihre gegenseitige Berücksichtung zu fördern. Eine agentiell-realistische Ausarbeitung von Performativität räumt der Materie auf entscheidende Weise ihren Anteil als aktiver Teilhaber am Werden der Welt, an ihrer fortlaufenden Intraaktivität ein. Und außerdem trägt sie zu einem Verständnis der Frage bei, auf welche Weise die diskursiven Praktiken von Bedeutung sind.
Durch die Ablehnung des Anthropozentrismus von Humanismus und Anti-Humanismus markiert der Posthumanismus die Praxis der Zurechnung für die Grenzen erzeugenden Praktiken, durch die das »Menschliche« und seine Gegenspieler voneinander abgegrenzt und definiert werden.6 Wenn ich diesen strittigen Begriff beanspruche, möchte ich klarstellen, daß ich kein Interesse an postmodernen Siegesfeiern (oder Dämonisierungen) des Posthumanen als lebendige Zeugnisse für den Tod des Humanen oder als nächstes Stadium des Menschen habe. Es geht hier nicht um eine unkritische Annahme des Cyborgs als eines ironisch gemeinten, befreienden Retters.7 Wie ich ihn hier verstehe, ist der Posthumanismus nicht auf den Menschen abgestimmt; im Gegenteil, es geht bei ihm darum, den Ausnahmestatus des Menschen aufs Korn zu nehmen, wobei er zugleich die Rolle erklären soll, die wir bei der unterschiedlichen Konstitution und unterschiedlichen Positionierung des Menschlichen inmitten anderer Geschöpfe (sowohl der belebten als auch der unbelebten) spielen. Der Posthumanismus weist die Quelle aller Veränderungen nicht der Kultur zu und verweigert dadurch der Natur auch nicht jede Art von Tätigsein und Geschichtlichkeit. Tatsächlich lehnt er die Vorstellung einer natürlichen (oder auch einer rein kulturellen) Spaltung zwischen Natur und Kultur ab und fordert eine Erklärung dafür, wie diese Grenze aktiv festgelegt und immer wieder neu gezogen wird. Der Posthumanismus setzt nicht voraus, daß der Mensch das Maß aller Dinge ist. Er ist kein Gefangener des Größenmaßstabs des Menschlichen, sondern schenkt den Praktiken Aufmerksamkeit, durch die Maßstäbe produziert werden. Der Posthumanismus hat nichts übrig für prinzipielle Behauptungen, die die Abschaffung oder den Tod der Metaphysik annehmen, besonders wenn solche hochmütigen Behauptungen sich als Lockmittel für die heimliche Wiedererrichtung des Menschen als des unausgesprochenen Maßes dessen erweisen, was beobachtbar oder verstehbar ist oder nicht.8 Er gehorcht keinen Verboten gegen die Rede von Ontologie, wodurch jegliches Nachdenken auf das Erkenntnistheoretische beschränkt werden soll (das im sicheren Hafen des Menschen verankert ist). Der Posthumanismus meidet sowohl humanistische als auch strukturalistische Darstellungen des Subjekts, die das Menschliche als entweder bloße Ursache oder bloße Wirkung betrachten, und des Körpers als der natürlichen und festen Trennlinie zwischen Innerlichkeit und Äußerlichkeit. Der Posthumanismus setzt nicht die Getrenntheit irgendeines »Dings« voraus, geschweige denn die vermeintliche räumliche, ontologische und erkenntnistheoretische Auszeichnung, die den Menschen absondert.
Tatsächlich betrachtet die agentiell-realistische Ontologie, die ich vorschlage, Getrenntheit nicht als ein wesentliches Merkmal der Beschaffenheit der Welt. Aber sie spielt die Getrenntheit auch nicht zu einer bloßen Illusion herab, zu einem Artefakt eines irregeleiteten menschlichen Bewußtseins. Die Welt wird nicht von Dingen bevölkert, die sich mehr oder weniger voneinander unterscheiden. Beziehungen hängen nicht von ihren Relata ab, sondern umgekehrt. Die Materie ist weder fest und gegeben noch das bloße Endergebnis verschiedener Prozesse. Materie wird produziert und ist produktiv, sie wird erzeugt und ist zeugungsfähig. Materie ist ein Agens und kein festes Wesen oder eine Eigenschaft von Dingen. Wenn etwas wichtig ist, dann wird es von anderem unterschieden, und diejenigen Unterschiede, die bedeutsam werden, erlangen ihre Bedeutsamkeit durch die iterative Produktion verschiedener Unterschiede. Sich verändernde Muster von Unterschieden sind weder reine Ursachen noch reine Wirkungen; vielmehr sind sie das, was eine kausale Struktur bewirkt oder vielmehr verwirklicht, wodurch Ursache und Wirkung voneinander unterschieden werden. Muster von Unterschieden ändern sich nicht nur in Raum und Zeit; die Raumzeit ist eine Verwirklichung von Verschiedenheit, eine Methode der Herstellung/Markierung des Hier und Jetzt.
Eine agentiell-realistische Ontologie
»Die Wirklichkeit ist größer als wir.«
Ian Hacking, Representing and Intervening
»Ich glaube, daß in den Lehren der Repräsentation und
wissenschaftlichen Objektivität die Welt gerade verlorengeht.«
Donna Haraway, »The promises of monsters«
Der Repräsentationalismus hält den Begriff der Trennung für grundlegend. Er trennt die Welt in die ontologisch disjunkten Bereiche von Wörtern und Dingen und setzt sich selbst dem Dilemma ihrer Verbindung aus, damit Erkenntnis möglich wird. Wenn Wörter von der materiellen Welt entbunden werden, wie können Repräsentationen dann Fuß fassen? Wenn wir nicht mehr glauben, daß es in der Welt vor vorgegebenen Ähnlichkeiten wimmelt, deren Signaturen in das Antlitz der Welt eingeschrieben sind, daß die Dinge schon mit Zeichen geschmückt sind und die Wörter nur wie so viele Sandkörner am Strand darauf warten, entdeckt zu werden, sondern vielmehr, daß das erkennende Subjekt in ein dichtes Gewebe von Repräsentationen verstrickt ist, so daß der Geist seinen Weg zu den Gegenständen nicht finden kann, die jetzt auf ewig außerhalb seiner Reichweite liegen, und nur noch das zähe Problem der menschlichen Gefangenschaft in der Sprache sichtbar ist, dann wird klar, daß der Repräsentationalismus ein Gefangener der problematischen Metaphysik ist, die er postuliert. Wie der entmutigte Möchtegernläufer in Zenons Paradox scheint der Repräsentationalismus einer Lösung des von ihm gestellten Problems niemals näher zu kommen, weil er in der Unmöglichkeit dessen gefangen bleibt, einen Schritt aus seinem metaphysischen Startloch heraus zu machen. Wir brauchen ein neues Startloch.
Das Postulat individuell bestimmter Entitäten mit vorgegebenen Eigenschaften ist das Kennzeichen der atomistischen Metaphysik. Der Atomismus geht auf Demokrit zurück.9 Demokrit zufolge leiten sich die Eigenschaften aller Dinge von den Eigenschaften der kleinsten Einheit ab – den Atomen (den »Unzerschneidbaren« oder »Untrennbaren«). Liberale Gesellschaftstheorien ebenso wie naturwissenschaftliche Theorien verdanken der Vorstellung viel, daß die Welt aus Einzeldingen mit getrennt zuschreibbaren Eigenschaften besteht. Ein verwickeltes Gewebe wissenschaftlicher, gesellschaftlicher, ethischer und politischer Praktiken und unser Verständnis derselben hängt von den vielfältigen unterschiedlichen Instanziierungen dieser Voraussetzung ab. Vieles liegt bei der Bestreitung ihrer scheinbaren Unvermeidlichkeit in der Schwebe.
Niels Bohr erhielt den Nobelpreis für sein Quantenmodell des Atoms, das den Beginn seiner bahnbrechenden Beiträge zur Entwicklung der Quantentheorie markiert. Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung, daß Bohr in einer verblüffenden Umkehrung des Schemas seines geistigen Ahnherrns die atomistische Metaphysik ablehnt, die »Dinge« für ontologisch fundamentale Entitäten ausgibt. Für Bohr haben die Dinge keine vorgegebenen bestimmten Grenzen oder Eigenschaften, und Wörter haben keine vorgegebenen bestimmten Bedeutungen. Bohr stellt auch den verwandten kartesischen Glauben an die vorgegebene Unterscheidung zwischen Subjekt und Objekt, Erkennendem und Erkanntem in Frage. Tatsächlich stellt Bohrs Philosophie-Physik nicht nur eine radikale Herausforderung für die Newtonsche Physik dar, sondern auch für die kartesische Erkenntnistheorie und ihre repräsentationalistische triadische Struktur von Wörtern, erkennenden Subjekten und Dingen.
Man könnte sagen, daß der erkenntnistheoretische Rahmen, den Bohr entwickelt, sowohl die Transparenz der Sprache als auch die Transparenz von Messungen ablehnt; er lehnt jedoch noch grundlegender die Voraussetzung ab, daß Sprache und Messungen vermittelnde Funktionen ausüben. Die Sprache repräsentiert keine Sachverhalte, und Messungen repräsentieren keine meßunabhängigen Seinszustände. Bohr entwickelt seinen erkenntnistheoretischen Rahmen, ohne der Verzweiflung des Nihilismus oder dem Taumel des Relativismus nachzugeben. Mit Brillanz und Raffinesse findet Bohr einen Weg, um an der Möglichkeit objektiver Erkenntnis festzuhalten, als die großartigen Strukturen der Newtonschen Physik und des Repräsentationalismus einzustürzen beginnen.
Bohrs Bruch mit Newton, Descartes und Demokrit beruht nicht auf »bloßer eitler philosophischer Reflexion«, sondern auf neuen empirischen Befunden auf dem Gebiet der Atomphysik, die im ersten Viertel des 20