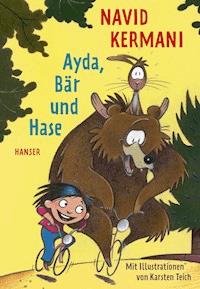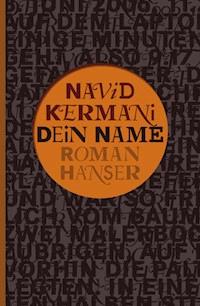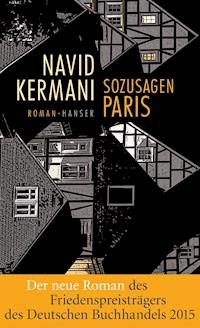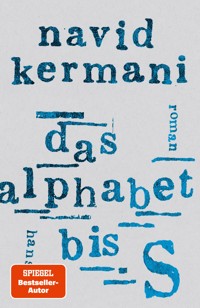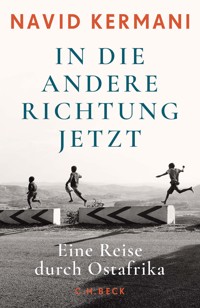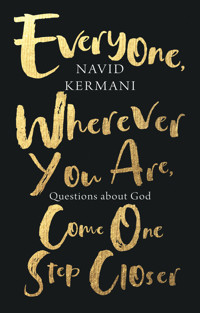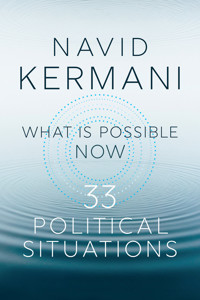Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit seinen Romanen "Dein Name" und "Große Liebe" wurde Navid Kermani als einer der eigensinnigsten Schriftsteller unserer Zeit gefeiert. Nun liegen seine frühen Romane und Erzählungen in einem Band vor – vier literarische Paukenschläge, die bei aller Verschiedenheit zugleich ein Kontinuum ergeben: Ob es die Heilung der Babykolik aus dem Geiste der Rockmusik ist, die Heiligenviten aus Köln-Eigelstein und Umgebung, die Kämpfe, Erniedrigungen und Missverständnisse der erotischen Liebe oder der Tod in Gestalt einer SMS – jedes Mal erweist sich das Wunder oder das Scheitern der menschlichen Existenz in den scheinbar banalsten Situationen unseres Alltags.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 701
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanser E-Book
Navid Kermani
Album
Das Buch der von Neil Young Getöteten
Vierzig Leben
Du sollst
Kurzmitteilung
Carl Hanser Verlag
ISBN 978-3-446-24690-4
© Carl Hanser Verlag München 2014
Umschlag: Peter-Andreas Hassiepen, München
Alle Rechte vorbehalten
Satz: Greiner & Reichel, Köln
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Das Buch der von Neil Young Getöteten
Vierzig Leben
Du sollst
Kurzmitteilung
Das Buch der vonNeil Young Getöteten
Ich will Kinder, ich will nicht mich.
Friedrich Nietzsche
Als wolle Gott ihr die Erkenntnis einbleuen, daß sie das Paradies verlassen habe, als wolle er ihr die Erinnerung rauben oder, schlimmer noch, die Geborgenheit zu einer bloßen Erinnerung gerinnen lassen, bekam meine Tochter regelmäßig abends um acht oder halb neun Blähungen. Das Wort hört sich harmlos an, aber wer einmal ein Neugeborenes in den Händen getragen hat, das sich vor Schmerzen windet, dessen Gesichtszüge sich zu tausend Falten verzerren, wer sich, und sei es für zehn Minuten bloß, diesem dünnen Kreischen ausgesetzt hat, muß zynisch sein, um die Welt zu tolerieren. Ich hatte vorher nicht gewußt, was Blähungen exakt sind und daß es für sie, wenn sie bei Neugeborenen auftreten, einen feststehenden Begriff, den der Drei-Monats-Kolik, gibt. Drei Monate der Folter standen meiner Tochter also bevor. Keiner hatte uns vorgewarnt, und wen immer wir alarmierten, niemand schien ihre Qualen ernst zu nehmen. Die Beteuerungen unserer Hebamme, der Großeltern und Freunde, daß Blähungen bei vielen Säuglingen aufträten und kein Anlaß zur Beunruhigung seien, erschienen mir euphemistisch und roh. Meine schreiende Tochter durch die Wohnung tragend, beschuldigte ich die Menschheit, sich den tatsächlichen Konditionen ihres Daseins zu verschließen, und Gott des Verbrechens an der Menschlichkeit. Was, wenn nicht ein Neugeborenes, das anders als Erwachsene oder sogar Kinder den Schmerz nicht abmildern kann, indem es die Empfindung durch die relativierenden Instanzen des Bewußtseins schickt, was, wenn nicht die Blähungen seiner Tochter, sollte einen Vater beunruhigen, nicht weil er sich ernstlich um ihre Gesundheit sorgte, sondern vielmehr weil er das Elend alles Irdischen in ihr zappelnd verkörpert sieht?
Der Schock war um so größer, als die erste Zeit mit meiner Tochter bis auf einzelne panische Anfälle völlig friedvoll und schon die Geburt für meine Tochter (nicht für meine tapfere Frau) viel sanfter verlaufen war, als ich es mir vorgestellt hatte. Nur wenige Sekunden hatte sie (meine Tochter, nicht meine Frau) geschrien. Dann schaute sie uns aus Riesenaugen ruhig an, ein wenig abwartend, ein wenig prüfend; so seht ihr also aus, schien sie zu denken. Seither kenne ich den Geschmack der Seligkeit. Ich habe meine Tochter an jenem frühen Morgen, von der Ernsthaftigkeit ihres Blicks gefesselt, wohl fast eine Stunde lang wiegend durch den spärlich beleuchteten Kreißsaal getragen und ihr so leise, daß nur sie es hörte, Turaluraluralu der deutschen Gruppe Trio vorgesungen, aber das gehört eigentlich nicht hierhin, weil ich ein Buch über Neil Young schreibe und dieser erst ins Leben meiner Tochter trat, als sie ihn brauchte (früher glaubte ich, daß man Neil Young immer braucht, aber inzwischen denke ich, man kommt die ersten paar Tage auch ohne ihn über die Runden).
Die Blähungen begannen, wenn meine Erinnerung nicht trügt, etwa zehn Tage nach der Geburt. Ich war mit meinem besten Freund ausgegangen und brachte ihn auf einen Wein noch mit nach Hause, als wir meine zermürbte Frau und meine winselnde Tochter auf dem Sofa vorfanden. An diesem Abend witzelte ich noch ausgiebig über ihr mütterliches Unvermögen und meine väterliche Aura, weil meine Tochter sich auf meinem Arm beruhigte, doch am nächsten und übernächsten und auch am dritten Abend wirkten meine Hände kein Wunder mehr, und ich mußte feststellen, daß ich am ersten Abend wahrscheinlich nur zur rechten Zeit, nämlich gegen halb zwölf, nach Hause gekommen war, da meine Tochter ihre seitdem tägliche Tortur soeben überstanden hatte.
Die folgenden Abende waren niederschmetternd. Wie ich in unserer zweigeschossigen Wohnung rauf und runter trabte und vergeblich die unterschiedlichsten Haltemöglichkeiten und Griffe probierte, hielt mich nur die Verpflichtung am Leben, meiner Tochter beizustehen, und außerdem die Aussicht, daß der Schmerz nach ziemlich exakt drei Stunden nachlassen und die Koliken in drei Monaten überwunden sein würden. Aber der Gedanke, meiner Tochter diesen Trost nicht mitteilen zu können, quälte mich. Sie zu tragen und zu liebkosen hatte wohl seine Wirkung, oft hörte sie auf zu kreischen, wimmerte nur noch oder verstummte für einige Minuten; aber schon ihr angespanntes Gesicht ließ erkennen, daß das Unbehagen anhielt. Scheißwelt! Das Büchner-Zitat von uns armen Musikanten und unseren Körpern als den Instrumenten meldete sich jeden Abend zu Wort: »Sind die häßlichen Töne, welche auf ihnen herausgepfuscht werden, nur da, um höher und höher dringend und endlich leise verhallend wie ein wollüstiger Hauch in himmlischen Ohren zu sterben?« Ich hatte es in meiner Arbeit über die islamische Mystik aufgegriffen, weil diese ein ähnliches Motiv kennt. Aber das hier, die Töne, die ein ungutes Schicksal aus meiner Tochter herauspfuschte, das war kein Motiv, das war so real wie ein Auto oder wie Zahnweh.
Ich stand mit meiner Tochter in der Mitte meines Arbeitszimmers, als mir am vierten Blähungsabend die Idee kam, Musik zu hören; vielleicht würde es sie ablenken, überlegte ich, ohne der Hoffnung viel abzugewinnen. Aber etwas anderes hatte ich ohnehin nicht zu tun, und schaden würde es gewiß nicht. Einem Impuls folgend, entschied ich mich sofort für Neil Youngs Last Trip To Tulsa, das letzte Stück auf seiner ersten Soloplatte: eine schier endlose Wiederholung der immer gleichen, von sekundenlangen Pausen unterbrochenen Akkorde zu einem grandiosen Text, den ich bis heute nicht verstanden habe. Das Brüchige, das Assoziative, das Zufällige ist hier, wie später so oft in seiner Musik und seinen Texten, zum Prinzip erhoben, die herkömmliche Liedstruktur der äußeren Form nach bewahrt, von innen jedoch zertrümmert. Das Gewand einer Folkballade tragend, mit der akustischen Gitarre als einzigem Instrument, ist The Last Trip To Tulsa in Wahrheit das mal meditative, mal schroffe Rezital einer Lyrik, die sich bewußt dem Reimzwang sowie den Assonanzen und Dissonanzen der Sprache unterwirft und eben dadurch mit jeder Strophe in eine andere Richtung treibt, mit jedem Vers eine Überraschung erlebt. Das hat etwas von Kinderreimen und ebenso vom Zungenreden; wenn ich die Verse höre, stelle ich mir vor, wie Neil Young auf dem Bett seines Hotelzimmers sitzt, die Westernstiefel ausgestreckt auf dem gestärkten Bettuch, eine ordentliche Dröhnung hinter der Stirn, und den Silben und rhythmischen Lauten lauscht, die aus den immer gleichen Akkorden seiner Gitarre hervortreten, den Reihen gleichlautender Vokale wie dem /e/ in the servicemen were yellow oder dem /a/ in but i was afraid to ask, den Anfangs- oder Endkonsonanten wie dem /g/ in gasoline was green oder eben dem /t/ in last trip to tulsa. Daß Neil Young im Booklet alle Buchstaben des Liedtextes klein und die Strophen fortlaufend, ohne Zeilenwechsel also, schreibt, folgt der Logik des Textes.
Keineswegs war ich so vermessen anzunehmen, meine Tochter bereits am Ende ihrer ersten Lebenswoche in die literarästhetischen und lautmalerischen Nuancen der kanadischen Avantgardelyrik einweisen zu können. Was mich bewog, gerade The Last Trip To Tulsa aufzulegen und nicht eines der vielen harmonischen, selbst Frauen und Kindern zugänglichen, mitunter zugegeben seichten, vereinzelt – ich bekenne es, um gar nicht erst den Verdacht aufkommen zu lassen, ich sähe die Dinge nicht objektiv – peinlichen Lieder (etwas anderes als Neil Young stand nicht zur Debatte, allenfalls Turaluraluralu wäre in Erwägung zu ziehen gewesen, sofern ich die CD besessen hätte, obgleich es vorzusingen ich bereits ohne Wirkung erprobt hatte), was mich bewog, war die Stimme, die jämmerlich hohe, regelmäßig ins Weinerliche kippende, für einen Sänger, zumal für einen Rocksänger eigentlich unmögliche Stimme, die viel zu schmal, fast fistelig ist, diese Stimme eines Kafkaschen Hungerkünstlers, die für jeden Unempfänglichen neuralgisch sein muß und mir nun schon so viele Jahre die boshaftesten Bemerkungen von Bekannten und Brüdern beschert, wohingegen ich wie wahrscheinlich jeder seiner Fans sie mehr als alles andere an ihm liebe. Neil Youngs Stimme kommt in diesem Stück im Reinzustand zur Geltung, wegen der minimalistischen Instrumentierung, aber auch weil er die meiste Zeit ganz leise singt, nicht durchgehend an der Grenze zum Flüstern, wohl aber jenseits der Grenze zum Selbstmonolog. Es ist für ein Lied, das sich doch fast immer an ein Publikum, an eine Mehrzahl von Adressaten richtet, tatsächlich eine ungewöhnliche kommunikative Situation, insofern Neil Young in dieser Aufnahme gleichsam für sich selbst singt oder allenfalls noch für jemanden, der neben ihm auf dem Bett sitzt (zum Beispiel mich), Schulter an Schulter gegen die Rückwand gelehnt. Seltene Schattierungen seiner Stimme treten so zutage, dunkle, zärtliche und rauhe.
Das Stück beginnt damit, daß Neil Young zwei-, dreimal mehr oder weniger planlos in seine Gitarre drischt, um sie daraufhin, wie zur Entschuldigung, kaum hörbar zu streicheln. Weil dieses Intro im Gekreische meiner Tochter vollständig unterging, drehte ich den Lautstärkeregler weit nach rechts. Und dann stand aus heiterem Himmel die Stimme im Raum, behutsam, fast schüchtern und doch lockend, wie schon angedeutet an der untersten Grenze des noch Stimmlichen, aber durch den Lautsprecher eben doch äußerst laut, viel zu laut für ein Baby.
well i used to drive a cab you know, heard a siren scream, pulled over to the corner and fell into a dream. there where two men eating pennies and three young girls who cried, »the west coast is falling. i see rocks in the sky.« the preacher took his bible and he laid it on the stool. he said »with the congregation running, why should i play the fool?«
Nach einigen Sekunden der Erstarrung wollte ich bereits zum Verstärker eilen und den Regler zurückdrehen, aber in eben jener Zeit zwischen der Einsicht, die Musik leiser stellen zu müssen, und dem Impuls, zum Regal zu gehen, im Verlaufe dieser zehntelsekundenwährenden Zeitlosigkeit zwischen zwei Gedankeneinheiten wurde meine Tochter still. Ich bemerkte das sofort, und zwar nicht, weil sie verstummte – dazu war die Musik zu laut und ich zu sehr von ihr in den Bann gezogen –, vielmehr weil ihr Körper sich beruhigte. Ich bemerkte es an meinen Händen, auf denen sie seitlich lag, ihre Brust auf der linken, ihr Unterleib auf der rechten, ich bemerkte es an meinen beiden kleinen Fingern, die ihren Bauch berührten, an den Nerven im Polster meiner Fingerspitzen.
well i used to be a woman you know, i took you for a ride. i let you fly my airplane, it looked good for your pride. ’cause you’re the kind of man you know, who likes what he says. i wonder what it’s like to be so far over my head. well the lady made the wedding and she brought along the ring. she got down on her knees and said, »let’s get on with this thing.«
Das ganze knapp zehnminütige Stück über blieb sie ruhig, auch inmitten des Sturmes, der in der Mitte der Fahrt zweimal unversehens hereinbrach und uns dem Tosen eines windgepeitschten Meeres aussetzte, dem harten, schrillen Klang der mit aller Wucht geschlagenen Saiten und dem Kreischen eines ohnehin viel zu hohen Tenors – selbst von diesem Intermezzo des Hardrock auf der akustischen Gitarre oder eben jenem Bildnis des Punkers als jungem Mann ließ sich meine Tochter keine Sekunde aus der Ruhe bringen. Cool wie ein alter Seemann auf dem Ozean der Neil Youngschen Musik trotzte sie dem Lärmgewitter, bis wir wieder sanftere Gewässer erreichten. Neil Young hat diese metallene Seite, dieses periodisch auftretende Beharren darauf, sich den Harmonien zu verweigern, für das ich ihm durch alle Auszeiten der Harmlosigkeit hindurch die Treue gehalten habe wie sonst nur dem 1.FC Köln (aber der ist schließlich auch das Real Madrid des Westens). Viele seiner stärksten Stücke und seine besten Alben entwickeln sich aus der Spannung zwischen der Lust zum Zertrümmern und seinem unglaublichen Gespür für gute Melodien, die er allein aufgrund seiner Stimme aufrechterhalten kann, die weder hart noch hübsch, sondern ganz einfach fistelig ist und damit keiner der beiden Tendenzen nachgibt. Es gab Tourneen von ihm, da liefen zwischen den Stücken Endlosbänder mit Maschinengeräuschen und mußten die Roadies – aus medizinischen, nicht aus optischen Gründen – Sicherheitshelme mit Ohrenschützern tragen. Das Mini-Album Eldorado zum Beispiel, das er am Ende einer solchen Tournee, nämlich 1989 in einer lächerlich geringen Stückzahl und ausschließlich in Japan und in Australien, veröffentlichte, das also außer dem harten Kern nur Japanern und Australiern bekannt ist, gehört eben deshalb zu seinen drei, vier Platten, die als Gesamtkunstwerk herausragen. Das ist Lärm wie aus einer Fabrikhalle, aber eine Fabrikhalle, durch die der erste Frühlingswind weht. Auf Eldorado kommt dieses Spannungsverhältnis am klarsten zum Ausdruck, aber ähnlich ließe es sich für die besten regulären Alben sagen, für Everybody Knows This Is Nowhere aus dem Jahr 1969, für Zuma und Live Rust aus den Siebzigern oder seine späten Glanzstücke Ragged Glory, Weld und Sleeps With Angels, alles Platten übrigens, die er mit den Rabauken von Crazy Horse aufgenommen hat, jener Garagencombo, die fast so falsch spielt, wie Neil Young singt (»drei Männer und ebenso viele Akkorde«, hat ein Journalist sie mal beschrieben).
Ich war selbst nicht darauf vorbereitet gewesen, daß Neil Young aus der Versunkenheit des Anfangs heraus plötzlich seine Stimme zu einer durchdringenden Deklamation über seine Vergangenheit (er war damals 22 Jahre alt) als Folksänger erhob, begleitet von der Gitarre wie von einer Alarmglocke; so genau war mir das Stück nicht gewärtig, und vor allem hatte ich es vorher noch nie so laut gehört.
i used to be a folk singer, keeping managers alive, when you saw me on a corner and told me i was jive. so i unlocked your mind you know to see what i could see. if you guarantee the postage, i’ll mail you back the key. well i woke up in the morning with an arrow through my nose. there was an indian in the corner trying on my clothes.
Neil Young mochte mit einem Indianerpfeil in der Nase erwacht sein, aber wir beide, meine Tochter und ich, waren noch immer in das Spiel seiner Gitarre und Stimme versunken, und so begann ich instinktiv, nachdem ich sie bisher in der Musik nur gewiegt hatte, mit ihr zu tanzen (ein Außenstehender hätte vielleicht einen anderen Begriff benutzt, etwa »herumhampeln« oder »schwankend stolzieren wie ein betrunkenes Kamel«). Mein Oberkörper schwappte wie der Bug eines Ozeandampfers bei Windstärke zwölf nach vorne und wieder zurück, während uns meine Füße in schweren Ausfallschritten durch das Arbeitszimmer lenkten. Sah man von den Schritten ab, mochte die Darbietung an tanzende Derwische erinnern, die sich außer in Konya keineswegs so pittoresk drehen, sondern die Ekstase meist im Stand, mit wippendem Leib heraufbeschwören, oder an das kopfschüttelnde Publikum eines Heavy-Metal-Konzerts, nur bewegte ich mich ungleich langsamer, nicht in Zeitlupe, aber doch so, als hingen an meinen Gliedern weit mehr als nur die 3450 Gramm meiner Tochter. Im Rausch befand ich mich nicht, weshalb ich mich erinnere, mir darüber bewußt gewesen zu sein, daß sie nicht über Gebühr durchgeschüttelt wurde, da sie gleichsam in der Mitte des Bootes lag; vielmehr konzentrierte ich mich bis in die Haarspitzen auf die Musik und ihre Wirkung. Dieser Zustand der extremen Wachheit, des Daseins im Heideggerschen Sinn, für den die östliche Philosophie freilich unverdächtigere Bezeichnungen gefunden hat, er war beinah selbst schon rauschhaft, indem er das Gegenteil davon war, wie zwei Bögen, die vom selben Punkt ausgehen und sich am anderen Ende zum Kreis wiedertreffen. Hätte ich eine abwehrende Regung meiner Tochter gespürt, es hätte nicht länger als eine Sekunde gedauert, bis die Musik leiser oder ausgestellt gewesen wäre. Aber ich spürte, nein, ich wußte um ihr Wohlbehagen; nicht durch eine Regung, die ich an meinen Fingern wahrnahm, teilte sie es mir mit, es war mehr wie eine Gedankenübertragung, als ob ihr Gehirn dem meinen eine SMS gesandt hätte. Sie fand also die dritte Strophe von Last Trip To Tulsa auch zumindest passabel. Daß sie allerdings das Versonnene, das Sehnsuchtsvolle des Beginns vorzog, nahm ich wahr, als mit den letzten Silben der Strophe der Grundton des Stückes wiederkehrte. Sie genoß es fühlbar, als Neil Youngs zunächst wortloser Gesang an das Paradies erinnerte, das vergangene und zukünftige. Mein Arbeitszimmer durchsegelnd, wiegte ich sie wie in der ersten Stunde ihres Lebens.
Im ersten Satz dieses Buches hatte ich geschrieben, daß die Geborgenheit meiner Tochter zu einer bloßen Erinnerung gerann; daß wir uns erinnern, hielt ich, da ich über die Koliken meiner Tochter nachdachte, für das Schlimmste, was Gott uns antut. Aber eben, beim Schreiben des letzten Absatzes, habe ich gemerkt, daß die Erinnerung zu versöhnen oder wenigstens zu trösten vermag. Das ist ein Widerspruch, und zuerst habe ich den Schluß gezogen, der erste Satz sei falsch und müsse geändert werden. Aber dann ist mir erst klargeworden, was er wirklich bedeutet, daß er nämlich den Prozeß des Gerinnens, des Zur-Erinnerung-Werdens zum Thema hat, der so grausam wie ein Sterben oder Gebären ist, indes The Last Trip To Tulsa meine Tochter die Erinnerung zum ersten Mal kosten ließ – sie war angekommen in unserer Welt, in unseren Armen. Die gesungenen Vokale Neil Youngs und vielleicht auch meine Bewegungen, meine mit ihr schwingende Nähe, bildeten die Geborgenheit ab, und indem sie in das Bild eintrat, trat sie aus dem Schmerz heraus. Das war ein anderer Zustand als nach der Geburt, anders als Turaluralu, als das Paradies noch in der Gegenwart lag. Es war Vergegenwärtigung, ihre erste Wiederkehr, es war der Beginn der Zeit. Wann immer ihre Uhr begonnen hatte zu laufen – jetzt hörte sie sie ticken. Deshalb sang Neil Young vom Tod.
well i used to be asleep you know, with blankets on my bed. i stayed there for a while ’til they discovered i was dead. the coroner was friendly and i liked him quite a lot. if i hadn’t ’ve been a woman i guess i’d never have been caught. they gave me back my house and car and nothing more was said.
Aber dann begann die Gitarre gleich einer Zirkustrommel, die den gewagtesten Akt des Abends ankündigt, eine rasche Folge des immergleichen Wirbels, zu denen Neil Young eine Serie von langgezogenen Indianer-Ouuuhs ausstieß, bis ein neuerliches, nein, das eigentliche Gewitter ausbrach.
well i was driving down the freeway when my car ran out of gas. pulled over to the station but i was afraid to ask. the servicemen were yellow and the gasoline was green. although i knew i couldn’t i thought that i was gonna scream. that was on my last trip to tulsa just before the snow. if you ever need a ride there be sure to let me know.
Das war nun wirklich schwerer Tobak für ein Neugeborenes; Neil Young sang wie von einer Tarantel gestochen und schlug in die Saiten seiner akustischen Gitarre wie Oskar Matzerath auf die Blechtrommel. Hätte mich jemand beobachtet, er hätte annehmen müssen, nicht bloß dieser irre Sänger mit der Piepsstimme, sondern auch ich sei von der Tarantel gestochen worden, denn diesmal tanzte ich nicht bloß in den gleichen Bewegungsabläufen, sondern auch fast so schnell wie das Publikum eines Heavy-Metal-Konzerts. Gleichzeitig war ich nahe daran, dem Spektakel ein Ende zu bereiten, zur nächsten Strophe zu springen oder die Lautstärke zu senken, aber etwas sagte mir, ich solle es lassen und mich weiter der Musik hingeben, solange meine Tochter kein Zeichen gab. Ich spürte, daß sie diesem Lärm nicht allzu lang gewachsen sein würde, wollte aber nicht zu früh abbrechen. Und tatsächlich sollte auch der zweite, heftigere Sturm rechtzeitig vorübergehen und uns noch achtsamer zurücklassen für die Stille der letzten Strophe.
well i was chopping down a palm tree when a friend dropped by to ask if i would feel less lonely if he helped me swing the axe. i said »no, it’s not a case of being lonely we’ve had here. i’ve been working on this palm tree for eighty seven years.« he said »go get lost« and walked toward his cadillac. i chopped down the palm tree and it landed on his back.
Neil Young war, als er diesen Text verfaßte, höchstens 22 Jahre alt, wahrscheinlich jünger, doch das selbstironische Zähnefletschen, das er dem Leben zeigt, die grimmig-fröhliche Stimmung, die sich in den Versen vermittelt, kenne ich sonst nur aus Samuel Becketts älteren Tagen. In der Geschichte ist nahezu alles enthalten, was Neil Youngs Poesie und seine Haltung zur Musik und zum Leben ausmacht. Da ist jemand damit beschäftigt, eine Palme zu fällen, und ein anderer kommt vorbei und fragt ihn, ob er sich weniger einsam fühlte, wenn sie gemeinsam die Axt schwängen. Schroff weist ihn der Besuchte zurecht und ironisiert ihn gleichzeitig, indem er auf den therapeutischen Ton der Frage mit einer Diagnose antwortet, deren Begründung gar keine zu sein scheint und die so paradox ist wie eine indische Weisheit: »Nein, wir haben hier keinen Fall von Einsamkeit vorliegen. Ich arbeite seit 87 Jahren an dieser Palme.«
Natürlich ist jemand, der 87 Jahre mit einer Palme verbringt – wie jeder andere Mensch – allein, und weil er sich dessen bewußt ist, ist er es noch mehr. Aber die Einsamkeit scheint diesem Holzfäller so selbstverständlich und unausweichlich, daß er weder mit ihr hadert noch sich der Illusion hingibt, die Gemeinschaft mit anderen Menschen würde etwas an seiner Einsamkeit ändern. Mit solchen Lappalien hält er sich schon lange nicht mehr auf, denn er hat zu tun. Er muß sich um eine Palme kümmern.
Neil Young hat sich seine gesamte Karriere hindurch als Arbeiter vorgestellt, oder genauer: als Vorarbeiter einer Mannschaft von Arbeitern, die sich Crazy Horse nennt, als jemand, der den Auftrag hat, einen bestimmten Groove, ein bestimmtes musikalisches Gefühl zu erzeugen, ähnlich einem Bäcker, der für sein Schwarzbrot berühmt ist, oder einem Farmer, der eine besondere Art von Mais zu züchten hat, weil sie nur auf seinem Acker wächst. Nicht nur sind seine Texte voller Anspielungen auf das Motiv der Handarbeit, des Pflügens, des harten Ackerns – schon die Besetzungsliste manches seiner Alben läßt mich klare amerikanische Landluft riechen: Namen wie Spooner Oldham, Joe Yankee, Rufus Thibodeaux, Hargus »Pig« Robbins oder Oscar Butterworth verweisen in eine Welt, die noch mit dem ersten Hahnenschrei aufwacht und mit dem Absatteln der Pferde zu Bette geht. Die karierten Baumfällerhemden, die Neil Young wie eine Jacke über dem T-Shirt und der schon lange, bevor es Mode wurde, zerfransten Jeans trägt, die buschigen Koteletten, die Heuballen auf der Bühne, die vielen Coverphotos, die ihn und seine Band auf Bauernhöfen zeigen, seine wiederkehrenden Reminiszenzen an die Country-Music und sein Engagement für verarmte amerikanische Bauern, das manchmal gebrochene, manchmal unerträgliche Home Sweet Home der Texte, sie alle sind Zeichen der Bodenständigkeit, des einfachen Lebens und der disziplinierten Plackerei, die im denkbar größten Kontrast zu seinem flatternden Gesang, dem Krawall seiner Gitarre und der längsten Strecke seines eigenen Lebensweges stehen. In David Lynchs Straight Story ist ebenso wie in Last Trip To Tulsa ein Bildnis Neil Youngs als alter Mann gezeichnet. Ein Greis wird er sein, der tut, was er zu tun, was er immer schon getan hat, nämlich tagein, tagaus zum Marsch durch die Seelenwelt zu blasen. Mehr ist das Leben nicht, aber das ist das ganze Leben.
Und dann kommt dieser Idiot von Freund, Manager, Musikkollege, Fan, Nachbar oder Mitmensch und fragt, ob der Holzfäller weniger einsam wäre, wenn er ihm hülfe. Das ist eine Frage, so naheliegend und abwegig, wie sie nur Mitmenschen fragen können. In einer Zen-Geschichte wird von Milarepa erzählt, der überall nach Erleuchtung gesucht, aber nirgends eine Antwort erhalten hat, bis er eines Tages einen Greis, der einen schweren Sack auf der Schulter trägt, langsam einen Bergpfad herabsteigen sieht. Milarepa erkennt sofort, daß dieser Greis das Geheimnis weiß, nach dem er so viele Jahre verzweifelt gesucht hat, und rennt ihm nach.
»Alter, bitte sage mir, was du weißt. Was ist Erleuchtung?«
Der Greis lächelt ihn an. Dann läßt er seine schwere Last von der Schulter gleiten und richtet sich auf.
»Ja, ich sehe!« ruft Milarepa. »Meinen ewigen Dank! Aber bitte erlaube mir noch eine Frage: Was kommt nach der Erleuchtung?«
Abermals lächelt der Greis, bückt sich und hebt seinen schweren Sack wieder auf. Er legt ihn sich auf die Schulter, rückt die Last zurecht und geht seines Weges.
Ich stelle mir vor, Milarepa, dem so etwas natürlich nicht zuzutrauen ist, würde dem Greis eine beleidigte, höhnische Bemerkung hinterherwerfen. Vielleicht würde der Beschimpfte, ohne zu reagieren, weiterziehen, vielleicht aber würde er Milarepa auch ohne viel Aufwand eine Lektion erteilen, die dieser bis an sein Lebensende nicht vergäße. Wenn er garstig genug, stark und mit dem kindlichen Spaß an gemeinen Streichen ausgestattet wäre, vielleicht würde er Milarepa die Last, die er ein Leben lang getragen hat, einfach an den Kopf werfen. Was sich, abgesehen vom Humor, darin ausdrückte, wäre seine Freiheit. Der Holzfäller, der zum letzten Hieb ausholt, während der ungehaltene Besucher zu seinem Cadillac zurückgeht, hätte längst die Möglichkeit gehabt, die Palme zu fällen. Jahrein, jahraus hat er sich um sie gekümmert, wahrscheinlich hat er sie selbst gepflanzt, gewässert und zum Schluß seine Axt in sie geschlagen. Gefällt hat er sie jedoch bis zu dem Kairos nicht, da ihr Sinn sich erfüllte. Man kann sagen: Hätte er die Palme nicht großgezogen, wäre niemand gekommen, um ihn mißzuverstehen, und es hätte keinen Sinn gehabt, sie zu fällen. Aber das könnte man über alle Dinge des Lebens sagen, das nicht sinnlos, sondern sich selbst Sinn ist.
Daß die Verse – wie alle guten Texte Neil Youngs – offen genug sind, sie anders zu deuten, versteht sich; so ist es reizvoll, sich vorzustellen, der Holzfäller sei eher jung, seine Antwort daher noch spöttischer und das Ende der Geschichte um so böser. Ich habe nur notiert, was die Strophe mir selbst sagt. Ihr zu lauschen, hatte ich Gelegenheit genug. Mit dem Ende des letzten Wortes, das Neil Young nur noch ins Mikrophon haucht und gleichzeitig das Ende des Stückes und der CD ist, begann meine Tochter wieder unruhig zu werden. Sie schrie nicht sofort, aber sie regte sich und fing nach dreißig Sekunden oder einer Minute an, regelrecht zu zappeln. Sie hätte gewiß geschrien, wenn ich ihr Neil Young noch länger vorenthalten hätte. Interessanterweise beruhigte sie sich auch diesmal erst, als seine Stimme erklang, nicht schon mit dem Klang der Gitarre.
In drei Stunden kann man den Last Trip ToTulsa etwa sechzehn Mal hören, und mit sehr viel weniger gab sie sich nach ihrem initialen Hörerlebnis nicht zufrieden. Am dritten Abend fragte meine Frau, halb scherzhaft, halb im Ernst, ob man unsere Tochter nicht auch mal schreien lassen solle, schließlich stärke das angeblich die Lungen. Am vierten Tag begannen unsere Nachbarn, die zunächst erleichtert gewesen sein dürften, daß ich ein Mittel gefunden hatte, um die neue Mitbewohnerin zu besänftigen, mir auf dem Flur zufällig von anderen CDs vorzuschwärmen, und zwei Tage später schenkte mir die junge Frau aus dem Stockwerk unter uns, eine angehende Opernsängerin, die mich mit ihren Tonleitern selbst schon zur Weißglut getrieben hat, sogar eine Kassette deutsch geträllerter amerikanischer Kinderlieder. Jingle Bells gehörte ohnehin nicht zu den Melodien, die ich für ein Neugeborenes angemessen fand, aber von einem Chor penetrant fröhlicher deutscher Blagen vorgetragen, ist es so schauderhaft, wie nach Aussage der ignoranten unter meinen Freunden – also den meisten – Neil Young sein soll.
Dabei wäre ich durchaus bereit gewesen, ab und an mal, sagen wir einmal am Tag, etwas anderes als Neil Young aufzulegen, und ich habe mein Entgegenkommen mehrfach unter Beweis gestellt. Aber meine Tochter vermochte weder Mahlers Vierter Symphonie noch melodischem Pop aus Afrika etwas abzugewinnen. Sie bestand auf Neil Young und quittierte jeden anderen Klang mit einem Schreikonzert, das Fußballkommentatoren gellend nennen würden. Ich habe für die geschilderten Reaktionen Zeugen. Mehreren Freunden, die bei Bedarf öffentlich zu nennen ich absolut bereit bin, habe ich die Wirkung Neil Youngs auf meine Tochter unter objektiven Bedingungen demonstriert. Was immer sie für absurde und herabwürdigende Erklärungen für das Phänomen fanden (eine genetisch bedingte Hörstörung, dringend zu untersuchendes Anzeichen für eine geistige Behinderung, Gehirnwäsche durch permanente Beschallung im Mutterbauch und ähnlich Abstruses) – niemand konnte den Effekt, der nachweislich nur bei Neil Young auftrat, leugnen. Um meine These wissenschaftlich zu untermauern, bedürfte es weiterer empirischer Untersuchungen, dennoch bin ich mir beinah sicher, daß speziell die hohen Frequenzen in der Stimme Neil Youngs auf Neugeborene beruhigend wirken, nicht nur auf meine Tochter. Ich vermute, daß der Klang der Stimme an die Vergangenheit der Neugeborenen rührt.
Ohnehin waren die Klagen unserer Umwelt über die Einseitigkeit des abendlichen Musikprogramms maßlos überzogen, da meine Tochter, wie sich im Verlaufe schon der ersten Woche herausstellte, keineswegs zwingend Last Trip To Tulsa zu hören verlangte, sondern auch andere Lieder goutierte, solange Neil Young sie sang. Es stand mir also im Prinzip ein ganzer Kosmos zur Verfügung, um die Abende musikalisch zu gestalten. Gewiß kamen in diesem Stadium noch keine Brecher wie Cocaine Eyes, Sedan Delivery oder Pressure in Frage, und ich mußte mich in der Auswahl auf die eher ruhigen Stücke Neil Youngs beschränken. Aber man muß sich keineswegs vorstellen, ich hätte ihr nur akustische Lieder vorgespielt. Helpless zum Beispiel mochte sie sehr gern, dabei hat es ein echtes Schlagzeug und einen elektrischen Baß. Na gut, man kann Helpless nicht eben flott nennen (»Recorded in San Francisco about 4 AM, when everybody got tired enough to play at my speed«, hat Neil Young, handschriftlich wie immer, im Booklet von Decade notiert), aber Prime Of Life aus Sleeps With Angels, mit dem ich einen vollständigen Heiligabend bei den Schwiegereltern bestritten habe, geht wirklich ab. Ich wäre normalerweise nicht auf die Idee gekommen, es aufzulegen, doch an dem Abend stellte ich um acht Uhr fest, daß ich meine eigenen CDs vergessen hatte und als einzige Aufnahme Neil Youngs Sleeps With Angels verfügbar war, die ich meiner Schwägerin als Weihnachtsgeschenk mitgebracht hatte, eine Platte, von der ich annehmen durfte, daß sie eine Achtzehnjährige mit Vorlieben für Grunge, Rap und Metal ansprach, die aber selbst ich nicht ohne Not einer Vierwöchigen vorgespielt hätte. Zu meiner Überraschung mochte meine Tochter die CD, und am meisten Prime Of Life, obwohl das Album ruhigere Stücke enthält. Der exzellente, fliegend-fliehende Rhythmus, der unter dem sanft gehaltenen Gesang und einer berückend einfältigen Flöte liegt, muß in Kombination mit meinen Bewegungen einen Groove erzeugt haben, der exakt dem Pulsschlag meiner Tochter entsprach (der Puls von Babys schlägt bekanntlich schneller als der von Erwachsenen). Selbst meine Schwiegermutter rief mir nach der elften oder zwölften Wiederholung zu, das sei ja ganz schön. Anschließend wies sie verlegen auf ihre Anneliese-Rothenberger-CD hin, die jedes Jahr an Weihnachten auf große Resonanz bei der Familie stoße und wenigstens in Teilen durchaus rhythmisch und eingängig zu nennen sei. Ich nickte ihr von Musikkenner zu Musikkennerin zu und rief, daß ihr Enkelkind in spätestens anderthalb Stunden schlafen werde. Der Abend hat dazu geführt, daß die außergewöhnliche Empfänglichkeit meiner Tochter für Neil Young und mein mindestens ebenso außergewöhnlicher Tanz der Nachwelt als Videoaufzeichnung erhalten sind. Freilich sind wir auf dem Film die meiste Zeit nur als beweglicher Flecken im Hintergrund zu sehen; nur wenn meine Schwägerin die Kamera führte, gelangen dank kühner Schwenks über die abwehrenden Hände meiner Schwiegermutter und das fahle Gesicht meiner Frau hinweg faszinierende Großaufnahmen, die zu gegebener Zeit auch ihrer wissenschaftlichen Auswertung zugeführt werden sollten. Die Tonqualität der Kassette ist, nebenbei bemerkt, erstaunlich gut, meine Verwandtschaft bis auf Wortfetzen nicht zu hören, so daß ich seitdem, wenn mein CD-Spieler einmal ausfallen sollte, auf Video ausweichen könnte, um meiner Tochter Neil Young vorzuspielen.
Aufregend war es, zu verfolgen, wie sie ihre Favoriten wechselte. An die Stelle von Last Trip To Tulsa trat nach einigen Wochen Helpless, das wiederum von Sugar Mountain abgelöst wurde, dem Urstück Neil Youngs über die Kindheit, das er an seinem 19. Geburtstag verfaßt und auf einem Sony-Heimgerät aufgenommen hat. Vier Strophen hat das Lied, wie das Jahr Jahreszeiten, und einen Refrain, der dem Wunderbaren des Wandels den Verlust des Vergangenen entgegenhält.
Oh, to live on Sugar Mountain
With the barkers and the coloured balloons,
You can’t be twenty on Sugar Mountain,
Though you’re thinkin’ that you’re leavin’ there too soon,
You’re leavin’ there too soon.
It’s so noisy at the fair
But all your friends are there
And the candy floss you had
And your mother and your dad.
(Oh, to live on Sugar mountain…)
There’s a girl just down the aisle,
Oh, to turn and see her smile.
You can hear the words she wrote
As you read her hidden note.
(Chorus)
Now you’re underneath the stairs
And you’re givin’ back some glares
To the people who you met
And it’s your first cigarette.
(Chorus)
Now you say you’re leavin’ home
’Cause you want to be alone.
Ain’t it funny how you feel
When you’re findin’ out it’s real?
(Final chorus twice)
Sein Vater, dem wir die beste Biographie Neil Youngs verdanken, schrieb einmal, daß die herzzerreißende Schönheit von Sugar Mountain sich so wenig erklären lasse wie das Lächeln der Mona Lisa, ein zwar nicht origineller, aber korrekter Vergleich, dem ich nur hinzufüge, daß meine Tochter bis heute, sobald ich ihr das Lied vorspiele oder -singe, mindestens ebenso rätselhaft lächelt. An den Weihnachtsfeiertagen hörten wir dann jeweils drei Stunden lang Prime Of Life, auf das über den Jahreswechsel My Heart und A Dream That Can Last folgten. Es sind die beiden Stücke, die Sleeps With Angels eröffnen und beschließen, zwei Wiegenlieder, zu denen ein übersteuertes Klavier im Saloonstil klimpert. Später entzückte sich meine Tochter an Pocahontas, genauer gesagt, an der noch besseren elektrischen Version aus Year Of The Horse, dem Livealbum von 1997. Das war die Zeit, als ich das Gefühl hatte, von jetzt an könnten wir zusammen richtig rocken.
Pocahontas gehört zu einer Serie von Liedern, mit denen Neil Young das indianische Amerika heraufbeschwört und selbst unter allen Rockmusikern zum Mythologen seines Kontinents geworden ist. Die Eroberung durch die Weißen gerät ihm zur wiederkehrenden Metapher für das zentrale Motiv seiner Kunst: den Verlust des Paradieses. Gleich, ob es sich um die Liebe, die Geschichte, die Politik, die Musik, seine eigene, mit der Hippie-Bewegung verwobene Biographie oder die Kindheit handelt, immer sind es ein ernüchterndes, verhängnisvolles Heute und ein unschuldiges, sagenumwobenes Gestern, das er in Umkehrung der Hegelschen Dialektik beschwört. Das ist so allgemein, wie es sich anhört. Wenn es zwei Topoi gibt, die sich durch die Geschichte des menschlichen Geistes ziehen, sind es die Liebe (und mit ihr die Geburt) und der Zerfall (und mit ihm der Tod). Die Grundform des ersten ist das Gedicht, die des zweiten das Epos. Alle Epik, die griechische nicht anders als die indische oder persische, ist aus dem Gedanken entstanden, daß die große Zeit vorbei sei. Gerade jene Epochen, die wir rückblickend für ihren kulturellen Reichtum bewundern, huldigen der Logik des Niedergangs – man muß sich nur an das Weh und Ach erinnern, unter dem Goethe und Schiller die Lage der deutschen Sprache und Literatur in ihrer Zeit besprechen. Es ist kein Zufall, daß Neil Young immer wieder die Form der Ballade aufgegriffen hat, musikalisch wie textlich, die epische unter den Liedformen. Alle seine Balladen preisen das Untergegangene, doch ist das Sentimentalische nur ein Gewand, das den Drang schillernd kleidet, das Mögliche gegen das Wirkliche zu erinnern. Das eben unterscheidet seine Haltung vom Konservativen und schafft gleichzeitig die Ambivalenz zu diesem, denn nicht immer ist zu unterscheiden, ob das Vergehende zu bewahren oder das Verlorene zu beklagen gesucht wird. Daß er das Mögliche in einer konkreten Vergangenheit ansiedelt, gibt seinem Aufbegehren einen konservativen Zug, der in den ernstgemeinten Ausflügen in die Welt und die Musik des Country und einzelnen reaktionären Äußerungen in Interviews seine Entsprechung in Neil Youngs Leben hat. Ich nenne es das Heideggersche an ihm, und es ist mir als solches, isoliert betrachtet oder in seiner Musik isoliert zum Klang gebracht, suspekt. Daß er sich jedoch der Funktion der Vergangenheit als eines Anderen bewußt ist und die Verklärung selbst reflektiert, daß er noch in der einzigen Strophe seines gesamten Werkes, in der er das Vergangene im Präsens, den Sugar Mountain als Gegenwart besingt, daß er selbst in dieser Hymne auf die Kindheit deren Angst und Unbehagen nicht übersieht: »It’s so noisy at the fair«, das rettet ihn – meistens – vor der Nostalgie: »And the homeland we’ve never seen.« Nicht um das Gewesene geht es ihm, sondern um den Verlust. Das ist Adorno in ihm, der Heidegger eben deshalb so emotional attackiert hat, weil dieser an etwas Echtes rührte, aber es handzahm machte, so wie derjenige, der mit der Religion ringt und hadert, auf die Weichspülungen der zeitgemäßen Kirchen und des New Age als eine zu billige Antwort schimpft. Die starken und die schwachen Momente in Neil Youngs Musik, die ein Pendant in seinen oft kritischen, bisweilen jedoch restaurativen Versen und Wortmeldungen zur Politik haben, unterscheide ich für mich anhand der beiden Philosophen: wo er – und sei es in Westernstiefeln – Adorno folgt und wo er hippiemäßig in Heidegger abgleitet.
Aurora Borealis
The icy sky at night
Paddles cut the water
In a long and hurried flight
From the white man to the fields of green
And the homeland we’ve never seen
Ich gebe zu, daß Adorno, der ohnehin diese Art von Musik verabscheute, wohl kaum je einen »Versuch, Pocahontas zu verstehen«, unternommen hätte. Aber nun gut, es handelt sich ja auch nicht um Weltliteratur, sondern um einen Rocksong, nicht um klassische Neue Musik, sondern um neue Volksmusik. Und das Bild, das Neil Young mit fünf Pinselstrichen von den Indianern zeichnet, die unter dem Nordlicht (»Aurora Borealis«) in ihren Kanus vor dem Weißen fliehen, und der sechste Strich, der das Untergegangene ins Utopische wendet, das ist schon fabelhaft, es ist zugleich einfach, präzise und plastisch. Das Weinerliche der Stimme treibt die Schwermut des Textes auf die Spitze, während das Stück gleichzeitig durch das Leiernde seiner Melodie abgehalten wird, in die reine Betrübnis zu schlittern. Gewiß, Pocahontas ist ein Klagelied auf den negativen Urmythos des heutigen Amerika, aber es ist seinem musikalischen Charakter nach und, wie sich herausstellt, auch in seinem Text keine Elegie, es hat nichts von den Trauer- und Schmerzensgesängen der religiösen Passion. Eher ist man auf einen Bänkelsänger verwiesen, der auf einem belebten Platz in einer durchschnittlichen amerikanischen Großstadt die Geschichte Amerikas erzählt. Das gilt für die erste Version von 1979 auf Rust Never Sleeps. Die Einspielung auf dem Unplugged-Album von 1993 hat eben das Elegische, das die erste Version glücklich nur gestreift hatte; fast singt Neil Young nicht das Lied, sondern sinniert darüber, wie er es früher einmal gesungen hat. Das gefällt beim ersten Hören, aber das Stück verliert dadurch, so will es mir inzwischen scheinen, an Schärfe, Wucht und Tiefe. Es plätschert an einem vorbei. Alles, was Pocahontas auf Unplugged verliert, gewinnt es im Year Of The Horse dreifach und vierfach zurück. Die Lakonie, die der Melodie und dem Text zugrunde liegt, ist hier eine grimmige, brutale, sie ist so metallen wie die Instrumentierung, und genauso singt Neil Young, die Zähne gefletscht zu einem trotzigen Grinsen.
Wenn sich die ersten Gitarrenriffs aus einer quietschenden Rückkopplung als dröhnende Fanfare erheben und anschließend ein harter Baß, ein klares Schlagzeug und die mächtige, dunkle Rhythmusgitarre von Frank »Poncho« Sampedro zu einem Beat einsetzen, der nur anfangs gemächlich wirkt und unerbittlich nach vorne peitscht, mag man seinen Ohren, die von Pocahontas ganz anderes gewohnt sind, kaum glauben; aber je länger das Stück andauert, desto mehr reißt es mit, und je öfter man es hört, um so deutlicher wird, daß die elektrische die eigentliche Fassung des Liedes ist, mag Neil Young auch zwanzig Jahre gebraucht haben, bis er es herausfand. Der treibende Rhythmus, die herrlich klirrende Leadgitarre und sein furios grollender Gesang nehmen Pocahontas den größten Teil seiner Romantik; nicht mehr ein Klagelied ist es, nicht mehr ein Bänkelgesang, sondern eine Abrechnung. Der junge Mann, der es einst gesungen hat, ist erwachsen geworden, er lamentiert nicht mehr, er stellt fest. Er ist selbst ein Indianer:
They killed us in our teepees
And they cut our women down
They might have left some babies
Cryin’ on the ground
But the firesticks and the wagons come
And the night falls on the settin’ sun.
Vielleicht war der Sänger eines der Babys und lebt nun das ewige Leben, um die Geschichte seines Volkes vor dem Vergessen zu bewahren, denn die dritte Strophe wechselt mit der Zeitebene auch die Perspektive. Wie in einem Film, der mit einer Rückblende beginnt, von der man zunächst nicht weiß, daß es sich um eine handelt, und dann plötzlich den Zurückschauenden vorstellt, oder wie eine Kamera, die zunächst eine Kinoleinwand ohne deren Ränder zeigt und dann das Gesicht des Helden, der im Kino sitzt, so schwenkt die folgende Strophe vom Erinnerten auf den, der sich erinnert. Das Geniale an diesem Wechsel ist, daß er sich mitten in der Strophe und völlig unscheinbar vollzieht, so daß man zunächst überhaupt nicht versteht, wo man sich befindet. Von der ersten auf die zweite Zeile überspringt der Text ein ganzes Jahrhundert, er hebt in der Prärie an und landet »schräg gegenüber der Bank«, inmitten der heutigen Großstadt, wo niemand fremder sein könnte als ein Indianer, dem doch früher einmal dieses Land gehörte, hier also, auf dem Bürgersteig einer belebten Straße, wo die Taxis quer über seine Füße fahren, hat man, so könnte man es beim zweiten Mal lesen, den Büffel geschlachtet oder schlachtet ihn täglich.
They massacred the buffalo
Kitty-corner from the bank
Taxis run across my feet
And my eyes have turned to blanks
In my little box at the top of the stairs
With my Indian rug and a pipe to share
Die Strophe ist eine surreale Skizze der Entfremdung, wie Marx und Fanon sie nicht hätten schärfer zeichnen können, ein Bild der Gewalt, die von der Zivilisation ausgeht. Und wieder endet sie, wie schon die erste Strophe, indem sie sich von der Situation abwendet und aus deren Gegenwart tritt: mit dem verzweifelten, rührenden Bemühen, sich an dem Vergangenen festzuhalten und der augenblickweisen Versöhnung eine Chance zu wahren: »With my Indian rug and a pipe to share«. Doch dieses Vergangene, so stellt sich in der nächsten Strophe heraus, ist für den Sänger ein bloßes Konstrukt, eine Fläche, auf die er seine Sehnsucht projiziert, die Sehnsucht nach einem anderen Leben. Erneut wechselt der Text die Ebene und kehrt zurück in die Zeit, als die weiße Zivilisation in das natürliche Leben der Indianer einbrach. Weil der Text nun preisgibt, eine Vorstellung, nicht eine Darstellung zu sein, erscheint er, und mit ihm sein Ich, ein weiteres Mal in einem neuen Licht. Darin gleicht er einem Vexierbild, das den Betrachter auf viele Fährten führt, bevor es sich erschließt, wenn es denn überhaupt die eine richtige Fährte angelegt hat.
I wish I was trapper
I would give a thousand pelts
To sleep with Pocahontas
And find out how she felt
In the mornin’ on the fields of green
In the homeland we’ve never seen
Als Beschreibung der Vertreibung, mit der alle Geschichte einsetzt, fing das Lied an. Anschließend entpuppte der Beschreibende sich zunächst als jemand, der selbst von der Katastrophe betroffen gewesen war, dann als ein Nachfahre der Indianer, der in einem unbehaglichen Heute lebt und die Katastrophe ins Gedächtnis ruft, und am Ende als jemand, für den der indianische Mythos das Gleichnis seiner eigenen Sehnsüchte oder das schlechthin Andere zum Bestehenden ist, als ein Weißer wahrscheinlich, als jemand wie Neil Young. Wie bei einer Zwiebel schält sich das literarische Ich heraus. Interessanterweise wünscht es sich nicht, ein Indianer, sondern ein Trapper zu sein. Damit bewahrt es sich zum einen seine Ambivalenz – bei dem Ich könnte es sich doch um einen Indianer oder dessen Nachfahren handeln, um ein Opfer der Geschichte also, das sich wünscht, den Eroberern anzugehören – und benennt zum anderen präzise den Kern dessen, wonach die Menschheit seit dem Verlust des Paradieses strebt: mit dem jetzigen Bewußtsein den Zustand der Natürlichkeit wiederzuerlangen, als Erwachsener Kind zu sein. Nicht bloß will der Sänger mit der Indianerprinzessin Pocahontas schlafen – dann würde er davon träumen, selbst ein Indianerhäuptling zu sein –, sondern ein Trapper, ein Weißer will er sein, der mit ihr schläft, und zwar nicht, weil es sich so schön anfühlt, sondern um zu begreifen, wie sie, die Indianerin, fühlt, »am Morgen auf den grünen Feldern / In der Heimat, die wir nie gesehen haben«. Es ist immer und immer wieder die gleiche Bewegung, auf die die Menschen hoffen: den Kreis zu durchschreiten, um durch die Hintertür wieder ins Paradies einzutreten, das aber nicht mehr das gleiche sein wird, weil man selbst nicht mehr der Gleiche ist. Das ist Neil Youngs Leben, das ist seine Musik mit ihren immer neuen, manchmal beinah verkrampft, ja, manisch wirkenden Aufbrüchen, von hier wird erkennbar, warum er zugleich der Nostalgiker und der Ruhelose unter den Rockmusikern ist, der jede Veränderung als Verlust besingt, aber den Stillstand fürchtet wie der Teufel das Weihwasser: »It’s better to burn out than to fade away.« Hier wird erkennbar: Sugar Mountain und Rust Never Sleeps gehören zusammen, Heimweh und Fernweh sind zwei Saiten derselben Gitarre. Es kann nur besser gewesen sein, es muß besser werden als das, was ist.
Daß das Objekt der Begierde gerade Pocahontas ist, die Tochter des Häuptlings Powhatan, die den Frieden zwischen den Indianern und den englischen Siedlern vermittelte, weist auf die Sehnsucht nach Versöhnung und auf das Verlangen, die Vergangenheit zu wiederholen, um ihre Fehler zu vermeiden. Der Einbruch in das Paradies wird nicht als solcher beklagt, er hätte nur anders verlaufen sollen, so wie Neil Young in anderen Liedern nicht das Erwachsenwerden oder den Prozeß der Zivilisation bedauert, sondern die Brutalität, mit der beides sich vollzog. Wenn es geschehen mußte, hätte es anders geschehen müssen.
And maybe Marlon Brando
Will be there by the fire
We’ll sit and talk about Hollywood
And the good things there for hire
Like the Astrodome and the first teepee
Marlon Brando, Pocahontas and me.
Die letzte Strophe ist die schönste, weil sie dem Text jene Leichtigkeit einhaucht, die längst in der Melodie liegt. Wenn wir schon bei Versöhnung sind, können wir da nicht auch Marlon Brando mit in die Runde nehmen, weil er im Western so toll spielt? Sie säßen dann am Lagerfeuer und würden über Hollywood plaudern, über den schönen Tand, den es dort zum vergänglichen Vergnügen gibt, Kinofilme zum Beispiel, und den glücklichen Ausgang von Geschichten. Bestimmt würden sie auch darüber reden, was mit den Indianern geschehen und nicht wiedergutzumachen ist. Und Pocahontas, die Indianerprinzessin, wäre ebenfalls dabei, und das wirkliche Indianien machte es sich neben dem projizierten bequem und nähme den Projizierenden mit in die Runde: Marlon Brando, Pocahontas und ich am Lagerfeuer – ein witzigeres, bescheideneres, selbstironischeres Bild der Utopie ließe sich nicht malen.
Die Begeisterung für Pocahontas hat lange angehalten. Sie setzte ein, kurz nachdem meine Tochter die Koliken überwunden hatte, und legte sich erst gegen Ende unseres Aufenthaltes im Ausland, wo ich beruflich zu tun hatte. Fast fünf Monate lang waren Pocahontas und Human Highway, das auf Year Of The Horse gleich im Anschluß folgt, die Musik, zu der sie einschlief. Die Kombination der beiden Stücke scheint sich vollständig an elterlichen Belangen orientiert zu haben. Für einen Vater wie mich, der seiner Tochter etwas Gutes tun und sie den Rock ’n’ Roll fühlen lassen möchte, gleichzeitig aber gezwungen ist, sie zu Bett zu bringen, könnte die Abfolge nicht besser gewählt sein, denn nachdem wir zu Pocahontas den am Tag angestauten Emotionen zu ihrem Recht verholfen hatten, fing das akustische Gedudel von Human Highway uns auf, schunkelte es uns beide in zärtliche Träume und sie weiter in den Schlaf. Je nachdem, wie aufgekratzt oder erschöpft sie war, benötigten wir mehrere Durchgänge, damit sie bettreif wurde, und oft – wenn ich das Gefühl hatte, daß sie den Punkt, von dem an der Schlaf sich Bahn bricht, erreicht hatte, aber noch einen kleinen Anstoß brauchte, um ihn zu passieren – wiederholte ich nur Human Highway. Meine Frau konnte es nicht fassen, wie perfekt das allabendliche Musikprogramm seine Funktion selbst in Ausnahmesituationen, bei Krankheiten oder auf Reisen, erfüllte, zumal ihre Versuche mit afrikanischen Weisen oder anderem ethnologischem Material regelmäßig scheiterten oder sich zumindest endlos hinzogen, bis sie endlich von ihrem multikulturellen Starrsinn ließ. Mit Neil Young hat sie es nie probiert. Es herrschte, obwohl nie ausgesprochen, von Anfang an ein Einverständnis darüber, daß Neil Young ein Code bleibt, mit dem meine Tochter und ich kommunizieren. Meine Frau hätte auch kein Gefühl dafür gehabt, welches Stück in welchem Zustand notwendig war, und sie hätte wohl auch niemals die Geduld aufgebracht, über einen solch langen Zeitraum hinweg immer wieder dieselben paar Noten zu hören. Und meine Tochter bestand nun einmal zwischen ihrem dritten und sechsten Monat auf Pocahontas und gerade auch auf Human Highway, obwohl ich von letzterem selbst keineswegs angetan und es eher dem Zufall zu verdanken war, daß wir überhaupt darauf stießen. Es lag einfach daran, daß das Stück auf Pocahontas folgt. Wahrscheinlich gibt es in solchen, den (vor dem Einschlafen) letzten Dingen keine Zufälle. So viele andere von Neil Youngs langsamen, sanften Stücken sind mir näher, und mir selbst hätte ich Human Highway, weil es zu simpel und gleichzeitig nicht simpel genug ist, nicht in solcher Regelmäßigkeit zugemutet, aber in Verbindung mit dem vorangegangenen Pocahontas und meiner müden Tochter auf dem Arm war es doch wundervoll. Zu der Zeit hatte meine Tochter übrigens die Position, in der sie anfänglich Neil Young zu hören pflegte, längst aufgegeben. Sie lag nicht mehr seitlich nach vorne blickend auf meinen Händen, sondern vergrub ihren Kopf entweder in der Kuhle zwischen Brustkorb und Schultergelenk oder an meinem Hals.
Als problematisch erwies sich im Ausland – ich hätte es mir vorher denken können –, daß ich keine vernünftige Anlage zur Verfügung hatte und die CD in den Laptop legen mußte, dessen Lautsprecher immerhin so schlecht nicht sind. Andere Stücke Neil Youngs kann man unter Umständen, wenn anders es sich nicht einrichten läßt, leise hören – Pocahontas gehört in der Live-Version nicht zu ihnen. Aber weil sie es bereits gut kannte, bevor wir für drei Monate in ein fernes Ausland flogen, hat es zunächst doch geklappt. Mein Laptop war laut genug, um die Erinnerung, nein: die akustische Vorstellungskraft wachzurufen, und das genügte in den ersten sechs, sieben Wochen. Gegen Ende unseres Aufenthaltes bemerkte ich jedoch Abnutzungserscheinungen. Das abendliche Klangerlebnis verlor seine Einzigartigkeit und Magie. In den letzten zwei oder drei Wochen unseres Aufenthaltes schob ich Year Of The Horse nur noch sporadisch in den Laptop. Rein akustische Stücke, in denen die Stimme Neil Youngs mehr im Vordergrund stand, waren noch eher geeignet, meiner Tochter zu gefallen. Es war eine schwierige Zeit, wie man sich inzwischen wohl ausmalen kann, die zweite Krise im Verhältnis zur übrigen Welt und die erste leichte Enttäuschung im Verhältnis zu Neil Young. Dieser büßte seine Wirkung nicht völlig ein, doch zauberte er, so leise gestellt, nicht mehr.
Zum Glück kehrten wir bald schon nach Deutschland zurück; ich hatte unseren Flug sogar eigens umgebucht, um eine Woche früher wieder bei Pocahontas zu sein. Der Moment, da ich am Tag nach unserer Ankunft (ich wollte nichts überstürzen) mit meiner Tochter im Arbeitszimmer vor der Anlage stand, war ein ganz großer. Ich legte Year Of The Horse in das Gerät, tippte den sechsten Titel an und schob den Lautstärkeregler des Verstärkers nach rechts. Da war es, aus satten, zufriedenen Boxen, die meine Tochter damals noch nicht mit ihren Fingernägeln ruiniert hatte: die quietschende Rückkopplung, die trillernde Fanfare und der unglaubliche Rhythmus, nicht zu schnell, nicht zu langsam, zu dieser durchdringenden, etwas leiernden Melodie, die Neil Young klirrend auf seiner Gitarre spielt. Und dann begann er zu singen. In diesem Nu, da sich Neil Youngs Stimme zum »Aurora Borealis« erhob, wirklich erst dann waren wir endlich zu Hause angelangt. Diese Erfahrung war so stark, daß sie später einmal in mein akademisches Schaffen einfloß. Ich mußte einen Vortrag zum Begriff Heimat halten, und so versuchte ich, der für dieses Thema über keinerlei Vorbildung verfügte, dem aufgeklärten Publikum sowie den übrigen Experten für Trans-, Multi- und Postnationales zu erklären, daß ich mich heimisch fühle, wo Neil Young gespielt wird. Sie fanden das, glaube ich, nicht kompliziert genug. Hätte ich eine literaturwissenschaftliche Analyse von Neil Youngs Texten über den Verlust der Geborgenheit und die Fremdheit im Leben hinzugefügt, vielleicht wären sie zufrieden gewesen.
Ich habe selten so ausgiebig über Neil Youngs Texte nachgedacht wie in den letzten Tagen über Pocahontas oder zuvor über The Last Trip To Tulsa. Bei den Liedern waren es meist einzelne Verse oder Strophen, die ich aufschnappte, reflektierte, mir merkte. Es kam vor, daß ich ein Wort oder einen Satz falsch verstand und mich dadurch zu abenteuerlichen Deutungen verstieg. »Pocahontas« zum Beispiel war mir als Begriff völlig schleierhaft, bis ich mir das Booklet vornahm, den Text studierte, ein Lexikon zu Hilfe holte und erfuhr, daß es sich um eine berühmte Indianerprinzessin, eine historische Figur also, handelt. Ich hatte wohl angenommen, daß Pocahontas eine Frau sei, die mit den Indianern in irgendeiner Verbindung stand, aber um wen es sich handelte und wie genau sie hieß, das konnte ich nur vermuten und beflügelte eben deshalb meine Phantasie. Statt Pocahontas hörte ich immer etwas wie Procol Harum, den Namen dieser englischen Band, was ich mir nicht erklären konnte, so daß das Wort mir zum Synonym für die Schönheit und das Geheimnis einer fernen Frau geriet. »With my Indian Rug and a pipe to share« mißverstand ich als »With my Indian Love and a fight to share«, was das literarische Ich natürlich in einem völlig anderen Licht erscheinen läßt und zu ganz neuartigen Deutungen Anlaß gibt, die ich dem geneigten Leser aber vorenthalten möchte, da es selbst mir übertrieben erscheint, ihn mit den Interpretationen solcher Verse zu behelligen, die Neil Young gar nicht verfaßt hat (es handelt sich hier schließlich nicht um ein Buch über mich). Im selben Lied blieb »Aurora Borealis« eine seltsam klingende Buchstabenfolge, ähnlich wie die Siglen am Anfang mancher Koransuren, und statt »teepee« hörte ich »TV«: die guten Dinge, die es in Hollywood zum Ausleihen gibt, wie den Astrodome und den ersten Fernseher – auch nicht schlecht. Ganz genau verstand ich allerdings die einzige Zeile, die zweimal auftaucht: »In the homeland we’ve never seen.« Zusammen mit der Vorstellung von Marlon Brando, der sagenumwoben schönen Indianerin und Neil Young am Lagerfeuer reichte das bereits, um dem Text einen lebenslangen Platz in meinem Gedächtnis zu sichern. Wenn ich damals meiner Tochter Pocahontas vorsang, waren es immer die erste und die letzte Strophe, die ich in Ausschnitten und fehlerhaft vortrug, immer wieder die Heimat, die wir nie gesehen haben, und das Lagerfeuer, das am Ende eines schlechten Tages oder Lebens ein wenig zu versöhnen vermag, weil es viel weniger als eine Versöhnung ist, ein erschöpfter Frieden allenfalls.
Noch Monate, nachdem ich meine Tochter kennengelernt hatte, gab es bis auf Are You Ready For The Country? kein Lied, dessen Text ich vollständig auswendig beherrschte. Das habe ich erst gemerkt, als ich ihr Neil Young vorsingen wollte, und es überraschte mich selbst. Von nennenswertem Nachteil war das nicht, denn man kommt, wie ich herausgefunden habe, mit ein paar Zeilen aus Sugar Mountain, Only Love Can Break Your Heart oder Lotta Love schon ziemlich weit, sollte gerade keine Anlage zur Hand und dennoch ein Baby zu beruhigen sein. Kleinen Schreihälsen scheint die Wiederholung der immer gleichen paar Akkorde und Worte nicht aufzustoßen, im Gegenteil (vermutlich bin ich nicht der erste, dem das auffällt). Are You Ready For The Country? mochte ich meiner Tochter nie vorsingen, ich halte es für eines der überflüssigen Stücke Neil Youngs. Daß ich den Text behalten habe, ist erstaunlich. Das Lied stammt von seiner ersten Platte, die ich je bewußt gehört habe, nämlich von Harvest, die mein Bruder als einzige von Neil Young besaß. Es ist bis heute sein populärstes Album, das einzige, mit dem er es je zur Nummer eins der Charts brachte; mit äußerstem Befremden mußte ich konstatieren, daß ein Stück daraus, Heart Of Gold, in den Flugzeugen von Swissair als Hintergrundmusik Fron tat (mögen sie pleite gehen dafür). Meine Sympathien für Harvest waren da bereits Jahre verflogen; lange Zeit war es mir sogar schier unerträglich, die Platte zu hören, weil sie so soft ist und die übrige Welt von Neil Young nur dieses eine Album zu kennen scheint. Gleich, wo man hinkommt, wird das Bekenntnis zu ihm mit der Bemerkung konfrontiert, das sei doch der mit Harvest, woraufhin die Falschen ihre Zustimmung bekunden und die Richtigen einen als Anhänger handtuchweicher Mädchenmusik aufziehen oder, schlimmer noch, im stillen als solchen abtun. Wenn sie spotten, kann ich mich unter Hinweis auf die zahlreichen Kracher Neil Youngs und seine große Anhängerschaft unter Punk-, Grunge- und jeder neuen Generation von Independentmusikern, die schon mehrere Platten zu seinen Ehren aufgenommen haben und ihn überhaupt für den Allergrößten, für ihren Paten halten, wehren. Aber wenn sie ihre Irritation für sich behalten, stehe ich wie bedeppert da.
Jedenfalls gefiel mir damals, als ich Harvest im Zimmer meines Bruders hörte, Are You Ready For The Country? besonders gut. Auch wenn ich heute die Banalität des Stückes deutlich wahrnehme und es zu den schwächeren eines ohnehin nicht herausragenden Albums zähle, spricht die Vorliebe für mich, finde ich, denn es ist der einzige Titel auf Harvest, der nach Rock ’n’ Roll klingt. Mit den Jahren habe ich zwar herausgefunden, daß Are You Ready For The Country? eine ziemlich abgefederte Fassung dessen bot, was in der Welt der Rockmusik möglich ist, und sich anhört, als würde eine Country-Band versuchen, mal so richtig die Post abgehen zu lassen, aber seinerzeit kannte ich nicht so viel anderes. Meine Brüder besaßen Platten von Leonard Cohen, Genesis, Yes oder Pink Floyd. Letztere mögen wohl auch härtere Töne beherrschen, aber so ein einfach gestrickter, geradliniger Rock ’n’ Roll ist deren Sache nicht (es gab einzelne Titel von Pink Floyd, die in die Richtung gehen, und die erfreuten sich dementsprechend meiner besonderen Wertschätzung als Kind).
Ich kann nicht sagen, daß ich damals, ich war acht oder neun Jahre alt, Neil Young schon verfallen war; ich hatte immer Phasen, in denen ich einzelne Alben oder Gruppen mochte, und im nachhinein muß ich gestehen, daß es insgesamt tatsächlich eher Pink Floyd waren, die mich durch diese Phase zwischen Kindheit und Pubertät begleiteten. Bis mir an meinem zwölften Geburtstag die Klassenkameraden gemeinsam The Wall schenkten (das wohl am häufigsten, nämlich vier- bis fünfmal täglich vollständig genutzte Geschenk, das ich je erhalten sollte), war meine absolute Lieblingsplatte The Dark Side Of The Moon. Unter all den Gruppen, die ich bis zu meinem Abitur hörte, sind Pink Floyd neben Led Zeppelin und natürlich Neil Young die einzigen, die sich meine Verehrung bewahrt haben (Pink Floyd mit Roger Waters, versteht sich, nicht die Greise, die in der Generation Golf unter diesem Titel firmieren). Die alles andere verzehrende Liebe zu Neil Young setzte später ein, mit vierzehn etwa, als ich auf Rust Never Sleeps stieß, was einen Quantensprung in meiner nicht bloß musikalischen Bewußtseinswerdung hervorrufen sollte; bis dahin war er einer von mehreren, sich ablösenden Favoriten. Jetzt, da ich das schreibe, fällt mir ein, daß ich mir meine eigenen wöchentlichen oder monatlichen (an die Frequenz erinnere ich mich nicht mehr) Top Ten aufzustellen pflegte, die ich auf sorgfältig gesammelten Zetteln vierfarbig festhielt. Ich sehe auch der Tatsache ins Auge, daß sich Mike Oldfield und manch andere Räucherstäbchen in diese Liste verirrten, sogar über einen sehr langen Zeitraum hinweg. Den Spitzenplatz machten allerdings durchweg Neil Young und Pink Floyd aus, bevor sich ersterer endgültig durchsetzte und ich die Liste dann auch bald aufgab, weil sich auf den vorderen Rängen ohnehin nichts mehr tat.
Es gab also immer Phasen, in denen eine Platte oder eine Band mein Leben dominierte, so wie ein junger Mann sich oft verliebt, bevor er sich auf eine Frau einläßt und Kinder zeugt. Anders als in der erotischen Liebe hatte ich in der musikalischen allerdings niemals das Gefühl, die Monogamie sei eine Konvention, die, wenn überhaupt, aus pragmatischen Gründen zu befolgen sei. Und eine dieser Phasen meiner musikalischen Casanoverei, eine sehr frühe, bestand eben aus Harvest. Ich hörte die Platte rauf und runter, sooft mein Bruder sein Zimmer verließ. Wenn er allein im Zimmer war, wollte er immer nur lernen, aber hatte er Freunde bei sich, schlich ich mich zum Plattenspieler und legte klammheimlich Harvest