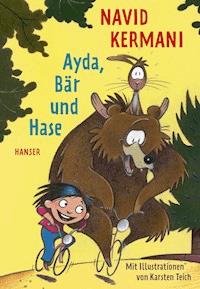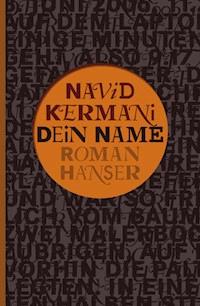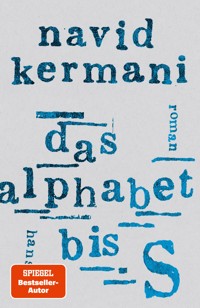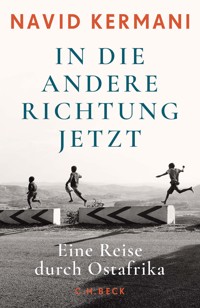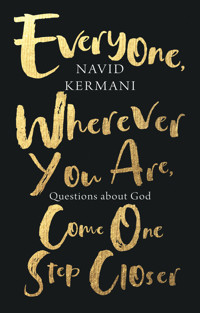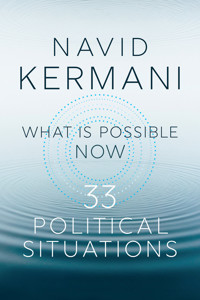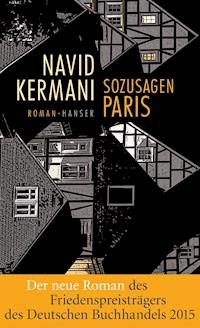
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Schriftsteller hat einen Roman geschrieben über die große Liebe seiner Jugend. Nach einer Lesung steht eine Frau vor ihm, die er nicht erkennt. Aber sie ist es trotzdem. Er ist jetzt Autor, sie ist seine Romanfigur – und aus dem jungen Mädchen von damals ist ganz offensichtlich eine interessante, auch anziehende, aber verheiratete Frau geworden. Die Situation wird etwas komisch: Man setzt sich zusammen, trinkt ein Glas Wein, redet über französische Liebesromane, fragt sich, was man von der Liebe erwartet, wenn man älter geworden ist, Juttas Mann sitzt im Nebenzimmer – wie soll das alles enden? Navid Kermani schreibt einen Liebesroman ganz eigener Art, tiefgründig, überraschend, witzig.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Ein junges Mädchen wie damals ist sie natürlich nicht mehr, aber der Erzähler ist ja auch nicht mehr der leidenschaftliche, etwas naive junge Mann, der so unsterblich in sie verliebt war. Er ist jetzt Autor, und sie ist seine Romanfigur geworden – und ganz offensichtlich eine interessante, auch anziehende, aber verheiratete Frau. Was wird aus einer großen Liebe zwischen jungen Leuten, wenn man sich dreißig Jahre später wiedertrifft? Und was wird überhaupt aus der Liebe in unserer Welt, die sich wohl schneller verändert als die Menschen, die in ihr leben. Navid Kermani schreibt einen Liebesroman ganz eigener Art, tiefgründig, überraschend, witzig. Er erzählt von Menschen, die alles über sich zu wissen glauben und plötzlich ahnen, dass sie sich noch gar nicht kennen. Ist die Sehnsucht, die unauslöschliche, ein Elixier, oder ist sie ein Gift?
Hanser E-Book
Navid Kermani
Sozusagen Paris
– Roman –
Carl Hanser Verlag
ISBN 978-3-446-25415-2
© 2016 Carl Hanser Verlag München
Umschlag: Peter-Andreas Hassiepen
Bild: © Teka77 / Thinkstock
Satz im Verlag
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de .
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, www.le-tex.de
Sozusagen Paris
– Aber nicht für Jutta.
Ich schaue zu der Frau hoch, die mir das Buch zum Signieren auf den Tisch gelegt hat, Anfang, Mitte Vierzig, taxiere ich sie, auffallend klein, schlichtes, vermutlich nicht billiges Kleid, das etwas zu eng geschnitten ist, der Leib zwar grazil, aber doch ein Pölsterchen vorm Bauch, die glatten blonden Haare wie mit dem Lineal auf Höhe des Kinns abgeschnitten, so daß ihr Kopf runder wirkt, als er wohl ist, und ihr Hals noch zarter, ja so fein wie ein Blumenstiel, geht mir ein Bild durch den Kopf, das der Lektor abgeschmackt finden wird, um die braunen Augen auffallend viele Linien allerdings, Falten würde ich’s nicht nennen, Krähenfüße nennt man es wohl, also älter jedenfalls, Ende Vierzig vielleicht und dennoch mädchenhaft, ihr Blick von mildem, beinah schon geschwisterlichem Spott, seltsam vertraut.
– Wie bitte?
– Schreib bloß nicht für Jutta, bekräftigt die Frau.
Unmittelbar nach Lesungen bin ich grundsätzlich verwirrt, erkenne selbst Freunde nicht wieder oder kann mich nicht auf ihren Namen besinnen. Auch jetzt dauert es, bis ich mich an das Lächeln erinnere, das die Lippen wie in Zeitlupe in die Länge zieht und die Wangen rund wie Aprikosen macht, es dauert – ich kann die Zeit nicht abschätzen – zehn Sekunden?, fünfzehn, hinter der Frau noch zehn, fünfzehn andere Menschen, die sich zum Signieren angestellt haben. Die Lesung lief ungewöhnlich gut; ohne einmal aufzusehen, spürte ich, wie die Zuhörer mit mir in der Geschichte versanken, wie ich jetzt ohne Hinsehen spüre oder mir einbilde, daß die Zuschauer meinen offenen Mund und die unruhigen Pupillen bemerken, mein nicht recht funktionierender Verstand, der das Lächeln hektisch einem bestimmten Punkt meines Lebens zuzuordnen sucht und noch immer nicht die Nase registriert hat, die mit der leicht nach oben gewölbten Spitze ein hinreichend deutliches Erkennungszeichen ist. Mit einer Sprungschanze verglich ich ihren Nasenrücken in dem Roman, aus dem ich heute abend las.
Später wird sie meine Verwirrung verspotten und werde ich mich für meine Blödheit entschuldigen; sie wird unsere Liebe herunterspielen, aber ich werde daran festhalten, mich dreißig Jahre lang nach ihr gesehnt und deshalb mehr als nur einen Brief, nämlich ein ganzes Buch geschrieben zu haben. Alle Tage, werde ich sagen, alle Tage hätte ich gehofft, im Briefkasten ihre Antwort zu finden, und bei jeder Lesung nach ihr Ausschau gehalten. Als sie jedoch vor mir steht und sogar den Namen nennt, den ich für sie erfand, erkenne ich sie zehn oder fünfzehn Sekunden lang nicht, so daß auch die zehn oder fünfzehn Menschen hinter ihr merken müssen, daß etwas nicht stimmt. Endlich springe ich auf und stammle, daß ich sie doch irgendwie hätte nennen müssen.
– Deinen richtigen Namen zu schreiben, hab ich mich nicht getraut.
– Das hätte ich dir auch nicht geraten, sagt sie in ihrem betont erwachsenen, ironisch lehrerhaften Ton, der allein mich dreißig Jahre zurückversetzt, und rollt die Wangen noch weiter auf, so daß die Zähne zum Vorschein kommen: makellos. Ich hatte schon damit gerechnet, daß sie die Lücke, durch die ich vor dreißig Jahren am liebsten verschwunden wäre, längst wegoperiert hat.
Nicht allein aus Höflichkeit gegenüber den Menschen, die in der Schlange warten, frage ich, ohne sie eigentlich begrüßt zu haben, ob sie nachher noch Zeit habe; ich muß mich sammeln, merke ich, muß überhaupt erst die Worte wiederfinden, die ich mir für unsere Begegnung bis in die Nebensätze zurechtgelegt hatte. Sie nickt und tritt sofort aus meinem Blickfeld, wartet im Foyer oder vielleicht nur einen Schritt hinter mir. Während ich fremden Menschen meinen Namen ins Buch schreibe, vergleiche ich die Frau, die nicht Jutta genannt werden möchte, ein ums andere Mal mit dem Mädchen, das ich in der Raucherecke angehimmelt.
Sicher fürchtete ich ihren Zorn, da ich sie ungefragt zu einer Romanfigur gemacht hatte, und war darauf gefaßt, daß sie mir meine Erinnerungen als bloße Einbildungen um die Ohren schlägt. Allein, das war nicht der ganze, nicht einmal der hauptsächliche Grund der Bangnis, mit der ich an das zugleich so sehr ersehnte Wiedersehen dachte. Mehr als alles andere fürchtete ich die Zeit. Wenn ich Freunde nach Jahrzehnten treffe, stemme ich mich inzwischen mechanisch gegen die Melancholie, in ihrem Gesicht meine eigene Vergänglichkeit gespiegelt zu sehen. Auch die Schönste des Schulhofs stellte ich mir, um der Enttäuschung vorzubeugen, mit allen Schattierungen des Alters vor, stämmig und faltig geworden, die Lippen brüchig, die Mundwinkel nach unten gerutscht und die Backen wie ungebügelte Wäsche auf der Leine, schlecht gekleidet noch dazu und längst nicht so klug, wie sie dem Fünfzehnjährigen schien, eine vergrämte, ältere Frau, die nichts mit der lebensfrohen Abiturientin gemein hat als den Namen und allenfalls äußere Merkmale wie die Nase, die sich zur Spitze hin leicht nach oben wölbt. Als Proust-Leser rufe ich mir, wenn ich mich zum Signieren an den Büchertisch setze, beinah rituell die Matinee am Ende der Recherche ins Bewußtsein, wo der Romanschreiber nach Jahrzehnten in die Welt der Guermantes zurückkehrt und auf den ersten Blick keinen seiner Bekannten erkennt, weil sie wie auf einem Kostümfest eine Maske angelegt zu haben scheinen, durch starkes Pudern vor allem, das sie völlig verändert. Die Männer machen noch die vertrauten Mienen, Gesten, Scherze, scheinen sich jedoch weiße Bärte umgehängt, die Füße mit bleiernen Sohlen beschwert und ihr Gesicht mit Runzeln, die Brauen mit struppigen Haaren ausstaffiert zu haben. Und erst die Frauen: Ganze Epochen mußten abgerollt sein, damit sich in der Geologie ihres Gesichts solche Revolutionen vollziehen konnten, seien es Erosionen längs einer Nase, sei es eine Anschwemmung am Gestade der Backen, die mit undurchsichtigen, zahllose Brechungen erzeugenden Massen in das ganze Gesicht einbrach. »Man nannte mir einen Namen, und ich war bestürzt, als ich verstand, daß er sowohl der blonden Walzertänzerin gehörte, die ich früher gekannt hatte, als auch der grobgliedrigen Dame mit weißem Haar, die bleischwer an mir vorüberschritt.«
Es bedeutet eine enorme Anstrengung, einen alten Kameraden oder eine frühe Geliebte gleichzeitig mit den Augen und mit dem Gedächtnis zu betrachten, und niemand weiß um die Anstrengung besser als ein Romanschreiber oder sonst ein fahrender Künstler, wird er doch immer wieder einmal von einem Fremden überrascht, der behauptet, ein Freund zu sein. Nicht bedenkt der Fremde, daß er selber sich spätestens mit dem Kauf der Eintrittskarte auf die Begegnung eingestellt hat, von den Plakaten ein heutiges Photo kennt und während der Lesung unmerklich mit den Linien vertraut geworden ist, die dem Romanschreiber ins Gesicht gemalt, die Haare, die ihm ausgerupft, die Polster, die um den Bauch gebunden worden sind. Mir hingegen widerfährt während der Sekunden oder gelegentlich sogar vollen Minuten, die das Wiedererkennen dauert, jedesmal die Matinee, die Proust gegen Ende der Recherche unvergeßlich beschreibt: »Nun begriff ich, was das Alter war – das Alter, das unter allen Realitäten des Lebens vielleicht diejenige ist, von der wir uns am längsten eine lediglich abstrakte Vorstellung machen: Wir blicken nach dem Kalender, setzen das Datum auf unsere Briefe, sehen zu, wie unsere Freunde und selbst die Kinder unserer Freunde sich verheiraten, ohne daß wir verstehen – vielleicht weil wir Angst haben, vielleicht weil wir zu träge sind –, was all das zu bedeuten hat. Aber endlich kommt der Tag, an dem wir eine unbekannte Silhouette wahrnehmen, die uns lehrt, daß wir in einer neuen Welt leben; der Tag, an dem der Enkel einer Freundin, ein junger Mann, den wir instinktiv wie einen Kameraden behandeln, lächelt, als ob wir uns über ihn lustig machen wollten – weil wir für ihn wie ein Großvater sind. Ich begriff nun, was der Tod, die Liebe, die Freuden des Geistes, der Nutzen des Leids, die Berufung und dergleichen bedeuteten. Denn wenn auch die Namen für mich ihre Individualität verloren hatten, enthüllten die Wörter mir doch ihren wahren Sinn. Die Schönheit der Bilder wohnt hinter den Dingen, die der Ideen davor. Deshalb hört die Schönheit der Bilder auf, uns in Erstaunen zu setzen, wenn wir zu den Dingen vorgedrungen sind, während man die Schönheit der Dinge erst begreift, wenn man diese hinter sich gelassen hat.«
Wie überrascht bin ich, Jutta anders zwar, aber dreißig Jahre später genauso anziehend zu finden, zierlich geworden, selbst die Wölbung des Bauchs zart, die Schultern so schmal, daß ich sie nicht mehr nur aus Erregung, sondern beinah aus einer Art Schutzinstinkt, mehr freundschaftlich als wieder sekundenverliebt in den Arm nehmen möchte; und wie sehr erleichtert mich die fröhliche, mir erkennbar zugetane Ironie, mit der sie mich angesprochen hat. Lag Proust etwa falsch? Obwohl ich weiß, daß es nur ein Hirngespinst ist, bezwingt mich der Wunsch, daß sie genauso einsam sei, sagen wir geschieden wie ich, Kinder haben mag oder nicht, und unsere Schulhofliebe sich doch noch als Vorsehung erweise. Ich male mir den restlichen Abend aus, den wir zusammen verbringen werden, die Nacht in ihrer Wohnung oder meinem Hotelzimmer, stelle mir vor, in ihrem Arm aufzuwachen, nach dem Frühstück durchs Städtchen zu schlendern, in das es sie verschlagen hat, buchstabiere bereits die Telefonate und Briefe aus, mit denen wir in Verbindung bleiben, das Wiedersehen und die Liebe, die nicht mehr in einer Sekunde entsteht, um für immer zu halten.
Ein ums andere Mal nehme ich mir vor, mich auf die Menschen zu konzentrieren, die mir den Roman hinhalten, aus dem ich heute abend las, und lasse mich auf kurze Gespräche ein, um die Gedanken in den Griff zu bekommen, die verrückt spielen. Als ich das letzte Buch signiert habe, überwiegt bereits die Sorge, nach dreißig Jahren immer noch der Junge zu sein, der die Liebe wie eine Prüfung vergeigt, so daß ich mir halb wünsche, sie sei längst nach Hause gegangen und ich behielte das Wiedersehen als süßen Traum in Erinnerung. Da ich mich vergeblich nach ihr umschaue, springe ich dennoch von der Bühne, um ins Foyer zu eilen. Erst der Lektor wird auf den Gedanken kommen, daß es mir mit Jutta ergeht wie dem Romanschreiber der Recherche mit Odette: »Man geht von der Vorstellung aus, die Leute seien die gleichen geblieben, und da findet man sie alt. Wenn man aber von der Vorstellung ausgeht, daß sie alt sind, findet man sie wieder und findet sie so übel nicht.«
Der Kulturdezernent hält mich im Foyer mit der Bitte auf, rasch das Vertragliche zu regeln, bevor wir essen gehen, da stellen sich schon jemand Drittes und Viertes zu uns und bestürmen mich mit Fragen, die ich gewissenhaft beantworte, während meine Augen die Menschenmenge absuchen, die sich mit Brezeln und Wein erfrischt. Auch am Büchertisch, wo ich Jutta, um bei dem Namen ein für allemal zu bleiben, am ehesten vermute, erblicke ich sie nicht. Ich bitte um Entschuldigung, daß ich nach einer alten Bekannten schauen müsse, die vor der Tür wartet, ich sei in einer Minute zurück.
– Ihre Bekannte kann gern zum Essen mitkommen, ruft der Dezernent mir nach, der auch für den Fremdenverkehr zuständig ist.
Natürlich steht mir der Sinn danach, mich bei Jutta einzuhaken und spazierenzugehen, doch möchte ich die Gastgeber nicht verärgern, die mir mehr und aufmerksamere Zuhörer beschert haben, als ich es in einem solchen Städtchen erwarten durfte. Ich müßte mich mit Migräne oder Rückenschmerzen herausreden und würde sie dennoch betrübt zurücklassen. Außerdem hülfe es vielleicht über meine Beklommenheit hinweg, wenn ich mich mit Jutta zunächst in größerer Runde unterhielte, fällt mir noch ein zweites Argument ein, sie mit ins Restaurant zu nehmen. Als ich sie auf dem Bürgersteig vor der Mehrzweckhalle entdecke, betrachte ich sie genauer als auf den ersten Blick. Rasch wird mir klar, daß ich ohnehin nicht den Mut hätte, sie ungefragt an der Hand zu nehmen und davonzumarschieren. Auch bei Odette ist es ja weit mehr als nur eine negative Erwartung, womit sich der Romanschreiber gegen die Enttäuschung gewappnet hat, werde ich dem Lektor entgegenhalten, der an allem was auszusetzen hat: Ihr Aussehen scheint das Gesetz der Zeitlichkeit herauszufordern, »wundersamer als der Einspruch, den die Fortdauer des Radiums gegen die Naturgesetze erhebt«. Zum Glück ist Jutta selbst im Gespräch mit irgendwelchen Leuten, älter als wir, also vermutlich nicht ihr Mann oder Geliebter darunter, so daß ich ihr nur die Einladung hineinrufe, mit uns essen zu gehen; die Veranstalter hätten einen Tisch reserviert, der obligaten Geselligkeit könne ich mich schlecht entziehen. Als hätte sie nichts anderes erwartet, willigt Jutta mit einem Kopfnicken ein.
Während ich mich gesenkten Blicks, um nicht angesprochen zu werden, zurück zum Kulturdezernenten durchschlage, frage ich mich, ob das Bild, das Jutta sich von mir macht, nicht genauso ein Produkt ihrer Einbildungskraft ist wie mein dreißigjähriges Sehnen nach ihr. Denn so unwirklich es mir selbst jedesmal vorkommt und so eitel die Erwähnung ist, so gehört es doch zu den Umständen, unter denen wir uns wiedersehen, daß ich etwas hergebe, wenn ich als weitgereister Schriftsteller, dessen Bücher von den überregionalen Zeitungen besprochen und sogar im Fernsehen hochgehalten werden, in einem kleinen Städtchen lese. Es ist nicht die Prominenz allein – jede Wetteransagerin eines Regionalsenders ist bekannter und wird von mehr Menschen bewundert als ein Mitglied des literarischen Betriebs. Es ist mehr eine romantische Vorstellung des Dichters, die wir, wenn überhaupt bei irgendwem, dann bei dem ohnehin nicht zahlreichen, überwiegend weiblichen, älteren Lesepublikum eines Provinzstädtchens evozieren, und mit dem Dichter zugleich das Klischee des Antibürgers und Weltenbummlers, manchmal sogar des weitblickenden Denkers und tiefen Melancholikers, wenn die Damen zu lang auf die Plakate gestarrt haben, auf denen wir immer so ernst gucken. Und dann vermag ich offenbar auf dem Podium bisweilen eine Souveränität, aber noch viel überraschender: eine Heiterkeit, ja, angeblich sogar Weisheit auszustrahlen, die niemand je mit mir verbinden würde, der mich privat kennenlernt. Gerade auf Frauen, die vielleicht einmal von einem anderen Leben geträumt haben, wirkt das anziehend, bilde ich mir ein – also auch auf Jutta?
Daß ich es bin, der einem Klischee aufsitzt, nicht sie, wird mir erst auffallen, wenn ich den Roman schreibe, den der Leser in Händen hält: das der Provinzialin, deren Leben äußerlich unbewegt zwischen ihren vier Pfählen dahinläuft, neben einem vielbeschäftigten Mann und mit zwei tadellos erzogenen Kindern, doch ihr Herz bebt vor ungestillter, quälender Sehnsucht nach irgend etwas, das sie selbst nicht kennt, da sie fühlt, daß sie alt wird, alt, ohne anderes vom Leben gehabt zu haben als die langweilige gleichmäßige Tretmühle derselben Gänge, Begegnungen und Pflichten. »Immer dachte sie an Paris«, heißt es dann bei Guy de Maupassant. Die Konstellation ist geradezu klassisch in der französischen Literatur, der Großstadtdichter und die Gattin irgendeines Notars in der Provinz. Für Jutta bin ich sozusagen Paris! polstere ich mir die Wirklichkeit mit weichem Plüsch aus, während der Kulturdezernent die Fahrtkosten in das Abrechnungsformular einträgt: »Hübsch war sie noch immer. Das ruhige Dasein hatte sie frisch erhalten wie einen Winterapfel im verschlossenen Schrank. Aber in ihrem Inneren bohrten und stachelten immer wieder heftige, heiße Wünsche, die sie aus dem Gleichgewicht brachten; Sehnsucht nach der Großen Welt, Lebensgier überkam sie. Sie fragte sich unablässig, ob sie denn wirklich die Welt verlassen solle, ohne wenigstens einmal etwas von der süßen Sünde, diesem herrlichen Leben in Rausch und Wonne genossen und – wenigstens einmal! – sich in den Strudel der Lüste von Paris hineingestürzt zu haben.«
Den Leser, dem die Proust-Zitate womöglich noch passend erschienen, mag es irritieren, daß er sogleich auch noch auf Maupassant verwiesen wird. Ja, möchte ich sofort auf die Frage antworten, die ich mir als Leser ebenfalls stellen würde, ja, dahinter steckt ein Plan: Die französische Literatur des 19. und frühen 20.Jahrhunderts zieht sich durch den Roman, den der Leser in Händen hält; wie und warum, werden die folgenden Seiten hoffentlich schlüssiger erweisen, als es noch so viele Erklärungen vermöchten. Und nein, sei auch die nächste Frage beantwortet, die ich mir stellen würde, wenn ich den Roman läse, den ich schreiben werde (ein Blumenstrauß dem Lektor, damit er mir dieses Satzungetüm durchgehen läßt) – nein, natürlich sage ich nicht im Geist Proust auf und denke nicht einmal dem Namen nach an Maupassant, während ich aufgewühlt zwischen Jutta und dem Kulturdezernenten hin- und herlaufe. Selbst als Romanschreiber, der ich nun einmal bin, trage ich höchstens schattenhaft die Literaturgeschichte mit mir, wenn ich durchs Leben gehe. Auch was ich jetzt denke, da ich den Umschlag mit dem Lesungshonorar ungeöffnet in die Innentasche meines Sakkos stecke, ist ungleich ungeordneter, unreflektierter, uninformierter als der Gedankenstrom des Romans, den ich schreiben werde. Schließlich trage ich weder ein Diktaphon mit mir noch eine digitale Taschenbibliothek. Und weil die Unmittelbarkeit, die das Präsens sprachlich vorgibt, genauso konstruiert und notwendig Folge einer Bewußtwerdung ist wie jede andere literarische Form, kann ich auch gleich Zitate einstreuen, auf die spontan nicht einmal der beste Leser käme.
Auf dem kurzen Weg zum Gasthof durch das verlassen wirkende, aber abends um Viertel vor zehn wohl einfach schon schlafende Städtchen erfahre ich, daß Jutta Medizin studiert und danach auf dem Kontinent ihrer Lieblingslektüren gearbeitet hat, wie sie Lateinamerika wieder mit der sanften, wenn nicht süffisanten Ironie nennt, mit der sie unsere Vergangenheit grundsätzlich zu bedenken scheint. Dort verliebte sie sich in ihren späteren Mann, nein, keinen Guerillero, nimmt sie meine Frage vorweg, sondern einen Deutschen, der ihr Kollege war, die Trauung auf dem Standesamt von Quito mit …
– Stell dir vor! seufzt Jutta nostalgisch.
… buntgekleideten Indiofamilien auf dem Flur, die singend und klatschend gratulierten, als sie aus dem Zimmer traten.
– Wow, sage ich nur.
Als sie das zweite Kind erwarteten, zogen die Eheleute zurück nach Deutschland, arbeiteten zunächst im Krankenhaus, bevor seine Eltern die Praxis ausfindig machten, die groß genug für beide und dazu erschwinglich war. Lieber wären sie in der Stadt geblieben, klar, nur hatten sie im Ausland kein Kapital erwirtschaftet, an die Zukunft dachten sie ja schon aus ideologischen Gründen nicht. Inzwischen sind es drei Kinder, einundzwanzig, sechzehn und vierzehn Jahre, da sei an neuerlichen Aufbruch nicht zu denken, meint Jutta, wiewohl das Fernweh sie immer noch packe.
– Und wenn die Kinder aus dem Haus sind? frage ich.
– Ich glaube nicht, daß ich meinen Mann noch einmal von hier fortbewegen kann, sagt Jutta so, daß es keinesfalls kummervoll klingt.
Vielleicht möchte sie auch nur ihre Position als glücklich verheiratete Frau abstecken. Oder sie weiß, wie die Erzählung von Maupassant ausgeht: Der Großstadtdichter, den sich die Provinzialin so wild und leidenschaftlich imaginiert hat, schläft vor der Zeit ein! »Die Nacht verlief ruhig; nur das Ticken der Wanduhr störte den Frieden. Sie lag da, ohne sich zu rühren, und dachte an die Nächte in ihrem Ehebett. Und im gelben Schein einer chinesischen Laterne betrachtete sie – bohrenden Schmerz im Herzen – den auf dem Rücken liegenden kleinen dicken Mann neben ihr, dessen Kugelbauch bei jedem seiner Atemzüge gleich einem aufgeblasenen Luftballon die dünne Bettdecke mit emporschwellen ließ. Er schnarchte in allen Tönen wie eine Orgelpfeife: mit langen, schnaubenden Stößen und kurzen, komischen Röchellauten dazwischen. Seine zwanzig, dreißig Haare nutzten die Ruhe seiner Geistesstirn für sich aus und reckten sich widerborstig nach allen Seiten, als wollten sie sich von ihrer täglichen Zwangslage auf dem kahlen Schädel erholen, dessen öde Wüste sie verschleiern sollten. Und aus dem Winkel seines halboffenen Mundes sickerte in dünnen Fäden der Speichel heraus.«
Zu meiner Verblüffung muß ich niemandem am Tisch Jutta vorstellen und werde nicht ich, sondern wird sie nach unsrer Bekanntschaft befragt. Spontan oder nicht, schwindelt sie, daß wir uns während ihrer Zeit in Lateinamerika begegnet seien. So froh ich bin, das Geheimnis zu wahren, achte ich dennoch darauf, ob sie mir einen augenzwinkernden Blick zuwirft; sobald wir allein sind, möchte ich sie schon nach unserer Schulhofliebe fragen. Allein, Jutta blickt mich nicht an, das ganze Essen über nicht, obwohl ich neben ihr sitze. Als sei sie der Gast des Abends, führt sie das Gespräch, das sich nach zwei Bemerkungen zur Lesung, die mehr pflichtschuldig sind als höflich, auf die örtlichen Angelegenheiten konzentriert, die sensorgesteuerte Ampelschaltung, die an der Zufahrt zur Autobahn Wunder wirkt, den Unterrichtsausfall an der Grundschule, den zweiten Rasenplatz für den Fußballverein. Konsterniert nehme ich zur Kenntnis, daß die Lesung offenbar doch keinen so tiefen Eindruck hinterlassen hat, wie ich auf der Bühne wähnte; daß Jutta die Stupsnase hat, die der Roman hervorhebt, fällt schon gar niemandem auf.
Ich wünsche mir nach Lesungen ja stets, nicht weiter Auskunft geben zu müssen, und bin dennoch jedesmal enttäuscht, wenn mein Buch keinen mehr interessiert. In diesem Fall stört meine Anwesenheit regelrecht, denn ich nehme den Gästen rechts von mir die Sicht auf Jutta, die mehr und mehr das Wort führt; mein direkter Nachbar lehnt sich gar, als ich mich zum Essen vorbeuge, hinter meinem Rücken ungeniert auf meinen Stuhl, um sie besser zu sehen. Meinen eigenen Blick aufs Schnitzel geheftet, bereite ich mich innerlich auf das Fiasko vor, dem der Abend zustrebt. Auf alles war ich gefaßt, nur darauf nicht, daß sich innerhalb einer halben Stunde die Konstellation auf dem Schulhof wiederholen würde, sie umringt von Bekannten, ich schmachtend am Rand. Denn je öfter ich jetzt doch zu ihr luge, desto schöner erscheint sie mir, unglaublich selbstbewußt, zugewandt jedem, den sie anspricht, mit beneidenswertem Eifer, selbst wo es nur um die Ampelschaltung geht. Ich weiß nicht, wie viele Hinweise ich überhört habe, als ich endlich begreife, daß Jutta die Bürgermeisterin des Städtchens ist.
Später werde ich erfahren, daß sie im Unterschied zu den meisten, die vor dreißig Jahren die atomare Aufrüstung verhindern wollten, nie nachließ in ihrem Kampf für eine bessere Welt, sich für das Medizinstudium entschied, weil es die Linderung des Elends ganz unmittelbar versprach, und in Lateinamerika Ernst machte mit dem politischen Engagement. Zurück in Deutschland ließen ihr die Kinder und später die neue Praxis nicht viel Zeit, da lag es nahe, sich wenigstens um die örtlichen Mißstände zu kümmern. Über den Einsatz für die Kindertagesstätte und, ja, die Einführung getrennter Mülltonnen geriet sie in die lokale Politik, überwand sich und trat, um Veränderungen nicht nur zu fordern, sondern auch durchsetzen zu können, einer Partei bei. Durchaus als Aushängeschild, wie sie selbst sagen wird, als junge, berufstätige, in der Kirche aktive und – wie ich selbst hinzufügen werde, um mich sofort für das lausige Kompliment zu genieren – für Wahlplakate wie gemachte Frau, wurde sie bald schon für den Gemeinderat nominiert. War sie in Lateinamerika noch aufgegangen in ihrer Arbeit als Ärztin, befriedigte sie die Allgemeinmedizin, die sie mit ihrem Mann betrieb, immer weniger, das Hamsterrad von sechs Patienten die Stunde, in das die Krankenkassen sie zwangen, die Wochenenden, die sie mit Abrechnungen verbrachte, am Ende auch ihr eigener Zynismus, der sich einschlich, weil die meisten Patienten unter Wehwehchen litten im Vergleich zu den Elenden, die sie in Lateinamerika behandelt hatte. Hatte sie dort noch Leben gerettet, vertrieb sie hier oft nur gelangweilten Rentnern die Zeit. Die Nachmittagsbetreuung für die Kinder setzte sie bereits in der ersten Wahlperiode durch und die Mülltrennung ebenso.
Wir sind bereits beim Schnaps, da steckt das Gespräch weiter in der Kommunalpolitik fest; die Prognosen für die nächste Wahl, um die es seit dem Dessert geht, fallen am Tisch rundherum günstig aus für Jutta. Ich strenge mich an, nicht überheblich zu werden, und sage mir, meine Welt wirkt von außen genauso klein; schließlich unterhalten sich Schriftsteller beim Abendessen auch nur über die eigenen Angelegenheiten, Verkaufszahlen, Lesungshonorare, Rezensionen, die für jeden Außenstehenden noch belangloser sind. Doch wurmt mich weiterhin, daß die Lesung, die ich vorhin noch als Erfolg verbuchte, keine Stunde später in so fahles Licht gerückt ist. Daß niemandem das Stupsnäschen, die Haarfarbe und vor allem das Lächeln Juttas aufzufallen scheint, niemand neunzehn plus dreißig Jahre rechnet, spricht nicht für eine bleibende Erinnerung an meinen Roman. Ich kenne das schon, gerade von Städtchen wie diesem, die oft nicht einmal eine Buchhandlung haben: zwischen Frauenchor und Tourneetheater eingeladen zu werden, damit in der Jahresbilanz auch die Literatur steht; mit einem wie mir hat das Kulturamt zugleich die Integration abgebucht.
Gerade als die Trübsal mich so fest gepackt hat, daß sie die Nacht im obligaten Einzelzimmer anzuhalten verspricht, spüre ich unterm Tisch Juttas Hand auf meinem Handgelenk. Ob sie gemerkt hat, wie verloren ich mich in der Runde fühle? Es ist keine eigentlich zärtliche Berührung, ihre Finger bewegen sich nicht, es kommt mir eher wie eine Beruhigung vor und hat doch endlich auch etwas Verschwörerisches. Warte, scheint mir ihre Hand zu sagen, warte, bis wir hier raus sind, dann werden wir uns schon noch unterhalten. Ich schaue Jutta an, die aber auch nur einen harten Wahlkampf verspricht.
Auf der Runde, die wir ums Städtchen drehen, weil es keinen Ort zum Einkehren gibt, kommen wir an den beiden Rasenplätzen vorbei, der eine längsseitig mit schmaler Tribüne, der andere, neu gelegte, dann wohl fürs Training. Die Fußballmannschaft sei in die Regionalliga aufgestiegen, berichtet Jutta und nennt das einen Wahnsinn, weil in der Regionalliga sonst nur Städte ab dreißig- oder vierzigtausend Einwohnern spielen.
– Ist das schon der Profibereich? frage ich, um das Gespräch am Laufen zu halten.
– Nein, das nicht, antwortet Jutta, aber gefühlt war es die deutsche Meisterschaft.
Es ist nicht so, daß mich Juttas Elan kaltließe oder ich ihre Lebensleistung ignorierte, ihren Mut wie ihre Opferbereitschaft, nach Lateinamerika zu gehen, statt Karriere zu machen, der Neuanfang in Deutschland: eine Praxis aufbauen und drei Kinder großziehen, die mit Sicherheit Pfundskerle sind, der Erfolg als junge Politikerin in einem Städtchen, das bis dahin von älteren Männern regiert worden war. Als Romanschreiber würde ich am lautesten bejahen, daß man jeden Ort zum Mittelpunkt der Welt machen kann. Und umwerfend sieht Jutta außerdem aus, die Augen, die vom Licht der Straßenlaternen warm funkeln, die eigenwillige Nase, ihr filigraner Körper unruhig von zu viel Energie. Ich spüre nur, daß ich keine Verbindung zu ihr herstellen kann. Wir gehen nebeneinander so nah, daß sich immer wieder unsere Schultern berühren, wir tun wie Freunde, die sich zu lange nicht trafen, wir erzählen von unserem Leben, als sei es selbstverständlich, daß es den anderen angeht. Aber was uns tatsächlich verbindet, die eine Woche, in der wir jeden Nachmittag Eis auf dem Bahnhofsvorplatz aßen und drei Nächte miteinander verbrachten, das rührt sie nicht an, hat den Roman, aus dem ich heute abend las, mit keinem weiteren Wort erwähnt.
– Einer wie du wird das ja für unbedeutend halten, sagt Jutta, als sie nicht mehr mit meiner Erwiderung rechnen kann: Aber das mit dem Fußballplatz war wirklich eine große Sache für mich.
– Erzähl mir von dem Fußballplatz, erwidere ich so geschwind, daß ich selbst nicht genau weiß, ob die Bitte nur mein Desinteresse überspielt.
Als fahrender Künstler, der ich als Romanschreiber nun einmal auch bin, habe ich öfters mit Bürgermeistern unscheinbarer Gemeinden und kleinerer Städte zu tun: Ich bin eingeladen, mein Buch vorzustellen oder etwa die Festrede zum Neujahrsempfang zu halten; die Beamten sind bereits nach Hause gegangen, selbst das Vorzimmer ist leer, da empfängt mich der Bürgermeister in seinem Büro; ich bin neugierig, ich frage zur Freude des Bürgermeisters ein ums andere Mal nach, bis er einen kurzen Rundgang vorschlägt; das wär’ sehr schön, antworte ich artig, worauf der Bürgermeister zum Hörer greift und jemandem mitteilt, seiner Frau oder seinem Vorzimmer, in dem doch jemand auf den Feierabend wartet, daß er mal eine halbe Stunde weg sei oder sich ein Stündchen verspäte, und schon stehe ich mit einem Herrn, der gar nicht älter sein muß als ich, so viele jüngere Bürgermeister gibt es inzwischen ja auch, aber mit seiner Krawatte und dem Seitenscheitel einfach anders aussieht, einen anderen Weg genommen hat als ich, der ich ebenfalls in einem Städtchen geboren bin, weder gegen die atomare Aufrüstung noch für die Revolution in Lateinamerika kämpfte, sich vielmehr um die Schülervertretung bewarb, gar nicht erst studierte oder nach dem Studium gleich wieder ins Städtchen zurückzog – wir stehen auf diesem grau in grauen Vorplatz, über dessen kostspielige, jedoch so notwendige Sanierung der Bürgermeister mit einer Leidenschaft spricht, als ginge es um den Bau des Petersdoms. Dabei sind die Bäume, der Rasen und der Brunnen, die der Bürgermeister vor meinem inneren Auge entwirft, erst der Anfang: Wenn er auf dem Rundgang von den größeren Aufgaben spricht, den bewältigten und noch unbewältigten, den Jugendlichen, die keine Lehrstelle finden, den Türken, die nicht länger in einer Garage beten sollen, dem Lärm der Durchgangsstraße, der die Anwohner um den Schlaf bringt und so weiter und so fort – nie nehmen die Aufgaben ein Ende –, dann denke ich, während ich zu seiner Freude weiterhin eine Frage nach der anderen stelle, ich denke: ja, du hast recht, nicht immer nur ich, was du hier tust, ist wichtig, nicht was ich tue, und würde den Bürgermeister am liebsten an beiden Oberarmen packen und rütteln und rufen, wie mich nach einer Lesung nie jemand packt: Du hast gut daran getan, daß du im Städtchen geblieben bist.
Ich werde später nicht mehr genau rekonstruieren können, was Jutta vom zweiten Fußballplatz erzählt, es geht auch irgendwie um das Zusammenleben der Völker, das Asylantenheim und einen Nigerianer, der zur Meisterschaft beitrug, aber diesen Eindruck, daß hier jemand am richtigen Ort ist und Schwierigkeiten löst, die konkret sind wie ein Laib Brot oder ein Schluck Milch, die Bewunderung auch, die mir etwas Simples wie ein gesundes, fair gehandeltes Schulfrühstück abtrotzt, für das sich Jutta eingesetzt hat, diesen Eindruck empfinde ich noch stärker als in anderen Städtchen, weil sie gar nicht hierhin gehört. Sie hat einfach einen Ort, einen wirklich beliebigen Ort, an dem sie zufällig war, zum Mittelpunkt der Welt gemacht. Mit Bäumen, Rasen und Brunnen wäre selbst der Vorplatz des Rathauses nicht mehr grau.
Ich frage mich, ob Jutta aus derselben Scheu, aus der ich ihre Ehe übergehe, nicht nach meiner Scheidung fragt, die der Roman mehrfach erwähnt, aus dem ich heute abend las. Wahrscheinlich ist es viel simpler und interessiert sie mein Privatleben einfach nicht – warum auch? Unsre einstige Liebschaft ist ebensowenig angesprochen, da haben wir das Städtchen bereits umrundet und noch das Infrastrukturgesetz der Bundesregierung erklärt. Dennoch ist das Gespräch anregend, ich kann es bei aller Ernüchterung nicht anders sagen, erfahre ich manches über den deutschen Alltag und lerne andres neu, sogar freundlicher zu sehen, wofür ich freilich aufgeschlossener wäre, wenn ich mir nicht fortwährend Gedanken machte, was sich wohl hinter Juttas Schädeldecke und gar in ihrem Herzen tut, welche Fragen und Erlebnisse sie außerhalb des Amts bewegen, nicht nur mit ihrer Ehe, meine ich, wie sie überhaupt das Leben und ihr Leben findet, ob Nöte sie belasten, von denen sie einem Fremden wie mir nie berichten würde, und der Dank fürs Daseins tatsächlich eine Erfahrung ist oder bestenfalls ein Bekenntnis.
– Ich möchte gar nicht aufhören, mit dir zu reden, rufe ich mitten in ihren Satz und bin selbst von der Intimität überrascht, die mein eigener Satz herzustellen versucht.
Jutta bleibt stehen und dreht sich zu mir, die Wangen wieder wie Aprikosen. Bewußt oder unbewußt wird sie ihr Lächeln, das so entwaffnend zugewandt wirkt, auch im nächsten Wahlkampf einsetzen, geht mir durch den Kopf.
– Laß uns noch ein Glas Wein bei mir trinken, schlägt sie vor und fügt, da ich nicht sofort reagiere – hat sie etwa gemerkt, daß ich aus der Fassung gebracht bin, oder fürchtet sie, sich zweideutig ausgedrückt zu haben? –, fügt hinzu, daß ich dann auch ihren Mann kennenlernte, der nie vor zwei Uhr im Bett sei.
– Muß er denn nicht morgens ganz früh raus? frage ich, was mich gerade am wenigsten bewegt: Ich meine, so als Arzt.
– Doch, doch, antwortet Jutta und erklärt, daß ihr Mann schon in Ecuador mit vier Stunden Schlaf ausgekommen sei: Aber trinkst du überhaupt Alkohol?
– Ja, den ganzen Abend schon.
– Ach so, stimmt.
Wenn ich den Roman schreibe, werde ich außer dem Namen andere Äußerlichkeiten gerade so viel verändern, daß die Frau unerkannt bleibt, die ich auf dem Schulhof geliebt. Sie ist also vielleicht gar nicht Bürgermeisterin oder hat keinen Pagenschnitt, vielleicht nicht einmal eine Stupsnase und blonde Haare, so daß der Schwindel bereits im Roman begonnen hätte, aus dem ich heute abend las. Für den Roman, den der Leser in Händen hält, werde ich noch mehr, nach meinem Dafürhalten auch Wesentliches verfremden und selbst schmerzhafte Auslassungen in Kauf nehmen, damit sich Jutta, die nicht Jutta heißt, mit der Veröffentlichung einverstanden erklärt. Doch das Gefühl, das das Wiedersehen in mir auslöst, die vielen widerstreitenden Gefühle, werde ich so genau als möglich dokumentieren. Überhaupt erfinde ich als Romanschreiber nur und nur dort, wo es – ich mag das Wort, das ich aus Kriminalfilmen kenne – der Wahrheitsfindung dient. Ich behaupte schließlich nicht, auch nur meine eigene Wahrheit zu kennen, also zu wissen, was ich gerade fühle, wie ich die Welt sehe und so weiter. Oder anders: Was ich fühle, sehe und so weiter, das weiß ich oder glaube ich zu wissen, nur wie ich es zu entschlüsseln habe, worin der Sinn dieses oder jenes Erlebens liegt, das wird oft dunkler, je mehr es zu bedeuten scheint. Nur deshalb schreibe ich und nur dort, in den großen wie den kleinen Dingen, wo ich etwas Gesehenes, Gehörtes, Gefühltes nicht verstehe. Und vom Wiedersehen nach einer Lesung – so viel ist nun auch im herkömmlichen Sinne wahr –, dem unerkannten Zusammensein im Restaurant, dem Spaziergang durch ein fremdes, wie verlassenes Städtchen, das ich andernfalls schon am nächsten Morgen vergessen würde, von der Einladung ins Einfamilienhaus, in dem sie mit Mann und drei Kindern lebt, und von allem, was ich in einer Nacht über die Liebe erfahre, werde ich Bericht erstatten müssen, eben weil es vor Bedeutung immer dunkler leuchten wird.
Dem Leser, der nach diesem Einschub was weiß ich welches Drama erwartet, durch das Wort der Wahrheitsfindung verleitet gar einen Kriminalfall, diesem selbstverständlich ebenfalls willkommenen, jedoch für die Romane, die ich schreibe, vielleicht gar nicht so passenden Leser möchte ich vorsorglich die Ankündigung machen, daß die Nacht nichts Spektakuläres bringen wird, keine Bettszene, nicht einmal einen Kuß. Es wird nichts sein und doch so viel, und genau in dieser Lücke zwischen offenbar werdender Bedeutungslosigkeit sogar für die Liebenden selbst und überwältigender Sinnhaftigkeit noch für einen Unbeteiligten mit zugegeben empathischem Blick, in diesem winzigen Abstand, den ich bis hierhin, bis zum Rundgang durchs Städtchen und dem Eintreten in ihr Haus übersehen oder für unwürdig gehalten habe, liegt womöglich doch ein Himmel, den Gott den Menschen verheißt. Ja, genau andersherum als in dem Roman, aus dem ich heute abend las, wird das Geschilderte den Liebenden selbst nichtig vorkommen und doch alles sein, was Liebe auf Erden verspricht.
Obwohl ich es mir hätte denken können – er Arzt, sie Bürgermeisterin –, überrascht mich die Größe der – ja, es ist eine richtige Villa, ein dreistöckiger, geradezu ehrwürdiger Altbau mit bodentiefen, offenbar nachträglich vergrößerten Fenstern im Obergeschoß, dahinter Schlafzimmer wahrscheinlich, als Anbau eine Doppelgarage, auf dem Dach Sonnenkollektoren.
– Sind auf der Garage auch welche?
– Ja, antwortet Jutta: Wir geben sogar Strom ab.
– Und das rechnet sich?
– Mittlerweile rechnet es sich auch.
Es ist ihr Mann, erfahre ich, dessen ökologisches Bewußtsein und Faible für technische Neuerungen so ausgeprägt sind, daß er den Altbau über die Jahre zu einem Muster naturverträglicher Lebensführung ausgebaut hat, Regenwassernutzung, konsequente Wärmedämmung, Naturgasgewinnung und … so schnell komme ich gar nicht mit, wie Jutta die Einrichtungen aufzählt, die den Verbrauch der natürlichen Ressourcen mindern oder sogar Ressourcen erzeugen. Inzwischen stehen wir bereits in der Diele, in der die Kinder nicht allzu sehr auf Ordnung achten müssen, über den Boden verteilt Schuhe verschiedener Größe, Fahrradhelme, ein Skateboard und ein Basketball, der gegen den Arztkoffer aus schwarzem Leder gerollt ist, wahllos auf die Kommode geworfen signalfarbene Regenbekleidung, dazwischen abnehmbare Fahrradleuchten und ein Stapel DVDs mit Hollywoodfilmen.
– Die großen Fenster verkleinern, also dagegen habe ich mich erfolgreich gewehrt, flüstert Jutta: Und die beiden Autos sind für uns total unverzichtbar.
– Aber dann wenigstens Elektro, oder? frage ich und habe nicht nur die Lautstärke, sondern auch den Ton übernommen, mit dem sie über das Faible ihres Mannes spricht.
– Er muß sich mit Hybrid begnügen, antwortet Jutta: Mit dem Elektroauto käm er hier auf dem Land nicht weit.
– Und du?
– Am liebsten meine Dienstlimousine, kichert Jutta.
– Soll ich die Schuhe ausziehen?
– Ja, bitte.
Beim ersten Mal sehe ich es, weil ich meine eigenen Schuhe aufschnüre, bloß aus dem Augenwinkel, dafür die zweite Bewegung in ihrer ganzen Anmut und Pracht, wie sie auch den linken Unterschenkel in Richtung des Pos hebt und den Oberkörper behend wie eine Tänzerin gleichzeitig dreht und beugt, wie sie mit zwei Fingern den Stöckel hält und die Ferse aus dem ebenso eleganten Schuh hebt und wie sie dann, ja wirklich eine Tänzerin jetzt, so leicht, wie sie den Unterschenkel nach vorne wirft, worauf der Schuh vom Fuß fliegt, um zwischen den Turnschuhen und Sneakers der Kinder zu landen. Ist sie es überhaupt? frage ich mich, so klein war Jutta doch nicht, die nicht Jutta hieß, so klein und feingliedrig wie die Frau vor mir, die auf Nylonstrümpfen so selbstverständlich ins Hausinnere voranschreitet, als gehörte ich zur Familie oder wäre ein täglicher Gast. Richtig, als sie mich vor dreißig Jahren mit nach Hause nahm, ging sie ebenfalls voran und von der Haustür weiter durch den Flur nach oben in ihr Zimmer, ohne nach hinten zu schauen; nur damals, da nahm ich sie überhaupt nicht wahr, oder kann mich nicht erinnern, ob sie sich bereits mit derselben Sicherheit bewegte, bewahre keine Geste im Gedächtnis, die an Grazie den weggestoßenen Schuhen gleicht, während ich jetzt jeden Blick und jede Regung aufzeichne, ihre leicht gespreizten Finger beim Gehen, das Gesäß, das in dem schmal geschnittenen Rock hin- und herwiegt, dieser frappante – ja, das ist der stärkste Eindruck –, dieser frappante Automatismus ihres Auftretens, der das offensichtlich Ungewohnte, nicht Geprobte, auch nicht Erwartbare unsrer Situation bricht.