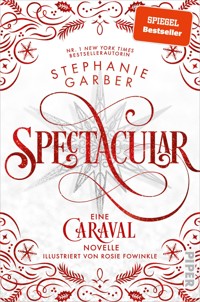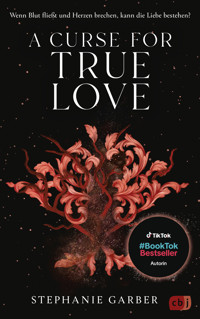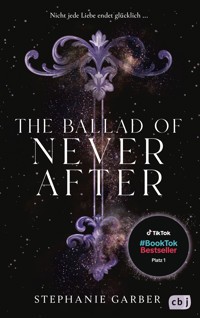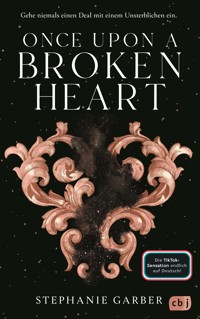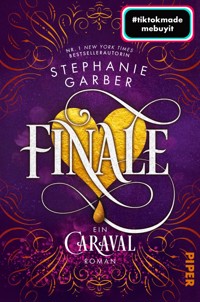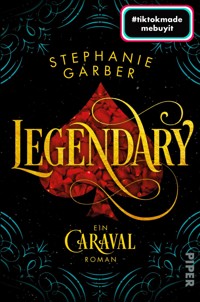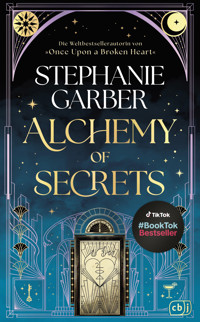
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Alchemy-of-Secrets-Reihe
- Sprache: Deutsch
Alles beginnt mit einem Kurs in einem alten Kino …
Folklore 517: Lokale Legenden und urbane Mythen, unterrichtet von einer Frau, die alle nur »die Professorin« nennen.
Die meisten Studierenden glauben, dass die Geschichten der Professorin nur erfunden sind. Es gibt keinen Mann in Hollywood, den man anrufen kann, um zu erfahren, wann man sterben wird. Es gibt keine Hotelbar in Los Angeles, in der es spukt und der Teufel höchstpersönlich sich gerne die Zeit vertreibt. Und so etwas wie Magie gibt es ohnehin nicht. Aber ... keine von ihnen hat eine so tragische Vergangenheit wie Holland St. James. Holland hofft, mit ihrer Abschlussarbeit ihre Vergangenheit neu schreiben zu können. Und das, indem sie beweist, dass einige der berüchtigtsten Todesfälle im alten Hollywood in Wirklichkeit Morde waren – begangen von niemand anderem als dem Teufel selbst. Sie ahnt nicht, dass die Recherche sie in eine tödliche Welt voller jahrhundertealter Geheimnisse und unvorstellbarer Lügen führen wird. Und auf die Spur zweier extrem gefährlicher Männer, die beide bereit sind, alles zu tun, um eine Magie ausfindig zu machen, die Hollands Leben entweder für immer verändern oder völlig zerstören wird.
Magisch, düster und romantisch – der neue Fantasyroman von New-York-Times-Bestsellerautorin Stephanie Garber!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
STEPHANIE GARBER
Alchemy of Secrets
Aus dem amerikanischen Englisch von Diana Bürgel
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
© 2025 der deutschsprachigen Ausgabe
cbj Kinder- und Jugendbuchverlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Copyright © 2025 Stephanie Garber
Published by Arrangement with Stephanie Garber
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2025 unter dem Titel: »Alchemy of Secrets«
bei Flatiron Books, einem Imprint von Macmillan Publishers Ltd., New York
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Übersetzung: Diana Bürgel
Lektorat: Kerstin Fricke
Kapiteleinstiegsvignette: © iStockphoto / filo
Umschlagkonzeption: Geviert GbR, Grafik & Typografie
unter Verwendung einer Illustration von © Kelly Chong, nach einer Vorlage von Rachael Lancaster / The Orion Publishing Group
sh · Herstellung: AnG
Satz und Reproduktion: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-33174-0V001
www.cbj-verlag.de
Das hier ist für meinen Dad.
Du hast mir zwar gesagt, ich soll dieses Buch nicht für dich schreiben, aber ich habe es trotzdem getan.
Ich liebe dich, Dad!
Folklore 517
Es begann mit einem Flüstern in deinem Ohr in der Warteschlange im Coffeeshop, eine Geschichte, die du wahrscheinlich besser ignoriert hättest. Doch das Gerücht hat sich in deinem Kopf festgesetzt wie ein Song, wie ein ungelöstes Rätsel, das dich einfach nicht loslassen wollte. Bis es dich schließlich hierhin geführt hat. Auf einen Parkplatz, dem eindeutig egal ist, was der Wetterbericht sagt.
Angeblich sollte es eine sternenklare Nacht werden, wolkenlos, aber du fühlst den Regen auf deinen Zehen. Eifrige Tropfen treffen dich, während du in Sandalen über den Asphalt läufst. Die Straßenlampen um dich herum flackern wie ein knisternder Hintergrundchor zu deinen nassen Schritten.
Du bist zwar nicht außer Atem, aber du wirst trotzdem langsamer und bleibst schließlich unter einem Vordach stehen. In roten Blockbuchstaben surren die Worte »Demnächst im Programm« über dir und werfen ihre Neonschatten auf einen altmodischen Kassenschalter, der mit ausgeblichenen Postern zu längst verstrichenen Attraktionen bedeckt ist. In verwaschenen gelben Buchstaben prangt Veronika Lakes Name ganz oben auf einem der Poster, während dir von einem anderen eine schwarz-weiße Loretta Young entgegenlächelt. Lorettas Poster kündigt die Krimikomödie A Night to Remember an, und du hoffst inständig, dass dies hier ebenfalls eine erinnerungswürdige Nacht werden wird.
Du bist dir nicht sicher, ob die Geschichten wahr sind, aber du erwartest fast, in ein Kaninchenloch zu fallen, während du durch die Kinotüren in den Saal dahinter trittst.
Deine Vorfreude verleiht allem einen zusätzlichen Glanz. Rechts von dir entdeckst du eine Reihe Telefonzellen, schimmernde Kabinen aus Holz und Glas. Noch nie hast du so viele davon in einer Reihe gesehen. Fast bist du versucht, ein Foto davon zu schießen, aber du tust es nicht. Und du könntest es auch gar nicht, denn mittlerweile funktioniert dein Handy nicht mehr, was du aber noch nicht weißt. Auf einmal lenkt dich der alte Verkaufstresen links von dir ab, auf dem der Staub so nostalgisch wirkt, dass dir kaum auffällt, wie abgeblättert die Goldfarbe der Art-déco-Verzierungen aus geometrischen Sonnen und springenden Delfinen ist. Auf dem Schild darüber steht:
10 Cent für Popcorn
15 Cent für Popcorn mit Butter
25 Cent für Zigaretten
Du wusstest gar nicht, dass im Kino Zigaretten verkauft wurden, aber einen Moment lang kannst du den Rauch und das Popcorn riechen. Beinahe kannst du auch die Butter schmecken. Doch du bleibst nicht in der Lobby stehen. Es gibt nur einen Kinosaal – nur eine Attraktion –, den du finden möchtest, also machst du dich auf den Weg dorthin.
Deine Brust ist eng. Dein Herz pocht schon jetzt wild. Und du hoffst immer noch auf das Kaninchenloch, das dich in eine andere Welt bringt. Als du durch die Flügeltüren trittst, fühlst du dich so hoffnungsvoll und optimistisch wie eine überbelichtete Fotografie.
Es riecht weiterhin nach Rauch und Popcorn, aber da ist noch etwas anderes. Vielleicht nur das Aroma von altem Samt, gemischt mit einem Hauch von Regen, doch in dir ruft es Träume in Technicolor wach, während du den Kopf in den Nacken legst, um die unfassbar hohe Decke zu betrachten. Sie ist elfenbeinweiß und golden und mit weiteren Art-déco-Motiven verziert, die aussehen, als könnten sie etwas mit den Sternbildern der Tierkreiszeichen zu tun haben.
Einige der Sitze unter der kunstvollen Kuppel sind bereits besetzt. Fünfundzwanzig? Oder vielleicht fünfzig? Du bist zu nervös, um richtig zählen zu können, während du dir einen Platz ganz hinten suchst. Der Stuhl wackelt, und der abgewetzte Samt fühlt sich weich an, aber es gefällt dir nicht, dass du so weit von der Bühne entfernt bist.
Also beschließt du, näher heranzugehen und dabei einen weiteren Blick auf die anderen zu werfen. Du möchtest sehen, wer es noch hierhergeschafft hat und ob du vielleicht jemanden wiedererkennst. Allerdings überrascht es dich nicht, dass dir alle Gesichter fremd sind, immerhin kennst du an der Uni kaum jemanden. Ein paar von ihnen flüstern, ein paar kichern, ein paar wenige schweigen wie du, aber da gibt es etwas, das euch alle miteinander verbindet: Erwartung.
Das hier muss es sein. Die Vorhänge vor der Bühne weisen ein dunkles, intensives Rosa auf, und als sie sich teilen, hältst du den Atem an.
Gentlemen, bitte nehmen Sie Ihre Hüte ab, flackert über die Leinwand.
Darauf folgt: Lautes Pfeifen und Reden sind nicht gestattet.
Woraufhin natürlich mehrere Pfiffe ertönen. Doch dann werden alle still und leise, als die Leinwand wieder dunkel wird, bevor in der rechten oberen Ecke ein winziger Stern zu blinken beginnt. Einmal, zweimal. Dann erlöschen alle Lichter im Saal.
Es ist dunkler als die Nacht draußen. Du hörst, wie einige der anderen ihre Handys zücken, aber keines davon funktioniert, auch deines nicht. Kein Netz. Kein Licht. Keine digitale Uhr, die dir verrät, wie viel Zeit verstreicht.
Du weißt nicht, wie lange du schon hier sitzt, bevor die erste Person den Saal verlässt. Sie hat beschlossen, dass dies nicht der richtige Kurs für sie ist, falls es denn überhaupt ein Kurs ist. Ein paar weitere folgen.
Es gefällt dir gar nicht, dass du selbst schon daran denkst, es ihnen nachzumachen.
Deine Zehen sind zwar nicht mehr nass, aber du hast eine Gänsehaut vor Kälte. Es kommt dir so vor, als würde dich jemand beobachten, aber es ist zu dunkel, als dass irgendjemand irgendetwas erkennen könnte.
Die Zeit verstreicht, und du denkst noch einmal über die Geschichten nach, die du gehört hast, die Gerüchte und das Gewisper über eine ganz besondere Vorlesung, die man in keinem Onlineverzeichnis findet, unterrichtet von einer Professorin, die auf keiner Website genannt wird. Und auf einmal glaubst du, dass es einen guten Grund dafür gibt. Vielleicht solltest du doch lieber gehen. Vielleicht …
Ein Licht flammt auf der Bühne auf. Nur ein kleines Leuchten, das dich aber trotzdem blendet. Du schließt die Augen und öffnest sie wieder. Und als du endlich etwas erkennen kannst, ist sie da.
Sie sitzt auf einem hölzerneren Hocker mitten auf der Bühne.
Du weißt nicht, wie lange sie schon dort ist, hast aber den Eindruck, sie würde schon seit Stunden warten, genau wie die etwa zwei Dutzend von euch, die noch hier sind. Sie ist kleiner, als du erwartet hast. Die Art, wie die anderen über sie geredet haben, hat sie in deiner Vorstellung imposant erscheinen lassen, statuenhaft, buchstäblich überlebensgroß. Aber sie sieht aus wie eine Großmutter. Ein silberner Bob umrahmt ein rundes Gesicht, auf dem ein kaum wahrnehmbares Lächeln liegt, als sie die Worte ausspricht, die dir das Gefühl geben, das hier wäre die Kälte und die Nässe und das Warten wert gewesen.
»Ihr seid wegen einer Geschichte hier«, sagt sie. »Und jetzt werde ich euch noch eine erzählen.«
EINS
Holland St. James hatte die Minuten bis zu diesem Abend gezählt. Sie hatte sieben verschiedene Kleider und fünf Paar Schuhe durchprobiert, sie hatte ihr Haar gelockt und sich sogar die Augen frisch geschminkt. Und jetzt war sie drauf und dran, alles zu ruinieren.
»Ich dachte, wir wollten ein Eis essen gehen?« Jakes Frage klang einfach nur freundlich. Weil Jake vielleicht der freundlichste Kerl war, mit dem sich Holland jemals getroffen hatte.
Als Jake vor ein paar Wochen zum ersten Mal ins Santa Monica Coffee Lab gekommen war, hatte Holland gedacht, dass er auf einfach perfekte Art süß war. Eher Clark Kent als Superman, mit genau der Art von dunklem Brillengestell, die schon immer Hollands ganz persönliches Kryptonit gewesen war. Dann war er mit ihr zusammengestoßen und hatte etwas von seinem Cold Brew verschüttet, und da war Hollands Blick auf die Fachbücher unter seinem Arm gefallen. Jake studierte Englisch als Fremdsprache im Aufbaustudium.
Bei ihrem ersten Date hatte sie erfahren, dass er außerdem ehrenamtlich im Tierheim in Los Angeles und beim Echo Park Time Travel Mart arbeitete, einer gemeinnützigen Organisation, die Kinder in kreativem Schreiben unterrichtete. Bei ihrem zweiten Date hatte sie erfahren, dass Jake vor Kurzem Vegetarier geworden war und Fahrrad statt Auto fuhr, weil er tun wollte, was immer er konnte, um die Umwelt zu schützen.
Jake war einfach ein guter Kerl.
Vielleicht gab es einen winzigen Teil in Holland, der ihn für ein bisschen zu perfekt hielt. Wie eine E-Mail ohne Tippfehler oder ein Airbrush-Bild, auf dem selbst das winzigste Fältchen fehlte. Aber vielleicht war es auch einfach nur typisch für Holland, dass sie nach Alarmsignalen suchte, die es nicht gab.
Dies war erst ihr drittes Date, und Holland hatte es in den vergangen zwei Jahren nie bis zu einem vierten geschafft.
Sie wollte das hier wirklich nicht vermasseln. Allerdings befürchtete sie, dass dieser Zug bereits abgefahren war, weil sie einfach nicht anders gekonnt hatte, als Jake in diese schmutzige Gasse zu schleifen, nachdem sie ein Poster entdeckt hatte, das sie an die Geschichten der Professorin denken ließ.
Das Poster war an eine Betonwand gepflastert worden. Es war eines dieser Vintage-Bilder, die aussahen, als müssten sie auf den hölzerneren Postkarten abgebildet sein, die am Santa Monica Pier verkauft wurden. Palmen in sonnengebleichtem Braun und Grün umrahmten die kohlegraue Silhouette eines Mannes, der einen Fedora trug und auf seine Uhr hinabschaute. Keine Logos, keine Markennamen waren auf dem Poster zu sehen. Tatsächlich gab es überhaupt keinen Schriftzug, der verriet, was dieses Poster anpreisen sollte. Nur zwei Initialen auf den Manschetten des gesichtslosen Mannes: D. U.
Der Uhrenmann.
Das war der erste Gedanke, der ihr in den Kopf kam. Dann hatte sie Jake in diese Gasse gezogen. Sie hatte einfach nicht anders gekonnt.
Holland war mit den Schatzsuchen ihres Vaters aufgewachsen. Als Kind schon hatte sie gelernt, nach Hinweisen Ausschau zu halten, während andere Kinder mit Bauklötzen oder miteinander spielten. Vielleicht hatte sie deshalb schon immer den Eindruck gehabt, nicht ganz dazuzugehören, bis sie den Folklorekurs der Professorin entdeckt hatte. Ihre Geschichten hatten Holland das Gefühl gegeben, sie befände sich wieder auf einer der Schatzsuchen ihres Vaters.
Eigentlich hatte sie nicht erwartet, an diesem Abend etwas zu finden. Überall in L.A. erinnerte sie irgendetwas an die Geschichten der Professorin, und jedes Mal hatte Holland den Impuls, diesen Hinweisen nachzugehen. Ständig jagte sie irgendeine Gasse entlang, von der sie hätte schwören können, sie noch nie gesehen zu haben, nur um am Ende auf eine Bar oder einen Coffeeshop oder einen Buchladen zu stoßen, in denen sie tatsächlich schon mal gewesen war.
Aber nicht heute Nacht. Heute Nacht wusste Holland, dass sie sich noch nie in dieser Gasse befunden hatte. An dieses Schild würde sie sich erinnern.
Kurios & Uhrwerk
Drinnen fragen
Das Schild hing von einem glänzenden Kupferhaken an einer Tür, die Holland gern für sehr alt gehalten hätte, die aber vielleicht einfach nur schmutzig war. Ein Blick auf Jake verriet ihr, dass er sie jedenfalls für einfach nur schmutzig hielt. Wahrscheinlich überdachte er außerdem gerade seine Entscheidung, zu diesem Date zu gehen. Sie wollte seine Meinung gern ändern. Aber sie wollte auch wirklich gern durch diese Tür gehen, und sie wollte ihn dazu überreden, mit ihr zu kommen.
»Magst du urbane Mythen?«, fragte sie.
»Ja – eigentlich finde ich die sogar richtig super.« Das Lächeln, das Jake ihr schenkte, war viel mehr Superman als Clark Kent. Ein Hoffnungsfunke, sie könnte wieder in die richtige Richtung unterwegs sein, glomm in Holland auf.
Trotzdem … zögerte sie.
Die Professorin hatte eine Regel, die besagte, dass man ihre Geschichten niemandem außerhalb ihres Kurses erzählen durfte. Keiner brach diese Regel. Diese Vorlesung verlangte den Studenten viel zu viel ab, als dass sie die Geschichten einfach so ausgeplaudert hätten, und die Professorin warnte sie stets davor, es könnte ernste Konsequenzen haben, wenn sie es doch taten. Allerdings gehörte Folklore 517 nicht mehr zu Hollands Kursen, und es war nur eine einzige Geschichte. Aber …
»Bevor ich dir mehr verrate«, sagte sie leise, »musst du mir schwören, auf das Leben deines Hundes, auf dein Fahrrad und auf diese Zimmerpflanze, mit der du dir solche Mühe gibst, damit sie nicht eingeht, dass du es niemandem weitererzählst.«
Jakes Lächeln wurde breiter. »Ich schwöre es.« Er beugte sich vor und küsste sie sacht auf den Mund, wie um sein Versprechen zu besiegeln. »Ist das hier so was wie ein Familiengeheimnis?«
Holland erstarrte.
Sie rief sich in Erinnerung, dass Jake aus einer großen Familie kam, deren Mitglieder ihn ständig anriefen, um mit ihm über völlig belanglose Details des Alltags zu plaudern. Über die Familie zu reden, war ganz normal für ihn. Er forschte nicht nach Informationen.
Trotzdem brauchte sie ein paar Sekunden, um ein hoffentlich verspielt wirkendes Lächeln zustande zu bringen. »Es ist kein Familiengeheimnis, aber ich soll nicht darüber reden. Damals im Grundstudium habe ich Folklore 517: Lokale Legenden und urbane Mythen gewählt. Dieser Kurs ist selbst so etwas wie eine lokale Legende. Man kann sich nicht einfach anmelden und man findet ihn auch nicht auf der Website. Man muss durch Hörensagen darauf kommen. Wenn man den Kurs am Ende des Semesters bestanden hat, erscheint er auf dem Zeugnis.«
Jake wirkte fasziniert. »Dann ist das also so was wie eine Geheimvorlesung?«
Holland nickte nervös, oder vielleicht war sie auch eher aufgeregt. Sie würde schließlich niemandem wehtun, wenn sie dieses kleine Geheimnis ausplauderte. »Jede Woche hat die Professorin von einem anderen urbanen Mythos erzählt, und wir mussten schwören, dass wir nichts weitersagen. In einer der Legenden geht es um jemanden, den man den Uhrenmann nennt. Angeblich gibt es überall in Los Angeles Hinweise, die zu ihm führen. Wenn man den Zeichen folgt und es schafft, ihn zu finden, kann man ihn fragen, wie spät es ist, und der Uhrenmann verrät einem, wann man stirbt.«
Jacks Miene veränderte sich und eine winzige Sorgenfalte bildete sich zwischen seinen Augenbrauen.
»Es ist nicht ganz so morbide, wie es klingt«, fuhr Hollands hastig fort. »Die Professorin hat auch erzählt, dass man einen Handel mit ihm schließen kann, um mehr Zeit zu bekommen und länger zu leben, als man eigentlich sollte.«
»Und du glaubst wirklich daran?«, fragte Jake. Da war etwas in seiner Stimme, das Holland nicht ganz einordnen konnte, doch auf einmal befürchtete sie, etwas zu optimistisch gewesen zu sein, was sein Interesse an Legenden betraf. Er war ein ganz normaler Typ, der vermutlich an ganz normale Dates gewöhnt war. Und wahrscheinlich wollte er einfach ein ganz normales Mädchen.
Natürlich nicht.
Ist doch nur Spaß.
Nein – kein bisschen.
Das alles wären hervorragende Antworten auf seine Frage gewesen. Das alles würde ein normales Mädchen wahrscheinlich sagen.
»Komm einfach mit mir da rein«, wich Holland aus.
»Klar«, willigte Jake ein, und weil er eben ein netter Kerl war, streckte er den Arm aus und öffnete ihr die Tür.
Alles auf der anderen Seite war Milchglas und Gold.
Eine makellose Reihe von Milchglaslampen an goldenen Kordeln erhellte einen makellosen Boden aus münzgroßen Milchglasfliesen, durchbrochen von ein paar schimmernden Goldfliesen, die das Wort Ticktack bildeten.
Es gab keine Fußabdrücke, keine Flecken, nur das schimmernde Wort, das im Licht der Glaslampen flackerte wie ein Sekundenzeiger.
Es fühlte sich fast magisch an. Keine große Wundermagie, sondern die einfache Magie der schlichten Dinge. Wie Zweidollarscheine und handgeschriebene Briefe und Schreibmaschinen und Telefone mit Wählscheibe.
Vielleicht hatte Holland dies versehentlich laut ausgesprochen, doch Jake sah aus, als wüsste er nicht recht, was er von diesem seltsamen Raum am Ende einer skurrilen Gasse halten sollte. Er wollte ein Date, über das sich ein schöner Instagram-Post verfassen ließ, keines, das in ein Forum über Albtraumdates gehörte.
Eine eindeutige Fehleinschätzung Hollands, doch nun konnte sie nicht mehr zurück. Es fühlte sich an, als wäre sie noch nie so nah dran gewesen, einen der Mythen der Professorin im echten Leben zu finden.
An der gegenüberliegenden Wand befanden sich zwei Türen, ebenfalls aus Milchglas und schillernd weiß mit goldenen Türknäufen und rechteckigen Goldplaketten in der Mitte. Auf einer der Plaketten stand Kurios. Auf der anderen Uhrwerk.
Holland streckte die Hand nach der Uhrwerk-Tür aus und hoffte, dass diese sie zum Uhrenmann führen würde. Wenn sie dieses Date schon ruinierte, dann wenigstens aus gutem Grund.
Der Knauf rührte sich nicht.
Sie versuchte es noch mal. »Ich glaube, es ist abgeschlossen.«
Jake streckte den Arm über ihre Schulter und klopfte an. Zwei laute Trommelschläge mit den Fingerknöcheln.
»Kann ich euch helfen?« Die Stimme kam von der anderen Tür.
Von der Tür, auf der Kurios stand.
In der Öffnung sahen sie nun ein Mädchen. Sie hatte einen platinblonden Pixiehaarschnitt und trug einen kleinen Nasenring zu einem engen weißen Kleid in derselben Farbe wie das Milchglas. Auf den ersten Blick wirkte sie jung, doch die Art, wie das Mädchen dort stand und sie anstarrte, ließ Holland ahnen, dieser Eindruck könnte täuschen.
Holland versuchte, einen Blick hinter das Mädchen zu werfen, darauf, was es dort so Kurioses zu entdecken gab, doch sie sah nur noch mehr weißes Licht.
Ungeduldig trommelte das Mädchen mit seinen eckig gefeilten Nägeln gegen den Türrahmen.
»Wir suchen nach dem Uhrenmann«, sagte Holland.
»Tut mir leid. Da kann ich euch nicht helfen.« Sofort trat das Mädchen einen Schritt zurück, um die Tür wieder zu schließen.
»Ich möchte ihn nur fragen, wie spät es ist«, platzte Holland heraus.
Das Mädchen erstarrte. »Bist du dir da sicher, Schätzchen?« Auf diese Frage ließ sie einen Blick folgen, der Holland nahezulegen schien, sie solle lieber machen, dass sie hier wegkam, und den süßen Typen an ihrer Seite mitnehmen.
»Sie ist sich sicher«, antwortete Jake. »Und ich wüsste auch gern, wie spät es ist.«
»Wirklich?«, fragte Holland.
Er legte ihr einen Arm um die Schultern, seine Haut fühlte sich warm an ihrer an. »Wenn du es tust, dann bin ich dabei.«
Sie wollte ihn fragen, was seine Meinung geändert hatte, doch auf einmal war diese ganze nervöse Aufregung einfach zu viel.
Das Mädchen in Weiß murmelte etwas vor sich hin, was sehr nach »Dummköpfe« klang. Dann verschwand sie hinter der Tür.
Die Zeit im Milchglasraum schien sich zu verlangsamen, während Holland darauf wartete, dass das Mädchen zurückkehrte. Jakes Arm auf ihren Schultern wurde immer wärmer, und dieses Mal schien sie diejenige zu sein, die sich unwohl fühlte. Hoffentlich würde das Mädchen überhaupt zurückkommen.
Endlich öffnete sich die Kurios-Tür wieder. Das Mädchen tauchte auf und hielt ihnen Stifte und Zettel mit einem Kohlepapierdurchschlag an der Rückseite hin. Sie schürzte die Lippen. »Wenn ihr beide euch sicher seid, dann schreibt hier eure Namen auf, mitsamt der verlangten Information, und der Uhrenmann wird sich bei euch melden.«
ZWEI
Der nächste Morgen dämmerte langsam herauf, widerstrebend, die Aufgabe zu erfüllen, die er allmählich leid war.
Als Holland erwachte, herrschte dicke Stille um sie herum. Keine zwitschernden Vögel, keine vorbeirauschenden Autos auf der Straße draußen, keine knarrenden Dielen ihres erwachenden und sich streckenden Hauses. Einen Moment lang hätte sie schwören können, dass nicht mal ihr Herz schlug.
Als sie sich schließlich aufsetzte, drehte sich alles um sie, und auf einmal war ihr leicht übel. Sie war nicht verkatert, jedenfalls glaubte sie das nicht.
Sie versuchte, sich daran zu erinnern, was sie am vergangenen Abend gemacht hatte, doch einen Moment lang wusste sie nicht mal, welcher Tag heute war. Es war, als würde eine Buchseite an der vorherigen festkleben.
Wankend beugte sich Holland zur Seite, um auf ihr Handy zu schauen.
Es war Donnerstag.
Gestern war Mittwoch gewesen.
Ihr drittes Date mit Jake.
In einer langsamen Parade unscharfer vergilbter Bilder, die sie an selbst gedrehte Filme denken ließ, kehrten die Details allmählich zurück. Sie erinnerte sich an die Gasse … das Milchglas … Jakes Arm um ihre Schultern … Kohlepapier … die einfache Magie der schlichten Dinge … den Uhrenmann …
Gestern hatte sich alles so aufgeladen angefühlt.
Doch nun wirkte der Abend seltsam dumpf und fern in ihren Erinnerungen, während sie die Ereignisse durchging.
Nachdem sie die Gasse wieder verlassen hatten, waren Jake und sie endlich zur Eisdiele gegangen und hatten sich ein Erdnussbutter-Bacon-Eis geholt, und dann hatte er sie bei ihrem Auto geküsst. Der Kuss hatte ziemlich lange gedauert. Aber vielleicht dachte er inzwischen anders darüber als sie, denn dies war der Morgen nach ihrem Date, und sie hatte beim Aufwachen keine Textnachricht von ihm vorgefunden.
So spät war es ja eigentlich noch gar nicht. Er könnte immer noch schreiben: Guten Morgen.
Wie aufs Stichwort gab ihr Handy ein leises »Ping« von sich.
Nur war es keine Nachricht von Jake.
14:00 Uhr Treffen mit Adam Bishop
Holland ließ das Handy wieder aufs Bett fallen.
Adam Bishop war neu an der Fakultät und erst vor Kurzem vom UC Berkeley Folklore Program hierher gewechselt. Holland war ihm noch nie persönlich begegnet, aber sie hatte gehört, wie andere Graduierende über ihn klatschten und tratschten. Alle schienen ihn zu lieben.
Die E-Mail, die er ihr am Montag geschickt hatte, war kurz, und er hatte sie darin gebeten, ihn an diesem Nachmittag aufzusuchen. Sie hatte sich nach dem Grund erkundigt, woraufhin Adam Bishop nur kryptisch erklärt hatte, das ließe sich in einem persönlichen Gespräch besser erörtern.
Sie fragte sich, ob er vielleicht auf der Suche nach einer Lehrassistentin war und ob die Professorin ihm Hollands Namen genannt hatte. Holland mochte mit ihrer Abschlussarbeit ein bisschen hinterher sein, aber sie war eine exzellente Lehrassistentin. Zwei Jahre lang hatte sie für die Professorin gearbeitet – ein Jahr im Bachelorstudium und ein Jahr im Postgraduiertenstudium – und jeder wusste, dass dieser Job eine Menge Geduld und eine Reihe von Kompetenzen verlangte, die man normalerweise nicht in einen Lebenslauf schrieb. Tatsächlich vermisste sie diese Arbeit. Aber sie hatte jetzt einen anderen Job. Einen fantastischen Job.
Jeden Freitagabend zeigte Holland auf dem Dachboden des Santa Monica Coffee Lab alte Filmklassiker, auf die eine Diskussionsrunde folgte. Es war wie Unterrichten, nur ohne Noten. Und alle durften dabei trinken.
Sie liebte es.
Sie liebte das Coffee Lab. Sie liebte die Leute, die dort jede Woche auftauchten. Aber am meisten liebte sie die alten Filme.
Holland liebte Filme schon, seit ihr Vater ihr und ihrer Zwillingsschwester Der Zauberer von Oz gezeigt hatte, als sie vier Jahre alt gewesen waren. Nach dem Ende des Films war ihre Schwester auf einem Besen davongesaust, und Holland hatte sofort ein Paar rubinrote Schuhe verlangt.
Ihr Vater hatte gesagt: »Dachte ich mir doch, dass du das sagst, Hollybells.« Und dann hatte er ihr erklärt, dass die Schuhe schon irgendwo im Haus auf sie warteten und Holland sie nur finden müsste.
Das war ihre erste Schatzjagd gewesen.
Er hatte seine Jagden immer mit Filmen verbunden. Wenn sie im Coffee Lab die alten Streifen zeigte, hatte sie das Gefühl, ihm nah zu sein. Im Moment widmete sie sich einer Film-noir-Reihe, und sie liebte die Geschichte hinter den Aufnahmen. Die Art, wie sie den Eindruck erweckten, es gäbe irgendwo auf der Welt einen verborgenen schwarz-weißen Winkel, in dem keine Fast-Food-Ketten, sondern Detekteien die Straßen säumten und mindestens einmal pro Woche eine Femme fatale mit einer Haarwelle vor einem Auge durch die Tür marschiert kam, um das Leben eines anderen Menschen auf einen dunklen, gewundenen Pfad zu führen.
Falls Adam Bishop sie wirklich als Hilfskraft anheuern wollte, wäre das vermutlich nichts für sie. Trotzdem war Holland neugierig. Sie war immer neugierig.
Nachdem sie aufgestanden war, ging sie eine Runde joggen und versuchte, sich vorzustellen, was Adam Bishop wohl sonst noch von ihr wollen könnte. Doch nachdem die Joggingrunde in einen Spaziergang umgeschlagen war und der Morgen sich in den Mittag verwandelt hatte, kehrten ihre Gedanken immer wieder zu Jake zurück.
Er hatte ihr immer noch nicht geschrieben.
Holland wollte es bereuen, ihn mit in diese Gasse genommen zu haben. Sie wollte glauben, dass alles anders gelaufen wäre und sie beim Aufwachen eine Guten-Morgen-Nachricht auf dem Handy gehabt hätte, wenn sie einfach direkt zum Eisessen gegangen wären und sie nicht alles verdorben hätte, nur weil sie einem urbanen Mythos über den Tod hatte nachjagen müssen.
Doch was Holland wirklich wollte, war, dass Jake sie trotz – oder gerade wegen – der Mythen mochte. Ironischerweise gehörte der Uhrenmann nicht mal zu Hollands Lieblingslegenden. Eigentlich wollte sie gar nicht wissen, wann sie sterben würde, sie wollte nur herausfinden, ob an diesem Mythos etwas Wahres war.
Inzwischen war es fast Zeit für das Treffen, und Holland warf einen letzten Blick auf ihr Handy.
Nichts.
Sie wusste, dass dies nicht gleich bedeuten musste, dass alles vorbei war, doch in diesem Moment fühlte es sich nicht so an, als würde es irgendwo hinführen. Sie überlegte, ob sie Jake ihrerseits schreiben sollte, aber sie hatte ihm gestern Abend schon geschrieben, nachdem sie nach Hause gekommen war.
Wenn January nur hier wäre.
Holland wusste, was ihre Zwillingsschwester sagen würde – etwas wie: Wenn er dich nicht will, dann pfeif auf den Typen. Nur hätte January statt »pfeif« wohl ein anderes Wort mit »ei« verwendet.
Die Schwestern mochten gleich aussehen, aber in fast jeder anderen Hinsicht könnten sie nicht unterschiedlicher sein. Trotzdem war January ihre beste Freundin. Der eine Mensch, dem sie alles anvertraute.
Holland eilte die Treppe hinab, um sich auf den Weg zu ihrem Treffen zu machen. Wie so vieles, was Holland liebte, war ihr Haus alt. Es stammte aus den Vierzigern, und es gab viel Holz, weiße Wände und eine Menge Fenster, die reichlich Licht hereinließen. Auf halbem Weg die Stufen hinunter rief sie ihre Schwester an.
Normalerweise sprachen Holland und January jeden Tag miteinander, doch seit Anfang Oktober hielt Januarys Arbeit sie mehr auf Trab als üblich. In den vergangenen drei Wochen hatte sie nur ab und zu mal eine Textnachricht oder ein Foto aus Spanien geschickt.
Direkt nach dem College hatte January begonnen, als Sammlerin seltener Bücher zu arbeiten. Die Leute waren bereit, exorbitant viel Geld für etwas auszugeben, das sonst niemand besaß, und es war Januarys Aufgabe, dieses Etwas aufzustöbern. Die Arbeit war wirklich wie geschaffen für sie, weil sie schon immer die Welt hatte bereisen wollen und weil sie ebenfalls mit den Schatzjagden ihres Vaters aufgewachsen war. Doch immer, wenn sie fort war, vermisste Holland sie sehr.
Januarys Handy läutete einmal, dann sprang die Mailbox an. »Hallo. Dies ist der Anschluss von January St. James. Ich halte mich derzeit im Ausland auf …«
Die Ansage brach ab, als January den Anruf entgegennahm. »Hey …« Sie klang außer Atem, aber hellwach, obwohl es bei ihr schon spät sein musste.
»Schlechter Zeitpunkt?«, fragte Holland.
»Nein, aber ich habe nur ganz kurz Zeit.« Im Hintergrund rauschte der Verkehr, so als wäre es bei ihrer Schwester eher Mittag als Mitternacht.
»Was machst du gerade?«, fragte Holland.
»Langweiligen Arbeitskram. Ich war bis eben bei einem Treffen mit einem Kunden, der sich wirklich gern selbst reden hört.« January versuchte immer, ihren Job viel uninteressanter klingen zu lassen, als er war, vermutlich, um Holland nicht neidisch zu machen. Aber heute klang January tatsächlich ein bisschen erschöpft. »Du fehlst mir, Kleine.«
January sagte nie Du fehlst mir.
»Du fehlst mir auch«, antwortete Holland. »Mein Haus ist viel zu sauber, weil du schon so lange nicht mehr da warst. Wann ist deine Reise denn vorbei?«
»Nicht früh genug …« Kurz herrschte Schweigen in der Leitung, und Holland glaubte schon, die Verbindung wäre unterbrochen worden, doch dann fuhr January fort: »Ich wünschte, ich wäre bei dir …« Ihre Stimme war so sanft, dass sie gar nicht nach ihr klang.
»Ist alles in Ordnung?«, fragte Holland. »Du hörst dich ja fast rührselig an.« Normalerweise war Holland die Rührselige.
»Ich bin nur müde.« Und das musste sie wirklich sein, denn sie schnaubte nicht mal empört darüber, dass Holland sie rührselig genannt hatte. »Hier ist es schon spät, und ich wünschte, ich könnte länger mit dir reden, aber ich muss los. Ich …«
Hollands Türklingel ertönte und verschluckte Januarys letzte Worte.
Dann war ihre Schwester fort.
Holland warf einen Blick aus dem Fenster neben der Tür. Bei ihr klingelte nie jemand, abgesehen von den gelegentlichen Verkäufern, die ihr Schädlingsbekämpfungsmittel oder Solarpaneele andrehen wollten. Doch dieser Gentleman sah nicht so aus, als wollte er etwas verkaufen.
Silberne Haarbüschel lugten unter seinem Hut hervor und seine hellbraunen Wangen waren faltig. Sein Hemd war weiß, seine Hose khakigrün, und sie wurde von einem Paar leuchtend rot-weiß karierter Hosenträger gehalten, die alles andere in Hollands ruhiger Straße irgendwie dumpf und farblos erscheinen ließen.
Holland hatte keine Zeit zu verlieren, wenn sie noch rechtzeitig zu ihrem Termin auftauchen wollte. Doch während sie durchs Fenster sah, überkam sie ein Déjà-vu. Ich bin ihm schon einmal begegnet, dachte sie. Aber sie kam einfach nicht dahinter.
Vielleicht lag es auch nur an den Hosenträgern, die sie an ein altes Foto ihres Großvaters erinnerten, der noch vor ihrer Geburt gestorben war.
Was auch immer es sein mochte, es brachte sie dazu, die Tür zu öffnen.
»Hallo, Holland.« Der Gentleman lächelte, ein freundliches Lächeln, das sie an Bonbons in glänzendem Einwickelpapier und endlos lange Gutenachtgeschichten denken ließ.
»Kenne ich Sie?«, fragte sie.
»Nein, ich fürchte nicht.« Er lächelte immer noch, aber seine braunen Augen funkelten ein bisschen weniger intensiv, als er ihr eine in braunes Papier eingeschlagene und mit einer Paketschnur umwickelte Schachtel reichte.
»Was ist das?«, fragte sie.
»Das habe ich auf deiner Türschwelle gefunden.«
Holland musterte das Päckchen genauer. Es war kein Absender angegeben, dafür prangte in einer Ecke ein orangeroter Stempel, der in dicken Buchstaben Happy Halloween verkündete. Mitten auf dem Päckchen stand in verwischter, altmodischer Handschrift ihr Name: Holland St. James.
Das musste von der Professorin sein. Sie verschickte gern Päckchen und schrieb, natürlich, niemals einen Absender darauf, damit es geheimnisvoll blieb.
Hollands Handflächen prickelten, als sie die braune Papierschachtel in den Händen hielt. Sie war neugierig, was die Professorin ihr dieses Mal geschickt haben mochte. Normalerweise waren es irgendwelche esoterischen Bücher oder mit dem Teufel in Verbindung stehende Manuskripte, die für Hollands Abschlussarbeit vielleicht hilfreich sein könnten.
Leider hatte Holland jetzt wirklich keine Zeit, das Paket zu öffnen, daher legte sie es im Flur ab.
»Danke, dass Sie mir das gebracht haben«, sagte sie zu dem Mann. »Aber ich fürchte, ich muss jetzt …«
»Ich weiß, dass du nicht viel Zeit hast, und ich werde nur eine Minute davon beanspruchen«, versprach er und hielt ihr eine cremeweiße Visitenkarte mit glänzend smaragdgrüner Schrift hin.
MANUELVARGAS
Leitender Bankier und Erbschaftsspezialist
First Bank of Centennial City
Ganz unten stand eine Telefonnummer.
Auf der Rückseite entdeckte Holland eine Straßenkarte, auf der die Lage der Bank mit einem Stern markiert war, und darunter stand: Nur nach Terminabsprache.
»Von dieser Bank habe ich noch nie gehört«, sagte Holland. Die Professorin hatte in ihrem Kurs von einer Bank erzählt, die man ebenfalls nur nach Terminabsprache besuchen konnte. Doch dies war die eine Geschichte, an die sich Holland einfach nicht mehr richtig erinnern konnte, und aus irgendeinem Grund war sie nun ungewöhnlich skeptisch bei der Vorstellung, der Mann könnte von ebenjener Bank kommen.
Centennial City, wo sich besagte Bank angeblich befand, war nicht mal eine echte Stadt. Holland war zwar noch nie dort gewesen, aber sie wusste, dass es ein sehr altes, sehr reiches Viertel in Los Angeles war, das im Grunde nur aus einer exklusiven ummauerten Wohnanlage und einem ausgedehnten Park bestand, in dem reiche Leute tun konnten, was reiche Leute eben so taten, wie zum Beispiel Polo spielen. Sie hatte auch gehört, dass es in Centennial City einmal ein Boutiquehotel gegeben hatte, dass die Anwohner mit ihrem geballten Reichtum jedoch dafür gesorgt hatten, dass es geschlossen wurde.
»Hast du meine Briefe nicht bekommen?«, fragte er.
Holland hob die Augenbrauen. »Ich habe noch nie irgendwas von dieser Bank gehört.«
»Das tut mir so leid. Dann müssen die Briefe irgendwie verloren gegangen sein. Ich bitte um Entschuldigung. Ich dachte, du würdest sie einfach ignorieren, weshalb ich beschlossen habe, heute selbst vorbeizukommen, als eine Art letzter Versuch.« Mit ernster Miene nahm Mr Vargas den Hut ab und enthüllte noch mehr bauschig weißes Haar. »Vor fünfzehn Jahren hat einer meiner Kunden einen Safe gemietet. Kurz darauf ist diese Person verstorben. Da für den Safe bereits im Voraus bezahlt wurde, ist er bisher unberührt geblieben. Doch nun läuft die vereinbarte Mietdauer ab.« Mr Vargas hielt inne, um auf seine Uhr zu schauen. »Und zwar in vierundzwanzig Stunden. Wenn vor Ablauf dieser Frist niemand Anspruch auf den Safe erhebt, dann wird er mitsamt Inhalt verbrannt.«
»Lassen Sie mich raten«, warf Holland ein. »Sie sind hier, weil ich Anspruch auf diesen geheimnisvollen Safe erheben kann?«
Mr Vargas nickte gemessen und wischte sich den Schweiß von der Stirn.
»Wissen Sie«, sagte Holland. »Das ist eine wirklich hervorragende Geschichte.« Und das war es auch. Es war genau die Sorte Geheimnis, der Holland normalerweise nur schwer widerstehen könnte.
Doch auf einmal begriff sie, was sie so skeptisch machte.
Es schien schon ein außergewöhnlicher Zufall zu sein, dass sie in der vergangenen Nacht ihre Kontaktdaten an eine Fremde weitergegeben hatte, nachdem sie einer Spur der urbanen Mythen ihrer Professorin gefolgt war, woraufhin heute eine weitere lokale Legende vor ihrer Türschwelle auftauchte.
Vielleicht hatte das Mädchen von gestern Abend deshalb »Dummköpfe« gemurmelt. Nicht, weil Holland und Jake sich mit Magie und Mythen einließen, sondern weil sie so blöd gewesen waren, ihre Kontaktdaten herauszugeben.
»Ich würde Ihnen wirklich gern glauben«, fuhr Holland fort. »Aber das alles fühlt sich an wie eine Live-Version dieser Nigerianischer-Prinz-E-Mails, in denen einem jemand mitteilt, dass ein lange verschollener Onkel einem ein Vermögen hinterlassen hat und dass man, um dieses Vermögen zu bekommen, nicht mehr tun muss, als dem Absender der Mail seine Sozialversicherungsnummer, seine Bankdaten und fünf Liter Blut zu überlassen.«
Mr Vargas runzelte die Stirn. »Ich bin kein Betrüger.«
»Sie haben Betrüger gesagt, nicht ich.« Holland machte Anstalten, die Tür zu schließen.
Mit verblüffender Geschwindigkeit packte Mr Vargas den Rand der Tür. »Es ist klug von dir, misstrauisch zu sein. Aber wir wissen beide, wen deine Schwester und du vor fast fünfzehn Jahren verloren habt.«
Zum zweiten Mal an diesem Tag hatte Holland das Gefühl, ihr würde das Herz stehen bleiben.
Dieser Mann ist ein Hochstapler.
Ein Betrüger.
Er ist ein Lügner, redete sich Holland ein.
Die meisten ihrer Freunde wussten, dass sie eine Zwillingsschwester hatte. Und vor fünfzehn Jahren waren eine Menge Leute gestorben. Dieser Mr Vargas könnte diese Zeitspanne einfach willkürlich ausgesucht haben, um einen möglichst dramatischen Effekt zu erzielen. Das bedeutete nicht, dass er tatsächlich wusste, wen sie verloren hatte.
Holland konnte in ihrem Kopf praktisch die Stimme ihrer Schwester hören, die ihr streng befahl, die Visitenkarte wegzuwerfen und das, was auch immer sich in diesem Safe befand, brennen zu lassen – falls es denn überhaupt einen Safe gab. Lass die Toten dort, wohin sie gehören, würde January sagen.
Das Problem war nur, dass Holland nie das Gefühl gehabt hatte, ihre Eltern würden wirklich zu den Toten gehören. Vielleicht war dieser Mann ein Lügner, ein Betrüger, ein Hochstapler. Aber Holland konnte nicht anders. Sie fragte: »Falls ich zu dieser Bank gehe, was würde ich brauchen, um den Safe öffnen zu lassen?«
»Man muss dich dort nur identifizieren können. Allerdings …« Mr Vargas hielt inne und fuhr dann mit gesenkter Stimme fort. »Falls du dort einen Termin machst, dann tu mir bitte einen Gefallen. Erzähl niemandem davon. Und auch wenn du diese Nummer nicht anrufst, wäre es am besten, meinen Besuch hier oder den Safe niemandem gegenüber zu erwähnen.«
Die First Bank of Centennial City hatte keine Website. Und Holland konnte auch keine E-Mail-Adresse von Mr Vargas finden.
Sie lief in ihrem Flur auf und ab, wohl wissend, dass sie unbedingt zu ihrem Termin mit Adam Bishop aufbrechen musste, aber sie war einfach zu durcheinander, um Auto zu fahren.
Normalerweise lebte sie für die Jagd nach Hinweisen, doch dies hier kam ihr definitiv wie Betrug vor. Warum sonst hätte ihr dieser Mr Vargas raten sollen, niemandem von seinem Besuch zu erzählen? Und wenn die Sache stimmte, dann hätte er nicht mehr tun müssen, als ihren wahren Nachnamen auszusprechen oder die Namen ihrer Eltern, anstatt auf einen mysteriösen Todesfall anzuspielen.
Holland sprach die Namen ihrer Eltern niemals aus. Soweit alle hier in L.A. wussten, lautete ihr eigener Name Holland St. James. Ihr wahrer Nachname war ein sorgsam gehütetes Geheimnis.
Als ihre Eltern vor fast fünfzehn Jahren gestorben waren, hatten ihre Tante und ihr Onkel vorgeschlagen, ihn zu ändern. Alle wussten, wer ihre Eltern gewesen waren. Ihr Tod war zu einer Art Sensationsstory geworden, über die man heute noch sprach. Falls jemand herausfand, wer Hollands und Januarys Eltern waren, dann würde niemand, der mit ihnen zu tun hatte, noch an etwas anderes denken als daran, wie sie gestorben waren und was ihr Tod den Mädchen angetan haben musste. Die Schwestern würden niemals eine eigene Identität haben. Sie würden immer nur eine Geschichte sein, die endlos wiederholt wurde, oder Thema irgendeines Medien-Specials.
Sie dachte an den vergangenen Abend zurück, an dem sie so dumm gewesen war, dem Mädchen in der Gasse ihren Namen und ihre Nummer zu geben. Vielleicht war sie eine ehemalige Studentin der Professorin gewesen, und nachdem sie die Legende über den Uhrenmann gehört hatte, war sie auf diesen Trick verfallen, um persönliche Daten von Leuten weiterzuverkaufen und damit Profit zu machen. Es war nur folgerichtig, dass Studenten, die an Mythen glaubten, vielleicht auch auf einen Fremden hereinfallen würden, der vor ihrer Tür auftauchte und ihnen weismachen wollte, dass ihnen irgendein geheimer Safe vermacht worden war.
Holland wollte nicht naiv sein. Falls ihre Eltern ihr tatsächlich etwas hinterlassen hätten, dann hätte sie davon sicher nicht erst heute erfahren.
Sie konnte Mr Vargas’ Nummer nicht wählen, auch wenn sie sehr versucht war. Holland kannte sich selbst zu gut. Wenn sie sich erst einmal in ein Kaninchenloch begeben hatte, dann würde sie ihm bis ans Ende folgen. Die Vorstellung, sie könnte fallen, hatte ihr noch nie so viel Angst gemacht wie die Möglichkeit, vielleicht niemals die Wahrheit herauszufinden.
Folklore 517: Die besten Sidecars der Stadt
Dies ist der zweite Abend des Kurses.
Du befindest dich wieder in dem alten Kino. Heute Abend duftet es hier leicht süß. Karamellpopcorn – oder vielleicht Cracker Jack?
Der Geruch hängt so klebrig schwer in der Luft, dass du fast erwartest, die Studentin neben dir dabei zu erwischen, wie sie sich über eine Tüte des Süßigkeitenklassikers hermacht. Aber alle sind vollkommen gebannt davon, was auf der Bühne vor sich geht. Niemand trinkt Kaffee oder tippt auf seinem Laptop herum. Natürlich sind hier keine Laptops erlaubt, nur Stifte und Schreibblöcke – herzlichen Dank auch –, aber es macht sich auch niemand Notizen.
Die Professorin hat bereits mit ihrer Geschichte begonnen.
Ein kaum hörbares Klicken erklingt, und sie lächelt, als auf der Leinwand ein Bild erscheint. Es ist eine Fotografie einer Visitenkarte. Mattschwarz mit goldener Art-déco-Bordüre. Es sieht aus, als hätte in der Mitte der Karte einmal etwas gestanden, was nun aber verwischt ist.
Das nächste Foto ist eindeutig älter, das Gold und das Schwarz wirken dumpfer. Das Design der Karte ist zweifellos das gleiche, nur scheint hier nichts in der Mitte zu stehen, verwischt oder nicht.
Es folgen ein paar weitere Bilder, jedes noch älter als das vorhergegangene. Doch es ist jedes Mal die gleiche schwarz-goldene Karte darauf zu sehen.
Eigentlich war dir Art déco immer herzlich egal, doch nun faszinieren dich die eleganten Ränder. Schließlich werden die Fotos schwarz-weiß.
Unten auf einem der Bilder ist die Zahl 1942 zu lesen.
Dann 1936.
Gefolgt von 1927.
Die ganze Zeit spricht die Professorin kein Wort.
Du wartest darauf, dass sie etwas sagt – schließlich hat sie versprochen, euch eine Geschichte zu erzählen –, doch sie steht einfach mit ihrem Mona-Lisa-Lächeln da.
Schließlich hebt jemand die Hand, wartet jedoch nicht darauf, aufgerufen zu werden, sondern fragt: »Sollen wir eine dieser Karten finden?«
Die Professorin lacht trocken und kratzig. Nicht sehr amüsiert. »Diese Karten findet man nicht, junger Mann. Es gibt nur eine Möglichkeit, an eine davon heranzukommen.« Endlich beginnt sie mit ihrer Geschichte. »Es gibt eine Reihe von heimgesuchten Hotels in Los Angeles, und eines davon bevorzugt der Teufel ganz besonders. Er sagt, dass die Sidecars dort außerordentlich gut sind.«
Die Studentin neben dir flüstert: »Was ist ein Sidecar?«
»Irgendein Drink, glaube ich«, murmelst du zurück.
»Es ist ein Cocktail«, erklärt die Professorin und sieht dich direkt an. »Aus Cognac und Zitrusfrüchten. Der Sidecar wird schon seit über hundert Jahren getrunken, und wenn man dem Teufel einen davon ausgibt, dann überreicht er einem dafür seine Visitenkarte. Jede Karte kann nur ein einziges Mal für einen Termin mit dem Teufel verwendet werden, bei dem man einen Pakt abschließen kann, oder was man eben so möchte, und dann …«
Sie lässt die Hand in der universellen Geste durch die Luft gleiten, die Magie bedeutet, während sie erklärt, warum die Karten allesamt leer sind – sie wurden für einen Pakt mit dem Teufel verwendet, und danach ist die Schrift darauf verschwunden.
Du bist skeptisch. Der einzige Beweis der Professorin sind die Fotografien, und du bist dir nicht mal sicher, ob sie echt sind. Diese Bilder hätte jeder schießen können.
Der Teufel ist ein Mythos. Einer, an den du nicht glaubst.
Doch als du das Kino wieder verlässt, willst du eine dieser Karten haben.
DREI
Im vergangenen Jahr hatten sämtliche von Hollands Vorlesungen am Abend stattgefunden. Es fühlte sich anders an, jetzt am helllichten Tag über den Campus zu laufen.
Alles duftete nach frisch gemähtem Gras und sah aus wie auf dem Hochglanzcover einer Informationsbroschüre. Die späte Oktobersonne schien auf Fahrrad fahrende oder Frisbee spielende Studenten herab. Im Baumschatten saß ein Pärchen, das lachend an Bechern mit Eiskaffee nippte, während ein tragbarer Lautsprecher in Dauerschleife einen vertrauten Song spielte. Es war ein bisschen nervenaufreibend, immer und immer wieder dasselbe Lied zu hören, während sie den Campus überquerte, aber vielleicht ging es ja genau darum?
Es war der Tag vor Halloween.
Die Musik verklang, als Holland das Gebäude betrat, in dem das Institut für Folklore untergebracht war. Ihre Korkabsätze verursachten ein leises Tappen auf den Fliesen, während sie auf die Treppe zuhielt. Dieses Geräusch hatte Holland immer schon geliebt. Und jedes Mal, wenn sie High Heels trug, erinnerte sie das laute Klackern daran, warum sie eigentlich noch nie gern hohe Absätze getragen hatte.
Leider kamen die Korksohlenschuhe dem, was man als professionelles Outfit bezeichnen konnte, in ihrem Schuhschrank am nächsten. Im Coffee Lab gab es keinen Dresscode, also trug Holland meistens fließende Röcke, bis es dafür zu kalt wurde. Auch jetzt trug sie so einen Rock, einen knielangen weißen, und dazu eine kurze rosa Bluse, die nur knapp bis zum Bund reichte. Über ihrer Schulter hing eine Kuriertasche aus Leder, die January ihr bei ihrer ersten Arbeitsreise nach Italien gekauft hatte. Holland nahm sie überallhin mit.
Das Tappen ihrer Absätze verstummte, als sie den ersten Stock erreichte, der mit einem unglücklich gewählten grünen Teppich ausgelegt war, der sämtliche Geräusche dämpfte. Der Gang war mit ein paar Plastikkürbissen dekoriert und an den Wänden reihten sich geschlossene Türen mit dumpfen Bronzeplaketten darauf.
Adam Bishops Tür befand sich ganz am hinteren Ende, und sie stand bereits einen Spalt offen.
»Hallo?«, Holland klopfte an. Die Tür schwang weiter auf, wie um sie in dem leeren Büro willkommen zu heißen. Offenbar war die Klimaanlage kaputt, denn darin war es wärmer als draußen. Es fühlte sich an wie an einem vergangenen Sommertag.
Hier drin gab es keine Halloweendeko. Eigentlich gab es überhaupt nicht viel. Die Wände waren weiß und kahl, abgesehen von drei Diplomen einiger sehr elitärer und eindrucksvoller Universitäten.
»Entweder ist der neue Professor noch nicht mit dem Auspacken fertig, oder er möchte, dass man über ihn nur erfährt, auf welche überteuerten Unis er gegangen ist«, murmelte Holland vor sich hin.
»Das habe ich auch gerade gedacht«, erklang eine leise Stimme hinter ihr.
Holland fuhr herum.
In der Tür stand ein Student in zerrissenen Jeans und kariertem Hemd. Er schien etwa in ihrem Alter zu sein. Vielleicht ein Doktorand. Und er war – ihr fiel einfach kein passenderer Begriff ein – heiß. Unverschämt heiß. Sogar für L.A.-Standards, wo eigentlich alle mehr oder weniger attraktiv waren. Er musste aus einem anderen Fachbereich stammen, denn an ihn würde sie sich definitiv erinnern, wenn sie ihn hier schon mal gesehen hätte. Er hatte zerzaustes goldenes Haar, gebräunte Haut und schöne Arme – die zeigten, dass er trainierte und dass ihm das zwar wichtig war, aber so wichtig nun auch wieder nicht.
Sie sollte seine Arme wirklich nicht so anstarren.
Allerdings schien er sie ebenfalls zu mustern. Sein Blick ruhte auf der Kette, die knapp über ihrem Ausschnitt hing. Sie wollte seinem Blick schon folgen, fing sich jedoch rechtzeitig wieder.
Holland traf sich mit Jake. Auch wenn es sich nun, da sie darüber nachdachte, eher so anfühlte, als wäre ihre kurze Beziehung schon längst wieder vorbei. Sie erinnerte sich an ihn, wie sie sich an die Leute erinnerte, die sie vor ihrem Umzug nach L.A. gekannt hatte und die sie nur ein paar Kapitel ihres Lebens begleitet hatten.
»Und was davon stimmt jetzt?«, fragte der Student und deutete auf die schwarz lackierten Rahmen.
Hollands Bauchgefühl sagte ihr, dass es eine bewusste Entscheidung gewesen war, nur diese Diplome aufzuhängen. Allerdings verspürte sie den albernen Impuls, diesen Typen beeindrucken zu wollen, also entschied sie sich für die großzügigere Antwort. »Ich schätze, Professor Bishop ist noch nicht mit dem Auspacken fertig.«
»Dann irrst du dich. Er ist ein aufgeblasener Idiot.« Es klang nach einem Fakt, nicht nach einer Vermutung.
Das überraschte Holland. Bisher hatte sie nur Gutes über Professor Adam Bishop gehört. »Warum magst du ihn nicht?«
»Ich habe nicht gesagt, dass ich ihn nicht mag.«
»Du hast ihn einen aufgeblasenen Mistkerl genannt.«
Der Student hob eine Braue. »Ich glaube, ich habe Idiot gesagt.«
»Nein, du …« Sie hätte schwören können, dass er das Wort Mistkerl ausgesprochen hatte, aber als sie nun versuchte, die letzten paar Sekunden Revue passieren zu lassen, hörte sie ihn sagen: Dann irrst du dich. Er ist ein aufgeblasener Idiot. Idiot. Idiot. Mistkerl. Idiot. Mistkerl. Die Worte wiederholten sich in ihrem Kopf wie ein hängengebliebener Musiktrack. Bis sie etwas spürte, das nicht in ihrem Kopf war.
Tropf.
Tropf.
Tropf.
Holland hob die Hand, um das Blut aufzufangen, das ihr aus der Nase lief. Rote Tropfen landeten auf ihrer Handfläche, bevor sie ihren weißen Rock beflecken konnten.
»Hier, nimm das …« Der Student zog ein rotes Taschentuch aus der Gesäßtasche seiner Jeans. Natürlich hatte er ein Taschentuch dabei. Es war total normal, ein Taschentuch dabei zu haben – vor sechzig Jahren.
Holland hätte das Taschentuch für ein Requisit eines Halloweenkostüms gehalten, aber Halloween war erst morgen, und außerdem sah der Typ ansonsten ganz normal aus.
»Wer bist du?«, fragte sie.
Er schenkte ihr ein perfektes Lächeln. »Ich bin Adam Bishop.«
Holland lachte. »Ja, klar.« Kurz flackerte der Gedanke in ihr auf, dass heiß und lustig wirklich eine faszinierende Kombination war. Doch nun lächelte er nicht mehr. Stattdessen nickte er beunruhigend ernst. Und auf einmal fühlte sie einen schmerzhaften Stich der Scham.
»Vielleicht solltest du dich lieber setzen«, sagte er, und nun klang er auch noch beunruhigend ernst. Kein Lächeln oder Grinsen mehr, und sie kam sich albern vor, weil sie geglaubt hatte, er würde mit ihr flirten. Nur …
So hatte sie sich Adam Bishop nicht vorgestellt. Zerrissene Jeans, Karohemd, sexy Lächeln. Nein. Er war Professor. Und er hatte kein sexy Lächeln. Nur dass er es eben doch hatte, auch wenn er es ihr nicht mehr zeigte.
Sie versuchte, nicht auf seinen Mund zu starren, doch dann beging sie den Fehler, den Blick zu den Sommersprossen auf seiner Nase zu heben. Und dann waren da seine Augen. Haselnussbraun mit viel Grün, Goldsprenkeln und einem dunkelblauen Rand, und jetzt starrte sie ganz eindeutig doch.
»Ich glaube, du solltest dich wirklich lieber setzen«, sagte er. »Du siehst ein bisschen erhitzt aus.«
»Ich bin nicht erhitzt. Nur überrascht.« Aber ihr war definitiv heiß. Sie fühlte, wie sie rot anlief, und er musste es sehen.
Er schob die Hände in die Hosentaschen. Eine Geste, mit der er sich von ihr distanzierte, weil sie die Situation ganz eindeutig falsch interpretiert hatte. Dann wich er nachdrücklich einen Schritt zu seinem Schreibtisch zurück. »Fangen wir noch mal von vorne an. Ich bin Adam, und ich habe dich hergebeten, weil ich dein neuer Betreuer für deine Abschlussarbeit bin.«
»Entschuldigung, was?«, platzte sie heraus.
»Ich bin dein neuer Betreuer«, wiederholte er.
»Aber ich habe schon eine Betreuerin.«
»Deshalb habe ich ja auch gesagt, dass ich dein neuer Betreuer bin.«
»Das kann nicht sein.«
»Warum nicht?«, fragte er unschuldig, und da sah sie es wieder. Ein kurz aufblitzendes Lächeln, das zu fragen schien: Weil du mich attraktiv findest?
»Da muss es einen Fehler gegeben haben«, entgegnete sie gefasst. »Professorin Kim ist meine Betreuerin, seit ich mit dem Studium begonnen habe.«
Bei der Erwähnung der Professorin runzelte Adam die Stirn. »Aus diesem Grund habe ich dich gebeten, persönlich hier zu erscheinen. Mir wurde gesagt, dass ihr einander ziemlich nah gestanden habt.«
»Was soll das heißen, gestanden habt?«, fragte Holland nervös. »Ist ihr etwas zugestoßen?«
Sie überlegte, wann sie die Professorin zuletzt gesehen hatte. Das musste zu Beginn des Monats gewesen sein. Holland erinnerte sich noch daran, dass die Professorin ungewöhnlich aufgeregt gewesen war, weil endlich der Oktober begonnen hatte. Seither war Holland ihr nicht mehr persönlich begegnet, aber sie hatte vorhin dieses Päckchen von ihr bekommen.
»Soweit ich weiß, geht es ihr gut«, versicherte Adam Bishop ihr.
»Warum ersetzen Sie sie dann?«
»Weißt du das wirklich nicht?« Auf einmal schien Holland ihm leidzutun, und einen Moment lang schwieg er, als wüsste er nicht, wie er es ihr erklären sollte.
»Wurde die Professorin gefeuert?«, fragte Holland.
»Nein«, antwortete er vorsichtig. »Ich bin nicht befugt, mehr darüber zu sagen, aber sie kann nicht länger deine Betreuerin sein.«
»Moment … Warum nicht?«, entfuhr es Holland. »Die Professorin ist eines der beliebtesten Fakultätsmitglieder in diesem ganzen Fachbereich …«
»Aber ihre Vorlesungen sind voller Lügen«, unterbrach er sie.
Holland zuckte vor der plötzlichen Schärfe in seinem Tonfall zurück.
»Es tut mir leid, das sagen zu müssen«, erklärte er sanfter. »Ich weiß, dass du sie bewunderst, aber das solltest du wirklich nicht tun. Diese Frau ist eine Lügnerin und eine Betrügerin.«
Dann fügte er noch hinzu, dass er ihr wirklich keine weiteren Fragen über dieses Thema beantworten dürfe, aber Holland fiel es schwer, sich zu konzentrieren. Sie musste die Professorin irgendwie erreichen und herausfinden, was hier los war.
Sie wusste, dass es durchaus Fakultätsmitglieder gab, die ihre Professorin nicht ernst nahmen, aber die meisten dieser Leute hielten ihre Vorlesungen für einen harmlosen Spaß. Und niemand bezeichnete sie als Lügnerin.
»Tja, danke für diese Information. Es war nett, Sie kennenzulernen«, log Holland.
»Warte«, bat Adam. »Wir müssen uns noch über deine Arbeit unterhalten.«
»Schon gut, nicht nötig.« Holland wich bereits zurück, denn wenn sie noch länger blieb, würde sie entweder einen Streit anfangen oder in Tränen ausbrechen, und sie wollte beides nicht.
»Ich muss darauf bestehen.« Damit griff er hinter sich nach einer Kartonmappe auf dem Schreibtisch. Darauf stand nichts außer Hollands Name in strengen Blockbuchstaben in einer Ecke.
Auf einmal hatte Holland das Gefühl, auch sie würde in Schwierigkeiten stecken. Und dieses Mal musste sie nicht mal fragen, warum.
Ihre Handflächen wurden feucht, und unwillkürlich begann sie, mit ihrer Halskette herumzuspielen, während sie dabei zusah, wie Adam Bishop die Mappe aufschlug.
Holland war sehr stolz auf das, was sie geschrieben hatte, doch ihre Arbeit hätte eigentlich etwas bleiben sollen, über das nur sie und die Professorin Bescheid wussten. Sie hatte January einige Passagen daraus vorgelesen, was nicht sonderlich gut gelaufen war, und sie hatte so das Gefühl, dass es mit Adam Bishop nicht besser werden würde.
Nachdem er die Mappe aufgeschlagen hatte, hielt er den Blick eine gefühlte Ewigkeit auf ihre Arbeit gerichtet, bis er schließlich sagte: »Was du geschrieben hast, ist gut.«
»Wirklich?«, fragte sie erleichtert.
»Du kannst hervorragend schreiben«, versicherte er ihr aufrichtig. »Den Unterlagen der Professorin habe ich entnommen, dass du im Grundstudium kurzzeitig kreatives Schreiben als Hauptfach belegt hast, und das merkt man. Du hast mich mit deiner Version von Natalia Wests Tod sofort in den Bann gezogen. Die Art, wie du ihren rapiden Aufstieg zur Berühmtheit in den Fünfzigern mit ihrem mysteriösen Tod verknüpft hast, ist wirklich clever, und es ist dir ausgezeichnet gelungen, Parallelen zwischen den bizarren Details ihres Todes und anderen Stars zu ziehen, die unter tragischen oder unerklärlichen Umständen gestorben sind.«
Adam blätterte ein paar Seiten um. Holland versuchte, sich das Grinsen zu verbeißen. Sie war immer noch sauer wegen dem, was er über die Professorin gesagt hatte. Dennoch konnte sie den Gedanken nicht unterdrücken, dass an Adam Bishop vielleicht mehr dran war, als sie ihm zugetraut hatte. Er schien wirklich zu verstehen, was sie tat. Und er hatte sie clever genannt.
»Leider« – er schloss die Mappe und sah Holland an, ohne den leisesten Hauch eines Lächelns im Blick – »kannst du nichts davon verwenden.«
»Aber … Moment …«, stotterte sie. »Sie haben doch gerade gesagt, dass es gut ist.«
»Ist es auch. Deine Theorie darüber, dass einige der berüchtigtsten Todesfälle in Hollywood tatsächlich vom Teufel begangene Morde sind, ist äußerst unterhaltsam. Für einen Fantasyroman.«
Dies traf sie wie eine Ohrfeige. Zum zweiten Mal, seit sie Adam Bishop begegnet war, fühlte sie ihre Wangen heiß werden. Sie war sich nicht sicher, ob er das absichtlich machte oder ob er einfach ein Mistkerl war, aber sie hatte das Gefühl, reingelegt worden zu sein.
»Du bist seit dem Grundstudium in diesem Fachbereich, also muss ich dir wohl nicht erklären, was wir hier tun«, fuhr er fort. »Du wirst dir ein anderes Thema überlegen müssen.«
»Und wenn ich beweisen kann, dass nichts davon erfunden ist?«
Adam sah sie an, als wäre dies nicht die Reaktion, die er erwartet hatte. Einen Moment lang kam es ihr vor, als wäre er beeindruckt, doch genau wie sein rätselhaftes Lächeln war der Ausdruck sofort wieder verschwunden. »Du willst beweisen, dass es den Teufel wirklich gibt?«
»Ja.« Bei dieser Antwort überkam sie ein fast erschreckender Nervenkitzel, so wie jedes Mal, wenn sie an ihrer Arbeit schrieb. Es war ein dunkles Thema – sich in die alten Todesfälle Hollywoods zu vergraben und sie mit nicht beglichenen Teufelspakten in Verbindung zu bringen. Wenn sie zu lange am Stück recherchierte, bekam sie mentale Probleme, weshalb sie mit ihrer Arbeit auch zeitlich hinterherhing, und wenn die Professorin sie nicht unablässig ermutigen und Holland dieses Thema nicht auch persönlich so viel bedeuten würde, dann hätte sie es längst aufgegeben.
»Ich verstehe«, sagte Adam Bishop schließlich. »Die Professorin kann sehr überzeugend sein. Aber ich halte es für eine äußerst gefährliche Idee, ihren Geschichten nachzugehen. Also nein. Ich werde dir nicht die Chance geben, die Existenz des Teufels zu beweisen. Du wirst mir bis kommenden Mittwoch ein neues Thema für deine Arbeit nennen müssen.«
»Das ist viel zu wenig Zeit«, protestierte sie.
»Genau deshalb habe ich auch schon einen Vorschlag für dich.« Mit galanter Geste zog Adam eine Seite aus der Mappe und hielt sie Holland hin.
»Nein, danke.« Sie nahm das Papier nicht entgegen.
Schrecken huschte über Adam Bishops schönes Gesicht, als wäre ihre Antwort wieder nicht das, was er erwartet hatte. »Nimm es einfach mit, für alle Fälle«, beharrte er.
»Ich will Ihre Hilfe nicht.« Und sie brauchte sie auch nicht. Holland war egal, was er gerade gesagt hatte. Die Professorin war keine Lügnerin. Holland war nicht naiv, und sie würde es beweisen, für ihre Mentorin und für ihre Eltern.
Sobald sie Adam Bishops Büro verlassen hatte, zog Holland ihr Handy hervor und rief die Professorin an.
»Hallo, dies ist die Mailbox von M. Madeleine Kim. Ich rufe üblicherweise nie zurück, weil mir persönliche Begegnungen lieber sind. Wenn Sie mich wirklich sprechen möchten, dann kommen Sie während meiner Sprechstunden zu mir, oder schicken Sie mir einen Brief nach Hause – falls Sie das Glück haben, die Adresse zu kennen. Außerdem können Sie mir auch Briefe, Telegramme oder Pakete in mein Büro schicken.« Darauf folgte ein langer Piepton.
Holland legte auf und schickte der Professorin eine Nachricht.