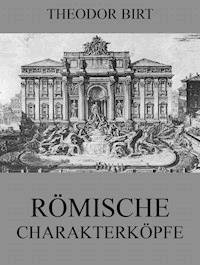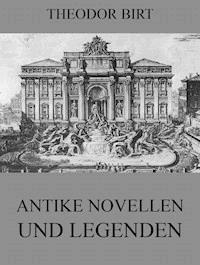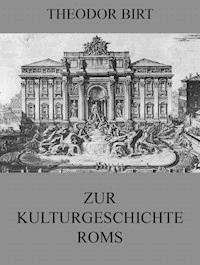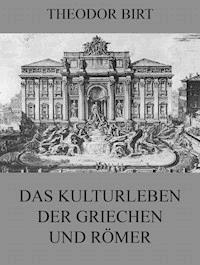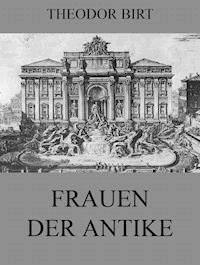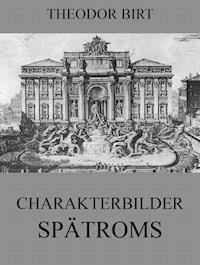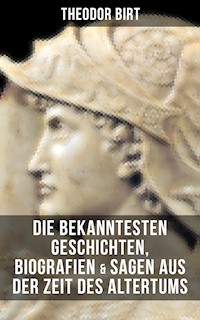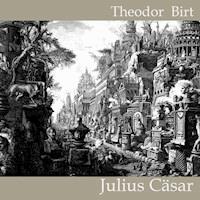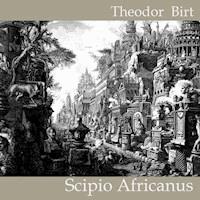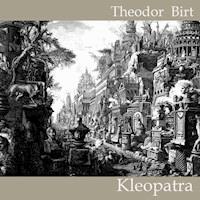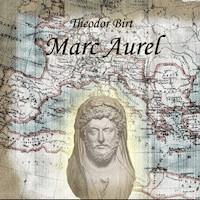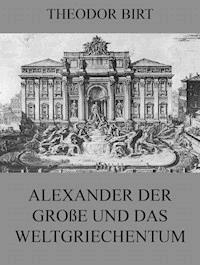
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Alexander der Große war König von Makedonien und Hegemon des Korinthischen Bundes. Mit seinem Regierungsantritt begann das Zeitalter des Hellenismus, in dem sich die griechische Kultur über weite Teile der damals bekannten Welt ausbreitete. Theodor Birts Biografie gehört zu den bedeutendsten Werken über diesen Helden der Antike.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 651
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alexander der Große und das Weltgriechentum
bis zum Erscheinen Jesu
Theodor Birt
Inhalt:
Theodor Birt – Biographie und Bibliographie
Alexander der Große und das Weltgriechentum
Einführendes
Einleitung
Mazedonien
Griechenland und König Philipp
Griechenland im vierten Jahrhundert v. Chr.
König Philipp
Alexanders Jugend
Das Perserreich
Alexander als Herr Asiens
Das erste Kriegsjahr in Asien (334 v. Chr.)
Das zweite Kriegsjahr (333 v. Chr.)
Von Tyrus bis Alexandrien
Die Entscheidung
Alexander König Persiens
In Iran
In Indien
Der Weltfriede und das Ende
Die Neugestaltung der Welt
Alexanders Nachleben
Das Weltgriechentum und sein Geistesleben
Aristoteles.
Hellenistische Naturforschung
Das alexandrinische Museum.
Hellenistische Kunst
Intermezzo
Der Trieb zur Weltreligion
Alexander der Große und das Weltgriechentum, T. Birt
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849622961
www.jazzybee-verlag.de
Theodor Birt – Biographie und Bibliographie
Birt, Theodor, Philolog, geb. 22. März 1852 in Wandsbek, verstorben am 28. Januar 1933 in Marburg. Studierte seit 1872 in Leipzig und Bonn, habilitierte sich 1878 in Marburg und wurde 1882 außerordentlicher, 1886 ordentlicher Professor daselbst. Seine Hauptwerke sind: »Das antike Buchwesen in seinem Verhältnis zur Literatur« (Berl. 1882); »Zwei politische Satiren des alten Rom« (Marb. 1888); die erste kritische Ausgabe des Claudian (Berl. 1892); »Eine römische Literaturgeschichte in fünf Stunden« (Marb. 1894); »Unterhaltungen in Rom. Fünf Gespräche deutscher Reisender« (Berl. 1895); »Sprach man avrum oder aurum?« (Frankf. a. M. 1897); »Der Hiat bei Plautus und die lateinische Aspiration bis zum 10. Jahrh. n. Chr.« (Marburg 1901); »Griechische Erinnerungen eines Reisenden« (das. 1902). Auch als Dichter hat er sich bekannt gemacht, z. T. unter dem Pseudonym Beatus Rhenanus, mit folgenden Werken: »Philipp der Großmütige«, Prologszene (Marb. 1886); »Attarachus und Valeria«, lyrische Erzählung (das. 1887); »Meister Martin und seine Gesellen« (Reimspiel, das. 1894); »König Agis« (Tragödie, das. 1895); »Das Idyll von Capri« (das. 1898); »Die Silvesternacht« (Reimspiel, das. 1900).
Alexander der Große und das Weltgriechentum
Einführendes
Einleitung
Jedes Geschichtsbild ist ein Bruchstück; denn wo wäre eine Geschichte ohne Vorgeschichte? Soll der Historiker mit Adams Apfel oder dem Ei der Leda beginnen? Ein ins Endlose gedehnter Bilderfries ermüdet, und es ist gut, daß wir ihn in eng gerahmte Bilder zerlegen können, die mehr Rast und die der Versenkung den Raum, nach dem sie verlangt, gewähren. So ist auch, was ich jetzt hier gebe, nur ein dürftig behauener Block aus dem Steinbruch der Zeiten. Was dazu an Vorgeschichte zu wissen nötig ist, findet man in meinem Buch über die alten Griechen dargelegt, das den Leser von Homer bis Sokrates führt. Dort endete die Darstellung mit dem Zusammenbruch Athens, dem Scheitern der Einheitsbestrebungen, dem Sturz des Alkibiades, dem neuen Zerfall in die Kleinstaaterei, die das Griechentum nach außen hin wehrlos machte. Gleichzeitig aber wurde der Höhepunkt des griechischen Geisteslebens erreicht in Plato und Praxiteles und ihren Konkurrenten, in der philosophischen Durchdringung und Wertung des Ichs und des Alls, die sich bis zur Offenbarung hochschwang, und in den Offenbarungen absoluter Schönheit durch die Hand der Bildmeister, die spielend die Menschengestalt zum Gott verklärten. In den Schöpfungen des Denktriebes und Künstlertriebes war Vollkommenheit, Größe und Ewigkeitswert, im politischen Handeln Schwäche und kläglicher Unverstand, wie sie der kurzsichtigen Masse eignet, die da Staaten bildet und leitet.
Jetzt treten wir in die Zeiten, wo Menschen wirklich Götter werden, und in das rein Menschliche des älteren Hellenentums beginnt sich das Glaubenswunder des Orients zu mischen, in die Kriege der Könige und stillen Kämpfe der Buchgelehrten der Fanatismus der Gläubigen.
Alexander ist der entscheidende Name; er heißt der Große. In der Tat: das ganz Großartige setzt mit Vollakkord plötzlich ein. Man müßte ein Epos schreiben oder mit Beethovens Tönen reden, um es sich recht zu vergegenwärtigen. Der monarchische Absolutismus beginnt durch Alexander das Bürgerleben zu bändigen und zu umfassen; alle Ländergrenzen fallen; das Kleinleben ist zu Ende; die Weltmonarchie Roms bereitet in ihm sich vor.
Die südländische Phantasie ist zur Vergöttlichung bereit, wo das Außerordentliche und Übergroße auf sie eindringt. Schon die Helden der Sage, Herkules, Achill, sollten einst Göttersöhne gewesen sein. Was aber hatten sie geleistet? Herkules erwürgte Löwen und holte die Äpfel der Hesperiden aus dem Märchenland; dem Achill gelang es nicht einmal, die Tore Trojas zu durchbrechen. Wie anders Alexander, der, Hunderte von Städten erobernd, als Sieger durch ganz Asien bis zum Himalaja ging, der, was mehr ist, das Antlitz der Weltgeschichte völlig veränderte, indem er das Nationalitätsprinzip zerbrach, den Menschheitsbegriff aufgriff und kühn verwirklichte, sein Reich zu einem Reich von Weltbürgern erweiterte, das alle Kulturgüter aller Länder zum Gemeingut aller machte. Das Weltreich Roms, in dem das ganze Altertum gipfelte und ausruhte, war nur das Nachbild dessen, was Alexander gewollt. Das kam aber auch der Religion zugute; für Christus wurde so der Weg gebahnt, ihm selbst wurde der Boden auf Erden bereitet.
Man fürchte also nicht, daß dies Buch nur von Schlachten erzählen wird. Kriegsberichte sind wir im Anfang unseres unseligen 20. Jahrhunderts bis zum Überdruß zu lesen gewohnt. Die militärischen Ereignisse machten in den Zeiten, von denen ich handeln will, nur den Boden frei für ein neues Geistesleben, das überraschend groß und reich und üppig aufwucherte in Wissenschaften, Künsten und Darbietungen der Frömmigkeit. Auf Alexanders Siege folgte das Weltgriechentum, der Hellenismus. Wir wollen auch sehen, was er der Welt gegeben hat. Astronomie und Christenlehre, sie allein schon zu nennen genügt. Beide erschlossen damals für alle Zeiten den Himmel, jede in anderer Weise. Und so umgrenzt sich meine Aufgabe, ein wunderbarer Aufstieg: Alexander der Anfang, Christus das Ende; von Gottessohn zu Gottessohn. Man wundere sich nicht über diese Formel, die entheiligend klingt. Wer weiter liest, wird sie verstehen.
Alexander selbst lebte nur so kurz; er starb 32jährig, da er kaum ins Mannesalter eingetreten, nach einem Regiment von nur 13 Jahren. Blendend wie ein grelles Blitzlicht auf dunkler Strecke taucht er vor dem Wanderer auf, um zu verschwinden. Um so wunderbarer schien dieser Mensch allen, den Zeitgenossen und den nachlebenden Jahrhunderten, und nicht nur allerlei Fabeln und Wundermärchen hängten sich früh an ihn; auch die eigentliche Geschichtsschreibung wurde sofort pathetisch und begann in Superlativen aufzuschweben, wo sie von ihm redete. Wir dagegen wollen schlicht im Positiven verharren (es bleibt dies immer noch erstaunlich genug) und Alexander den Großen, mit dem wir zu beginnen haben, als Produkt seiner Zeit und seines Landes zu begreifen suchen.
Der Sohn eines Reitervolkes: er trägt den Typus des mazedonischen Landadels, den wir auch sonst kennen, aber schwer geladen mit Energien, ein Mensch, in dem Intelligenz und Wille gleich stark entwickelt und urwüchsig zu raschester Wirksamkeit ineinander hingen; sein Denken schon ein Handeln. Er war ein Genie der Tat. Die Namen der berühmten Griechen der Vorzeit, Perikles, Epaminondas, selbst Themistokles verblassen vor ihm; diese feinen Menschen sind neben ihm wie die Windspiele neben dem Panther, wie die Schwalben neben dem Falken. Woher der Unterschied? Alexander war eben kein Grieche wie jene; er war Mazedone, seine Mutter Epirotin; sein Blut war anders gemischt. Er stammte aus frischem Erdreich, von einer noch unverbrauchten Rasse, die in ihm ihr Höchstes gab.
So hat er im großen Stil Epoche gemacht, den großen Strich durch das Gewesene.
Dasselbe taten nach ihm auch andere; ich nenne nur Julius Cäsar, Konstantin und Karl den Großen, Alexanders Fortsetzer; so auch Napoleon, und ihn zu vergleichen liegt für uns am nächsten. Denn wir Deutschen spüren noch immer persönlich dieses Korsen unheimliche Nähe, und wir können also an ihm am besten ermessen, was einst Alexander bedeutet hat: beide Heermeister ersten Grades, beide gleich ehrgeizig ohne Maß, gleich rastlos, unersättlich und unermüdlich und sieggewohnt bis zur Überhebung, aber voll Geist und so, daß sie sich tragen ließen von den Ideen ihrer Zeit, die sich durch sie erfüllten. Dabei beide fremdblütig und Außenseiter, der Korse und der Mazedone; im Mazedonen erfüllt sich die griechische Sendung, so wie der Korse italienischen Bluts die Ergebnisse der französischen Revolution nach Osten trug. Auch der Zug nach Osten ist beiden gemeinsam; beide haben unter den Pyramiden Ägyptens gestanden. Beide von ihrer Umgebung gefürchtet bis zur Angst, bitter ernst bis zum Jähzorn, als könnten sie nie lachen; Vollsoldaten und darum auf den Männerverkehr angewiesen, und sie wußten zu imponieren, angebetet von ihren Truppen, Offizieren und Gemeinen, aber auch unbedingte Herren der ausgezeichneten Generäle, die sie selbst erzogen. Zu den Frauen standen sie verschieden; aber beide blieben ohne Nachkommen ihres eignen Bluts, die, als sie von der Bühne abtraten, ihr Schwert und ihre Krone hätten fassen können. Sie ließen beide die Leere hinter sich.
Wer war der größere? Es scheint untunlich sie zu vergleichen. Denn Bonaparte kennen wir durch unzählige Memoiren, intime Briefschaften und Bildnisaufnahmen genau; er lebt vor uns, der kleine korpulente Mann mit dem Dreieckhut, den bleichen Wangen und brennenden Augen, und wir wissen, wie er blickte und sprach, schalt und tobte, die Schlachten persönlich führte, dabei schlecht zu Pferde saß usf. Dazu sein Verhältnis zu den Weibern. Hätten wir nur ähnliche Schilderungen, die wie Momentaufnahmen wirken, von Alexander. Er ist leider, wie die ganze Antike, unendlich weit von uns abgerückt und seine Züge, wenn nicht erloschen, so doch durch gewissenlose Skribenten stark übermalt; es gehört ein Studium dazu, sie freizulegen.
Trotzdem aber ist kein Zweifel: der größere Mann war Alexander. Das liegt schon in ihrem Wesen; Napoleon ein völlig moderner Mensch, daher reflektiert und ganz unnaiv, Alexander ein echter Ritter im Stil Rolands von Kaiser Karls Tafelrunde; der eine stets nüchtern und in jedem Wort und Blick kühl berechnend; auch sein Jähzorn gemacht, wo er zweckdienlich schien; der andere enthusiastisch, warmblütig, unverstellt, oft weinestoll als Zecher und auf Leben und Tod in unverhüllter Leidenschaft sich auslebend.
Aber auch der größere Erfolg war bei dem Mazedonen. Weltmonarchien sind freilich allemal vergänglich, sie sind ein Provisorium, das die unterjochten Nationen wieder beseitigen, sobald ihre natürlichen Instinkte die nötige Kraft gewinnen. Die Weltmonarchie Napoleons zerfiel vor seinem Tod, die Alexanders durch seinen Tod. Alexanders Politik hat einen folgenschweren Fehler nie begangen; Napoleon rechnete falsch, als er nach Moskau zog, und die Sonne von Austerlitz erlosch. So überlebte Napoleon sein Werk als Privatmann und Gefangener Englands, Alexander als Gott. Napoleon hatte keine Erben; als Erben Alexanders fühlten sich mit Stolz der Senat Roms und die Cäsaren, die seine universale Idee, die Idee der Völkerversöhnung durch Zwang, mit Wucht aufgenommen und durch Jahrhunderte zum Segen der Welt verwirklicht haben.
Mazedonien
Suchen wir Alexanders Heimat auf. Man beachtet einen Fluß erst, wenn er schiffbar wird, eine Nation erst, wenn sie anfängt Träger der Geschichte zu sein, sagt Friedrich der Große. Wir haben also allen Grund, auf Mazedonien achtzugeben.
Mazedonien liegt unter dem Balkan; seine Front aber weist nach Osten. Die ganze Balkanhalbinsel ist Asien offen zugewandt; sie stößt unmittelbar an Kleinasien an, auch dies Kleinasien eine Halbinsel, die gierig sich vorstreckt. Das ist bedeutsam. So wie Rußland und die Ukraine, war und ist auch die Balkanhalbinsel bestimmt, den Einfluß des übermächtigen asiatischen Riesen, gegen den Westeuropa sich wehrt, abzufangen. Daher kehrt sie Italien und Westeuropa gleichgültig den Rücken zu, und wer vom adriatischen Meer herkommt, sieht nur den klotzigen Schildkrötenrücken des durch unwohnliche, kalkige Gebirgsmassen verschlossenen Landes.
Nach Kleinasien zu dagegen tut die Halbinsel ihr Inneres weit auf mit offenen Buchten und Hafenplätzen und wohnlichen Tiefebenen, zu denen die Hochgebirge sich freundlich niedersenken, und so drang allezeit hierher über den schmalen Wasserstrang der Dardanellen der lastende Hauch des Orients und der Machtanspruch seiner Despoten, Sultane und Tschingiskane. Der Mazedone war, wie der Grieche in Byzanz, des persisch-babylonischen Weltreichs nächster Nachbar und seine Geschichte damals mit der Persiens so eng verflochten wie heute mit der Geschichte der asiatischen Türkei.
Im Norden ist die Halbinsel durch die breit flutende Donau, die zur Mündung strebt, von Europa abgesperrt, und unter der Donau her streicht nun der breite Kamm des Balkan als Ausläufer der österreichischen Alpen bis zum Schwarzen Meer hin, wie ein starker Balken, an dem die Halbinsel wie ein großer steinerner Handschuh hängt: ein massiver Stulphandschuh, wie die Fechter ihn tragen. Hellas selbst, das im Süden mit dem Peloponnes ins blaue Mittelmeer greift, das klassische Land der Städte Sparta, Athen und Theben, ist die fein fingernde Hand des Handschuhs, der im Norden weitauseinandergestreckte Teil der breite Stulpen; die Hand arbeitet, der Stulpen scheint wertlos, reglos und seelenlos. Aber ein starker Arm, voll strotzender Kraft, steckte darin. Es kam die Zeit, daß der Arm sich regte und die schwache Hand zu lenken begann.
Nehmen wir die Landkarte. Wer sie betastet, glaubt die Rauhheit der Gebirge zu fühlen, die sie dicht erfüllen. Am adriatischen Meer entlang – kaum ein Vergnügungsreisender setzt dorthin den Fuß – hausen in den Felsenwildnissen heute Albanesen, Montenegriner und Dalmatier, damals die griechischen Ätoler und Akarnanen, weiterhin auch Epiroten und Illyrier: rauflustige Bergvölker so damals wie heut'; die Epiroten unter Königen, die bald genug auch in Griechenlands Geschichte eingriffen.
Das Unbehagen vertreibt uns, und wir steigen ostwärts über den Pindus; da liegt in fruchtreicher Tiefebene das waldreiche Thessalien, das glückliche, nach dem griechischen Inselmeer offen, ein schönes Stück echtesten Griechenlands, das Vorland Mazedoniens. Wer von Athen durch die Thermopylen nordwärts ritt, kam dorthin. Über dem Land aber ragt wie ein Eck- und Grenzpfeiler der Olymp, der riesige Götterberg und Hochsitz des Zeus, der Thessalien von Mazedonien trennt.
Mazedonien war unlängst noch europäische Türkei. Unsere deutschen Soldaten kennen es; sie haben dort jüngst im Weltkrieg im Bund mit den Bulgaren bei Saloniki gekämpft. Kein Laut aber, kein Stein erinnerte sie da mehr an Alexander.
Für die Griechen war Mazedonien Fremdland, barbarisch. In der ganzen Ilias erscheint kein mazedonischer Held, wohl aber Achill, der Thessalier. Und so blieb es. Kein Mazedone durfte an den olympischen Nationalspielen teilnehmen. Auch noch Alexander selbst galt nur als Mazedone, nicht als Hellene, und auch ich werde mich darum diesem Sprachgebrauch fügen, so unberechtigt er ist. Die Ethnographie belehrt uns eines anderen. Der Grenzpfeiler des Olymp trug die Schuld; durch ihn war das Land wie abgeriegelt. Unter den nördlichen Abhängen des Olymp liegt freilich das Musenland Pïerien, wo man das Grab des Sängers Orpheus zeigte und dessen Rosen Sappho besang; Pïerien gehörte schon zu Mazedonien, und die Musen, die da sangen, sprachen sicher griechisch. Aber das nützte nichts.
Grabstein
Makedonische Familie. Grabstein aus Marmor, gefunden in Aiane, jetzt im Louvre zu Paris. Um 300 v. Chr. Nach Photographie.
Wirkliche Barbaren, die Triballer und Geten, wohnten an der Donau; Barbaren auch im unwegsamen Balkan, die Päonen und Dardaner, und so waren auch die Thrazier und Odrysen an der Maritza und in der Gegend Adrianopels Barbaren. Das Geblüt der Mazedonen war dagegen so echt griechisch wie das Achills. Aber schon in vorgeschichtlicher Zeit hatten sie sich von den Thessaliern, ihren nächsten Blutsverwandten, getrennt, waren in die lockende, vom Meer bespülte Ebene jenseits des Olymp ausgerückt und dort bald dem Griechentum durch Isolierung völlig entfremdet. Ihr Götterglaube blieb zwar derselbe, ihr Dialekt aber differenzierte sich stark. Die Trennung hatte aber weiter die Folge, daß die früh entwickelte Hochkultur der Griechen die Mazedonen lange Zeit nicht erreichte, und so blieben sie rückständig, lebten, in Dörfer verstreut, als Bauern oder Banditen der Jagd und dem Ackerbau oder dem Krieg, in häufiger Grenzfehde mit den Barbaren, die ich nannte; ohne Marine, ohne Handel, sogar ohne Schrift. Kein Stein mit Inschrift im mazedonischen Dialekt ist dort bisher aus dem Boden gehoben worden.
Heute fährt, wer nach Saloniki will, mit dem Orientexpreßzug Paris-Konstantinopel bequem und rasch über Wien und Pest, durch Serbien und Bulgarien zum Ziel. Moltke hatte es dereinst, im Jahre 1835, nicht so bequem. Mit dampfenden Pferden, die im Schnee versanken, so erzählt er, ging es im Herbst über die schlechten Wege, die den Balkan allmählich bis zur Paßhöhe bei Grabowa ersteigen. Nach Süden dagegen fällt der Balkan mit kahlen Steinwänden schroff ab, und der Reisende sieht dann in berauschendem Weitblick unter sich die Niederlande Thraziens und Mazedoniens hinausgedehnt bis ins glitzernde Meer. Im wilden Zug rauschen die Ströme im Frühling nach der Schneeschmelze vom Gebirge daher, so wild wie die jungen Thrazier und Mazedonen einst selber waren.
Ober-Mazedonien erstreckt sich noch weiter ins Gebirge hinauf, und die Üppigkeit der Vegetation steigert sich dort. Weinberge über Weinberge, Rosenfelder mit Millionen Blüten, die Heimat des Rosenöls. Der Wein ein schwerer Rotwein. Dazu Obsthaine und Maulbeerpflanzungen, Ölmühlen, Wasser- und Windmühlen stets im Betrieb. Kirschen, Nüsse, Feigen, Quitten, Granatäpfel in dichten Anlagen. Saftige Wiesen; große Herden von Pferden. In Wald und Unterholz aber hausen noch Bären, Schakale und Eber, und die Jagd ist noch Kampf. Das Klima gesund; am Tage Sonnenglut, die Nächte kalt. Im Winter gefrieren die Ströme; man bewahrt das Eis in Eisgruben für den Sommer. Thrazien und die Maritza waren das Sibirien der Antike, und man sprach von ihm, wenn man sich alle Schauer des Winters ausmalen wollte.
Begreiflich, daß da dereinst ein starker Menschenschlag wohnte, ein gesundes kernfestes Bauerntum; die Adligen flotte Reiter und hochgemut und wohlverpflegt auf ihren Höfen. An die heutige Bevölkerung Mazedoniens darf man nicht denken, eine Mischbevölkerung, vielfach zigeunerhaft; nur ab und an tauchen noch stattliche Männer dort auf, echt griechischer Prägung, bisweilen auffallend schön. Tagelöhner aber arbeiten auf den Gütern, deren Besitzer in den Städten das Wohlleben genießen; sie pflügen mit dem erbärmlichen Holzpflug, den sie mit Ochsen bespannen. In ihren elenden Lehmhütten nicht Tisch und nicht Stuhl; nur Bänke aus gestampfter Erde gibt's, auf denen man unausgekleidet schläft. Auch die besseren Landhäuser nur Fachwerkbau; auf dem Dach fehlt das Storchennest nicht. Man speist Schafskäse und hartgesottene Eier und Pilaw, der mit ranziger Butter zubereitet ist.
So klagt der Tourist, der heute dort reitet. Er reitet suchend durch Ebene und Höhen: wo war einst die Residenz Alexanders? und findet in der Fläche zunächst die Stadt Beröa, heute Karaferia; aber sie war es nicht. Wohl aber Ägä; wundervoll liegt Ägä mit steilen Gassen hoch am Gebirgsrand (heute Wodena); es war die ältere Residenz Mazedoniens mit den Königsgräbern. Da hat Alexander also seinen Vater begraben. Die Gräber sind indes schon im Altertum ausgeraubt worden. Reste des antiken Theaters aber sieht man dort wirklich noch; und da also hat Alexander einst des Euripides Dramen spielen sehen. Die eigentliche Residenz dagegen war Pella, das im Flachen hart an der Küste lag. Da wurde Alexander geboren. Heute ist da nur noch ein armseliges Dorf von 150 Häusern. Aber wir wissen: Pella zerfiel einst in zwei Teile; die Stadt selbst, die von Sümpfen umgeben war, und die königliche Burg, Phakos genannt, von der man nur auf einer Brücke zur Stadt gelangte. Auf der Burg war die Schatzkammer der Könige.
Prachtbauten fehlten ohne Zweifel. Die Schlichtheit herrschte. Aller Prunk wäre auch verblaßt vor der beispiellos großartigen Landschaft, die den armseligen Tagelöhner dort noch heute umgibt wie damals die Könige und Königssöhne. Eine abenteuerlich hochpathetische Landschaft: Stromschnellen und Meeresbrandung, und die wogenden Gebirgszüge ringsum wie erfrorene Leidenschaft. Gleich vorn aber das Riesenhafte, die Bergriesen Olymp und Athos, alles überschattend.
Die Marmorpyramide des Athos, 1935 Meter hoch, wurzelt mit ihren schweren Füßen unmittelbar im Meer. Heut hört man von den Athosklöstern, die auf der Höhe nisten, die Glocken hallen; im Altertum gab es keine Glocken und keinen Uhrenschlag, und die Himmelshöhe hüllte sich zeitlos in ein großes Schweigen und Feierstille. Ebenso nahe, aber noch riesiger der Olymp; er steht gegen Abend, auf massige Vorberge sich aufstützend, überschwänglich erhaben, ewiger Schnee sein Mantel; der glitzert und glüht in allen Farbenspielen, ein tägliches Schauspiel, und funkelt in purpurner Lohe unter dem Abendstrahl.
Die Giganten wollten den Olymp einst stürmen, um den Gottvater von seinem Thron zu werfen, so geht die Sage, und stülpten darum den Berg Ossa auf den Pelion; aber es war vergeblich; und auch Pelion und Ossa sieht man noch in der Ferne über dem Strand. Sie sind seit Urzeiten da stehen geblieben.
Die Abenteuerlust, der Wunderglaube, die Sehnsucht nach dem Übergroßen, hier, gerade hier konnte sie sich in Alexanders leidenschaftlicher Seele entzünden. Damals wohnten dort noch keine Türken und Muselmanen, deren Glaube die Seele stumpf macht und in Apathie einlullt und Schwunglosigkeit.
Auf den Berg Athos aber blickten die älteren mazedonischen Könige mit Grimm und Neid; denn er stand auf der Halbinsel Chalkidike, die, reich an Handelshäfen, dicht vor ihrer Küste lag, und die Halbinsel war in griechischen Händen. Die Könige waren nicht Herren ihrer eigenen Küste. So war ihr bescheidenes Reich eingeengt, blockiert von Barbaren und von Griechen. Nur am Strand entlang fuhren die mazedonischen Fischer auf ihren Booten, um das Netz zu werfen.
In der Tat, die Griechen: fast an allen Rändern des Mittelmeeres bis Marseille und weiter hatten sie ihre Kolonien, Kolonialstädte, größtenteils alte Gründungen, die fest in ihren Mauern steckten; so auch an den Rändern des Schwarzen Meeres bis nach Trapezunt und zur Krim, erst recht an den Küsten Thraziens und Mazedoniens. Am denkwürdigsten Byzanz, das noch heut die Dardanellen beherrscht.
Dies wunderbar betriebsame Kulturvolk, die Griechen, es war von Natur ein Wasservolk, das auf seiner kleinen Erdscholle nicht stillsitzen mochte. Sie waren wie die Möwen, die am Land nur ihre Brutplätze haben. Richtiger: ein betriebsames Kaufmannsvolk, das sich sagte: daheim haben wir nur Industrie, nur fleißige Hände, aber kein Rohmaterial. Holen wir es von draußen, von allen Küsten: Import und Export, Umsatz, Bewegung, mit fliegenden Segeln. Es lohnt sich. Die Barbaren, diese Landratten, sind dankbar, auch wenn wir sie übervorteilen. Erz und Getreide, Leder und Bauholz. Die Geldstücke kamen in den Truhen nicht zur Ruhe, und an den Wechslertischen rechnete man nach Zehntausenden.
Sollten die Barbaren dem wehrlos zusehen? Sie lernten vielmehr allmählich von den Griechen. Das Griechentum, das an den Küsten saß, färbte ab ins Innere des Landes und drang sachte durch alle Poren, wie der Purpur die Wolle durchdringt oder die Lippe sich färbt von der Frucht, an der sie naschte. Griechische Ware, griechisches Silbergeld, griechische Sprache drang in täglichem Austausch zu ihnen, und sie sahen das Treiben der klugen Leute aus nächster Nähe. So ging es überall, so auch den Thraziern, erst recht den Mazedonen. Auf der Halbinsel des Athos, von der ich sprach, lagen dicht beieinander die Griechenstädte Potidäa, Methone, Stagira, Olynth; hart daneben und weiterhin Amphipolis, Saloniki (damals Therma genannt) u. a. Stark befestigt wie Stachelmuscheln lagen sie da, für den Mazedonen lockend, aber unantastbar; auch hielt Athen, solange es das Meer beherrschte, seine Hand schützend über diese Städte.
Da an Eroberung nicht zu denken war, faßten die Könige Mazedoniens den Plan, die Gräzisierung ihres Volkes energisch durchzuführen, bis die Zeit kam, wo man die Griechen mit ihren eigenen Waffen schlagen konnte. Dabei wirkte der Instinkt der Rasse mit ein; denn im Grunde waren sie ja ihresgleichen. Lernen, hieß es. Es ist dies einer der rühmlichen Fälle, wo wir sehen, wie ein intelligentes Königtum sein Volk erzieht.
So konstruierten die Könige sich denn auch früh einen Stammbaum, der ihr Haus auf Herkules zurückleitete. Das war offizieller Schwindel, aber nützlich und bedeutete ein Programm, das man den griechischen Staaten vor die Augen hielt. Es besagte: ihr schließt uns aus? Wartet nur, bis wir unser Hausrecht in Griechenland geltend machen.
Athen war anerkanntermaßen die Hochschule aller Bildung. Eine Anlehnung an Athen war also notwendig; und auch die Pietät wirkte darauf mit ein. Denn Xerxes, der Perser, hatte, als er zum Angriff gegen die Thermopylen zog, unterwegs Mazedonien besetzt und ausgeraubt, und nur den Siegen Athens verdankte das Land damals seine Befreiung. So blieb, obschon unterbrochen durch Schwankungen während des peloponnesischen Kriegs, ein nahes Verhältnis bestehen. Auch als Athens Macht zerbrochen war, wagten die Mazedonen sich nicht daran, Olynth, Potidäa, Amphipolis für sich zu erobern. Das wäre verfrüht gewesen
Intelligent vor allem der König Archelaos, des Alkibiades Zeitgenosse, der nicht nur aus seinen Landbauern sich eine Infanterie schuf, Heerstraßen baute und aggressiv schon einen Vorstoß gegen Hellas, gegen Thessalien wagte, sondern der, was mehr, seine Hauptstadt schon damals zu einem Hauptsitz griechischer Bildung zu erheben unternahm. Geistige Eroberung! So trat er in Beziehung zu Hippokrates, dem berühmtesten aller griechischen Ärzte, dem Schöpfer der medizinischen Wissenschaft, Abkömmling einer thessalischen Adelsfamilie, den auch die heutige Medizin immer noch mit aller Ehrfurcht nennt. Grundlegende Schriften schrieb Hippokrates wie auch sein Sohn Thessalos, und dieser Thessalos wurde des Königs Archelaos Leibarzt, hernach ein Enkel desselben der Leibarzt der Roxane, der Gattin Alexanders des Großen. Aber auch die modernsten Theaterdichter, Tragöden, zog Archelaos nach Pella. Theaterspiele waren stets mit Gottesdienst verbunden, und sie hatten durchaus ethisch-religiös erziehenden Zweck. So kamen aus Athen Agathon, vor allem aber Euripides dorthin; Euripides gab dort sein Bestes; denkwürdig genug: er starb als Hofdichter in Pella. Aber auch die modernste Musik zog der König heran; Timotheos mußte sie ihm liefern, der sensationellste Komponist für Vokalmusik in jenen Tagen. Das setzt viel voraus, Hingebung an die Schicksalsprobleme der tragischen Dichtkunst, Musikverständnis für eine raffinierte Melodik und Harmonik: schon damals ein Hochstand der Bildung in den Kreisen des mazedonischen Adels und Hofes. Der Theaterbau in Pella wird ein Publikum von mindestens Zehntausend vorausgesetzt haben. Man sprach dort jetzt auch schon attisches Griechisch; das Mazedonisch war gut genug für die Rekruten. Daß man sich schönklingende griechische Eigennamen gab, wie Alexander und Archelaos, war ohnehin selbstverständlich.
Die Athener selbst blickten natürlich hochnäsig auf diese Bestrebungen herab. Vom Maler Zeuxis ließ sich Archelaos in Pella seine Saalwände mit Fresken schmücken; da hieß es in Athen: um des Zeuxis Bilder zu sehen reist wohl jeder gern auf eigene Kosten nach Mazedonien, um den König selbst zu sehen niemand, es sei denn, daß der König seine Gäste mit Geld lockt. Das Land schien immer noch halbwegs ein Grönland oder Kamtschatka.
Gleichwohl erschien in der Tagesliteratur Athens damals doch auch eine Schrift, die sich nach Archelaos selbst betitelte und in seinem Interesse über die Prinzipien der monarchischen Staatsform gehandelt zu haben scheint. Denn die staatlichen Einrichtungen waren in Mazedonien, etwa wie bei den Germanen des Tacitus, noch sehr unentwickelt, vor allem im Gerichtswesen. Die Mazedonen waren eben ein Land- und Reitervolk und keine Städter.
Der Verfasser jener Schrift hieß Antisthenes. In diesem Mann und seiner Schule keimte aber ein neuer Zeitgeist, und wir werden von seinen Gesinnungsgenossen noch mehr zu erwähnen haben. Man nannte diese Schule die kynische oder cynische; vom Hund (kyon) nahm sie ihre Bezeichnung. Der Hund, der immer international ist, war gleichsam ihr Wappentier. Es sollte dahin kommen, daß ein König Mazedoniens die übervölkischen Ideen dieser Schule in die weite Welt hinaustrug.
Auf des Archelaos gewaltsamen Tod folgten Thronwirren, die weitere Erfolge der mazedonischen Politik zunächst verhinderten. Dann kam die Zeit, wo Plato, der Athener, sein berühmtes Lehrbuch vom besten Staate schrieb. Da war es der König Perdikkas, der sich unmittelbar an Plato, den Meister der Staatstheorie, um Rat und Hilfe wandte, und wir sehen, wie Plato ihm rät, an der Erbmonarchie unbeirrt festzuhalten; nur müsse natürlich philosophisch gerecht, d. h. unter Schonung des Rechtsgefühls regiert werden, und Plato schickt dem König einen seiner rechtskundigen Schüler als Ratgeber zu. Das ist nur wieder ein Symptom, aber ein bedeutsames, für das Hochstreben der Vorgänger Alexanders.
Dann kam Philipp, Alexanders Vater (der Name Philipp war in Mazedonien beliebt, denn er bedeutet den Pferdefreund). Philipp wurde der Unterjocher Griechenlands. Der greise Plato erlebte das nicht mehr; er hätte sonst ratlos staunend mit seinen alten Augen um sich geblickt. Seine gutherzige Staatslehre rechnete nicht mit so großen Verhältnissen, wie sie jetzt plötzlich sich einstellten. Das staatsmännische Genie war völlig überraschend in Mazedonien erwacht, das sich ins Große reckte, da es nach hohen Zielen griff. Ich rede nur von Philipp, noch nicht von seinem Sohne. Mit diesem Menschen konnte kein Themistokles, kein Alkibiades sich vergleichen. Denn Themistokles war als Retter Griechenlands nur Defensivpolitiker gewesen; hier dagegen setzte die entschlossenste Offensive ein, und ihre Erfolge waren verblüffend. Was Xerxes nicht erreicht hatte, erreichte Philipp. Noch weniger verträgt Alkibiades den Vergleich; denn er war zwar Offensivpolitiker gleich großen Stils, aber er konnte sich die Mittel nicht sichern, seine Pläne durchzuführen. Es ist günstiger, König zu sein als Beamter einer launisch wetterwendischen Demokratie der sog. klugen Leute. Der Athener pflegte seine besten Führer im Stich zu lassen. Wie anders stand der Mazedone da! Da galt noch Vasallentreue, Gefolgschaftsdienst. Das Volk war in der Hand seines Königs.
So vollzog sich jetzt der Sieg des schlichten Soldatentums über die disziplinlose Masse der Hochgebildeten.
Griechenland und König Philipp
Griechenland im vierten Jahrhundert v. Chr.
Zunächst gilt es, einen Blick auf die Zustände in Hellas zu werfen. Sie sind unendlich verwickelt und an Mißklängen reich, und es ist ermüdend und betrübend, dabei zu verweilen; betrübend in der Tat, der Selbstzersetzung und Dekadenz eines edlen, eines der gottbegnadetsten Völker zuzusehen.
Panhellenismus, Einigung des gesamten zerspaltenen Griechentums mit geschlossener Front gegen äußere Feinde, das war bisher das große Ziel der besten Politiker im Lande gewesen. Nur mit Gewalt war das durchzusetzen. Athen hatte es vor 50 Jahren angestrebt; Alkibiades, der Athener, war der letzte, kühnste und befähigtste Vertreter dieser vaterländisch ausgreifenden Politik gewesen. Diese Politik war erledigt durch den 27jährigen Peloponnesischen Krieg und die Niederwerfung Athens im Jahre 404. Schon dieser Ausgang bedeutete eine Knickung der Volkskraft, eine Vorstufe des Untergangs. Was jetzt folgte und die nächsten 50–70 Jahre erfüllte, war nichts als Steigerung des Ruins, die Fortsetzung des traurigen Bruderkriegs von Griechen gegen Griechen. Aus dem dreißigjährigen Krieg wurde der hundertjährige. Es lohnt nicht, diese Dinge im einzelnen zu erzählen; schon die Abneigung gegen alles Vergebliche lähmt mir die Feder; denn es war ein vergebliches Kämpfen und Ringen.
Im Schoß der Zeiten schlummerte noch das Schicksal, ungeboren. Was würde es sein? Man ahnte das Verhängnis, und die Nervosität der Volksseele war groß; sie wirkte zerrüttend. Neid, Haß und Hader, eine Balgerei der Staaten ohne Aufhören, jener Kleinstaaten, die nun seit Jahrhunderten, auf sich angewiesen, eng nebeneinander lagen. Die Pest hört einmal auf zu wüten, nicht aber die Seuche der Zanksucht, wenn sie einmal ausgebrochen. Auch wir Deutschen wissen davon. Es gibt nur ein Heilserum, das hilft: die Knechtschaft. Knechtschaft bis zur Entwaffnung. Im großen römischen Reich ist dies wirklich späterhin zur Durchführung gekommen.
Und es war nicht nur Grenzhader; der Parteihaß in den Städten selbst kam hinzu; ewiger Umsturz; sahen sich die Demokraten in der Übermacht, so schlugen sie die Optimaten, die sog. besseren Leute, in der Gasse mit Knüppeln tot oder jagten sie doch aus der Stadt, und umgekehrt. Die Verbannten verschworen sich dann zur Rache, zur gewaltsamen Rückkehr; und so fühlte sich keine Stadt vor Putschen und Krawallen, vor blutigen Überfällen sicher.
Unter den Staaten waren Sparta, Athen und Theben jetzt die drei konkurrierenden größeren Gemeinwesen, die ehrgeizig nach der Vorherrschaft strebten; denn auch Athen hatte sich von seinem schweren Fall wieder aufgerichtet; aber sobald eines von ihnen zu mächtig wurde, fielen die übrigen Kleinstaaten, die sie als sog. Bundesgenossen um sich sammelten und auf die sie sich stützten, von ihnen ab. Es war nicht nur Angst vor der Ohnmacht, sondern auch Angst vor der Macht.
Das Hellenenland war zu klein; der Raum fehlte, sich auszudehnen. Man saß wie in einer engen Schachtel und trat sich ständig auf die Füße. Es war just so wie heut mit der Wohnungsnot, wo im Haus zu viel Zwangsmieter sitzen, die sich gegenseitig die Türen einrennen. Die Moral gewinnt dabei nicht; vielmehr gedeiht die Verrohung und wuchert wie scheußliches Unkraut mit geilen Trieben: Zersetzung und Niedergang, damals ohne Frage noch ärger als nach dem unseligen Dreißigjährigen Krieg, der unser Deutschland vor nun 300 Jahren physisch und moralisch verwüstet hat. Man lasse sich durch die edlen Töne nicht täuschen, die uns aus der griechischen Literatur der Zeiten, da ein Plato lebte, umrauschen. Gewiß, der Idealismus der Auserlesenen steigerte sich damals noch; aber die von Idealen getragene Sittlichkeit schloß sich jetzt ab und zog sich in die Schulen, in die Klubs der Weisheitsfreunde zurück. Das städtische Leben draußen sank ins Gemeine, die politische Moral erst recht. Auch die Satire des Aristophanes war verstummt, und kein gesundes Lachen scholl mehr herzbefreiend in die verbissene, verhetzte Stimmung der Massen. Glaubte man, man wäre allein auf der Welt?
Der Mazedone freilich sah noch dem allen gelassen zu; der Perser aber rieb sich die Hände, denn er hatte davon zunächst den Vorteil. Die persischen Statthalter oder Satrapen im nahen Kleinasien waren seine Diplomaten; sie gaben acht; ja, sie hatten seit langem schon ihre Hände im Spiel, und das Spiel schien zu gelingen:auro, non ferro; es zeigte sich jetzt, daß das persische Gold siegreicher war als die persischen Waffen.
Freiheit, das Recht der Selbstbestimmung fordert die Ehre der Nation. Sie zu wahren und zu hüten, ist ihr Stolz. Unauslöschlich glorreich war der Sieg der Griechen über Xerxes, den Perser, gewesen; er ist in der Weltgeschichte das vielgepriesene Muster aller Freiheitskämpfe geblieben wie hernach der Sieg der Schweizer über Burgund, der Niederlande über Philipp, den Spanier. Nun aber waren seit der Schlacht bei Salamis hundert Jahre vergangen, und das Ehrgefühl war völlig dahin. Persien war Trumpf. Gold, Gold! Man kämpfte jetzt blindlings mit persischen Hilfsgeldern für persische Zwecke. Schon der Ausgang des peloponnesischen Kriegs war ja in Wirklichkeit ein Sieg Persiens gewesen; denn ohne das persische Gold hätte der Spartaner Lysander sich die Flotten nie bauen können, die Athen schließlich bezwangen; es waren somit persische Flotten und die Rache, die einst Darius den Athenern geschworen, war also damit endlich vollzogen. Als danach Sparta zu mächtig zu werden drohte (denn spartanische Truppen wagten sich zum Kampf gegen Persiens Satrapen nach Kleinasien), wurde Athen alsbald mit Hilfe von persischem Gold neu befestigt; vor allem mußte ein athenischer Admiral daher, Konon hieß er, um die Spartaner mit persischen Galeeren von der See zu vertreiben Es gelang. Vor allem aber wurde Theben gegen Sparta gehetzt, und Theben gehorchte gern; es hatte ja landesverräterisch einst schon zu des Leonidas Zeit auf des Xerxes Seite gegen Hellas gefochten. Inzwischen stellte sich Athen wieder, wie in seinen besseren Zeiten, an die Spitze eines »Seebundes«, kam aber immer nur zu halber Kraft, und Persien sorgte nun dafür, daß die drei genannten Mächte andauernd sich möglichst balancierten, ein ewiger Kampf von zweien gegen einen, bei wechselndem Bündnis. Die drei Mächte waren wie die drei Personen im Lustspiel, wo immer zwei Personen sich lieben und die dritte Person dann voll Eifersucht dazwischen fährt. Für den Perser ein Lustspiel, für den Beteiligten eine Handlung von erbärmlicher Tragik.
Trat in diesen Kämpfen, die schließlich 70 Jahre andauern sollten, Erschlaffung ein, so gab es wiederholt Friedensschlüsse, aber sie waren wie ein halber Takt Pause im wilden Presto; Bestand hatten sie nie. Der Perserkönig in Susa aber – er hieß jetzt Artaxerxes – mußte diese Friedensschlüsse jedesmal genehmigen und zu garantieren versprechen, als wäre er oberste Instanz, aller Griechen Souverän und der eigentliche Beherrscher der Weltlage; denn kein Grieche traute dem Jawort und Eidschwur des andern Griechen mehr. Begreiflich genug, daß der König nun auch sogleich seine Bedingungen stellte; d. h. alle kleinasiatischen Griechenstädte, wie Milet und Ephesus, ließ er zunächst sich wieder ausliefern. Die alte Macht des Darius war damit glücklich wiedergestellt, die Großtaten des Themistokles und Kimon annulliert, und breit aufgestützt kauerte der asiatische Riese nun wieder dort am Küstenrand und starrte selbstzufrieden und drohend über das Inselmeer zu den kleinen Griechen hinüber, die nicht begriffen, wo ihr Feind war.
Aber auch sein eignes Militärwesen, das Soldatentum, wurde dem Griechen zur Plage. In der Art, wie sich ein Volk bewaffnet, verrät sich sein Charakter, sein Kulturstand. Die Geschichte aber lehrt, daß die allgemeine Wehrpflicht erziehend, das Söldnertum nur zu leicht demoralisierend wirkt. Damals aber hatte sich das Söldnerwesen, das wir in den Landsknechtshaufen Karls V., das wir bei Wallenstein und noch in der Armee Friedrichs des Großen wiederfinden, zum erstenmal ausgebildet, und es wurde alsbald zum Unwesen. Zu des Leonidas Zeit war es noch anders; da fochten nur die Bürgermilizen, und Hausväter und -söhne griffen, wenn der böse Feind anrückte, rasch zu Helm und Harnisch, der über dem Herd hing, und traten brav zum Gefecht an. Aber solche Miliz hält die großen Dauerkriege nicht aus; der Bauer muß endlich wieder zu seinem Pflug, der Schuster zu seinem Pfriemen zurück; der Bürger zahlt also jetzt vielmehr Kriegssteuer, um nicht selber zu fechten, und der Staat wirbt nun kampflustiges junges Volk, er wirbt Landsknechte für Geld an aus der Nähe und Weite, die dauernd von dem Solde leben und für den sich schlagen, der am besten zahlt.
Eine folgenschwere Neuerung; der Waffendienst wurde hinfort zum Beruf; es gab jetzt einen Soldatenstand, der sich breitmachte und nichts wollte, als schlagen und verdienen; ein abenteuerlustig vaterlandsloses Vagantentum. Heermeister und Truppe verwachsen zur Gemeinde, zum Korps, bis morgen alles wieder auseinander läuft. Der Korpsgeist ersetzt den Vaterlandssinn. Besonders aus Arkadien, dem bärenhaft wilden Bergland, das der Moderne sich gern als Heimat des seligen Friedens und zärtlichen Schäferglücks denkt, strömten die Burschen, stämmige Kerle, massenhaft zu den Werbeplätzen, da die Heimaterde zu wenig bot. Arkadien war kaum ein »Staat« zu nennen. Aber auch in den Handelsstädten gab es, da die sog. Sklaven, die Unfreien die Fabrikarbeit taten, eine Menge untätigen Menschenmaterials. Früher schickte man die überschüssige junge Mannschaft zu Kolonialgründungen aus; aber das war vorbei; die Erde war längst verteilt. Und so lagen die rüden Gesellen jetzt zu Tausenden in den Städten herum. Ein Glück, wenn es Krieg gab; dann zogen sie ab, womöglich ins Ausland, nach Thrazien, Ägypten; denn die dortigen Könige zahlten gut. Schon im Jahre 401 führte Kyros, der aufständische persische Kronprätendent, 12 000 solcher Griechen mit sich zum Kampf nach Babylon. Wehe, wenn sie unbeschäftigt waren! Bis zum 40. Lebensjahr unter den Waffen, ohne Haus und Hof und unbeweibt: das gab das wüsteste Treiben, Radau, Säbelrasseln, Gassieren, Suff und Weiberschändung; »daß Gott erbarm«! Wir brauchen es uns nicht auszumalen. Man lese Wallensteins Lager, und man ist im Bilde.
Wenden wir uns hiernach zu den Soldatenführern. Da lassen sich allerlei glänzende Namen wie Agesilaos und Epaminondas nennen, die wir einst in der Schule lernten und die gesperrt gedruckt in den Geschichtstabellen stehen. Cornelius Nepos hat einst ihre Biographien geschrieben, freilich so dürftig, als ob er für unsern Brockhaus schriebe. Wozu indes ihre Siege aufzählen, die verpufften und wie die Schaumkrone auf der Welle in Nichts zergingen? Wichtiger als ihre Erfolge sind für uns die Fortschritte der Kriegskunst und Kriegswissenschaft, die man in der Tat ihnen verdankte und die auch den Mazedonen zugute kamen. Der Grieche war schon von vornherein ein viel besserer Soldat als der Orientale; denn schon seine Bewaffnung war besser, wie sie ein Industriestaat liefert; und dazu kam nun die sich immer weiter steigernde Fechtkunst. Die unseligen Zustände, die ich schilderte, waren denn doch die beste Kriegsschule. Die Kriegskunst ist die Schützerin aller andern Künste, und man muß sie verehren, vorausgesetzt, daß sie für die Freiheit der Völker und daß sie für den Frieden kämpft.
In König Agesilaos sehen wir einen der ehrwürdigsten oder doch achtbarsten Vertreter des Spartanertums. Xenophon, der Sokratesschüler, hat ihn verherrlicht; Agesilaos war also, obschon ganz nur Kriegsmann und allen philosophischen Phrasen abhold, doch ein rechter Mensch im Sinne des Sokrates; dabei bewußt altmodisch und unmodern; auch seine Erfolge verdankte er der altbewährten Tradition seiner Heimat; denn das Kriegswesen alten Stils gipfelte ja im Militarismus Spartas. Der aber wurde eben jetzt überholt.
Wie anders in der Tat die eleganten Strategen Konon und Iphikrates, Chabrias und Timotheos, die Athen damals aufstellte: Söhne der Weltstadt und moderne Weltkinder, Kondottieren flott, üppig, genial und durch keine Skrupel behindert. Athen selbst mit seinem feigen Bürgertum, dem Geschacher der Händler, dem Geschrei der Volksversammlungen, dies ewige Einerlei war ihnen zuwider, und sie entzogen sich nach Möglichkeit seiner Kontrolle. Sie liebten die Gefahr und kämpften natürlich gemeinhin für Athen, doch aber auch für Persien, für Ägypten. Wenn nur gut gezahlt wurde! Blieb von Athen das Geld aus, so brandschatzten und räuberten sie, wo sie konnten. War Muße, so lebten die Herren draußen als Gast des Königs von Cypern oder auf Lesbos oder auf ihren thrazischen Besitzungen.
Iphikrates war der imposanteste unter ihnen von nahezu fürstlichem Gepräge, und es soll mir genügen, kurz nur von ihm zu reden. Der Thrazierkönig Kotys nahm ihn zum Schwiegersohn. Als in Mazedonien Thronwirren ausbrachen, ist er es, der die flüchtige Königin Eurydike mit ihren Söhnen in seinen persönlichen Schutz nimmt. Als der Perserkönig gegen Ägypten marschieren läßt, führt Iphikrates in Athens Auftrag ihm zur Hilfe 20 000 griechische Söldner dorthin; denn Athen suchte ängstlich die Fühlung mit Persien zu wahren. Persien aber mußte natürlich zahlen. Um so kecker erscheint der andere der athenischen Kondottieri, Chabrias, der umgekehrt nach eigenem Belieben mit seinen Schiffen und Söldnern in den Dienst des Ägypterkönigs Nektanebos trat, des Königs, der eben damals Ägyptens Freiheit gegen Persien verfocht. Athens Demagogen machten dem Chabrias darum den Prozeß. Aber er ließ sie schreien und war nicht zu fassen. Die thrazische Hochzeit des Iphikrates aber wurde in Athen mit Hohn auf die Bühne gebracht, jene Hochzeit, wo es Butter, wirkliche Butter von Kuhmilch zu essen gab (etwas durchaus barbarisch-ungriechisches) und wo der Schwiegervater, der König Kotys, angeblich selbst die Suppe im Gußgefäß auftrug, eine Küchenschürze vorgebunden. Dabei wurden dem athenischen General zu Ehren von griechischen Solisten Festlieder politischer Tendenz gesungen, aber, was unerhört, nicht etwa zum Lob Athens, sondern Spartas und Thebens.
Hätte Athen nur schon früher solch geniale Leute, und in solcher Anzahl gehabt! Konon war vor allem Meister des Seekriegs; aber auch im Landgefecht ordnete er eine originelle Kampfstellung an, die sich bewährte; man redete davon, und Konon selbst ließ sich sogar in dieser Stellung porträtieren; natürlich als Statue; es fehlte nur, daß er sie auf dem Kasernenhof aufstellte. Iphikrates aber stellte das ganze Militärwesen auf einen neuen Boden, als er an Stelle der bisherigen schwerfälligen »Hopliten« die leichte Infanterie schuf Das Fußvolk der »Hopliten« schritt in erdrückender Eisenrüstung schwerfällig wie Schildkröten oder wie wandelnde Festungen einher; es stand vortrefflich, war aber manövrierunfähig. Jetzt mußten die Waffenfabriken kleine Rundschilde liefern, die leicht im Arm hingen; der schwere Eisenpanzer fiel ganz fort; statt dessen wurden für den Nahkampf die Spieße erheblich verlängert, ebenso die Degenklingen. Damit entstanden fliegende Korps; auf Überraschung, schnellen Bewegungswechsel, Laufschritt bei der Verfolgung kam es an. Und so erlebte Sparta, das bisher, wie es sich rühmte, noch niemals eine Feldschlacht verloren, durch Iphikrates die erste empfindliche Schlappe bei Korinth (im Jahre 394). Das war ein Omen.
Agesilaos war schon zu alt geworden; Sparta, das stolze, lernte nicht um; es blieb bei seinem alten System, indes schon Epaminondas heranwuchs. Spartas Macht und Ansehen in Hellas zerbrach endgültig in der katastrophalen Schlacht bei Leuktra des Jahres 371, und sie war des Epaminondas Werk.
Dies führt uns nach Theben. Epaminondas war Thebaner; als Idealmensch wird er uns geschildert und ist eine der gern gefeierten Gestalten des Griechentums geblieben; denn er war, sein Ich vertiefend, auch den Musen zugewandt und als Musiker, Philosoph und Redner durchgebildet; erst 40jährig schwang er sich zum Staatsdienst, zur Führung Thebens auf. Unvermählt; die Vaterstadt nannte er seine Geliebte, den Ruhm der Schlachten seine Nachkommenschaft. So hat er in der Tat für zwanzig Jahre (371–351) Theben zur Großmacht erhoben; sein Genosse im Ruhm war Pelopidas. Bis in die Länder Thessalien und Mazedonien hinein griffen die thebanischen Waffen aus; dabei geschah das Bedeutsame, daß der nachmalige König Philipp, der noch Knabe war, aus Mazedonien nach Theben entführt wurde.
Was war es, wodurch Epaminondas in der Schlacht bei Leuktra Sparta niederwarf? Seine eigenartige Strategie, die wiederum Epoche machte. Denn er stellte seine Angriffsfront nicht, wie bisher üblich, gradlinig vor den Feind, sondern schief; den einen Flügel ließ er vorspringen, der dabei doppelte Tiefe der Aufstellung hatte. Er ballte also schon damals, wie später Napoleon es tat, die Masse auf einen Punkt zusammen, um den Durchbruch zu erzwingen. Von Pelopidas aber hören wir, daß er auch schon die seitliche Überflügelung des Feindes durch Kavallerie aufbrachte; das war die Form des Angriffs, die danach auch Alexander der Große befolgt hat. Thessalien lieferte seine Pferde. Die Bedeutung der Kavallerie wuchs; auch Xenophon schrieb darüber; die Reiterschlachten Alexanders bereiteten sich vor.
Aber auch der Fortschritte des Belagerungswesens sei endlich noch beiläufig gedacht. Achill war einst siebenmal vergeblich um Troja gerannt. Aber auch Athens berühmte lange Mauern, die Perikles gebaut hatte, schienen noch unersteiglich, und nur durch Aushungerung bezwang Lysander bekanntlich die Stadt. Jetzt arbeitete der erfinderische Grieche schon mit Sturmböcken, Minen und Gegenminen, mit Geschützen, die Steine oder Bleikugeln schleuderten. Die Historiker berichteten damals schon sorglich über diese Dinge, und eine militärische Fachliteratur entstand, von der uns wertvolle Reste erhalten sind. Als Verfasser erscheint ein Mann aus dem Söldnerlande Arkadien. Jene Reste handeln von Kundschafterwesen, Fernmeldungen, Lichtsignalen, chiffrierten Geheimbriefen. Der Belagerte spannt Segeltücher gegen die anfliegenden Wurfgeschosse aus und bestreicht alles Holzwerk gegen Feuerbrand mit Essig.
So bildete das kluge Griechenland damals die Kriegskunst für seine Gegner aus, die es hernach mit ihrer Hilfe knechteten (denn auch Rom waffnete sich mit dieser Kunst). Griechenland starrte in Waffen wie ein Igel, wie ein Nest von Igeln, und Persien hütete sich wohl, mit seiner großen Hand in das Nest zu greifen; es wartete, bis Griechenland an langsamem Selbstmord zugrunde ginge.
Sparta war, wie wir sahen, so gut wie erledigt. Als Epaminondas starb – er fiel schon i. J. 362 bei Mantinea –, schrumpfte sogleich auch Thebens Übermacht wieder zusammen. Daneben stand nur noch Athen, das sich zwar, um seinen Großhandel zu sichern, durch Erneuerung seines Seebundes zur Herrin des Inselmeers gemacht hatte, das aber doch die alte Vollkraft nie wieder gewann; es war kurzatmig wie ein Bergsteiger mit pfeifender Lunge geworden, und keinen seiner gelegentlichen Erfolge wußte es mit Nachdruck auszubeuten. Seine ausgezeichneten Feldherrn, die ich nannte, starben hinweg. Handels- und Industriestadt, dazu Metropole und Lieferungsstelle für Kunst und Philosophie und sonstige schöne Dinge, wollte es außerdem immer noch ein bißchen herrschen und siegen, steckte aber in ständiger Finanznot, die man begreift, wenn man hört, daß der Staat jedem Mann im Volk, damit er von seinem Handwerk abkommen und hübsch im Parlament mit abstimmen könne, seine Tagegelder zahlte. Wozu war man auch sonst demokratisch? Jeder Mann im Volk bekam seine Diäten. Das war mehr, als wenn wir den Volksvertretern Diäten zahlen. Die Kriegsgewinnler aber gediehen in Athen natürlich trotz allem. Die Stadt war stolz, wenn sie ihren Feldherren einmal Statuen errichtete; sie errichtete gelegentlich auch ein Standbild des Friedens; Kephisodot ersann das rühmenswert schöne Bildwerk, und wer in München war, kennt es: Eirene, die Friedensgöttin, einfach, schlicht und edel, als junge Mutter steht sie da, die ihren Knaben im Arm hält; der Knabe aber ist der Reichtum. Es ist dies einer der seltenen Fälle, wo das Motiv der Madonna mit dem Kinde im Altertum auftritt. Die Meinung aber ist, daß der Weltfriede den Nationalwohlstand gebiert und nährt. Der Sinn war gut. Aber es sollte keinen Frieden geben. Das Schicksal setzte ein.
Große Teile des Publikums gaben gar nicht acht, und die Gleichgültigkeit war groß. Von den Künstlern ist nicht erst zu reden. Nehmen wir nur Plato, den Großmeister der Staatslehre; in all seinen Schriften steht auch kein Wort, keine Silbe der Furcht vor einer Katastrophe der Vaterstadt. Plato war gar nicht nationalpolitisch, er war bloß sozial orientiert. Aber auch die vaterlandslos-internationale Gesinnung verbreitete sich schon, und das Militär, die vaterlandslosen Söldner, waren davon die ersten Urheber; eine regelrechte Arbeiterinternationale; es waren freilich nur Arbeiter des Krieges. Und die Sekte der Straßenphilosophen griff das auf; schon Antisthenes, Platos Nebenbuhler, predigte offen das Weltbürgertum: wir sind nicht besser als Perser und Mazedonen! Hundsphilosophen (Cyniker) nannten sich diese Leute, wie schon anfangs erwähnt ist; der Hund war ihr Ideal, der gleichfalls keine Landesgrenzen kennt. Dazu kam aber auch noch die Kaufmannschaft, und, wollen wir ein Bild jener Zeiten gewinnen, gilt es auch bei ihr noch kurz zu verweilen.
Der Piräus war zunächst immer noch der Hauptstapelplatz der weiten Griechenwelt: großer Geschäftsumsatz; dazu Freihandel, der von Sizilien und Südfrankreich, von Ägypten und Cypern her anlief und vom Asowschen Meer durch die Straße der Dardanellen ging. Die Frachtschiffe drängten sich auf den Wasserstraßen mit hohen Segeln. Wer mitmachte, wurde reich, und was ist schöner als im Luxus zu leben? Das durfte nicht aufhören. Der Staat selbst mußte das wünschen; denn der Betrieb sicherte den Nationalreichtum. Persien und die Balkanländer, die seit langem die griechischen Industriewaren kauften, bezahlten, wie wir sahen, jetzt auch die Söldnerhaufen, und die trugen das Bargeld alljährlich in vollen Beuteln heim. So vermehrten die Umlaufsmittel sich stark, und auswärtiges Gold strömte als Zahlmünze schon damals reichlich an die griechischen Plätze, die sonst nicht mit Gold, sondern nur mit Silberkurant arbeiteten. Die persische Golddareike gewann schon über den athenischen Geldmarkt die Herrschaft.
Denn auch der Geldhandel war voll entwickelt, das Bank- und Wechselgeschäft. Wer Kapitalien vorschoß, nahm zum mindesten 12 Prozent Zinsen. Die Finanzmänner gründeten Kompaniegeschäfte, freilich ohne Haftpflicht, wie wir sie fordern. Eine Fülle von Prozeßreden sind uns aus Athen erhalten, die uns in diese Dinge, Kreditwesen, Differenzen der Käufer und Verkäufer, Einblick gewähren.
Begreiflich nun aber, daß alle diese Geschäftsleute die ewigen Kriege verabscheuten wie der Landbauer den Hagelschlag; allein schon das Kapern der Handelsschiffe brachte, wenn es Seekrieg gab, ärgste Verluste und steigerte für den Transport ins Unberechenbare das Risiko. Wenn dagegen Persien herrschte und den Dauerfrieden unter den Griechen und auf dem Meer erzwang, war der Handel gesichert, alle Fahrstraßen frei, das Geschäft garantiert. Es wäre Erlösung; denn man wußte, daß die Regierung des Großkönigs dem Kaufmann überall freieste Hand ließ. Wozu noch viel von Nationalehre reden?
Man begreift die Trauergefühle der echten Patrioten, wenn sie den verhaßten Bruderkrieg, der nicht abriß, und wenn sie zugleich dies Publikum sahen mit seiner Gleichgültigkeit bis zum Pazifismus. Denn es gab immer noch Patrioten alten Stils, die mit heißem Herzen panhellenisch dachten und zu Themistokles und Kimon zurück wollten. Auch wir Deutschen kennen solche Stimmungen. Ihre Verzweiflungsrufe tönten in die Massen. Wenn zu den großen Festspielen Olympias aus allen Stämmen die Jugend zusammenströmte, traten jene Männer als Wanderredner auf, das Volksgewissen aufzurütteln mit dem Ruf: »Verwerflich die Trägheit, verwerflich aber auch der Bruderkrieg! Seid einig! Persien allein unser Feind! Wir brauchen ein neues Salamis.« Vor allem galt Theben seit alters als die sündhafte Stadt der Verräter; denn auch jetzt stand es, wie einst zu des Xerxes Zeit, mit Persien in besonders enger Fühlung; war doch Pelopidas persönlich als Thebens Gesandter auf der berühmten Königsstraße nach Susa gefahren, um seine Pläne durch persischen Druck zu sichern. Den Fußfall mußte man tun, wenn der Großkönig Audienz gewährte. Welche Schande!
Jene Reden gingen auch als Bücher um, aber wir hören leider nicht, daß sie wirkten; nur die Schönheit der Worte wußte man zu preisen, und nur die Ästheten lasen sie, nicht die Politiker. Die triviale Menge blieb, wie sie war; die Frivolität siegte.
Worte halfen nicht; es half nur der Zwang. Um das Jahr 372 tat sich im Land Thessalien, dem Vorland Mazedoniens, ein Zwingherr auf; die Geschichte nennt ihn Jason von Pherä; der geniale Mensch unterwarf sich als Tyrann das ganze thessalische Land; Pherä seine Residenz. Das Schwergewicht der Geschichte verschob sich für kurze Zeit nach Thessalien durch ihn, und er plante nun wirklich schon, wie wir hören, als Vorkämpfer aller Griechen einen Rachezug und Einbruch in das Perserreich. Aber ihn traf der Dolch, der jedem Tyrannen drohte: ein glänzendes Meteor, das früh erlosch.
So war denn ein anderer Zwingherr nötig. Mehr als zwanzig Jahre vergingen noch, da wandte ein Athener – der Mann war ein 90jähriger Greis und hieß Isokrates
Nun also Philipp von Mazedonien. Was wir bisher gehört, war wie die wüste Rauf- und Prügelszene in Wagners »Meistersingern«; man sehnt sich, endlich eine Solostimme zu hören.
Es war für die Stadt Theben, es war für Hellas das Verhängnis, daß Philipp, dies begabte Raubtier, als Knabe für drei Jahre nach Theben kam, das eben damals sich Großmacht dünkte. Der Bengel war frühreif, wach und schlau, dazu herzgewinnend und mutmaßlich auch bei Gelde. Dem Epaminondas und Pelopidas sah er da als gelehriger Schüler genau auf die Finger, lernte das neue Kriegswesen, aber auch die Schwächen der Einzelstaaten gründlich kennen, wie schwerfällig ihre Politik, wie brüchig ihre Bündnisse; dazu die Habgier und Käuflichkeit des Durchschnittsbürgertums.
Als er wider alles Erwarten, 23 Jahre alt, die Regierung Mazedoniens übernahm (im Jahre 359), fand der junge Mensch sein Land durch Wirren unter seinen königlichen Verwandten, mehr noch durch den Einbruch barbarischer Nachbarvölker bis zur Ohnmacht geschwächt und kläglich zerstückelt. Für die Herren in Theben und Athen war Mazedonien damals geradezu eine Niete geworden, mit der man nicht mehr rechnete. Philipp aber überblickte mit kaltem Hirn die Lage, und sein Genie begann sofort zu spielen; er organisierte sofort ein Heer als Mustertruppe nach modernstem Vorbild, warf die Barbaren, Illyrier, Päonier, Thraker in raschen Feldzügen oder auch durch Verhandlung aus dem Land und trieb die etlichen Prinzen, die ihm seine Machtstellung bestritten, ins Exil oder brachte sie ums Leben. So war er Alleinherrscher, das Gebiet Mazedoniens überraschend schnell in seinem früheren Umfang wiederhergestellt, an Bodenfläche annähernd so groß wie unsere Provinz Hannover, doppelt so groß wie Thessalien, viermal so groß wie die Gebiete, die damals noch unter Athens Oberhoheit standen. Im Heere hatte er die berühmte mazedonische Phalanx eingeführt, den Kerntruppen die alles überbietende, fast 16 Ellen lange Stoßlanze, die Sarissa, in die Hand gegeben. Dabei war er gar nicht einmal rechtmäßiger König. Dies wäre vielmehr sein Neffe Amyntas gewesen. Amyntas war noch Knabe; Philipp sein Vormund; aber Amyntas wagte auch später sein Herrscherrecht dem Onkel gegenüber nie geltend zu machen. Erstaunlich, daß Philipp ihn nicht umbrachte.
Denn der Verwandtenmord grassierte seit langem und durch Generationen in dem Königshaus just so wie in den Königshäusern der alten Germanen; man denke an die Merowinger oder an Shakespeares englische Königsdramen. So hatte man auch Archelaos, den Gönner des Euripides, den intelligentesten der früheren Herrscher, durch Mord beseitigt. Vettern und Stiefbrüder waren ihres Lebens nie sicher. Die Vielweiberei der Könige kam dazu; man hielt es damit wie der Held Gideon im Buch der Richter. Daher eben die vielen Stiefbrüder; daher aber auch die ewige Eifersucht, der Rachedurst der Königinnen. Die Frauen treten hier in Mazedonien dramatisch auf die Bühne, an Blut gewöhnt wie die Gotin Brunhilde oder wie Fredegunde bei den Franken. Auch Olympias, Alexanders Mutters, war solcher Gewaltmensch.
Philipp hatte sein Kronland errettet, das Vaterland wiederhergestellt, und nicht nur der junge Amyntas wird darum in dankbarer Verehrung zu ihm aufgeblickt haben, sondern auch die Männer des Landadels, die wieder sicher auf ihren Höfen saßen, zum Teil hochbegabte und willensstarke Recken und Herrenmenschen, hielten fortan unbedingt zu ihm, trotz aller Selbständigkeit, die dieser Adel dem König gegenüber behauptete. Die Majestät konnte sich hinter kein steifes Zeremoniell verschanzen; völlige Redefreiheit herrschte vielmehr in ihrem Verkehr. Jene Herren hießen des Königs Gefährten (ἑταῖροι). Es war Kameradschaft. Freilich dienten die Söhne der Edelherren als Knappen oder Pagen am Hof, wo sie stramm in Zucht gehalten wurden; auf Vergehen stand die Peitsche. Die human erzogenen Griechen berichten uns das mit Schaudern. Ein derbes Leben. Derb oder roh und gänzlich unsentimental. Später rückten die Knaben dann in hohe Stellungen, zum Heermeister oder Statthalter, auf.
Aber auch ganz Griechenland war für den so sympathischen jungen Monarchen, der aus schwierigster Lage sich so rasch hochgehoben, begeistert und voll Bewunderung; und Philipp verneigte sich auf das liebenswürdigste und dankbar für die Anerkennung wie ein guter Schauspieler nach allen Seiten. Es ist nichts praktischer als beliebt zu sein. Er spielte die Sirene, die betört und würgt. In Wirklichkeit war sein Lebensplan schon jetzt in ihm fertig. Eroberung. Er hatte es als Knabe den Thebanern abgelauscht. Er wollte es besser als sie machen; denn er war in viel günstigerer Lage als sie.
Die ganze Balkanhalbinsel wollte er haben, den ganzen Fausthandschuh bis in die Fingerspitzen. Sein Arm war stark, und er konnte damit selbst Persien bedrohen.
Aber gemach. Es galt die kleinen Griechenstaaten einzeln zu schlucken, Bündnisse unter ihnen zu verhindern, freundlich gegen alle zu sein bis auf den einen, dem er gerade zuleibe ging.
Zunächst Stärkung der Hausmacht. Weithin erobernd griff er im Balkangebirge und über den Balkan bis ins heutige Serbien und Albanien aus. Festungen oder Burgen sicherten gleich den neuen Besitz. Die unterjochten Stämme stellten Hilfstruppen, für Gebirgskriege trefflich zu verwenden. Aber auch an den lieben Griechen vergriff er sich schon ohne Besinnen. Sie saßen in ihren festen Mauern an seiner mazedonischen Küste unter dem Athos und Olymp, sowie jenseits des Olymp in Thessalien. Er wußte ihnen beizukommen. Nur nicht mit dem Säbel rasseln! Mit Lüge und Bestechung kämpft sich besser. Er selbst hat über sich geurteilt: nicht seiner siegreichen Schlachten wolle er sich rühmen, denn das Verdienst um sie teile er mit anderen; wohl aber seiner Diplomatie, seiner Kunst der Gesprächsführung, die ihm die größten Erfolge brachte; denn dabei habe ihm keiner geholfen. Was die Lüge im Kampf der Völker vermag, haben wir auch heute erfahren; damals war sie Philipps persönlichste Gabe.
In Thessalien waren Unruhen; freundschaftlich griff er, Ruhe schaffend, als Protektor im Lande ein und behielt dort sogleich einige Plätze besetzt. Welch freundliche Fürsorge! Dann überfiel er die erwähnten griechischen Küstenstädte einzeln. Diese Städte hatten sich dem athenischen Seebund, der sie noch hätte schützen können, eigensinnig entzogen. Denn Athen steckte all sein überschüssiges Geld in seine Kriegsflotte, und diese konnte Schutz gewähren, da sie damals noch ohne alle Nebenbuhler das ganze Inselmeer beherrschte. Plötzlich belagert Philipp Amphipolis; Athen runzelt die Stirn; denn Athen selbst erhob auf den Besitz dieser Stadt Anspruch; Philipp beteuert: »Bei den Göttern, ich nehme sie nur, um sie euch, ihr Teuren, zu überliefern.« Die Athener glaubten das, sandten der Stadt keine Hilfe. Philipp hatte die Beute. Ein Narr gibt heraus, was er hat (i. J. 358).
Und so ging es weiter. Ganz Griechenland erschrak. Unter dem Athos lagen auf der Halbinsel Chalkidike, vom Meer mm spült, 32 Handelsstädte dicht beieinander, Heimstätten alter griechischer Kultur. Philipp beschloß kurzerhand ihre Vernichtung und überrumpelte und zerstörte sie sämtlich. Sie existierten nicht mehr. Die stärkste und stolzeste unter ihnen war die Stadt Olynth, einst von Athen kolonisiert. Philipp verstand sie zuvor zu ködern; er spielte den Großmütigen, wendete ihr neues Gebiet zu (es war das Gebiet einer der Nachbarstädte, die er vor kurzem zerstört hatte), beschenkte die führenden Personen in Olynth mit Geld oder Geldeswert, wie mit Rinderherden, die aus Mazedoniens Weiden herbeigetrieben wurden. Als die Stadt eingeschläfert ist, steht er plötzlich vor ihren Toren, Unterwerfung fordernd. Jetzt rufen die Olynthier nach Athen. Als die athenischen Kriegsschiffe anliefen, war es zu spät. Die Stadt fiel durch schmählichen Verrat und wurde dem Erdboden, auf dem sie stand, gleichgemacht, die Frauen und Kinder auf dem Sklavenmarkt verhandelt (i. J. 348). Würden sich für sie Käufer finden? Gewiß. Sogar reiche Athener kauften sich die jungen Töchter Olynths und prahlten damit, indem sie sie mißbrauchten. Philipp rieb sich indes die Hände und trank einige Schläuche Weins leer vor Vergnügen. Er wußte jetzt, wie's gemacht wird. Die Offiziere, die Kommandanten der belagerten Städte selbst waren von ihm bestochen. Auf ihre Anordnung fuhr sich im Stadttor ein Lastwagen voller Bausteine fest, das Tor war nicht mehr zu schließen, und der Mazedone drang ein; und ähnliches mehr.