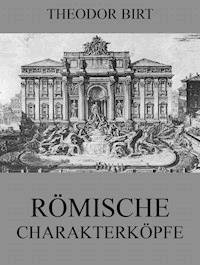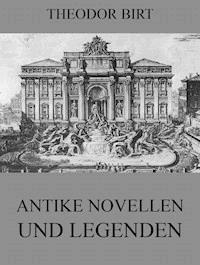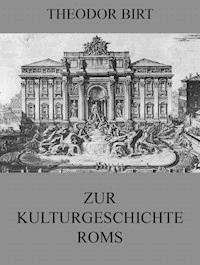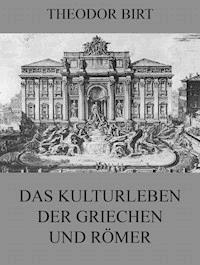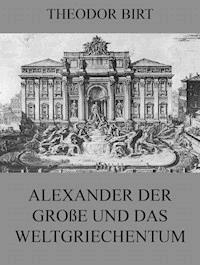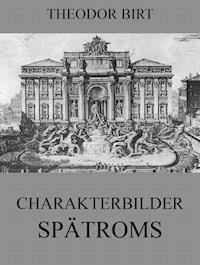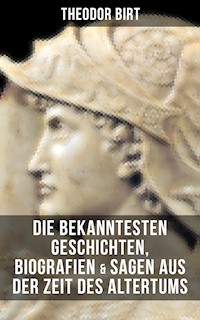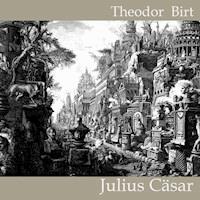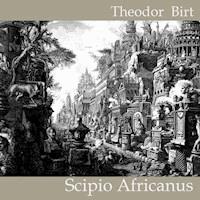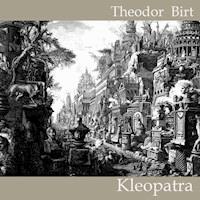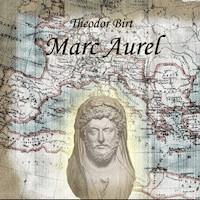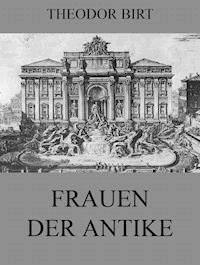
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch handelt von antiken Frauen, den Zeitgenossinnen der Aspasien und Messalinen. Es handelt sich um die Frau als Antiquität, um Galvanisierung der gewesenen Schönen mit dem griechischen Profil und dem Kraftblick der Römerin. Inhalt: Erstes Kapitel - Einleitung Zweites Kapitel - Idealbilder Drittes Kapitel - Die Hausfrau Viertes Kapitel - Die Frau des Euphiletos Fünftes Kapitel - Politische Frauen Sechstes Kapitel - Sappho Siebentes Kapitel - Die Kameradinnen Achtes Kapitel - Mazedonische Fürstinnen Neuntes Kapitel - Kleopatra und Rom Zehntes Kapitel - Römische Kaiserinnen Elftes Kapitel - Die Römerin Dreizehntes Kapitel - Die Römerin und die Ehe
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 303
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Frauen der Antike
Theodor Birt
Inhalt:
Theodor Birt – Biographie und Bibliographie
Frauen der Antike
Erstes Kapitel - Einleitung
Zweites Kapitel - Idealbilder
Drittes Kapitel - Die Hausfrau
Viertes Kapitel - Die Frau des Euphiletos
Fünftes Kapitel - Politische Frauen
Sechstes Kapitel - Sappho
Siebentes Kapitel - Die Kameradinnen
Achtes Kapitel - Mazedonische Fürstinnen
Neuntes Kapitel - Kleopatra und Rom
Zehntes Kapitel - Römische Kaiserinnen
Elftes Kapitel - Die Römerin
Dreizehntes Kapitel - Die Römerin und die Ehe
Frauen der Antike, T. Birt
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849622992
www.jazzybee-verlag.de
Theodor Birt – Biographie und Bibliographie
Birt, Theodor, Philolog, geb. 22. März 1852 in Wandsbek, verstorben am 28. Januar 1933 in Marburg. Studierte seit 1872 in Leipzig und Bonn, habilitierte sich 1878 in Marburg und wurde 1882 außerordentlicher, 1886 ordentlicher Professor daselbst. Seine Hauptwerke sind: »Das antike Buchwesen in seinem Verhältnis zur Literatur« (Berl. 1882); »Zwei politische Satiren des alten Rom« (Marb. 1888); die erste kritische Ausgabe des Claudian (Berl. 1892); »Eine römische Literaturgeschichte in fünf Stunden« (Marb. 1894); »Unterhaltungen in Rom. Fünf Gespräche deutscher Reisender« (Berl. 1895); »Sprach man avrum oder aurum?« (Frankf. a. M. 1897); »Der Hiat bei Plautus und die lateinische Aspiration bis zum 10. Jahrh. n. Chr.« (Marburg 1901); »Griechische Erinnerungen eines Reisenden« (das. 1902). Auch als Dichter hat er sich bekannt gemacht, z. T. unter dem Pseudonym Beatus Rhenanus, mit folgenden Werken: »Philipp der Großmütige«, Prologszene (Marb. 1886); »Attarachus und Valeria«, lyrische Erzählung (das. 1887); »Meister Martin und seine Gesellen« (Reimspiel, das. 1894); »König Agis« (Tragödie, das. 1895); »Das Idyll von Capri« (das. 1898); »Die Silvesternacht« (Reimspiel, das. 1900).
Frauen der Antike
Vorwort
Immer noch Antike ? und nach so manchen anderen auch noch ein Buch über Frauen? Ich habe dies Wagnis auf mich genommen – denn die Aufgabe ist schön – und hoffe, man wird nicht spotten und fragen, ob denn kein Ende ist und etwa auch noch über antike Kinder oder ähnliches Wissenswerte ein Buch folgen soll.
Der Inhalt der folgenden Blätter muß zeigen, ob mein Unterfangen nicht zu kühn gewesen. Nur auf eine Auswahl von Gestalten mußte ich mich beschränken. Historische Treue war mir dabei Pflicht und erstes Gebot. Antike Kultur- und Weltgeschichte wird zu allem den Hintergrund bilden, und jede dichterische Übersteigerung im Dienst der Anschaulichkeit ist vermieden. Wer letztere will, mag zu meinen Dichtungen, dem »Menedem«, der »Roxane« und den »Novellen und Legenden« greifen, die der höheren Pflicht gewidmet waren, dem verstummten Leben durch freie Erfindung wieder eine Sprache zu geben.
Theodor Birt
Marburg a. d. L., 30. Oktober 1932
Erstes Kapitel - Einleitung
Dies soll ein Buch sein über antike Frauen, die Zeitgenossinnen der Aspasien und Messalinen. Es handelt sich um die Frau als Antiquität, um Galvanisierung der gewesenen Schönen mit dem griechischen Profil und dem Kraftblick der Römerin. Die Aufgabe lockt, ist aber für den Frauenverehrer, der kein Juvenal ist, schwer zu lösen, und Bedenken über Bedenken regen sich. Wer möchte es wagen, ein Buch über die Frau der Gegenwart zu schreiben? Die moderne Frau als solche? Tausend Temperamente aus den verschiedenen sozialen Schichten treten ihm auch da entgegen, und einen Typus der Frau an sich gibt es nicht.
Und wie leicht ist es, bei Frauen sich zu irren! Und wie verantwortungsvoll! Sie alle sind ein Geheimnis hinter reizenden oder auch minder reizenden Fassaden, und es ist schwer, gerecht zu sein. Wer schwärmt, ist durch einen Blick, durch eine Geste bestochen; wer verurteilt, war voreingenommen oder gar nicht wert, daß sie, die er meint, ihm gefalle. Die eine ein Engel, den die Sünde verschönt, die andere still wie ein erquickender Brunnen, in dessen Tiefen kein Licht fällt, die dritte mit freier Stirn ehrlich, gedankenreich, aber fanatisch und alle Anmut von sich streifend. Geschminkte und Ungeschminkte, in Dürftigkeit oder perlenbehangen; Verzagtheit und Übermut, Brutalität und Gottseligkeit, Urkraft der Mütterlichkeit, Verschwendung des Ich, prahlendes Locken; Philanthropie und Selbstsucht, Emanzipierte und Häusliche, Ehrwürdige und Frivole, Klageweiber und schwatzende Elstern, Philisterinnen und Romantische, Modepuppen und Dichterinnen. Der Beobachter denkt sich sein Teil; er mag sie sortieren und registrieren. Aber was er bringt, wäre nie die atmende Wirklichkeit, und wer die tausend Lebensbilder zeichnen wollte, ein Wundermann wär's, wenn's ihm gelänge. Die Kompliziertheit der Frauenseele mit ihren siegreichen Instinkten ist groß; die Wirkungen sind Wonne und Weh, Hingebung und Verachtung; aber es wäre verwegen, den Schleier zu heben, die geheimen Untergründe dieses treibenden Lebens zu ertasten. Das bloß Sexuelle genügt nicht, erst recht nicht der Versuch, aus der Körperbildung allein den Charakter zu erschließen.1 Man möchte keiner Unrecht tun, und die Frauen stehen, weil sie Frauen sind, über unserem Urteil.
Und nun gar die uns weltenferngerückte Antike mit ihrem ebenso reichen Frauenleben! Auch die Griechin, die Römerin ist da kein Typus, der sich porträtieren ließe; auch ihr Bild löst sich, soweit wir sie kennen, in eine Unzahl von Frauenbildern auf, und auch sie möchte man lieben, von Entzückung zu Entzückung weitergehen oder sie schonen, wo es nottut. Aber sie sehen uns nur zu oft mit wilden und bösen Augen an oder spöttisch und mit Gelächter, als sagten sie: du Pedant unterfängst dich, mich zu verstehen? Sie können rasen und Blut vergießen und verstehen vortrefflich, die verliebten reichen Leute auszuplündern, wie es auch heute geschieht. Drollig ist es, wenn da die Namen mitspielten, die in ihrer Bedeutung oft so durchsichtig waren, und eine Kurtisane »Ziege« hieß und ihr Anbeter der »Schößling« oder »das junge Grün«. Der Zeuge, der uns dies mitteilt, bemerkt dazu: kein Wunder, daß sie ihn auffraß. Bei alledem aber verbergen sich uns die Wonnen, mit denen sie gleichwohl die Männerwelt entzündeten und beherrscht haben.
Wir leben in einer Zeit, in der sich die Lebensanschauungen radikal wie vielleicht noch nie zuvor bekämpfen. Das betrifft den Staat, die zerspaltene Gesellschaft, die Familie, die Frau, und eben die Frau insbesondere, und die erregenden Probleme füllen unsere Gespräche und unsere Bücher. Dabei gibt es viele, die es ablehnen, nach dem, was die Vergangenheiten uns brachten, zu fragen, als finge die Menschheit, wie in dem Versuchsobjekt Rußland, heute aus dem Nichts von neuem an: wer fragt noch danach, was früher war? Man will nicht erben, auch nicht mit Goethe das Ererbte neu erwerben. Nicht nur in den Familien soll es nicht mehr gelten, so daß gar dem Sohn von des Vaters Erwerb kein Heller mehr zufällt; auch das Kulturerbe, das frühere Zeitalter in langsamer Arbeit und unter heißen Kämpfen aufgehäuft, die Kulturarbeit jener Geschlechter, deren Blut wir wider Willen in uns tragen oder deren Gedankenkunst unsere Art zu denken vorbereitet und gezüchtet hat, sollen für uns nichts mehr gelten und verloren sein.
Wie verarmend dies wirkt, wird sich bald herausstellen. Bücher, wie das vorliegende, richten sich an die, die anders gesonnen sind. Es handelt sich also um die Frauenfrage und die Stellung und Bedeutung der Frau in der sogenannten Antike. Nicht die Frauenfrage als solche aber soll theoretisch durchgesprochen werden, sondern Exemplare aus der Frauenwelt bald nur schattenhaft, wo das Licht fehlt, bald in greller Deutlichkeit vor uns hintreten.
Die Auslese wird freilich nur spärlich sein. Denn die Schriftsteller jener alten Zeiten liefern fast nur Männergeschichte mit Strategen und Demagogen, Senatsherren, Königen und Kaisern. Auch das Mittelalter macht es noch nicht anders; da kommen die Prälaten und Ordensstifter und Scholastiker hinzu. Die Frauen tauchen in all den Händeln nur wie ein flüchtiges Wetterleuchten auf, das den Wolkenhimmel lichtet, oder wie wenn ein Scheinwerfer, sich verirrend, einmal in eine Frauenstube leuchtet.
Mit den Römerinnen steht es nicht ganz so ungünstig; denn sie waren Okzidentalinnen wie unsere deutschen Frauen, und von den Agrippinen und Messalinen Roms trägt wohl mancher ein Erinnerungsbild in sich, oder doch ihr Name klingt in uns an, als wüßten wir von ihnen. Auch für die Historiker Tacitus und Sueton ist die Geschichte freilich nur Männerwerk; aber als wirksames Intermezzo machen sie uns gleichwohl jene Kaiserinnen schreckhaft lebendig.
Aber es sind doch nur sie, und es sind doch nur die Ausgearteten ihrer Rasse.
»Biographien« antiker Frauen gibt es überhaupt nicht. Die Schriftgattung der Biographie war im Altertum nur ein jüngerer Ableger der Geschichtsschreibung, und daraus erklärt sich alles. So war es bei den Griechen; so blieb es auch in Rom. Die Königinnen und Kaiserinnen hätten es im Grunde so leicht gehabt, durch Drohung oder durch gutes Geld Schriftsteller zu gewinnen oder zu nötigen, ihr Lebensbild für die Zukunft zu verewigen. Es wäre damals im Buchhandel reißend abgegangen, und auch noch heute stünde es nicht anders. Warum taten sie es nicht? War es Bescheidenheit? oder hatten sie zu viel zu verbergen? Die Kaiserin Agrippina, die ich nannte, Neros Mutter, hat in der Tat selbst Memoiren geschrieben, und sie gingen um. Sie gab da wirklich ihren Lebenslauf, aber nur als Rahmen für den Klatsch aus der hohen Gesellschaft der Kaiserstadt, wie es die russische Kaiserin Katharina auch zu tun beliebte, und sich selbst zu konterfeien, lag ihr fern.
Für die Griechinnen aber – und wir fragen jetzt zunächst nach den Griechinnen der sogenannten Idealzeit des klassischen Griechentums, jener Zeit, als die republikanischen Staatsverfassungen noch alle Schichten der Bevölkerung in Bewegung setzten – für diese Griechinnen ist das betrübende Wort bezeichnend, das von Perikles stammt: »Die beste Frau ist, von der man nicht redet.« Nichts charakteristischer als das; die Frauen soll das Geheimnis umgeben. Warum? Waren sie zu kostbar für die triviale Welt? Oder hatten auch sie schon Sünden zu verbergen?
Wer aber hat uns das Perikleswort erhalten? Thukydides ist es, der griechische Historiker führenden Charakters, der bis heute das Muster und Vorbild wissenschaftlicher Geschichtsschreibung im Sinne Leopold Rankes gewesen ist. Und siehe da, wer die acht Bücher des Thukydides durchliest, findet auf keiner Seite eine Frau erwähnt, auch wo wir ihre Nennung erwarten, mit der einzigen Ausnahme, daß einmal in der Stadt Argos ein Tempel in Brand geriet. Die Kränze, die man der Gottheit dargebracht hatte, waren mutmaßlich der Opferflamme zu nahe gekommen, und daran trug die Priesterin, die Verwalterin des Heiligtums, schuld.
Nur als Priesterinnen sind Frauen damals Staatsbeamtinnen gewesen; so auch in Rom die Vestalinnen, die Roms Lebenslicht, die Herdflamme der Göttin Vesta, hüteten. Auch als Priesterinnen der Liebesgöttin Aphrodite waren solche griechischen Frauen ehrwürdige Personen, makellos auch die junge Hero, die in der Poesie weiterlebt und zu der in der romantischen Legende Leander, der Liebende, das wilde Meer durchschwamm. Sein Tod war ihr Tod; sie hatte, ihres Amtes vergessend, ihr Herz an ihn verloren.
Eifrig waren die Griechen seit Aristoteles bemüht, so wie man es auch heut versucht, aus der Körperbildung den Charakter der Menschen zu erklären. Man nannte das »Physiognomonik«, und Reste dieser alten Studien liegen uns in zwei Bänden noch vor. Aber auch sie enttäuschen uns schwer; denn auch da wird fast nur auf Männer acht gegeben, und wir hören, daß, wer frauenhaft weiche Haare hat, furchtsam ist; der Mann mit großen Ohren ist dumm und unverschämt, aber lebt lange; die aufgestülpte Nase deutet auf Rührseligkeit. Alle Körperteile werden so durchgenommen, vor allem aber der Ausdruck des Auges, wo wir erfahren, daß fröhlich blickende, graublaue Augen den Tapferen verraten; wer rein-blaue Augen hat mit feuchtem Glanz, ist ein guter Mensch. Steht einer vor dir mit weißem Teint, schwarzem Haar und dazu verquollenen, schwachen Augen, so wisse, das ist ein Wollüstling. Rollende Augen hat der Wüterich usf.
Nur einmal wird uns auch der Körper der Frau genau beschrieben. Jeder liebenswürdige Ton fehlt da; aber wir hören doch, daß ihr Fleisch zarter und weicher, ihre Füße schöner als beim Mann, daß ihr Teint durchgängig weiß, mitunter auch blaßdunkel zu sein pflegte, ihr Auge schwarz, tiefschwarz oder annähernd schwarz. Übrigens soll, wie es da heißt, auch manches, was vom Manne gilt, für sie mit gelten. Dies also dürfen wir im Sinn behalten, wenn im Verfolg meiner Erzählung bedeutende Frauen vor uns treten. Wenn die junge Königstochter Kleopatra, die, aus der Heimat vertrieben, durch List zu Julius Cäsar in den Palast gelangte, diesen großen Weltüberwinder beim ersten Anblick bis zur Unterjochung gewann, – wir dürfen uns denken: aus tiefschwarzem Auge hat ihn ihr Blick da getroffen, aber aus glitzernd lachendem Auge, wie es die Augen der siegreich werbenden Frauen sind. Rollende Augen aber sind die Augen der Wut? Die also standen der Furie Pheretime im Angesicht, als sie die Stadt Barka eingenommen, die Rebellen besiegt hatte und an deren Frauen die furchtbarste sadistische Rache nahm.
Sonst hören wir in jenen Schriften beiläufig noch, und zwar unter des Aristoteles Namen, daß die Frauen, obschon das schwächere Geschlecht, vordringlicher im Wesen seien. Dies wird sich uns gelegentlich bestätigen. Heißt es jedoch zugleich, daß sie von Natur bösartiger als wir Männer, so scheint da ein beklagenswerter Misogyn zu sprechen, und keinesfalls soll uns weder er abschrecken, noch was wir von jener Pheretime gehört haben und noch hören werden.
Kommen wir zur Sache. Es handelt sich um Südländerinnen, deren Temperament anders als unseres ist – das ist vorauszuschicken – und um ein Volk, das, den Asiaten nächstbenachbart, ja selbst zum Teil auf der Küste Kleinasiens ansässig, unmittelbar und durch regsten Verkehr den Einflüssen des Orients ausgesetzt war.
Kulturvölker waren, wie die Griechen, auch die Lyder, die Perser und die Ägypter, die man mit zu den Asiaten zählte. Schon seit Urzeiten hatten sie alle nichts mehr mit den Primitiven gemein, den Negervölkern, die man im Innern Afrikas sah, bei denen die Frau nur wie ein Werkzeug verknechtet das Wasser schleppte, das Vieh hütete, den Acker pflügte, während der Mann umschweifend und herrenhaft auf Krieg und Raub ausging, auch jagte und fischte. Wo Städte, Großstädte und Königreiche im Stil der Pharaonen entstehen, ändert sich alles; die Klassen teilen sich; ein dienender Stand entsteht, und der Frau erwachsen andere Pflichten, die höher greifen. Das zeigt uns schon Homer, wenn er ins häusliche Leben der Kleinkönige im griechischen Lande uns Einblick gewährt.
Aber der vornehme Perser hatte seinen Harem, und auch bei den ägyptischen Großen ist die Vielweiberei, die sie bei den Negerhäuptlingen sahen, unanstößig gewesen. Wie anders stand die griechische Ehefrau da! Für den Griechen war die Monogamie Gesetz, ob geschrieben, ob ungeschrieben, wie für den Römer und Germanen. Nur selten wird die Kebse im Haus geduldet; aber es geht ihr schlecht, und sie ist rechtlos. Der Gatte hat die Gattin neben sich als Herrin im Haus, wie Odysseus die Penelope. Macht er sonst noch auf Weiber Jagd, muß er die Hetäre draußen suchen; ihr ist die Tür verschlossen; die Hausfrau hat den Schlüssel. Die Kebse aber wird zur Dienerin im Haus, im Ersatz des Sklaven. Sonst hat der Mann nur männliche Bedienung.
Nun aber erhebt sich die Frauenfrage. Die Frage war ernst damals wie heut. Auch in Griechenland war das weibliche Geschlecht in beängstigender Überzahl; denn zu viele Männer starben weg, schon im Jünglingsalter. Das machten die Kriege, die jeder Sommer brachte, aber auch der Handel über See; auch er war Kampf; denn die Schiffe waren nicht so seetüchtig wie heute, und auch das Mittelmeer im Sturm griff nach dem Leben und verlangte seine Opfer. Die Frauen dagegen blieben daheim und starben nicht, wenn sie nicht an ihren Kindern starben. Das war Frauenlos. Die Göttin Artemis gab zwar acht; sie war die Hüterin und Helferin der Gebärenden. Nicht immer half sie, aber sie half doch oft, wenn sie gnädig gesonnen. Man mußte nur richtig beten. Da lesen wir sogar von einem lieben Wunder. Eine Frau ist erblindet und hofft zugleich auf ein Kind. So betet sie: »Laß mich, o Göttin, des Kindes genesen oder, soll es nicht sein, doch wenigstens die Blindheit verlieren!« Die Göttin erhörte sie; aber siehe da, bei der Geburt war die Frau zugleich sehend geworden. Das Wunder war die unmittelbare Wirkung des psychischen Erlebnisses auf den Körper.
Vor etwa zwei Generationen war bei uns in Deutschland die Frauenfrage noch nicht laut geworden; es war fast noch so wie in Goethes Zeit; die ledigen Töchter machten sich im Elternhaus nützlich, soweit dies nötig, trieben sonst ihre Liebhabereien, wurden zu lieben Tanten, wenn sie alterten, und zeigten sich da in Rat und Tat oft doppelt nützlich. Erst die Not hat heut die Frauenberufe geschaffen. Die Frauenemanzipation setzte ein; die Suffragetten kamen mit dem Frauenstimmrecht, und unsere Töchter suchen nun ihr Brot als Diakonissen, in der Schreibstube und Apotheke, studieren und wachsen mit oder ohne Doktortitel hinein in den Ärzteberuf, sind juristischer Beirat oder Fabrikinspektorin oder sitzen als gewählte Volksvertreter in den Parlamenten.
Dies alles lag der Antike ganz fern. Man dachte radikaler oder barbarischer, faßte das Übel an der Wurzel, und nach des Vaters Entscheidung wurden, wie die Mißgeborenen, so auch die überflüssigen Töchter nach der Geburt ausgesetzt, mochte aus ihnen werden, was da wollte. Viele fielen so den Mädchenhändlern in die Hände und füllten die Bordelle. Man verkaufte die Töchter auch geradezu an die Besitzer solcher Frauenhäuser. Es kam auch vor, daß die Oheime in der Familie, die Hagestolz geblieben, unter Zwang die ledig gebliebene arme Nichte heiraten mußten. Das alles war Herkommen; wir hören kaum von Tadel, und von einem Notzustand berufsloser Frauen wissen uns die betreffenden Instanzen, die im Altertum von Staat und Gesellschaft handeln, nichts mitzuteilen.
Zweites Kapitel - Idealbilder
Wir unterscheiden Frauen der Dichtkunst und Frauen der Wirklichkeit. Wer sich die Griechen im Sinn Schillers und Goethes vorstellt, denkt sich alles in Schönheit getaucht, so also auch das Weib der Griechen. Es wirkt wie Verklärung; Helena das Symbol. In der Tat haben uns im Altertum nur die Griechen, wenn auch nicht in der Helena, so doch in ihren Alcesten und Antigonen Ideale der Weiblichkeit in durchgeführter Zeichnung gegeben; nur die Griechen, nicht Rom, auch nicht das Alte und Neue Testament. Man wundere sich also nicht, daß ich zu Anfang bei ihnen verweile. Und nicht nur die Dichtkunst gab uns diese Bilder; die Grabsteine, die uns im Relief die Bürgerin, die verstorbene, zeigen, haben den Eindruck wundervoll bestätigt. Hier wie dort sehen wir Griechinnen idealisiert, das heißt nach künstlerischer Idee gestaltet, aber aus der Wirklichkeit konzipiert. Die kriegerische Ilias gibt uns die Andromache, die junge Mutter, die dem Hektor das erste Kind geboren und deren Seelenangst, da er dem Speer Achills entgegenrennt, uns ergreift und rührt; die Odyssee jene Penelope, die in Tränen nach dem seit langem verschollenen Gatten ohne Ablassen liebend sich sehnt, aber voll erfinderischer List die Bewerber hinhält, die sie wild bedrängen, und das Äußerste auf sich nimmt, um dem Einen die eheliche Treue zu halten; dazu aber auch Nausikaa, die heitere, junge Fürstentochter, die in aller Lieblichkeit auf der Wiese mit den Mägden Ball spielt, sich geschäftig zeigt im Dienst der Brüder, deren linnene Kleider es zu waschen gilt, und in reizender Feinheit und Verständigkeit den fremden, verstürmten Helden, der plötzlich erschreckend vor sie hintritt, begrüßt, ihn willkommen heißt, ihm hilft, da er Hilfe braucht, und ihn doch von sich fern hält, obwohl unausgesprochene Liebe, ein erstes Liebesahnen ihr Herz befallen.
Daneben die Antigone des Sophokles, auch sie mädchenhaft in erster Jugend, aber so anders; die kühn und tapfer und ihre Liebe preisgebend das Leben einsetzt für die Ihren, an die sie die Pflicht bindet. Der Bruder ist verfemt, dann auch ihr Vater. Des Bruders Leiche soll vor die Hunde; der geblendete Vater wird vor die Stadt gestoßen; den geleitet sie ehrfürchtig als wehrlose Wanderin in das fremde Land und wagt es auf Tod und Leben, dem Bruder die Bestattung zu verschaffen, die ihm der Staatswille verweigert.
Das interne Familienleben, wie es wirklich gewesen, ist uns sonst fast völlig zugedeckt. Nur die Dichtkunst gibt uns solche Bilder, aber sie sucht dabei nur den Konflikt. In solchem Konflikt steht auch Elektra; es ist des ermordeten Agamemnon Tochter, auch sie so jung. Aber sie ist härter, streitbar, aggressiv, fanatisch, und auch das ist echt; denn es gilt den Mord zu rächen. Elektra ist es, die in wilder Rede die sündige Mutter straft, den Bruder Orest aufhetzt zum Stoß der Rache. Sie hätte, in der Not allein gelassen, auch ohne ihn die Tat vollführt; groß im Haß wie in der Liebe; denn auch die jauchzende Liebe zum Bruder findet in dem Elektraschauspiel die schönsten Töne.
Die Geschwisterliebe war etwas Großes bei den Alten. Die Schwestern sind es auch sonst, die, wo andere Hilfe fehlt, den gefallenen Brüdern das Begräbnis bereiten, ohne das ihre Seelen im Totenreich keine Ruhe fänden. Diese Liebe stand in der Wertung der Antike höher als die erotische, die das Weib zum Manne zieht.
Und nun die Grabsteine! Zeitgenossinnen des Sophokles, der die Antigone schuf, sind wohl manche dieser Steinbilder, die man aus den verschütteten, berühmten Friedhöfen Athens ans Licht gezogen und die uns, jedes anders, die Athenerinnen, ob Jungfrau, ob Matrone, zeigen, um die die Familie trauert. Gestalten im Relief; der Meißel redet da seine stille Marmorsprache.
Auch diese Frauen tragen den Adel der Schönheit; es sind solche der höheren Stände, schlicht und vornehm in der Haltung, und wir müssen sie lieben und bewundern. Auch dies eine Idealisierung; denn sie alle sind nur in ihrer Jugend dargestellt, als kennten sie kein Alter. Es ist so, als wäre nie eine Greisin gestorben, als hätte der Tod nur die Jugend geliebt und keine Ahne, keine Großmutter hätte je den Nachen des Charon bestiegen. Der Tod versöhnt alles, und da ist keine, auf die die Abgelebtheit, die Sorge oder die böse Leidenschaft ihre unliebsamen Spuren geprägt hätte.
Soweit die Menschen in der Kunst. Aber auch die Götter dürfen wir heranholen, die Homer geschaffen. Denn auch diese Götter sind nichts anderes als Griechen mit Götterblut, die den Tod nicht kennen.
Was ist Athene, die Lieblingstochter Gottes, des Zeus? Das Ideal der Königstochter, die dauernd so geblieben, wie es die griechische Jungfrau vor der Vermählung war, das Ideal des hochintelligenten und zugleich furchtlos streitbaren Mädchens, das nicht an sich, sondern das nur für andere denkt, denen ihr Herz gehört. So tritt sie, auf Hilfe sinnend, bewaffnet in die Schlacht, springt auf den Streitwagen, aber nicht um selbst zu fechten, sondern den gefährdeten Kämpfern, denen sie wohl will, Rat zu geben und sie durch Zuruf zu stärken. Gewiß haben so auch die Schwestern im Griechenvolk ihren Brüdern, die ins Gefecht für Haus und Herd zogen, Mut zugesprochen, wie die Göttin es tut, wenn sie den Odysseus oder Diomedes verzagt sieht. Aber nicht nur das; auch ein Griechenweib in Waffen, wie die Göttin, werden wir kennenlernen, wenn wir von Schlachten reden werden.
Ganz anders Hera, die Juno der Römer. Ein zweites homerisches Charakterbild. Sie ist das göttliche Modell der Ehefrau in höchst realistischer Zeichnung, strotzend von Eifersucht, die höchst berechtigt ist bei der ausschweifenden Gesinnung des Gatten, von tödlichem Haß erfüllt gegen die Bastardkinder, die sie nicht geboren. Dieselbe Himmelskönigin zeigt uns aber auch noch, wie sorgfältig die Griechin Toilette machte, um den Gatten zur zärtlichen Stunde zu verlocken: nicht etwa durch Enthüllung ihrer Reize (mit tiefem Rückenausschnitt oder was sonst unsere klugen Frauen für nötig halten und was ähnlich schon in ältester Zeit den Frauen auf Kreta geläufig war); vielmehr soll die schönste Kleiderpracht die Sinne des Zeus erregen; Vollgewandung; der Gürtel darf nicht fehlen, auch die wertvollen Ohrringe nicht, die die Wange umrahmen.
Und nun gar Aphrodite, die Göttin der Liebe. Sie ist vermählt, aber die Ehebrecherin im Olymp, die, selbst jung und schön, einen alten garstigen Mann hat, der dazu noch Banause und Techniker ist und als Schmied für Kundschaft arbeitet. Begreiflich, daß sie vorzieht, mit einem jungen Quasioffizier oder Haudegen das Bett zu besteigen. Alles das ist aus dem gemeinen Leben genommen, aber vom Dichter in den Himmel projiziert, und der junge Offizier ist der Kriegsgott Ares. Alle andern Götter aber lachen, als der betrogene Gatte das Paar in flagranti ertappt; denn »die Sonne« brachte es an den Tag. So ist Aphroditens Spezialität denn auch bei Homer, den Ehebruch bei den Sterblichen zu stiften und zu beschönigen; dem Paris, der die vermählte Helena entführt hat, ist sie hold gesinnt; die sozusagen legale Liebe dagegen fördert sie nirgends in den Epen Homers, dieses Kenners der Liebhabereien der Götterwelt.
Für das Griechenvolk sind die Geschichten, die ihm Homer gegeben, das klassische Buch von nahezu biblischem Wert gewesen. Man lernte sie auswendig, ließ sie an heiligen Festen von Rhapsoden vortragen, machte sie, hoffentlich mit Auswahl, zur Schullektüre. Inzwischen hatten sich im Volk die Vorstellungen von Gott oder den Göttern völlig verändert; sie waren Staatsgötter geworden in überirdischer Stille und Hoheit, die keine Händel so irdischen Stils mehr suchen und nicht mehr unter sich intrigieren und sündigen. Aber der Sinn der Griechen war konziliant und voll Nachsicht, und sie freuten sich, in jenen Göttern, wie Homer sie gab, sich selbst wiederzufinden.
Drittes Kapitel - Die Hausfrau
Wenden wir uns zur irdischen Wirklichkeit zurück und versuchen, in das Familienhaus mit seinem verschlossenen Innenleben einzudringen. Es handelt sich um die Hausfrau und um die Töchter. Nur die Verhältnisse selbst dieses Innenlebens, das für die Neugier zugedeckt hinter der Haustür sich abspielt, sollen hier, vornehmlich im Hinblick auf die Kreise des wohlhabenderen Bürgertums, angedeutet werden. Ohne das bliebe alles folgende unverständlich, und die persönliche Bekanntschaft namhafter Frauen, auf die wir zielen, müssen wir, in Geduld gefaßt, uns auch jetzt noch versagen.
Ich nähere mich den Hausfrauen freilich mit Sorge und Beklommenheit. Es gab davon natürlich, wie heute, sehr verschiedene Exemplare; aber nur allzu üble Stimmen werden laut. Am brutalsten redeten die Spott- und Schimpfdichter von Beruf: die eine ist hündisch, die andere ein Ferkel oder wie ein Iltis, wie ein Affe und so fort. Aber sogar der edle Sophokles hat angeblich, alt geworden, als man ihm zu einer zweiten Heirat riet, gerufen: »Nie wieder solch rasende Despotie!« Suchen wir indessen gerecht zu sein.
Die Ehefrau war allerdings »Hausfrau« im eigentlichsten Sinne des Wortes; sie war Hausherrin und schon nach Solons Urteil dem Manne voll ebenbürtig. Aber es war ein arg getrenntes Leben: der Mann immer aushäusig; es duldet ihn nicht in den vier Wänden. Er gehört nach draußen, heißt es, auf Markt und Gasse. Die Frau herrscht also naturgemäß allein im Haus; es ginge ohne sie zugrunde. Arbeit genug, Verantwortung genug! Allein schon die Bändigung der oft fremdblütigen Dienerschaft.
Frauenwohnung und Männerwohnung sind im Wohnhaus scharf getrennt; beide sind abschließbar, und der Mann, der Liebe sucht, hat zum Lager der Frau nachts nur Zulaß nach ihrem Willen. Mehr noch; sie nimmt alles Geld in die Hand, das der Mann ins Haus bringt; sie muß es vor ihm sichern, verwaltet, bewacht und verausgabt es und hält es fest abgeschlossen in ihren Räumen. Dadurch wird sie allmächtig. Sie hat den Tresor, griechisch »Thesaurus«.
Aber es ist auch sonst gut, daß sie die Schlüsselgewalt hat; denn die leichtlebigen Männer gehen nur zu oft auf schlechten Wegen. In solchen Fällen läßt sie ihn nicht ins Haus. So einer raubt ihr gar aus ihrer Truhe ihren schönen Mantel und die Spange, um damit ein anderes Weibchen zu schmücken; sie merkt es und verschließt ihm, als er kommt, vor der Nase die Haustür. Das hatte er verdient. Es kann schließlich so scheinen, als wäre der Mann nur Gast im Hause. Auf alle Fälle war Gefügigkeit ratsam.
Durch Gewohnheitsrecht stand alles dies felsenfest, obwohl die Frauen zivilrechtlich im Staat unmündige Personen waren und ihnen jede Rechtsfähigkeit abging. Sie konnten keinen Prozeß anstrengen, auch nicht als Zeugen vor Gericht auftreten. Und so rächte sich ihre häusliche Machtstellung denn doch erheblich; sie galt nur in den vier Wänden. Auch jeder Ausgang war alltags der Frau der besseren Gesellschaft verwehrt. Sie hütet das Haus, und das Haus hütet sie. Schon von Solon stammten diese Einschränkungen, und die Passage auf den Gassen war also einigermaßen uninteressant; man begegnete da nie den stolzen Frauen, die bei uns die Promenade schmücken, und geschah es doch, so waren sie von Dienerinnen begleitet und verstopften grausam ihre Ohren, wenn eine Ansprache drohte. Zumeist ist es dann eine ältere Dame, wo man nicht fragt: wessen Frau ist das? sondern: wessen Mutter ist das?
Nur zu gewissen gottesdienstlichen Frauenfesten, durch die das Geschlechtsleben geheiligt wurde, durften sie hinaus und miteinander schreitend oder auch zu Wagen sich zum Festort begeben. Es war ein Austoben, wie bei den Hunden, die von der Kette gelassen. Aber kein Mann durfte sich zeigen. Auch nahmen sie wohl nachts an den jubelnden Reigen teil, die am Athenefest auf der Akropolis geschahen. Ins Theater aber ging man familienweise, Mann, Frau und Kinder, wo es zu Ehren des großen Heilgottes Dionys an vier Tagen im Jahr die berühmten Schauspiele gab. Auch da mußte die Frau sich beaufsichtigt fühlen.
Nach dem anfangs Gesagten ist es nun aber begreiflich, daß es bei den Männern gang und gäbe war, über ihr Hauskreuz zu lamentieren. Sophokles war nicht der einzige, und das »wir sind die Sklaven unserer Weiber« kann als Motto gelten. Der eine erkundigt sich »wie geht's deiner Frau?« »Leider besser, als ich es wünsche« ist die Antwort. Ein anderer ruft: »Was sagst du? Ist es wirklich wahr? Unser Freund X hat sich verheiratet? Aber ich traf ihn doch eben noch lebend an.« Und wieder einer: »Könnte ich meine Frau doch als Sklavin verkaufen! Aber niemand wird sie wollen!«
Indes nur, wenn die Männer unter sich sind, führen sie solche Reden. Vorsicht war geboten. War es doch auch in den gebildeten Kreisen verpönt, ein irgendwie unanständiges Wort in der Frauen Gegenwart zu gebrauchen. Darin verrät sich: die Hausfrau hält auf ihre Würde. Sie hält auf das, was sich ziemt.
Was leistete sie nun im Hause? Das Kindergebären war die erste Pflicht, Berufspflicht; sie konnte es darin weit bringen, und die Männer hatten nicht zu klagen. So hören wir denn als Ultraleistung von einer Begnadeten, die 29 Kinder in die Welt setzte, trotzdem 105 Jahre alt wurde und noch ohne Stock durch die Stuben ging; alle die Kinder aber lebten noch.
Beköstigung, Reinigung, Feuerung und Bad verstanden sich ferner von selbst. Dazu die Beherrschung der Dienerschaft und das Geldwesen. Es gab wohl Schuster, aber noch keine Schneiderinnen, Modistinnen und Kleiderhändler; sondern jedes Haus mußte hierin sich selbst versorgen. So spinnt und spinnt die Frau mit dem Gesinde Tag für Tag – mit der Sonne wird aufgestanden –, steht dann aufrecht am Webstuhl und fertigt alle nötigen Anzüge für jeden Hausgenossen aus eigenem Gewebe nach Maß, sorgt dabei auch für Zierat an Troddeln und bunten Borten, und die Truhen füllen sich. Aber sie arbeitet nicht für den Verkauf. Zu alledem aber kam die Erziehung der Kinder. Das waren die hohen Pflichten, die sie belasteten. Man meißelte auf den Grabstein einer solchen Frau als Symbole einen Zügel, einen Maulkorb und einen Hahn; das bedeutete, daß sie den Haushalt zügelte und daß der Hahn sie früh zur Arbeit weckte. Am wertvollsten der Maulkorb; er verrät, daß sie nicht geschwätzig war. Denn die Frauen können kein Geheimnis bewahren.
Kein Wunder also, daß für Beschäftigung mit hochgeistig literarischen Dingen keine Zeit übrig war. Die ästhetischen Interessen dieser Griechinnen beschränkten sich auf die eigene Schönheit. Auch die Frau, die einsam ist, schmückt sich gern. Man kennt die schlichte, edle griechische Frauentracht. An Festtagen aber sah man die Armspangen und Ohrringe, Blumen im Haar, wenn die flotten Gestalten im schleppenden Safrankleid und weißen Bänderschuhen über die Straße fegten; die Schuhe mit hohen Hacken. Den Sonnenschirm trägt die Sklavin (Regenschirme gibt es nicht). Haben sie gut gewachsene Zähne, ist es ratsam zu lächeln, damit man sieht, wie schön ihr Mund ist.
Was kümmerte sie dagegen Astronomie und Philosophie? und was sollten sie mit den unbequemen Rollenbüchern, in denen die großen Dichtungen geschrieben standen? Diese Matronen konnten also in der Tat geistig minderwertig scheinen, und die Halbwelt und ihre Verehrer sahen auf sie mit Spott herab. Pikante Konversation mußte man bei den Hetären suchen. Borniert ist, wer wie in der Schachtel lebt. Um so überwältigender aber wirkte es auf solche Seelen, wenn die große Dichtung trotzdem zu ihnen sprach. Wenn sie im Theater ein Stück wie die Phädra sahen (sie sahen da eine Ehebrecherin auf der Bühne, wie sie um den Buhlen wirbt und verschmäht den Tod sucht); gewisse Frauen aus der Gesellschaft, heißt es, die sich selbst ebenso schuldig fühlten, erhängten sich da. Das ist durchaus glaublich. Nie wirkt das tragische Bühnenspiel mächtiger als auf literarisch unerfahrene Menschen. Sie suchen in allem, was sie sehen, sich selbst.
Nichts scheint für uns verborgener als das Gefühlsleben dieser Frauen, und doch möchten wir ihm näher treten. Nehmen wir also das Selbstverständliche. Sie waren Mütter; den Herzschlag der Mütter können wir fühlen, und da offenbart sich auch ihre Klugheit. Denn nicht der Mann, nur die Frau bewacht und erzieht den Nachwuchs, auch die Knaben bis in das Jünglingsalter hinauf, und es war gut so. Stumpfsinnig sollen sie gewesen sein, diese Hausmütter? Wer das glaubt, irrt gewaltig. Die höchste Intelligenz und Schlagfertigkeit schlummerte oft in ihnen; sie schlummerte, um durch Vererbung in ihren Söhnen zu erwachen. So geht es mit Mutter und Sohn auch bei uns, ein wundervolles Spiel der Natur, von dem alle Zeiten wissen. Der »Mutterwitz« wird im Kinde laut, und das wußten auch die Alten; denn wir lesen: »Einen gut veranlagten Sohn gibt es, wenn er vom Vater den mannhaften Sinn, den weisen Sinn von der Mutter erbt.«
Daher nun auch die Freude am Sohn und des Sohnes Spezialverhältnis zur Mutter, mag sie ihn in der Erziehung auch noch so knapp gehalten haben. Sogar Sparta gibt uns dafür das Beispiel in den Söhnen Kleobis und Biton, die statt des Zugtiers sich selbst vor den Wagen spannten, um die Mutter zum Gebet in den entlegenen Tempel zu fahren. Sie starben an Erschöpfung, aber der Ruhm war ihr Lohn.
Gleichwohl lasse ich das Spartanertum hier beiseite, von dem sich kaum sagen läßt, daß es ein Familienleben kannte. Es wirkte auf die andern Griechen halbwegs barbarisch. Anstoß gab schon, wie gering dort das Schamgefühl in den Frauen, die nur im kurzen, hemdartigen Chiton herumliefen, der, an den Seiten aufgeschlitzt, mehr sehen ließ, als sich ziemte. Die Stadt selbst aber, oder der Staat, war wie eine Kaserne, das ganze Ländchen wie ein Truppenübungsplatz, die Erziehung Dressur der Knaben für den Krieg. Wie im heutigen Bolschewismus ersetzte so der Staat die Familie; aber es war ein Militärstaat. Er also erzog die Söhne, die er den Müttern im frühen Lebensalter wegnahm. Und die Mütter? Es klingt zwar heroisch ergreifend, wenn die Spartanerin, der ihre Söhne bei den Thermopylen fürs Vaterland starben, lakonisch nur das berühmte Wort fand: »ich wußte, daß sie sterblich waren!« oder wenn sie gar den Sohn selbst tötet, der vor dem Feind geflohen ist. Aber es fehlte da der rechte Herzenszusammenhang, die Verwachsenheit, und sie konnten die Söhne leichter dahingeben.
Ganz anders sprach die Natur bei den übrigen Griechen. Die Freude, wenn Mutter und Sohn, die sich verloren, endlich sich wiederfinden, liebte Euripides zu schildern, und so ist es auch die Liebe der Söhne, an der die Mutter sich tröstet, da sie sterben muß; davon lesen wir auf einem Grabstein, und auf einem andern hören wir eine Witwe sprechen: »Ich hinterließ einen löblichen Reigen von Söhnen, heiratete nie wieder, und sie sind es, in denen ich weiterlebe.« Ist ein Mann verklagt, so führte man den Richtern, um ihr Mitleid zu erwecken, dessen Mutter vor, die um den Ausgang bangt und untröstlich ist. Das pflegte zu wirken. Ein verliebter Jüngling aber weiß seine Liebe zum Mädchen nicht besser zu beteuern, als wenn er sagt: »Ich liebe dich noch mehr, als ich meine Mutter liebe.« Es war das Äußerste, was sich sagen ließ.
Die Töchter dagegen halten zu ihrem Vater. Das kleine arme Töchterchen bettelt beim Vater, nicht bei der Mutter, um Brot; und die Erwachsenen? Da genügt wohl eine kleine Szene, die ihre Fürsorge verrät und die zugleich den verbindlichen Ton zeigt, der da waltet. Zwei Schwestern, die zeitweilig Strohwitwen sind, sitzen zusammen auf schönen Stühlen. Der Vater spricht bei ihnen vor. Da springen sie auf mit dem »Sei gegrüßt«, und der Kuß erfolgt, aber mehr als einer, so daß er »genug!« rufen muß. Dann bieten sie ihm ihren Sessel an: »Nimm doch Platz, Vater.« »Nein, nicht da, wo ihr sitzt. Ich setz' mich hier auf die Bank.« »Aber nimm dann doch wenigstens unser Kissen!« »Sehr lieb. Aber die Bank ist weich genug.« »Nein, nimm doch.« »Soll ich?« »Ja, du sollst.« »Dann gehorch' ich.« Endlich sitzt der Alte weich, und das Gespräch kann beginnen; denn er hat viel auf dem Herzen.