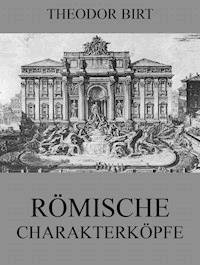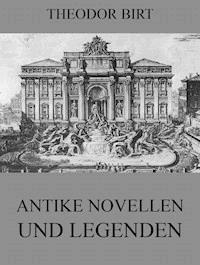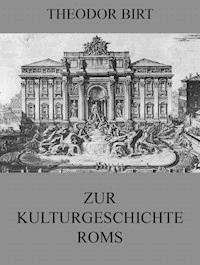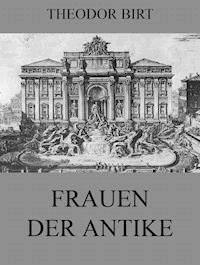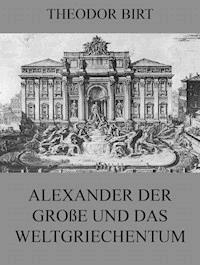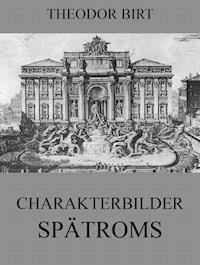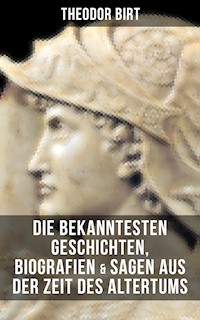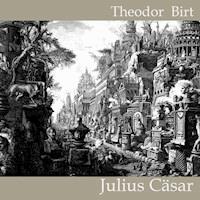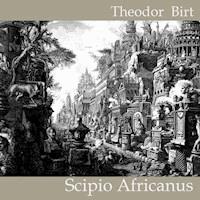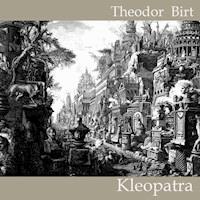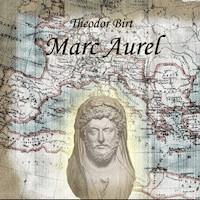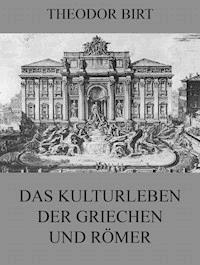
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Zwanzig Jahre nach dem Werk »Zur Kulturgeschichte Roms« wurde selbiges zu dieser größeren Darstellung erweitert, die nun auch das Wichtigere, das Kulturleben der alten Griechen, mit umfaßt. Erst so wird das Römertum voll und ganz verständlich werden. Die Seelen beider antiken Völker gilt es, die unter sich so verschieden geartet waren, zu erfassen, und es ist gleichsam ihre innere Biographie, die hier dargestellt wird. Aus dem Inhalt: Homer und die Zeit der Atriden 1. Zur Einführung 2. Unkultur. 3. Volksleben 4. Primitive Verhältnisse 5. Die Fürsten 6. Häusliches Leben der Vornehmen 7. Die Kunst 8. Die Mahlzeiten 9. Der Glaube 10. Ethisches und Ästhetisches Die Zeit der Demokratien 1. Das Primitive 2. Politisches 3. Städtische Zustände 4. Fortschreiten der äußeren Kultur 5. Die Frau und der Knecht 6. Der Lebenslauf 7. Das Schöne 8. Die Kunst und ihre Beurteilung 9. Kosmologie und Naturforschung 10. Übergang zum Ethischen; Historiographie und Drama 11. Die Ethik als Forschung und Wissenschaft 12. Der Sieg des Harmonischen Die Anfänge des Weltgriechentums 1. Ausbreitung des Griechentums und die Götter 2. Die Städte 3. Die Könige 4. Athen und die Philosophen 5. Junggesellen und Hetären 6. Die Dichter 7. Die Königskunst 8. Die Naturforschung 9. Philologie und rückschauende Studien 10. Das Ende Die römische Hochkultur 1. Vorbereitendes 2. Ankunft in Rom 3. Im Hause 4. Bevölkerung und Berufsleben 5. Zum Rechtsleben 6. Die Bäder 7. Gottesdienst und Glaube 8. Erziehung und geistiges Laben 9. Spiel und öffentlicher Zeitvertreib 10. Die Kunst 11. Die Sittlichkeit
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 680
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Kulturleben der Griechen und Römer
Theodor Birt
Inhalt:
Theodor Birt – Biographie und Bibliographie
Das Kulturleben der Griechen und Römer
Vorwort
Homer und die Zeit der Atriden
1. Zur Einführung
2. Unkultur.
3. Volksleben
4. Primitive Verhältnisse
5. Die Fürsten
6. Häusliches Leben der Vornehmen
7. Die Kunst
8. Die Mahlzeiten
9. Der Glaube
10. Ethisches und Ästhetisches
Die Zeit der Demokratien
1. Das Primitive
2. Politisches
3. Städtische Zustände
4. Fortschreiten der äußeren Kultur
5. Die Frau und der Knecht
6. Der Lebenslauf
7. Das Schöne
8. Die Kunst und ihre Beurteilung
9. Kosmologie und Naturforschung
10. Übergang zum Ethischen; Historiographie und Drama
11. Die Ethik als Forschung und Wissenschaft
12. Der Sieg des Harmonischen
Die Anfänge des Weltgriechentums
1. Ausbreitung des Griechentums und die Götter
2. Die Städte
3. Die Könige
4. Athen und die Philosophen
5. Junggesellen und Hetären
6. Die Dichter
7. Die Königskunst
8. Die Naturforschung
9. Philologie und rückschauende Studien
10. Das Ende
Die römische Hochkultur
1. Vorbereitendes
2. Ankunft in Rom
3. Im Hause
4. Bevölkerung und Berufsleben
5. Zum Rechtsleben
6. Die Bäder
7. Gottesdienst und Glaube
8. Erziehung und geistiges Laben
9. Spiel und öffentlicher Zeitvertreib
10. Die Kunst
11. Die Sittlichkeit
Das Kulturleben der Griechen und Römer, T. Birt
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849622985
www.jazzybee-verlag.de
Theodor Birt – Biographie und Bibliographie
Birt, Theodor, Philolog, geb. 22. März 1852 in Wandsbek, verstorben am 28. Januar 1933 in Marburg. Studierte seit 1872 in Leipzig und Bonn, habilitierte sich 1878 in Marburg und wurde 1882 außerordentlicher, 1886 ordentlicher Professor daselbst. Seine Hauptwerke sind: »Das antike Buchwesen in seinem Verhältnis zur Literatur« (Berl. 1882); »Zwei politische Satiren des alten Rom« (Marb. 1888); die erste kritische Ausgabe des Claudian (Berl. 1892); »Eine römische Literaturgeschichte in fünf Stunden« (Marb. 1894); »Unterhaltungen in Rom. Fünf Gespräche deutscher Reisender« (Berl. 1895); »Sprach man avrum oder aurum?« (Frankf. a. M. 1897); »Der Hiat bei Plautus und die lateinische Aspiration bis zum 10. Jahrh. n. Chr.« (Marburg 1901); »Griechische Erinnerungen eines Reisenden« (das. 1902). Auch als Dichter hat er sich bekannt gemacht, z. T. unter dem Pseudonym Beatus Rhenanus, mit folgenden Werken: »Philipp der Großmütige«, Prologszene (Marb. 1886); »Attarachus und Valeria«, lyrische Erzählung (das. 1887); »Meister Martin und seine Gesellen« (Reimspiel, das. 1894); »König Agis« (Tragödie, das. 1895); »Das Idyll von Capri« (das. 1898); »Die Silvesternacht« (Reimspiel, das. 1900).
Das Kulturleben der Griechen und Römer
Vorwort
Zwanzig Jahre sind bald vergangen, seit ich zuerst meine Skizzen »Zur Kulturgeschichte Roms« vorlegte. Sie werden jetzt endlich zu einer größeren Darstellung erweitert, die nun auch das Wichtigere, das Kulturleben der alten Griechen, mit umfaßt. Erst so wird das Römertum voll und ganz verständlich werden. Die Seelen beider antiken Völker gilt es, die unter sich so verschieden geartet waren, zu erfassen, und es ist gleichsam ihre innere Biographie, die ich darstelle. Die Literatur, in der sie sich auslebten, erstreckt sich über ein Jahrtausend, und sie ist wie ein ständiges Selbstbekenntnis. Man fürchte indessen nicht, daß ich Vollständigkeit in meinen Berichten anstrebe; denn wer den Gegenstand erschöpft, erschöpft auch den Leser. Dienlicher schien mir die übersichtliche Zusammenfassung, und mein Zweck ist nur, die schöne Linie der Aufwärtsentwicklung deutlich zu zeigen und das Menschentum selbst mit seinem Dichten und Trachten in rasch geschobenen Bildern zu veranschaulichen.
Auch ist, was ich gebe, nur ein Bild des Aufstiegs, nicht des Verfalls und Niedergangs. Was von Griechen und Römern dereinst an kulturellen Werten geschaffen wurde, haben schließlich Mächte fremden Bluts oder umstürzender Tendenz zerstört oder im Dienst neuer Ideale umgestaltet. Dafür sei auf mein Buch, das ich »Charakterbilder Spätroms« betitelte, verwiesen.
Viele sind heute jenen abgelebten Vergangenheiten und dem leidigen Humanismus, der sich auf sie gründet, völlig abgewandt. Sollen wir sie feierlich an das »Erbe der Alten« gemahnen? Es wäre umsonst; denn Dankbarkeit der Völker gibt es nicht. Man halte den Polen und Russen vor, wieviel ihnen die deutsche Kultur gegeben hat; sie werden sich nicht zur Dankbarkeit bekehren; denn der Schuldner haßt seinen Gläubiger. Darum genügt es nicht, daß uns das Altertum sein Schuldkonto mit den Worten hinhält: »Seht, wieviel ich euch vorgestreckt habe.« Es spreche vielmehr so: »Ich bin immer noch jung und verwegen und reich und klug und schön, und das ewig Menschliche ist zeitlos. Man gebe mir eine neue Gegenwart, und man wird nicht aufhören, mich umgänglich und liebenswert zu finden.«
Eine neue Gegenwart: wer gibt sie? Viele haben es versucht. Man müßte Zeitalter wie Berge versetzen können, um ihre Schätze recht zu heben. Aber man versteht, weshalb der Titel dieses Buches nicht nur von »Kultur«, sondern von »Kulturleben« spricht. Es ist das Leben selbst, das wir mitzuleben versuchen wollen.
Marburg a. L., im Mai 1928
Th. Birt
Homer und die Zeit der Atriden
1. Zur Einführung
Das Weltall und das Ich, der Sternenhimmel über uns und das Sittengesetz in uns: an diesen Gegensatz denkt sogleich, wer über Kultur der Menschheit reden will. Aber die Kultur der Menschheit existiert noch gar nicht. Nur von einem Teil der Völker ließe sich bis heute reden, und es bestanden anfangs nur schmale Kulturinseln im Ozean des Primitiven. Greifen wir obenhin rechnend ins älteste Altertum zurück, so gelangen wir nur etwa bis zum Jahr 5000 v. Chr.Hier sind die Zeiten des Diluvialmenschen und der Funde von Altamira noch gar nicht in Rechnung gesetzt.Ihren Gipfel erreichte die antike Kultur in der Zeit Jesu bei den Griechen und Römern. Sie glaubt sich noch einmal auf dem Gipfel in den heutigen Tagen und in unsrer herrlichen Gegenwart: ein Versuchen und Ausgreifen nach Vollendung des Ichs und der Gesellschaft, das durch die Jahrtausende geht, das aber nie zum Ziele führt, heute am wenigsten; ein Vorsichhinleben der Massen, ein Übersichhinausstreben der Einzelnen, bevorzugter Individuen. So war es stets. Unter die Masse der Selbstzufriedenen fährt aufregend der Prophet und Reformer. Die Ideale wechseln wie die Moden.
Und so mag es 5000 Jahre weitergehen. Alles hat sich im launischen Wechsel der Zeittendenzen wiederholt und wird sich wiederholen, und die Menschheit geht in Spiralen durch die Flur der Zeiten. Jedes Zeitalter dünkt sich das klügste oder das reifste, und jedes irrt sich.
Daran zu denken, lohnt in der Gegenwart; denn es gärt in den Tiefen der weiten Menschheit wie nie. Was steht uns jetzt bevor? Man rechne nur nicht den Maschinenbetrieb der Neuzeit zu den Hochwerten der Kultur. Denn das Fabrikwesen hat vielmehr zerstörend auf das Seelenleben der Masse gewirkt, und der Schrei nach Besserung der Existenz, nach Rückkehr aus diesem asphaltenen Dasein zum Naturgegebenen, nach Rettung des Adels der Menschheit istheute lauter und angstvoller, als er je gewesen. Es helfe, wer Beruf hat, zu helfen. Es gilt, zu wirken und zu hoffen, als stünden wir wieder einmal am Anfang der Dinge. Mag es so weitergehen und Staat und Volk sich mühen, die Strebenden nicht erlahmen. Was aber sind die Jahrtausende, die wir kurzatmigen Menschen zählen, was sind sie im Auge der Ewigkeit?
Die Sterne über uns reden anders; die goldenen Heerscharen der Sonnen, zu Systemen geordnet, wandeln am Himmelszelt im grenzenlos Unermeßlichen, und es gähnt um uns und über uns die Unendlichkeit der Zeit und des Raumes. Eine ewig bewegte Materie erfüllt das All. Was ist der Mensch? Der Erdenball in der Masse der Welten ein winziger Kiesel, der um seine Sonne rollt, und wie die Moosflechte auf dem Schiefer, so keimt auf der Erde die Menschheit, die armselige, von Geschlecht zu Geschlecht, als wäre sie nichts.
Uns aber, dem belebten Staube, ist gegeben, zu schauen, wahrzunehmen und zu denken. Unser Auge fängt das All, und wir sind berufen, den ungeheuren Kontrast zu fühlen und nicht zu verzagen. Der Mensch trotzt und versinkt nicht in ohnmächtiges Staunen. Er stellt sich auf seine zwei Füße, um nicht nur Gier, um Geist zu sein. Ihm ist gegeben, auch sich selbst zu denken. Im eigenen Hirn spiegelt sich sein Ich. Das Gedächtnis ist sein, das die Vergangenheiten an die Gegenwart bindet, und aus dem Geschehen wird Geschichte. Das Selbsterinnern schafft sie. Wie am Körper untrennbar sein Schatten hängt, so die Geschichte an uns, die wir durch die Gegenwarten schreiten. Wo sie ist, da ist aber Kultur, und wir vergessen die Winzigkeit alles Irdischen, die Endlichkeit alles Strebens, wenn wir Erinnerungen pflegen und auf die Wurzeln unseres Daseins schauen, das sich hinübersehnt aus dem Vergänglichen ins Unvergängliche.
Das ganze All pulsiert; aber sein Pulsschlag geht nach Gesetzen. Die Sterne haben ihre festen Bahnen. Solch festeBahnen will auch der Mensch. Er will ein Sittengesetz, ein wandelloses. Jede Wolke kann uns die Sonne rauben; das Lied Bürgers vom braven Mann, des Simonides Vers vom Leonidas, der vor dem Feind fiel, wie das Gesetz es befahl, dies und solcher Art sind die Leitsterne der Menschheit, die kein Schatten je verdunkeln kann.
Was ist interessanter als eine Geschichte der Erfindungen? Die Kultur aber besteht, wie schon gesagt ist, nicht in technischen Fortschritten, die für sie nur Hilfsmittel. Durch Telegraph, Telephon und Radio sind unsre Ohren nur länger geworden, und wir hören in die fernsten Fernen. Aber was wir hören und hören lassen, ist dadurch nicht besser geworden. Ob man im Auto mit Gummirädern, im Luftschiff fährt oder auf dem Bauernwagen, der kläglich holpert, der Fahrende wird durch das bessere Fahrzeug nicht wertvoller. Die Kultur besteht in der Seelenpflege, im Verständnis für den Nebenmenschen, in der sittlichen Haltung, im Schönheitssinn, der das profan Alltägliche verklärt und die Affekte mäßigt, im Feinsinn für geistige Werte und Menschengröße.
Seien wir indes glimpflich und nennen das eine die materielle, das andere die geistige Kultur.
Wer zählt all die köstlichen Neuerungen, durch die unser äußeres Wohlleben gesteigert worden ist, weit über die Ansprüche des römischen Kaisertums hinaus? Das Genie überbietet sich immer noch, die Naturgesetze zu belauschen und in seinen Dienst zu zwingen. Die Kolben stampfen, die Räder schwingen sich, die elektrische Welle trägt den Schall. Tausenderlei Maschinen arbeiten jetzt als Selbstbeweger, die nur des ersten Anstoßes bedürfen, und was sie leisten, sind lauter »erstklassige Fabrikate«, wie allemal die Reklame sagt. Die Konkurrenz schafft Wunder über Wunder, und das Wunder von heute ist morgen schon das Alltägliche. Auf all das mag unsre Gegenwart eitel sein; stolz kann sie sein auf ihre ethischen Strebungen, die soziale Fürsorge desmodernen Staates, die im größten Stil, der Pflicht gehorchend, die sich bekämpfenden Gesellschaftsklassen endlich auszusöhnen versucht.
Wir aber wollen nun das Werden unsrer Kultur verstehen, die in der sogenannten Antike wurzelt, und wenden uns zu ihren Anfängen zurück.
Sie entsteht allemal nur in der irgendwie staatlich geordneten Menschheit. Diese nennen wir darum »zivilisiert«; voncivis(»Bürger«) ist das Wort gewonnen. Das heißt: erhebliche Gruppen des Volkes sind Städter geworden, die die Pflichten und die Vorteile übernehmen, die solche bürgerliche Vergesellschaftung ihnen zuweist.
Schon die homerischen Griechen waren zivilisiert. Es scheiden sich dann aber alsbald in der Gesellschaft die Elemente des arbeitenden Volkes und der Arbeitgeber und Staatslenker. Nur die letzteren sind in der Lage, nach den persönlichen Bedürfnissen die Selbstpflege, d. h. die Kultur zu steigern. Sie sind es, auf die es ankommt. Aber wir können nicht mit ihnen beginnen und reden zunächst vom Primitiven.
2. Unkultur.
Zu Anfang war das Feuer, dasselbe Feuer, das heute noch jene Kolben treibt und uns unsre Stuben erwärmt, sei es im Dauerbrenner oder im Dienste der Zentralheizung. Hören wir die Griechen selbst, deren Lebensbetrieb wir vor allem kennenlernen wollen.
Äschylus erzählt vom Prometheus, dem Titanen. Wider des höchsten Gottes Willen brachte er der Menschheit voll Mitleid aus der vulkanischen Insel Lemnos die erste Feuerflamme, und der Dichter wagt zu sagen: so wurde das Feuer der Lehrer aller Kunst; zuvor wußten die Menschen nichts von backsteingefügten Häusern, nichts von Zimmerei. Erdeingegraben wohnten sie, ameisengleich, zeitlos, zwecklos, ordnungslos ihr Leben usf.Aeschylus' Prometheus 110 und 411 f.
Lassen wir Prometheus beiseite; in jedem Fall sei der Mann gepriesen, der zuerst aus dem Feuerstein den Funken schlug,Der Schiffer macht sich abends Feuer mit demλίϑος πυρσητόκος: Anthol. Pal. VI 90, 6. In der Odyssee geschieht es 16, 2.der zuerst zwei Hölzer aneinander rieb und quirlte, bis die Flamme hochschlug.Am liebsten nahm man Holz von Lorbeer und Epheu: s. »Alexander der Große«² S. 303, nach Theophrast.Die ganze Antike hat sich sogar mit dieser Art des Feuermachens begnügen müssen; man trug noch keine Zündhölzchen im Schächtelchen herum und hielt daher im Hausstand darauf, daß die Glut auf dem Herd nie ganz erlosch.
Aber wie? Hat nicht schon der kulturlose Wilde, die Rothäute im Urwald am Amazonenstrom, der Nigger oder der Malaie, ja schon der Urmensch, der, im Unterstand lebend, in der Höhle von Altamira Tierbilder an die Wand kreidete, das Feuer gekannt? Schon Homer belehrt uns eines Besseren; denn er erzählt uns das Märchen vom Cyklopen, dem Höhlenbewohner, der irgendwo unwirtlich an der Meeresküste haust.
Odysseus dringt neugierig in seine Höhle. Siehe da, der Cyklop ist Hirte. Nur Schafe und Ziegen hat er in seinen Hürden. Er lebt nicht von Brot, sondern nur von Milch, Molken und Käse. Der Boden des Raumes ist dreckig vom Schafsmist. Aber auch Fleischkost ist dem Cyklopen willkommen; er frißt des Odysseus Gefährten kannibalisch auf, und zwar roh und ungebraten. Nicht einmal einen Hund hat er, um sein Vieh zu hüten. Trotzdem aber hat er Feuer. Trockenes Holz schleppt er herbei, wirft es krachend zur Erde und macht Feuer. Erst als das geschehen, erkennt er den Odysseus und dessen arme Gefährten, da die Höhle zuvor stockdunkel war. Aber nicht nur Feuer; er hat auch schon Körbe, darin der Käse liegt, sogar Bütten, Kübel und Eimer. Es ist der Apparat, den auch jene wilden Völker kennen, die ich nannte. Körbe zu flechten, Gefäße aus Holz herzustellen, verstehen sie auch.
Also trotz des Feuers erschreckende Unkultur. Homer selbst hebt mit klugen Worten hervor, was dem cyklopischen Unhold und seinen Genossen fehlt. Er sagt: ihnen fehlt Gesetzund Ratsversammlung des Volkes; jeder richtet da noch allein nach Willkür seine Weiber und Kinder, und niemand achtet den anderen.Odyssee 9, 112.
Treffender läßt sich, worauf es ankommt, nicht sagen. Vorbedingung der Kultur ist das Zusammenwohnen in Dörfern oder Städten, ist die Gemeindebildung, die über das bloße Familiensystem hinausgeht, ist ferner ein Volksrat, öffentliches Gerichtswesen und Gesetz und jene Gesittung, die sich damals am schönsten in der Gastfreundschaft darstellte.
Der rohe Patron, den Odysseus da überlistet und blendet, ist sogar noch ganz waffenlos; er tötet nur mit seinen Händen oder schleudert Steine. Aber auch wenn der Hirt zum Jäger wird und sich die Steinaxt und, was der Gipfel seines Könnens ist, sich Pfeil und Bogen herstellt, fehlt ihm zur Kultur immer noch die erste Bedingung.
Menschenkultur beruht auf Agrikultur. Der Ackerbau ist hier der Anfang aller Dinge, der Acker »das Euter«, das man melkt.Demeterhymnus 450 und so schon Ilias IX 141 und 283οὖϑαρ ἀρούρης.Daher feierten die Griechen ihre holde Göttin Demeter, die in der Hand das Bund Ähren trägt; ja, schon von der vorgriechischen, pelasgischen Bevölkerung hatten sie das übernommen. Sie hieß die Mutter des Reichtums, des nimmer satten Säuglings, den sie an ihrem Busen nährt. So wie die Saaten im Saatfeld in Zeilen stehen, so gesellen sich jetzt auch die Bürger in Straßen. Die Ordnung der Masse beginnt, und es entsteht die Stadt und der Staat.Daher heißt Demeterϑεσμοφόρος. Im angegebenen Sinne lesen wir bei Justin XVII 3, 13: durch Einführung einer Staatsverfassung wird das Leben eines rohen Volkes kultivierter (vita cultior), wir würden sagen: es wird dadurch zivilisiert.Daher das mystische eleusinische Fest: Windet zum Kranze die goldenen Ähren. Die Bezwingerin roher Sitten, die die Menschen vergesellschaftet, sie wird von den frommen Griechen ganz anders als Prometheus gefeiert. Der Warenmarkt entsteht; die Städte werden zu Zentren; der Landmann liefert in die Städte. Es kommt zum Austausch, zum Handel. Die Berufe sondern sich, um sich zu ergänzen. Ein organisiertes Volksleben ist entstanden.
3. Volksleben
Blättern wir also in jenen Jahrhunderten, die der griechischen Geschichtsschreibung voraufliegen; es sind die Zeitstrecken, in denen für das Auge des Heutigen alles sich verkürzt und ein Jahrhundert ein Jahr wird, ein Jahrtausend ein Jahrhundert. Schon für die Griechen zur Zeit des Dichters der Ilias trifft die Schilderung zu, die ich soeben gegeben habe.
Homer öffnet sein Panoptikum; er zieht den Vorhang weg und läßt uns schauen. Ein Theaterspiel beginnt in hundert, aberhundert Bildern, und das Griechentum steht zum ersten Mal vor uns in seiner ersten Schlichtheit. In die fortschreitende Handlung des Epos sind die Kulturbilder eingewebt; es gilt sie zu isolieren und richtig aufzufassen.
Das Heldenleben, das Homer uns gibt, ist Dichtung und überwirklich; aber die Bühne für die phantastische Handlung, in der Götter und Helden sich mischen, ist trotzdem die alltägliche Wirklichkeit, sind die Lebensbedingungen, nicht wie sie in der Heldenzeit, sondern wie sie in des Dichters Zeit bestanden. Wir stehen damit also im 8. Jahrhundert v. Chr.; denn erst damals, 300 Jahre vor des Perikles Zeit, scheinen die beiden Epen, Ilias und Odyssee, fertiggestellt zu sein.Vgl. Philol. Wochenschrift 1921, S. 263.Sie sind natürlich nicht an einem Tag entstanden, sondern haben selbst in langsamem Wachstum ihre Geschichte gehabt.
Auch Ackerbau treibende Völker wandern. Man braucht zum Wandern kein Hunne zu sein. Die Völkerwanderung der Germanen, der Goten, der Vandalen, der Burgunder ist dafür das bekannteste Beispiel. So waren nun auch die sogenannten Griechen (sie selbst nannten sich nicht so) in vorhistorischer Zeit in die Balkanhalbinsel vorgedrungen und setzten sich fest. Sie wußten selbst nicht, woher sie gekommen, waren aber, wie ihr Typus zeigt, Abkömmlinge der nordischen Rasse. Die südlicheren Teile der Halbinsel wurden Griechenland, griechisches Mutterland; aber auch zu den KüstenstrichenKleinasiens drangen sie unter königlicher Führung besitzergreifend früh hinüber.Einerlei, ob die Hethiter ein umfangreiches griechisches Königreich in Kleinasien, das dort weit in das Innere hineinreichte, bezeugen oder nicht. Die Sache wird auch ohnedies allein schon durch den Umstand bewiesen, daß die Könige bei Homer über so viel Gold verfügen. Woher sollten sie es haben? Im eigentlichen Griechenland gab es kein Gold zu graben, es sei denn auf Siphnos und Thasos (s. H. Blümner, Technologie und Terminologie IV, S. 11), in Kleinasien dagegen wurde es am Sipylos und sonst sowie in den Flüssen reichlich gewonnen (ibid.S. 17). Undenkbar ist, daß so viel Gold, wie es im Epos erwähnt wird, durch Tauschhandel in der Atriden Hände kam; und nicht nur der Atriden. Denn allem Anschein nach sind auch die Trojaner der Ilias selbst Achäer oder Griechen gewesen, und auch die Hethiter konnten sie als solche betrachten. Schon unabhängig von obigen Erwägungen habe ich »Von Homer bis Sokrates«³ S. 83 und 434 ausgeführt, daß eben dies zutreffen muß, und den Kombinationen, die neuerdings von E. Bethe vorgetragen worden sind, kann ich nicht folgen. Das Wichtigste ist, daß bei Homer nur die Verbündeten der Trojaner, nie sie selbst, fremdsprachig heißen (z. B. Ilias IV 438). Zu den a. a. O. gegebenen Belegen kommt noch hinzu, daß die Sintier, weil thrakischen Ursprungs, in der Odysseeἀγριόφωνοιheißen (8, 294; vgl. E. Buchholz, Homerische Realien I, S. 364). Die Trojaner heißen nirgends ebenso; offenbar galt deren Sprache als die normale, also die griechische, und keinesfalls sind die Trojaner etwa Thraker und mit jenen Sintiern verwandt gewesen. Eben daher bestehen schon vor dem trojanischen Krieg zwischen Troja und Hellas nahe Beziehungen, denn nicht nur Paris besucht Sparta als Gastfreund, sondern auch Hektor kennt die griechischen Ortschaften auffallend genau (Ilias VI 457), wie Diomedes umgekehrt die trojanischen Verhältnisse (V 268). Die Machtsphäre und die kriegerisch-politischen Beziehungen Trojas reichten nun auch tatsächlich bis an das Hethiterreich heran. Bis an den Sangarius in Phrygien drang Priamus vor (III 184 f.), und daher ist derselbe berühmt bei denξεῖνοι(XXIV 202). Andromache stammt gar vom Volk der Kilikier in Großphrygien (VI 397), und ebendahin dringt dann auch Achill vor (VI 416–423). So hat auch Hektor ferne verwandtschaftliche Beziehungen, hat einen Onkel, den Bruder der Hekabe, der wiederum aus Phrygien, aus dem Gebiet des Sangarius, stammt (XVI 716 f.). Durch alles dies wird das Gesagte weiter empfohlen: ein Griechenreich, das bei Homer als trojanisch erscheint, reichte tief nach Großphrygien hinein und näherte sich Kilikien. Sind bei den Trojanern geringe kulturelle Differenzen nachweisbar (das betrifft den Harem, auch die Haartracht, dasσφηκοῦν), so walten bei ihnen eben orientalische Einflüsse. Einflüsse des Hethitischen auf die griechische Sprache sucht neuerdings H. Grimme (Glotta, XIV, S. 13 ff.) nachzuweisen. Äschylus ist m. W. der erste, der die Trojaner Barbaren nennt (Agamemnon 965 f.).Auch auf den nahen Inseln nisteten sie sich ein. Dabei stand ihr Trieb, ihre geistige Front dauernd nach Osten, war morgenländisch gerichtet und wandte dem Westen den Rücken zu. Mit Italien bestand kein Verkehr; nur der Seesturm warf den Abenteurer gelegentlich an des Westmeers unheimliche Küsten.
Sie saßen fest im Land, überwanden rasch die Urbevölkerung, die sie vorgefunden hatten und die, politisch unentwickelt, in primitiveren Zuständen lebte, und haben die so gewonnene Heimat nie wieder preisgegeben. Wir wissen es ja: es ist und war ein Land von abenteuerlicher, strenger Schönheit, für ein bequemes oder gar sybaritisch üppiges Genußleben indes keineswegs gemacht. Aber sie haben, arbeitsfähig und lernfähig, seine Ergiebigkeit mehr und mehr gesteigert, ja, es allmählich, den Ägyptern und Babyloniern zum Trotz, zum Zentrum der Weltkultur erhoben. Das gelang freilich erst, als der kaufmännische Geist erwachte und die Seefahrt gedieh und das Meer ihre zweite Heimat wurde. Es war kein Schlaraffenleben. Arbeit war die Losung vom ersten Tage an.
Nichts unbequemer als dies Griechenland: alpine Hochgebirge; eine Schweiz, die im Meer steht; die ganze Halbinsel wie ein Sack voll Steine. Die wilden Gebirgsstränge vom Pindus bis zum Taygetus, eng und unzugänglich, füllen sie aus bis zum Rand, wo die Meereswellen branden. Nur in den Schluchten, in den dürftigen Talsenkungen ließ sich siedeln. Die wenigen ebenen Strecken in Thessalien, Elis und Attika wirken wie Gnadengeschenke der Götter. Aber das Mittelmeerklima war wundervoll; die wonnigen Frühlinge gaben frühe und sichere Ernte; die Rebe wucherte; der Ölbaum senkte melancholisch freundlich seine Zweige, und die Arbeit lohnte.
Dieselben Gebirge aber, in deren Nischen man hauste, wirkten wie Barrieren dahin, das Volk von vornherein inhundert Sondergruppen und Kantone zu zertrennen, und jede Gruppe führte ihr Eigenleben. So wurde auch jede Griecheninsel ein Staat für sich, und jede hatte ihre eigene Geschichte. Dieselbe Spaltung im Sprachverkehr. Die Dialekte blühten, und keiner wich dem anderen. Jeder Kanton sorgte für sich, jeder wollte prosperieren, und so war das Leben der Griechen von vornherein auf Konkurrenz gestellt.
Daher der ewige Kleinkrieg, Griechen gegen Griechen, das ewige Katzbalgen und vergebliche Ringen nach der Vormacht, das bis zum Unleidlichen die Geschichtsbücher füllt und vom Kampf der »Sieben gegen Theben« weitergeht bis zum Tode des Alkibiades, des Epaminondas, des Demosthenes und weiter bis zum politischen Tode des Griechentums selbst, bis zu der Zeit, wo Hellas still wird und verödet unter dem Druck der Faust Roms. Daher aber auch der beispiellose Reichtum des griechischen Geisteslebens, die Blütenfülle auf den Feldern des Dichtens und Denkens und jedweden Kunstbetriebs. Die Konkurrenz der Stämme und der begabten Individuen, die aus ihnen erstanden, wirkte auch da und steigerte die Triebe und das Können. Rastlosigkeit war alles.
In der Zeit nun aber, die Homer uns schildert, spüren wir noch nichts vom Hader der Stämme, sondern es sind nur die sogenannten Könige, die sich befehden. Die Volksmasse politisiert noch nicht, haßt noch nicht. Blicken wir denn zunächst auf das Volk und sein Massenleben und lassen die Atriden und ihresgleichen noch ganz beiseite.
Ich sagte schon: es war kein bequemes Leben. Die Hochgebirge um Mykene und Delphi, um Sparta starrten damals noch in dichten Wäldern, und wilde Bestien hausten darin. Die Jagd war Kampf, und einen Eber und Löwen zu töten war der unvergängliche Ruhm eines Theseus und Herakles. Es war mühsam, in dieser Felsenwelt durch den Wald zu pirschen. Der Hirsch wird verwundet; er verkriecht sich; die Schakale kommen über ihn, und der Jäger zieht ohne Beute heim.Vgl. auch Ilias XVI 157. Jagd auf den Steinbock IV 105; Jagdhunde XVII 725.
Aber nicht nur der Jäger, auch der Holzhauer ist tätig, und die Schläge der Axt hallen im Forst. Er arbeitet als Tagelöhner, bis er müde wird, setzt sich nieder, nimmt still sein Essen, und die Arbeit beginnt von neuem. Dann geht ein Krachen durch den Wald; die gefällten Fichten werden die Gebirgsschroffen zu Tale hinabgewälzt oder von Maultieren gezogen; denn sie sollen zum Schiffsbau dienen.Ilias XVII 745. Die Fichte wurde von denτέκτοντεςschon hoch im Gebirge mit der Axt der Äste beraubt: XIII 391.Aber auch von Waldbränden redet Homer; unheimlich wundervoll der Eindruck aus der Ferne.Vgl. Ilias IX. 490; XIV, 396 (»Von Homer bis Sokrates« S. 70).Wurden sie durch die Nachlässigkeit der Hirten verschuldet? oder entzündete man den Brand, um zu roden und neuen Kulturboden zu gewinnen? Man brauchte damals noch nicht mit Holz zu sparen. Ein Wiederaufforsten gab es nicht.Vgl. meine »Griechischen Erinnerungen«² S. 233.
Heute ist Griechenland fast völlig entwaldet, das Grün wie weggefressen an allen Küsten, und nackter Fels, grauer Kalk und brüchiger Schiefer, das kahle Gebirgsskelett, schwer und wuchtig und blank im glühenden Sonnenlicht, starrt dem Reisenden, ob er die Küsten entlangfährt oder ins unwegsame Innere reitet (er kann jetzt auch im Automobil einige moderne Bergstraßen befahren), allüberall erschreckend entgegen, als hätte der Todesblick der Meduse hier alles Wachstum ertötet. Kaum ein Drittel des Bodens ist heute noch bebautes Land. Daher das verkümmert dürftige Leben des heutigen Dorfbewohners in den Bergen des Peloponnes oder Böotiens. Alle Romantik der Ungepflegtheit erlebt da, wer sich heute aufmacht, die Burg Agamemnons zu schauen oder gar Thebens Reste, wo einst Antigone gewandelt. Ein Saatfeld, eine Wiese wirkt da für das Auge wie ein schöner Irrtum. Auch nach der edlen Viehzucht sieht man umsonst sich um. Nur Hammel und Ziegen weiden in der Dürre; das Großvieh fehlt, und die Kuh Myrons, die vielbesungene, ist ausgestorben; man trifft sie wohl nur noch, wo der Fluß Alpheios sich aus Arkadien ergießt und das Land sich ebnet und weitet, und man lacht vor Freude, sie zu sehen, als ob das edle Altertum auferstünde.
Denn wie anders war es einst unter der Sonne Homers. Wir werden es sehen. Gedeihlich, sorgenlos und wohlverpflegt lebte das Volk hier zu der Zeit, da man von Achill und Odysseus dichtete, und war unter seinen »Königen« oder Landpflegern gut im Stande. Nichts lehrreicher als der berühmte Augiasstall. Die Stallungen des Königs Augias in Elis waren von Kuhmist so überfüllt, daß ein Herkules daher mußte, sie zu säubern. Wie eine schwarze Gewitterwolke, so wird es uns geschildert,Vgl. Theokrit Idyll 25.zogen des Augias Rinder zu Hunderten über die fetten Wiesen voll honigduftender Kräuter daher, wenn sie abends zum Melken kamen. Da ließ sich leben. Geld gab es nicht. Wollte man eine Dienerin kaufen, so zahlte man 20 Rinder; aus Rindern bestand die Mitgift der Jünglinge, die da heirateten.Ilias I, 430. Ein Gefangener wird mit 200 Rindern freigekauft: Odyssee 21, 79 f. An der Ägis der Athene hängen zehn Quasten, von denen jede 100 Rinder wert, Ilias II 447 usw.Es war schwergehörntes Alpenvieh, wie wir es aus der Schweiz kennen.
Greifen wir zum märchenhaften Schild des Achill. Der gibt uns Anschauung, so wie Homer ihn beschrieben hat. Ein kleines Kompendium der Kulturgeschichte! Der Gott Hephäst hat die Waffe mit allerlei Bildern inkrustiert, die eben das geben, was wir suchen. Es sind Idyllen, an denen der Dichter selbst sich freut und wir mit ihm; Achill dagegen, der zornige, der den Schild in die Schlacht vor Troja trägt, würdigt diese reiche Ornamentik keines Blickes. Sein Auge ist trauerumflort und Rache sein Gewerbe.
Und da haben wir nun gleich den Erntesegen. Zuerst sind die Pflüger dargestellt, die auf dem Acker mit ihrem Gespann hin- und herziehen. So oft sie wenden, wird ihnen ein Trunk Wein gereicht. Das steigert die Arbeitslust. Man sollte freilich meinen, bei einem achtstündigen Arbeitstag könnte das des Alkohols zuviel werden.
Aber da sind schon die Schnitter. Die Saat steht dicht und hoch auf dem Halm. Die Sichel rauscht; die Garben häufen sich; Knaben und Männer schleppen und binden. Der Gutsherr aber, zugleich Landesfürst, führt persönlich die Aufsicht; aber er freut sich stumm und findet nichts zu tadeln;alles ist nach Wunsch. Indes wird im Feld schon das Mahl bereitet. Eine Eiche ist nah; unter ihrem Schatten schlachten die Diener des hohen Herrn das Rind; auch Weiber sind da und bestreuen über dem Feuer das Fleisch mit Mehl. Die Arbeiter wittern schon den Braten. Welch liebliche Frühlingsstimmung!Man erntete schon im Frühling.Man möchte mitrasten unter dem Eichenschatten und hinhorchen, wie die Sicheln rauschen.
Es fehlt nur das Dreschen. Das Dreschen geschah so, daß die Rinder auf der Tenne das Korn zertraten.Ilias XX 495 f.
Dann kommt das Herbsten, und wir sehen den Rebenacker. Mit Graben und Zaun ist er vor Dieben geschützt. Die schwarzen Trauben hängen schon funkelnd im Laub. Nur ein einziger Pfad geht durch die Pflanzung, und schon sind Jünglinge und Mädchen bei der Lese und tragen jauchzend die traubenvollen Körbe daher. Daneben aber steht ein Knabe; der singt mit hellem Sopran zur Leier das liebliche Linoslied. Dazu beginnt um ihn her der Tanz der Jugend, da die Arbeit ruht. An Gott Bacchus denkt dies Volk noch nicht. Das Linoslied aber hatte schwermütigen Klang: Herbststimmung. Es galt der welkenden Vegetation. Keine Ernte ohne Sterben! aber auch kein Sterben ohne Ernte! Das lehrt die Natur. Der Mensch fühlt es in jedem Jahr neu. Davon sang das Lied. Die fröhliche Jugend aber tanzt dazu.
In all diesen Bildern sehen wir: die Arbeit lohnte, und überall spüren wir die Freude am Leben.
Und nun gar am Festtag der Reigentanz. Alles kommt in der besten Kleidung; dazu die Mädel in Kränzen; die Burschen tragen den Dolch am Riemen. So fassen sie sich an den Händen, daß ein weiter Kreis entsteht, und zur Musik bewegt der Kreis sich mit Hüpfen und Springen rundum, dann aber auch aufgelöst in zwei Reihen, die gegeneinander tanzen. Ein Volkssänger ist da, der zur Harfe singt. Da ruht der Reigen, und zwei Solotänzer treten in die Mitte und zeigen ihre Künste. Das klingt wie aus einermodernen Reisebeschreibung. Volkssitten bleiben eben immer dieselben.
Schlimmer hat es der Rinderhirt. Denn es gibt, wie wir hörten, auch Milchwirtschaft größten Stils. Homer gedenkt sogar der Fliegen, die den Eimer umschwärmen, wenn gemolken wird.Ilias XVI 641Das Vieh ist, die Hörner wiegend, hinaus auf die Weide gezogen, wo zwischen dem Schilfrohr frisches Wasser sprudelt. Vier Hirten sind nötig; so stark ist die Herde; die Hunde dazu. Da kommen, schon bevor es dunkelt, zwei Löwen (Homer weiß, daß Löwen auch gern gemeinsam jagen); sie schlagen zwei Farren nieder, brüllen laut und schleppen die Beute fort, fressen das Eingeweide und lecken das Blut. Die Hunde heulen, aber kriechen feige zurück und werden umsonst gehetzt. Die Hirten verzagen. Es waren ohne Frage asiatische Löwen, die damals noch bis in die griechischen Gebirge vordrangen. Der Löwe war für den Griechen nicht nur ein Fabeltier; er wurde erlebt. Nur mit Feuerbrand konnte man sich seiner erwehren.
So lebte das Volk, das Landvolk. Dem Gutsherrn gehört das Vieh, gehört die Ernte; der Hirt und Arbeiter aber wird immerhin gut gehalten. Die Arbeiter sind Tagelöhner, nicht Sklaven, und von Unzufriedenheit, von Unfrieden hören wir nichts. Dabei spielt sich alles unter freiem Himmel ab; das ist selbstverständlich. Da treffen sich dann auch insgeheim Jüngling und Jungfrau, und ihr Gespräch beginnt: »Dein Herz ist nicht von Eichenholz, ist nicht von Stein.«Ilias XXII 126. Der Sinn der vielfach mißverstandenen Worte ergibt sich aus Anthol. Pal. X 55, 2. Bei Hesiod Theog. 35 bedeuten sie dann so viel wie Geschwätz oder Überflüssiges reden.Homer aber ist diskret und verrät uns nicht, was auf diese zutraulichen Worte folgte.
4. Primitive Verhältnisse
Wozu sind die Häuser? Sie sind nur zum Schlafen da (wenn man nicht gar in Höhlen wohnte). Das gilt auch von den Städtern. Denn auch in das städtische Leben erhalten wir Einblick.In Dörfer oder Kleinstädte sammelten sich die Menschen vielfach gut bürgerlich in Anlehnung an den Burgsitz des Fürsten oder Grundherren. Es waren Marktflecken und zunächst wohl nur Ackerbaustädte, wie auch wir sie bei uns noch heute haben, wo das Vieh durch die Gassen läuft. Aber das Handwerk, Schmied, Töpfer, Schuster und Zimmermann, setzten sich da fest, und ein Tauschhandel entstand: Milchmarkt, Gemüsemarkt; das Landvolk bringt seine Ware. Vor allem die Bohnen und Linsen kommen an Markt; sie waren das Volksessen; sie waren die Kartoffel der alten Griechen, ein Massenverbrauch, warm und dampfend.Vgl. Berliner Philol. Wochenschr. 1915, S. 669 ff. über die Φακῆ des Sopatros und denfaba mimus.
Es war ein Handel ohne alles Geld, aber auch ohne Buchführung. Es war die Zeit, wo das Volk noch nicht schreiben und lesen konnte. Alles geschah mündlich. Auf der Wage wog man Ware gegen Ware. Die Zahlen zählte man an den zehn Fingern ab oder machte sich Striche ins Holz. Es ist bemerkenswert: die Griechen haben sich keine Schrift erfunden, kein Alphabet, keine Zahlenschrift. Das erschwerte, verlangsamte das Zählen größerer Summen gewiß, und so fehlte auch noch jede Zeitrechnung; jede Chronologie war unmöglich. Der Begriff des Jahres ergab sich zwar aus dem Wechsel von Winter und Sommer, der Begriff des Monats aus der Beobachtung des Mondwechsels;Vgl. Odyssee 11, 294: »Die Monate füllen das Jahr«. Der Monat als Zeitmaß 12, 325. Was das Zählen betrifft, so sind die Zehnzahl und Fünfzahl beliebt (vgl. dasπεμπάζεσϑαι). Man zählte eben nach den Fingern. Zehn Kehlen wünscht sich der Sänger. 2, 489, zehn Ratgeber Nestor Ilias II 372. Größere Massen zählt man nach je fünfen: Odyssee 4, 412. Sodann sind Dezimalzahlen beliebt, zwanzig, hundert und tausend, eine Vervielfältigung der Zahl der Finger: vgl. Ilias XI 244, XXIII 164, XVIII 470 u. a. Das sind oft Ramschzahlen. Doch hören wir natürlich gel. auch von elf oder zwölf Tagen (Odyssee 2, 375) usw. Bei der Landmessung werden dieμέτραgezählt, weiter auch die Ruderer im Schiff, die Mannschaften der einzelnen Kontingente, die Länge des Balkens mit der Schnur gemessen (Ilias XV 410), die Ware auf der Wage mit einem Gewicht gewogen (XII 434). Ob man sich hier schon mit Strichen,σήματαhalf, bleibt ungewiß. Eine genaue Jahreszählung wie Odyssee 2, 106, ist selten; daher das ungenaueπροτέρων ἐτέων, Ilias XI 691. Einmal hören wir, daß ein Kind neun Jahre in Pflege war (XVIII, 400), sonst nur von Tieren: ein Pferd oder Rind fünf- oder sechsjährig (II 403; XXIII 266). Dasἐννέωροςgehört schwerlich hierher. Ein Künstler Eubulides stellte den.digitis computansdar (Plin. nat. Hist.34, 88). Wie viel die Fingersprache vermag, zeigt derselbe 34, 33, wonach eine gewisse Stellung der Finger die Zahl 365, d. i. der Tage im Jahr, ausdrückte.aber man zählte die Monate noch nicht, benannte sie nicht.Freilich wurden Frühgeburten schon als solche festgestellt: Ilias XX 118.Es gab noch keinen Festkalender, feste Tage, den Göttern geweiht. Man zählte auch die Jahre noch nicht. Von keinem Menschen wird bei Homer das Lebensalter angegeben. Daher die Vorliebe für Dezimalzahlen, für Ramschzahlen. »Hekatomben« haben sicher nicht immer genau 100 Opfertiere bedeutet, und wenn der trojanische Krieg just 10 Jahre, des Odysseus Heimfahrt ebenso lang gedauert haben soll, so bedeutet das volkstümlich nur »lange Zeit«, es sei denn, daß Agamemnon jedes Jahr einen Nagel in die Wand schlug. So findet Odysseus denn seine Penelope ungefähr noch ebenso jugendschön vor, wie er sie verlassen.Vgl.S. 15Anm. "Vgl. Odyssee 11, 294: »Die Monate füllen das Jahr«..."
Beobachten wir noch weiter das städtische Leben. Die Städte waren beschränktesten Umfangs. Trojas Einwohnerzahl wird dahin taxiert, daß auf zehn Leute des griechischen Belagerungsheeres noch nicht ein Trojaner kommt, der ihnen Wein kredenzen könnte.Ilias II 123.Die meisten sind befestigt. Aus dem Stadttor müssen die Mädchen hinaus, um Wasser zu holen; in der Stadt gibt es keinen Brunnen.Odyssee 10, 107. Die Wäschegruben sind in Stein gefaßt: 22, 154.Drinnen sah es wohl nicht immer sehr wohnlich aus,Troja übertraf offenbar andere Städte, wenn an ihm dasεὖ ναιόμενονhervorgehoben wird: Ilias II 133.aber es herrschte munteres Leben. Eine Prozession kommt durch die Gassen; denn es ist Neumond, ein bedeutsamer Tag, und an die hundert Rinder werden bis hinaus zum Hain des Gottes Apoll zur Opferung geleitet. Mit einer Volksspeisung soll der Tag gefeiert werden.Odyssee 20, 276.Ein andermal ist es ein Hochzeitszug, der das Städtlein erregt. Alle Weiber treten neugierig vor die Türen, um die junge Braut zu sehen. Es dunkelt schon, und der Zug kommt mit Fackeln daher. Ein Chor singt das Hochzeitslied, den Hymenäus, und mit Schmausen und Tanzen endet auch dieser Tag.
Aber es gibt auch Zank und Streit; es wäre sonderbar, wenn der fehlte. Keifende Weiber schildert der Dichter, die auf der Gasse sich anlügen; denn alle ihre Bezichtigungen sind unwahr.Ilias XX, 252.Da strömt alles Volk auf dem kreisrunden Marktplatz zusammen; ein Totschlag ist gemeldet. Die Stadtältesten nehmen unter freiem Himmel auf ihren steinernen Sitzen Platz. Kläger und Verklagter erscheinen und reden (das römische Prozeßverfahren existiert noch nicht). Tumultuarisch, wie es dem Südländer ziemt, drängen ihre Freunde an und unterstützen beide Parteien mit Geschrei. Die Marktbeamten oder Polizisten müssen Ruhe schaffen, bis dann die Richter sich erheben und urteilen. Wer von ihnen den besten Spruch getan hat, bekommt eine Prämie, und zwar in Gold. Das Gold war ungemünztes, nach dem Gewicht zugemessen,Das Gold wird auf der Wage abgewogen: Ilias XXIV 232.in diesem Fall die Gabe des Landesherrn, der also auch über die Richtigkeit des Urteilsspruchs entschied.
Der Intelligentere unter den Bürgersleuten konnte sichdamals also schon solches Gold, das sonst nur dem Luxus der Fürsten diente, zurücklegen. Er erhob sich schon wirtschaftlich über die Masse; das bessere Individuum erhob sich damit auch gesellschaftlich über die Minderen im Volk, über die Vielheit, die damals, in der Zeit der Domänenwirtschaft der Landesfürsten vielleicht weniger nivelliert war als heute im Zeitalter der Maschine; denn der Dienst an der Maschine tötet die Eigenart mehr als alles andere Tagewerk.
Übrigens kennt der Dichter der Ilias in Wirklichkeit das Gold so wenig, daß er glaubt, es sei fester und undurchdringlicher als Erz.Ilias XX 268 und 272.
Soweit diese Lebensbilder; sie sind anschaulich genug, bieten aber dem, der die Mittelmeerländer kennt, nichts Besonderes. Auch wer zu den sogenannten wilden Völkern des Südens, z. B. nilaufwärts zu den Sudanesen geht, findet da alles heute ungefähr ebenso: Ackerbau, Viehwirtschaft, Musik und Tanz; auch größere Ansiedlungen und Marktbetrieb. Die primitiven Wohnungsverhältnisse bringt dort das Klima mit sich; aber bei den Griechen waren sie nicht besser.Der Rundbau der Hütten, wie ihn auch die etruskischen Aschenurnen in Hausform gel. zeigen, scheint das Primitivste gewesen zu sein; für Orchomenos bis ins 3. Jahrtausend zurückdatierbar.Auch noch zu des Perikles Zeit stand es im Durchschnitt erbärmlich mit den Wohnhäusern, und der Bedürfnislose nahm sich ein Tonfaß, um darin zu schlafen. Die Wände ungebrannte Lehmziegeln; das Innere oft noch ohne viel Raumteilung. Der Fußboden gestampfte Erde. Auch ein Herd fehlte bisweilen, und man häufte die Holzscheite am Boden, über die man den Kessel hing.Odyssee 21, 362. Ich erlebte dasselbe im Peloponnes (»Griechische Erinnerungen«² S. 150).Während die Edelleute in Betten schlafen, schläft der gemeine Mann auf dem Fußboden, wie dort noch heute, Herr und Knecht nebeneinander.Odyssee 11, 190, Herr und Dienerschaft speisen auch am selben Tisch: 24, 385.Wenn Feuersbrunst entsteht, ist niemand da, der löscht.Ilias XVII 738.Die Wände sind so unsolide: jeder Dieb kann sich ein Loch schlagen, um einzubrechen; er war ein wirklicher »Einbrecher«, aber er fand drinnen nicht viel zu stehlen. An Töpferwaren fehlte es nicht; auch der Stuhl war schon erfunden. Oft führte wohl auch schon eine Stiege, richtiger eine Leiter, in ein oberes Stockwerk, und das Haus zeigte in der Höhe ein paar Fensterlöcher. Der verliebteBursche konnte da also unter dem Fenster schon ein Ständchen bringen, und ein Mädchenkopf neigte sich heraus. Von solchen Zärtlichkeiten redet freilich Homer noch nicht.
Man begreift hiernach, wie rasch sich im Altertum zerstörte Städte wieder aufbauen ließen. Es geschah in ein paar Wochen. Xerxes hat Athen niedergebrannt; als er wieder abzieht, kommen die Athener aus Salamis und richten sich in ihrer Stadt sogleich wieder ein. Man kann also fragen, ob die alten Griechen wesentlich besser wohnten als der Beduine, der in seinem Zelt mit Frau und Kind, Stute, Ziege und Lamm haust? Fehlte doch auch sonst noch so manches, was der moderne Plebejer zur gemeinsten Vorbedingung der Kultur rechnet. Salz hatte man zwar; man gewann es aus dem Meerwasser. Aber man hatte noch keine Eierspeisen; denn zu Homers Zeiten fehlten im Lande noch die Hühner. Ja, auch die Tauben schwärmten noch nicht ums Hausdach. Erst später wurden aus dem Orient Hühner und Haustauben eingebürgert.τρήρωνεςsind nur Wildtauben,πέλειαι, vgl. Odyssee 12, 63. Trotzdem wird von Ortschaften oder Städten gesagt, daß sie taubenreich sind:πολυτρήρων: Ilias II 502 und 582. Das Taubenschießen ist Sport: XXIII 853 (πέλειαι). Vgl. übrigens »Horaz' Lieder, Studien« S. 58.Aber es fehlte, was schlimm, auch noch die Öllampe und das Kerzenlicht; man hatte nur die qualmende Fackel zur Beleuchtung. Daher fehlt alles Nachtleben; man kroch früh mit der Sonne ins Schlafgemach, und sogar die Götter des hohen Olymp, Gott Zeus und die Seinen, verschliefen darum, wie der Dichter glaubt, die Nächte.
Ich könnte noch fortfahren: das Schloß an den Türen galt noch als WunderwerkIlias XIV 168, auch einen soliden Knoten zu machen muß der Held erst lernen: Odyssee 8, 447.und fand sich wohl nur in den Palästen der Großherren, die etwas zu verschließen hatten. Auch das Hausbad fehlt; nur die Vornehmen baden.Odyssee 24, 254. Im Meer badet man nur, um sich von Schweiß zu reinigen, und nimmt dann noch ein Wannenbad: Ilias X 572 f.Das Mahlen geschah nur mit der Handmühle, und kein Mühlenrad ging im Tal, keine Windmühle streckte ihre Flügel. Die Damen kannten noch keinen Spiegel,Man sehe die Art, wie Hera in der Ilias Toilette macht.aber auch keine Schminke. Und nun gar die Stiefel, die Beschuhung! Unser Reiterstiefel ist völlig unklassisch; aber auch kein Pantoffel stand den Frauen zur Verfügung. Selbst die Fürsten gehen wie die Neger Afrikas zu Hause barfuß; müssen sie ins Freie, binden sie sich nur die Sandale unter den Fuß. Die Sandaleblieb auch später bevorzugt, und die Mehrzahl führte also ein Barfüßerleben. Daher war das Fußbad so dringend nötig. Und nun der Reisende. Er ritt nicht. Das Pferd war noch eine Kostbarkeit, und auch der Reisewagen, Zweispänner und leicht, diente deshalb nur den Vornehmen, die ihre Gäule sogar gelegentlich mit Wein stärkten. Das kennen auch wir.Man vermeidet in der Schlacht Pferde zu verwunden, und sie sind eine erwünschte Beute; vgl. Ilias XVII 488; XXIII 292. Das Pferd dient vorzugsweise als Wagenpferd; ein Lastwagen auf vier Rädern XXIV 324; vgl. dieἅμαξαIlias VII 426 und Odyssee 9, 241. Männliche Pferdenamen Ilias VIII 184; vielfach aber werden Stuten bevorzugt, ganz anders als auf der römischen Rennbahn; Achills Pferde sind Stuten, auch Nestors Ilias XI 597; vgl. die in XXIII. Wettfahrten sind außer in XXIII auch XI 700 erwähnt. Geritten wird selten wie in der Dolonie X 513; vgl. Odyssee 5, 371. Reiterkunststücke auf vier Pferden in Friedenszeiten Ilias XV 679. Pferde mit Wein getränkt Odyssee 8, 189, welcher Vers, wenn auch nicht ursprünglich, doch als Zeuge für die Sache dienen kann.Sogar Held Herakles mußte zu Fuß durch alle Länder, als rechter Globetrotter, bis nach Spanien und Marokko. Zu Fuß hat er die Äpfel der Hesperiden von dort nach dem Peloponnes getragen. Daß bei der langen Reise die Früchte frisch blieben, gehört zu den Wundern der Sage, die nicht nötig hat, mit der Macht der Zeit zu rechnen.
5. Die Fürsten
So weit das Volk: ein bescheidenes Kleinleben, die ewige Alltäglichkeit, die ihre Bedürfnisse nicht steigert. Wir merken nichts von Luxustrieb, von Trieb über sich selbst hinaus. Ist dies das Griechenvolk, das der Welt seine Kunstideale schuf und für alle Zeiten das Gedankenleben der Menschheit vertiefte? Wir spüren davon noch nichts. Alles das schlummert noch ungeboren. Nicht das Volk, vielmehr nur die Fürsten haben damals die hohen Aufgaben gestellt, die das Niveau des Lebens erhöhten. Die Kultur kam von oben, wie das die Weltgeschichte auch sonst gesehen hat (man denke an Mazedonien, Rußland, an Brandenburg und Preußen). Die hochgestellten Herren verlangten nach den wertvollen und importierten Werken der Kunst, die das Auge ergötzen, und zwar für sich, nicht für das Volk; sie sind es auch gewesen, die zum Ruhm ihrer Geschlechter die große Dichtung weckten: Heldengesang. Er erklang damals in der Fürstenhalle, nicht im Volke.
Welche Armut! Kein Rathaus, kein Theater gab es noch in den Städten, auch noch nicht die griechische Säule, diesich in Zeilen reiht, auch kein Gotteshaus, und kein Gottesbild stieg auf die Postamente.Diese Dinge habe ich im Anschluß an Reichel und gegen Bethe in der Philol. Wochenschrift 1921 S. 258 ff. ausführlich besprochen.Man war nur fähig, kleine Puppen in Ton zu formen; die Töpferei lieferte Gefäße mit sehr bescheidener Ornamentik. Ja, auch zur Dichtkunst waren die Ansätze im Volk noch künstlerisch ganz unentwickelt. Ein Bub war es ja nur, der bei der Weinernte das Linoslied sang, und Homer hütet sich darum wohl, uns dies Lied und ebenso die Lieder, die der junge Held Achill einsam in seinem Zelt vor sich hin sang, mitzuteilen; es waren gewiß nur Volkslieder, d. h. kurzgefaßt und in schlichtestem Versbau.Die Wehklagen um Hektors Leiche im Buch Ilias XXIV sind nicht etwa Lieder und herkömmliche Trauergesänge, sondern improvisierte Reden, die der Dichter gezwungen ist in Verse zu fassen. Die Vortragenden konnten sie, wie ihr Inhalt zeigt, nicht vorbereitet haben.Etwas Vorstellung davon können uns die Proben geben, die die Griechen in späteren Jahrhunderten gelegentlich aufnotiert haben. Die jungen Weiber suchen Blumen im Feld und singen: »Wo sind mir Rosen, wo mir Veilchen, wo mir das hübsche Selleriekraut?« und dann die Antwort: »Da sind die Rosen, da sind die Veilchen, da ist das hübsche Selleriekraut.« Oder man spielt eine Art Blindekuh, und das Mädchen, dessen Augen zugebunden sind, singt: »Die Fliege (aus Eisen) will ich fangen«; die andern laufen davon und antworten: »Fangen? Du wirst sie nicht erlangen.«Vgl. Pollux IX 123.So gibt man sich auch Rätsel auf oder memoriert einen Spruch in Versen auf die fünf Kobolde, die beim Brotbacken das Brot verderben.Vgl. den homerischen Kaminos.
Allerliebst ein munteres Prozessionslied für Kinder, das Spätere auf der Insel Rhodos hörten, und es sei mitgeteilt. Im Frühling war da ein Bittgang der Kinder üblich im Namen der Schwalbe, die heimgekehrt. Da werden auch schon mehr Worte gemacht:
Die Schwalbe ist kommen; sie kam beschwingt, Die uns die schönen Zeiten bringt. Sie ist zurück von ihrer Reis', Schwarzblau oben und unten weiß. Wein und Trockenobst gebt uns gleich, Auch Käse im Korb. Euer Haus ist reich. Auch Weizenbrot und Mandelkern, Alles das nimmt die Schwalbe gern. Wollt ihr, wie? oder soll'n wir gehn? Gibst du nichts, wir bleiben doch stehn, Heben dir Tür und Fensterlein aus, Und ist dein Weibelein im Haus, Hockt sie da drinnen, Die führen wir mit uns von hinnen. Sie schleppt sich leicht, ist ja so klein. Drum öffne die Tür fürs Schwälbelein. Wer Gaben gibt, der soll glücklich sein. Gib mehr oder minder. Wir sind ja nicht alte Leut', wir sind nur die Kinder.
So etwas ist ewig, d. h. man hört Ähnliches zu allen Zeiten. Auch unser deutsches Volk kennt solchen Frühlingsbittgesang der von Haus zu Haus ziehenden Kinder.Ich denke an das Kinderprozessionslied in des Knaben Wunderhorn: »Havele Hahne« mit dem »Ri ra rum, der Winter ist herum«.
Geben wir denn endlich auf die sogenannten »Könige« acht. Sie haben augenscheinlich Großes geleistet. Im Haus des Reichen wird der vornehme Luxustrieb mächtig. Man will in Schönheit leben; man fragt nach Gott und Schicksal und dem Zweck des Lebens, und ein kompliziertes Gedankenleben erwacht.
Es gab freilich viel nachzuholen, viel zu lernen. Solches In-die-Lehre-Gehen der Völker dauert oft Jahrhunderte; wir wissen es von den Germanen. Im Euphratland und am Nil, in den üppigen Ländern der großen Ströme, war damals längst das Höchste geleistet, was der Kulturtrieb der Menschheit leisten zu können schien: verschwenderischer Reichtum, Massenbeherrschung, ein jahrtausendlanges Wachsen und Werden. So war die assyrisch-babylonische Kultur und ebenso die Ägyptens um das Jahr 1200 v. Chr. schon abgeschlossen und in sich fertig. Ihre Bauten reden am lautesten; denn man sieht sie noch heute. Nur die Könige bauten; sie bauten mit dem Trieb zum strotzend Kolossalen, im Hochgefühl, Massen zu bezwingen. Ihre Tempel und Paläste stehen im Flachen und wachsen aus der Ebene zu künstlichen Gebirgen auf, die durch harmonische Gliederung die Natur überbieten. Sonnendienst. Die blaue Metallkuppel desHimmels schien so nah; sie ruhte auf den Gebirgen fest. So ist da auch das Bauen ein Sichhochstrecken der Materie himmelwärts. Dabei diente das Kreissymbol der Sonne als Tempelschmuck. Wie ungriechisch! Der Hellene hat die Gestirne als solche nie angebetet. Ihm war das Göttliche, ob licht, ob dunkel, nur Person und die große Mechanik der Gestirne nicht bedeutsamer als der Wechsel der Jahreszeiten und der Winde, die über das Land fegen.
Aber auch die Plastik leistete bei diesen stolzen Barbaren in raffiniertester Technik schon ihr Höchstes: minutiöseste Schildereien im Relief, die alle Pylonen, Säulenschäfte und Riesenwände streifenweise bedecken; die Säulen selbst in dichten Geschwadern geordnet, die das wuchtende Dach schwindelhoch heben: die Nachahmung des afrikanischen Waldes. Dazu die Götter- und Königsstatuen; auch sie kolossal und schwer, monolith, Mensch gewordene Felsen. So das Nilland. Nicht minder erstaunlich in Babel die Technik der buntfarbig strahlend glasierten Ziegel, die, zu Figuren großmächtig geordnet, den prunkvollsten Wandschmuck gaben, der im Auferstehen der Ruinen noch heute wirkt, als wäre er gestern entstanden. Soll ich noch vom Schreibwesen, Rechnungswesen, Geldwesen, von der Astrologie und Zeitmessung reden? Es sind allbekannte Dinge.
Jene Kunst war aber auch da nur Königskunst, das Schreibwesen und die Wissenschaft zumeist nur in Händen der Priesterkaste oder der höchsten Beamtenschaft.Vgl. »Die Buchrolle in der Kunst« S. 8.Die »Könige« der Griechen haben davon nur das wenigste übernommen. Es ist auffallend, da die Mächtigsten unter ihnen doch nach Asien übergriffen und in den Randgebieten Kleinasiens zeitweilig herrschten, daß sie von den Hethitern, mit denen sie sich dort berührten,Vgl. obenS. 9Anm. "Einerlei, ob die Hethiter..." und »Von Homer bis Sokrates«³ S. 82.so wenig und nicht einmal das Schriftwesen übernommen haben. Die Felseninschriften dieser Hethiter sind historische Urkunden; sie geben uns Zeitgeschichte; es herrschte bei ihnen schon der Sinn für Geschichtsschreibung, und sie berichten, daß griechischeKönige (ob die Atriden, bleibt ungewiß) in dem weiten Umland von Troja längere Zeit ein Reich besessen haben. Die Griechen selbst schrieben nicht, weder auf Stein noch in Büchern,Das Gesagte aufs neue ausführlich zu begründen, erübrigt sich; ich verweise auf meine Besprechung des Buchwesens in der »Kritik und Hermeneutik« S. 247; dazu »Aus dem Leben der Antike« S. 99; »Von Homer bis Sokrates«³ S. 430. Für eine Zeit, die noch keine Inschriften kennt, Buchschrift anzusetzen, gehört zu den Abenteuerlichkeiten unserer Gelehrten, die nicht ausrottbar scheinen; dies gilt leider auch von Diels »Antike Technik«² S. 71 f. Eine minoische Schrift gab es freilich schon; aber das spätere griechische Alphabet ist nicht davon, sondern vom phönizischen Alphabet abgeleitet. Geschrieben wird bei Homer vom Volk nie, von den Vornehmen und Helden nur zweimal; erstlich schreibt, wo man losen soll, Jeder Beteiligte seinσῆμαauf das Los (Ilias VII 189). Das konnte auch jeder Analphabet. Interessanter die Tafel mit geheimer Schrift, die einen den Überbringer selbst betreffenden Mordbefehl enthält (Ilias VI 168 f.), die Tafel, die der König Proitos von Tiryns durch Bellerophon nach Kleinasien zum König von Lykien tragen läßt. Dies ist ein Unikum, das seine besondere Erklärung verlangt. Denn keine der Personen denkt sonst bei Homer an brieflichen Verkehr mit Hilfe der Schreibtafel, während er doch oft so zweckdienlich gewesen wäre. Agamemnon bleibt ohne Kunde über das Verhalten Klytemnestras in Mykene, Telemach muß persönlich zu Nestor und Menelaus fahren, um über seinen Vater Nachricht zu erhalten. Daß nur mündlich durch Boten Nachrichten überbracht werden können, zeigt auch Odyssee 14, 122. Man muß die Stelle Ilias VI 168 f. achtsamer lesen. Die Tafel, die Bellerophontes da nach Lykien trägt, ist zwar gefaltet (πτυκτόν), d. h. sie besteht zwar aus zwei zusammengelegten Tafeln, aber sie ist unversiegelt (Homer kennt ja überhaupt das Siegeln noch nicht); auch unverschnürt; von irgendwelchem Verschluß wird da nichts erwähnt, was doch in diesem Falle zum Verständnis so wichtig gewesen wäre. Trotzdem merkt nun aber der Überbringer nicht, daß der Inhalt ihm selbst den Tod bereitet. Also ist vorausgesetzt, daß dieser Bellerophontes nicht lesen kann, die angewandten Schriftzeichen nicht versteht. Es war eine Geheimschrift, in der Schwager und Schwager, Proitos und der lykische König, sich zu verständigen wußten; es warenσήματα λυγρὰ πολλά, ob minoische Schrift, steht dahin, eher hethitische, wenn L. Malten mit seiner Auslegung des Bellerophonmythos, Jahrb. d. arch. Instituts 1925, Bd. 40, recht behält, vielleicht aber auch nur symbolische Zeichen, die auf Ermordung wiesen. Dasλυγρά»verderblich« steht hier so wie dieἀγγελίη λυγρήIlias XVII 642. – Offensichtlich ist nun, daß die erwähnte Schreibtafel zur Ansetzung einer Buchschrift für Homer nicht entfernt berechtigt. Auch die Sänger, die bei ihm auftreten, kennen sie nicht. Sie rezitieren immer nur frei aus dem Gedächtnis. Vgl. noch B. Niese, »Die Entwicklung der homerischen Poesie« S. 8 f.; W. Otto, Kulturgeschichte des Altertums S. 65.wissen infolgedessen auch von jenen Dingen nichts Bestimmtes mehr, und in der Ilias ist davon nur ein völlig entstellendes, dichterisch umgewandeltes Bild erhalten.
Also wissen Homer und seine Helden nichts von Amenophis, Ramses und Sesostris, von den Pyramiden und Sonnentempeln, noch nichts von Hamurappi, Sergon und den sogenannten Gärten der Semiramis. Aber Kreta zum wenigsten lag nahe; bis dahin getraute sich ihre sonst noch so schüchterne Schiffahrt.Die Griechen bauen sich ihre Schiffe natürlich selber (vgl. Ilias XIII 391), ihnen fällt auf, daß die Zyklopen es nicht tun (Odyssee 9, 126). Daß die Arkader es nicht konnten (Ilias II 614), verstand sich von selbst. Wie unentwickelt und scheu jedoch die Schiffahrt noch war, wird durch vieles deutlich gemacht. Menelaus reist zu Schiff nur bis Kreta (Ilias III 233), nach Ägypten und Sidon wird er nur wider Willen verschlagen (Odyssee 4, 83 ff.). Nur die in Asien angesessenen Trojaner sind es, die mit Plan und Absicht nach Sidon fahren (Ilias VI 291). In Troja sind die Schiffsbauer darum angesehene Leute, und ein solcher kämpft mit in der Schlacht (Ilias V 62). Die Schiffe der Achäer sind gleichsam nur Fähren oder militärische Transportschiffe, noch nicht Handelsschiffe, jedes führt 120 Mann, nach Ilias II 510, sie haben 20 Ruderer (Odyssee 9, 322). Daher halten Agamemnon und die Seinen während der zehn Kriegsjahre keinen regelmäßigen Schiffsverkehr mit dem Heimatlande aufrecht; sie behalten ihre Schiffe für die Rückfahrt bei sich. Nur bis zum nahen Lemnos senden sie einmal Schiffe, um sich Wein zu beschaffen (Ilias VII 467 f.). Die Phönizier allein sind es, die Handel über See führen; sie bringen Waren aus der Ferne (vgl z. B. Ilias XXIII 745); daneben auch die Tafier (Odyssee 1, 183 f.). Wenn August Köster »Das antike Seewesen« S. 70 sagt, daß der griechische Schiffsbau, wie Homer ihn zeigt, damals höher entwickelt war als andere Zweige des Kulturlebens, so zeigt das Obige doch, wie weit er noch hinter dem der Phönizier zurückstand. – Diese Erwägungen hindern mich, den Ansichten über die geographischen Kenntnisse Homers beizupflichten, die u. a. von F. Cornelius im Rhein. Museum 74 S. 344 f. und R. Hennig ebenda 75 S. 280 f. vorgetragen worden sind, als ob die Griechen schon Fahrten bis England und in die Nordsee gemacht hätten. Homer schildert allerdings vielleicht schon Tartessos; den Namen nennt er nicht. Nur durch die Phönizier aber, die ja an allen Küsten Griechenlands und auch an Ithaka anliefen, brauchen die Griechen damals davon Kunde erhalten zu haben; dies anzusetzen genügt zum Verständnis durchaus. Der Dichter hat sich die dortigen Dinge dann hübsch ausgemalt, denn er schildert gern. Gewiß ist es höchst verfehlt, mit Dörpfeld u. a. jede Bucht, Felsklippe u. a., die in den Epen erwähnt sind, heute genau nachweisen zu wollen. Schildert Homer doch auch mit derselben Genauigkeit den Eingang zum Hades und die Mündungen der Unterweltsströme am fernsten Okeanos, wo das Ufer niedrig und Haine von Pappeln und Weiden sind usf. (Odyssee 10, 509 ff.). Soll auch dies der Dichter oder sein Zuträger damals selbst gesehen haben oder gar die wunderbar schwimmende Insel des Aeolus (10, 3)? So wenig dies möglich, so wenig beruht auch manches andere, wovon wir Schilderungen erhalten, auf Eigenschau. Betreffs Ithaka s. A. Trendelenburg in »Humanist. Gymnasium« 1928, S. 116, der sich gegen Dörpfeld überzeugend in dem Sinne äußert wie ich selbst in den »Griech. Erinnerungen« S. 231. Man vergesse nicht, der Phantasie ihr Recht zu lassen. So gut ein Dichter sich Menschentypen ausdichtet, so auch Landschaften. Oder soll er auch den Bart und die Locken des Zeus und die Körpergröße und das Kreisauge des Zyklopen gesehen haben? Das dreimalige Fluten der Charybdis ist übrigens nach den Wasserverhältnissen des euböischen Meeres erfunden, die als Naturrätsel Anthol. Pal. IX 115 geschildert sind. – Als Problem für sich steht die Frage nach der Gewinnung des Zinns für die Bronze des Altertums; hierüber H. Blümner, Technologie usf. IV S. 81 ff. Daß man es in jener Urzeit durch Weitergeben von Volk zu Volk schon aus England oder gar aus Indien oder Japan bezog, scheint wenig glaublich; wahrscheinlich kam es vom Paropamisus zu den Babyloniern, Ägyptern und so auch zu den Karern und Griechen. Jedenfalls istκασσίτερος(»Zinn«) nicht griechisch (auch schwerlich indogermanisch), sondern barbarisches Lehnwort.Auf dieser halbwegs schon griechisch kolonisierten Insel war unter ägyptischen und asiatischen Einflüssen eine originell lokale Hochkultur entstanden, die sich uns freilich durch kein Literaturwerk, durch keine Königsinschrift, sondern lediglich durch die grandiosen Palastreste und ihren Wandschmuck offenbart hat, eine Kunst, die man minoisch nennt; das Berühmteste das sogenannte Labyrinth, das auch Homer erwähnt, der kompliziert großartige Renommierpalast des sagenhaften Königs Minos mit Sälen und Kammern und Bädern und Lichthöfen und der majestätisch breiten Treppe, Wasserleitung und Spüleinrichtungen für die Notdurft des Herrn. In den Vorratsräumen die riesigen Tonfässer, in die aus der Ölpresse das Öl unmittelbar ablief.
Was haben die griechischen Fürsten von dort gelernt oder lernen können? Sicher nicht das Schreiben.Vgl. obenS. 23, Anm. "Das Gesagte aufs neue ausführlich zu begründen...".Auch ihre Paläste, die wie unsere Burgen die Bergeshöhe suchten, mußten die Atriden, der Raumenge entsprechend, in kleinem Ausmaß, also im Grundriß ganz anders gestalten. Aber auch die erstaunlich entwickelte kretische Wandmalerei hat ihnen wenig geboten. Die Kunst sehnt sich sonst nach der Darstellung des Menschen, der Persönlichkeit, nach dem Porträt, und die Ägypter leisteten das damals wundervoll. Der Kreter dagegen triumphiert, wenn er Pflanzen, Fische, Quallen undandere Wasserwesen malt; auch Stiere und Löwen gelingen ihm, während seine Menschen noch ganz unpersönlich und nichts als drollige Kostümbilder, Trachtenbilder sind; man wird dabei an unsre Modejournale erinnert: die Männer wahnschaffen dünn geschnürt und wie verwachsen, die Frauenwesen weit dekolletiert, mit Puffen und Falten am Kleide, wobei das Kleid wie ein breiter Kegel nach unten sich weitet. Waren es wirklich Griechen, die so einhergingen, und wirklich Griechen, die das malten?Vgl. »Von Homer bis Sokrates« S. 13.Was hätte Homer gesagt, wenn er Helena oder Nausikaa in dieser Toilette, wenn er sogar den kretischen Helden Idomeneus, den er feiert, in dieser Karikatur gesehen hätte?
Suchen wir die Fürsten etwas näher kennenzulernen, die Homer uns vorführt. Mit den Pharaonen, den Sultanen Babylons lassen sie sich nicht entfernt vergleichen. Sie sind nicht Despoten im Stil Nebukadnezars oder des jüdischen Königs David, vor denen das Volk auf die Kniee fiel. Die deutsche Bezeichnung »König« selbst ist hier ganz irreführend. Das betreffende griechische Wortbasileusheißt auf deutsch nur der Sprecher oder Wortführer, der Mann, dessen Wort gilt.Über die Wortbedeutung vonβασιλεύςunddictators. Rhein. Mus. 76 S. 198 ff. und Philol. Wochenschr. 1928 S. 185 f.; wiedictatorzudiceregehört, soβασιλεύςzuβάζειν, »sprechen«. Bei Hesiod istβασιλεύςnur noch »Richter«.