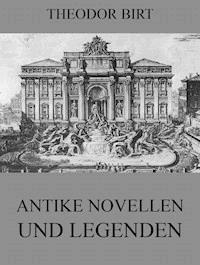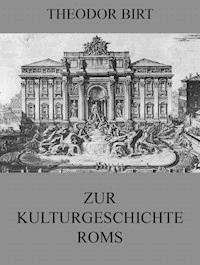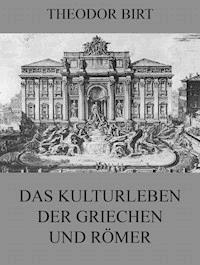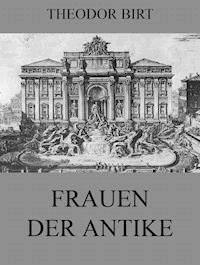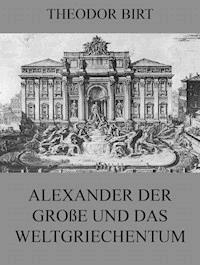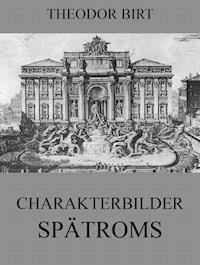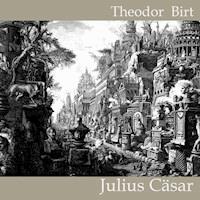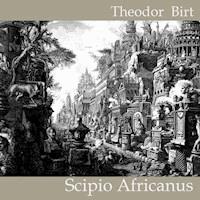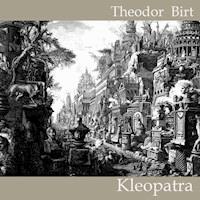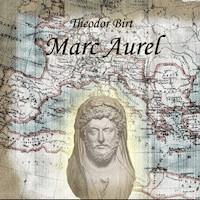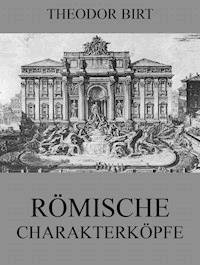
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das vorliegende Buch will Personen schildern, Menschen uns nahe bringen, und aus der Fülle der überlieferten historischen Einzelheiten das Wesentliche hervorheben, damit vom Beiwerk die Zeichnung selbst nicht zugedeckt werde. Dabei wendet sich die Darstellung der römischen Staatsmänner, Feldherren und Kaiser an den weiten Kreis der Gebildeten; sie möchte aber auch die flüchtige Beachtung des Gelehrten und Fachmannes auf sich lenken. Denn es handelt sich um eine wichtige Sache, um die richtige Beurteilung eben jener vielgenannten führenden Männer Roms, des Hadrian und Mark Aurel, aber auch des Pompejus, Augustus, Mark Anton und anderer Größen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 464
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Römische Charakterköpfe
Ein Weltbild in Biographien
Theodor Birt
Inhalt:
Theodor Birt – Biographie und Bibliographie
Römische Charakterköpfe
Vorwort
Einleitung
Scipio der Ältere
Cato der Zensor
Die Gracchen
Sulla
Lukull
Pompejus
Cäsar
Mark Anton
Octavianus Augustus
Kaiser Claudius
Titus
Trajan
Hadrian
Mark Aurel
Römische Charakterköpfe, T. Birt
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849623012
www.jazzybee-verlag.de
Theodor Birt – Biographie und Bibliographie
Birt, Theodor, Philolog, geb. 22. März 1852 in Wandsbek, verstorben am 28. Januar 1933 in Marburg. Studierte seit 1872 in Leipzig und Bonn, habilitierte sich 1878 in Marburg und wurde 1882 außerordentlicher, 1886 ordentlicher Professor daselbst. Seine Hauptwerke sind: »Das antike Buchwesen in seinem Verhältnis zur Literatur« (Berl. 1882); »Zwei politische Satiren des alten Rom« (Marb. 1888); die erste kritische Ausgabe des Claudian (Berl. 1892); »Eine römische Literaturgeschichte in fünf Stunden« (Marb. 1894); »Unterhaltungen in Rom. Fünf Gespräche deutscher Reisender« (Berl. 1895); »Sprach man avrum oder aurum?« (Frankf. a. M. 1897); »Der Hiat bei Plautus und die lateinische Aspiration bis zum 10. Jahrh. n. Chr.« (Marburg 1901); »Griechische Erinnerungen eines Reisenden« (das. 1902). Auch als Dichter hat er sich bekannt gemacht, z. T. unter dem Pseudonym Beatus Rhenanus, mit folgenden Werken: »Philipp der Großmütige«, Prologszene (Marb. 1886); »Attarachus und Valeria«, lyrische Erzählung (das. 1887); »Meister Martin und seine Gesellen« (Reimspiel, das. 1894); »König Agis« (Tragödie, das. 1895); »Das Idyll von Capri« (das. 1898); »Die Silvesternacht« (Reimspiel, das. 1900).
Römische Charakterköpfe
Vorwort
Das vorliegende Buch befleißigt sich der Kürze. Es will Personen schildern, Menschen uns nahe bringen, und aus der Fülle der überlieferten historischen Einzelheiten galt es deshalb immer nur das Wesentliche hervorzuheben, damit vom Beiwerk die Zeichnung selbst nicht zugedeckt werde. Dabei wendet sich die Darstellung der römischen Staatsmänner, Feldherren und Kaiser, die ich gebe, an den weiten Kreis der Gebildeten; sie möchte aber auch die flüchtige Beachtung des Gelehrten und Fachmannes auf sich lenken. Denn es handelt sich um eine wichtige Sache, um die richtige Beurteilung eben jener vielgenannten führenden Männer Roms, des Hadrian und Mark Aurel, aber auch des Pompejus, Augustus, Mark Anton und anderer Größen, und ich trage seit langem die Überzeugung in mir, daß in den bisherigen Darstellungen, auch den besten, oft noch die Deutlichkeit, ja, auch die überzeugende innere Wahrheit fehlt, wenn nicht gar schrullenhafte Verzeichnungen vorliegen. Denn in den Büchern, die ich meine, werden die Menschen, um die es sich handelt, mit dem Gang der großen Staatsgeschichte, an der allein dort das Interesse haftet, allzu eng verflochten, und sie selber leben sich in ihrer vollen Natur nicht vor uns aus. Man darf einen Cäsar und Pompejus nicht nach ihren Erfolgen und dem Vorteil, den der Fortschritt der Dinge von ihnen gehabt hat, man darf sie nur nach dem beurteilen, was sie gewollt haben. Nur wer sie isoliert, wer ihre persönliche Bekanntschaft sucht und sie bis auf ihre Lebenswurzeln hin scharf belichtet, kann sie verstehen und würdigen. Ein gewisses dichterisches Erfassen muß dabei helfen; ohne miterlebende Phantasie läßt sich keine Personengeschichte schreiben.
Täusche ich mich nicht und können die Porträts, die ich gezeichnet, auf wirkliche Ähnlichkeit Anspruch machen, so ist aber noch mehr gewonnen, und das gesamte Geschichtsbild selbst wird damit zugleich hier und da berichtigt und innerlich wahrhaftiger. Denn diese Männer sind es eben, aus deren Tun und Lassen alle großen Hergänge fließen. Ich habe darum als meine zweite Aufgabe betrachtet, mit den Charakterzeichnungen ein ununterbrochenes Bild der Entwicklung Roms und des römischen Reiches zu verweben; und dabei ergab sich noch eins. Man meint gewöhnlich, die guten und schlechten Herrscher wechselten in Rom zufällig wie das Wetter. Das bedeutet den Verzicht auf ein wirkliches Verstehen. Mein Geschichtsbild zeigt, daß in der Aufeinanderfolge der Personen vielmehr eine innere Notwendigkeit gewaltet hat; denn sie sind nur die Produkte der Gesellschaft, aus der sie hervorgehen. Es ist geboten, auf das Ethische zu achten. Mark Anton und Nero verkörpern nur den zerrütteten Zeitgeist, der sie bedingt hat. Mit der allmählichen und allgemeinen Hebung des Menschentums in Rom hebt sich auch das Regiment, veredelt sich die Natur der herrschenden Personen, von Seneca bis Mark Aurel. Kein blinder Zufall spielt hier; wer eine Bilderfolge gibt, hat auch die inneren Gründe ihres Wechsels aufzudecken.
Marburg a. L., 31. Juli 1913.
Der Verfasser.
###
Der Zweck meiner Darstellung ist, wie schon das obige Vorwort andeutet, nicht Unterhaltung, sondern Feststellung des Tatsächlichen. Wenn man sie gleichwohl unterhaltend gefunden hat, so liegt dies an dem so außerordentlich bedeutsamen Gegenstande, den sie behandelt. Ich wollte, der Satz hätte allgemeine Geltung, daß die Wahrheit immer fesselnd ist; ich wollte insbesondere, daß er auch von dieser meiner bescheidenen Arbeit gelten könnte! Die Gesichtspunkte, nach denen ich die Charakterbilder niedergeschrieben, habe ich inzwischen ausführlicher in den Preußischen Jahrbüchern 1914, S. 563 ff. dargelegt, und der Freund dieses Buches sei darauf verwiesen. Durch Berichtigungen und mehrere Zusätze habe ich endlich die nunmehr erscheinende Neuausgabe zu verbessern gesucht.
Marburg a. L., 31. Juli 1916.
D. V.
###
So wie die voraufgehenden hat auch die jetzige Neuausgabe meiner »Charakterköpfe« mehrere Berichtigungen und Zusätze erfahren. Wärmsten Dank habe ich meinem Kollegen, Herrn von Premerstein, zu sagen, der mir für die dritte Auflage auf das liebenswürdigste zu einer Reihe von Änderungen die Anregung gegeben hat. Mit einiger Genugtuung aber stelle ich fest, daß manches, worauf ich Wert lege, insbesondere die Auffassung des Pompejus und Julius Cäsar, die ich vertrete, und die Art, wie ich Augustus zu Pompejus und Cicero in Beziehung setze, seit dem Erscheinen der ersten Auflage meines Buches in der neueren Geschichtschreibung mehr und mehr Boden gewonnen hat, ohne freilich daß meine Arbeit dabei von den Fachgenossen einer Erwähnung gewürdigt wird. Um des Augustus Verhältnis zu Cicero und Pompejus zu verstehen, ist die richtige Auffassung der Schrift Ciceros vom besten Staat (De re publica) von wesentlicher Bedeutung. Neuerdings ist von R. Heinze der vergebliche Versuch gemacht worden, die Auffassung vom Zweck dieser Schrift, die ich vertrete, umzuwerfen. Es war daher nötig, obschon dies Buch sonst Polemik vermeidet, eine etwas eingehendere Widerlegung zu geben, wofür auf den Anhang S. 337 verwiesen sei.
Marburg, 2. Februar 1932.
D. V.
Einleitung
Die römische Geschichte ist einheitlich wie die Biographie einer Person, wie die Geschichte eines Individuums, aber sie ist zugleich groß wie keine andere Volksgeschichte. Denn sie erstreckt sich über elf Jahrhunderte, und ihre Leistung war ein Weltreich, wie man es, wenn man von China absieht, nie sonst gesehen, ein Weltreich, das die wichtigsten Teile Europas, Asiens und Afrikas umspannte und sich in diesem Umfange durch sechs Jahrhunderte erhielt. Wie schattenhaft kurzlebig waren dagegen die Weltreiche Alexanders des Großen und Napoleons! Das Außerordentliche erklärt sich aus der Zersplitterung und Schmiegsamkeit der Völker außer Rom; es wurde vor allem der beispiellosen Organisationskunst der Römer verdankt. Die unvergänglich große Leistung Roms aber ist nun, daß dies Reich schließlich auch eine einheitliche Kultur gewann, daß die Hochkultur des Altertums gleichzeitig Syrer, Juden, Gallier, Germanen, Spanier und Mauren beglückt und ebenbürtig erzogen hat.
Die eine Stadt Roma am Tiberfluß hat das geleistet, kraft ihrer Rasse, die an keinem gewonnenen Ziel stillstand. Aus dem Senfkorn erwuchs ein Baum, der die Welt überschattete.
Man könnte, wenn man Umschau hält, doch noch England damit vergleichen wollen, das sich allmählich im Verlauf von drei Jahrhunderten mit einem Kolonialreich englischer Sprache umgeben hat. Aber der nicht minder imperialistischen Entwicklung Englands, die es schließlich dahin trieb, unlängst den Weltkrieg gegen Zentraleuropa mit anzustiften und zu führen, fehlt völlig der funkelnde Ruhmesglanz Roms. »Geschäft« ist ihm alles. Es hat entweder nur Wildnisse annektiert, oder doch nur Völker geringer Widerstandskraft unterjocht und aufgesogen; dabei wird von ihm im Handelsinteresse die ehrwürdige alte Kultur Indiens planvoll zugrunde gerichtet. Rom hat seine eigenen Lehrmeister, Staaten, die geistig und kulturell weit über ihm standen, mit eisernem Griff unter sein Szepter gezwungen; seinen Ruhm und seinen Beruf sah es darin, ihre Zivilisation zu stützen und weiter der Welt mitzuteilen.
Meine Absicht soll sein, dies alles in großem Zuge vorzuführen. Aber meine Absicht greift höher; sie möchte zugleich auch denjenigen Genüge tun, die da im Leben oder in der Geschichte nach großen Menschen sich umsehen. Rom kann sie ihnen zeigen in Fülle, und darum gebe ich hier eine Porträtgalerie. Auch sie kann uns Geschichte lehren. Unter Größe aber verstehe ich nicht speziell das sittlich Außerordentliche, das zum Heiligenleben führt, obgleich wir auch dem begegnen werden, sondern die Kraft der Person, die unendliche Machtgebiete sich zu unterjochen weiß. Die großen Menschen waren es, und sie sind es noch heut, die die Geschichte machen. Schlimm, wenn sie fehlen! Die Masse fühlt wohl, was Not täte, aber sie vermag als solche nichts und wird es nie vermögen. Die Tat gehört dem einzelnen, der die Nation vertritt.
Das Leben der Völker ist Gesellschaftsleben; im Handel und Sitte spielt es sich ab, d. h. in der kommerziellen Entwicklung und in Erwerb und Steigerung der geistigen Güter. In den Schlachten und Friedensschlüssen hat das Volksleben nur seine vereinzelten großen Augenblicke. Die Blüte der Gesellschaft aber sind überall die großen Personen, die plötzlich und überraschend, wie der Riesenblütenschaft aus dem Blätterwuchs der Agave, in Vereinzelung aus den Familien hervorwachsen, seien es Künstler und Denker, seien es Männer der politischen Tat. Sie sind die Stromschnellen im ebenen Fluß der Zeiten. Wir denken an Scipio Africanus, Gaïus Gracchus oder Julius Cäsar. Sie sind wie tiefe Schnittpunkte in der unendlich geraden Linie der Dinge. Aber auch solche Männer, die die unaufhaltsame Entwicklung mit mächtigem Gegenschlag aufzuhalten versucht haben, ein Cato, ein Sulla, ein Brutus, ein Seneca, sind der biographischen Betrachtung wert. Denn oft bedeutet der sogenannte Fortschritt Verfall, und der Konservative vertritt in Wirklichkeit den wertvolleren Besitz, den Besitz der Vergangenheit, den er nicht preisgeben will.
Wahrhaft geschichtliches Leben ist nur da, wo große Menschen sind; das herrschsüchtige Rom, die Mutterstadt des Egoismus, aber hat fast nur Genies des Kampfes, es hat auffallend wenig bahnbrechende Führer der geräuschlosen Friedensarbeit erzeugt. Dies sei gleich hier festgestellt. Daher wirken die vierzig Friedensjahre unter Kaiser Augustus auf uns wie ein leeres Blatt; denn es stehen nur die Namen einiger Dichter darauf, die wohl verehrungswürdig, aber doch nicht groß sind in dem Wortsinne, der hier gemeint ist.
Lauter Männer sind es, die uns beschäftigen werden, und keine Frauen. Dies bedaure ich.
Gewiß, auch die Römerin konnte sich sehen lassen: ein Vollblutweib, wie wir sie uns denken; rassig und herrschfähig und mitunter auch klug. Der Römer, heißt es, beherrscht die Welt, die Römerin den Römer! Aber sie war Mutter. Von der unverheirateten Dame, von den rüstigen alten Jungfern und lieben, hilfreichen Tanten wissen die Autoren des Altertums wenig oder nichts zu berichten. Auch gar nichts von Stimmrechtlerinnen. Cornelia ist berühmt, weil sie die Mutter der Gracchen; Agrippina ist berüchtigt, weil sie die Mutter des Nero: an ihren Söhnen sollt ihr sie erkennen. Ob gut, ob schlecht: der Sohn ist in Rom die weltgeschichtliche Tat der Frau gewesen. Auch Intrigantinnen, auch Frauen, in deren verführerischen Gemächern sich die hohe Politik zusammenfand, auch solche, die sich vor dem Blut nicht scheuten und Legionen anwarben für den Bürgerkrieg, hat allerdings Cäsars und Octavians Zeit gesehen. Aber das, was wir davon hören, reicht für ein »Charakterbild« nicht aus. Ein Porträt braucht volle Linien, volle Farben, und über Frauen soll man nicht reden, wenn man nicht wirklich auf das Genaueste unterrichtet ist. Denn wir hören gegebenenfalls nur von ihrer bösen List und sehen die Anmut nicht mehr, mit der sie alles Arge zudeckten.
Wenn wir die Weltgeschichte in Biographien auflösen, so greifen wir damit auf ein Verfahren zurück, das, wie ich meine, mit Unrecht seit langem außer Gebrauch gekommen ist. Ich gestehe zu, daß es für manchen Geschichtsstoff sich allerdings nicht eignen würde. Eine englische Geschichte des 19. Jahrhunderts würde sich z. B. in dieser biographischen Weise kaum behandeln lassen; denn sie besteht im 19. Jahrhundert wesentlich aus Wahlreden, Bills und Parlamentsabstimmungen, und die Minister, wie Canning, Palmerstone, Disraeli, so bedeutend sie bisweilen sind, sie treten auf und treten zurück, je nach dem Ausfall der Abstimmung im Unterhaus; lauter Bruchstücke von Personalien; ein großartiges Geschiebe ohne Ruhepunkt; ein immer wechselnder Barometerstand ohne Gewitter und Blitzschlag.
Gleichwohl ist die Personenbetrachtung die unerläßliche Vorarbeit für jede rechte Geschichtschreibung. Auch war früher die Schätzung anders. Schillers Zeit, Luthers Zeit liebte die Biographie und die Anekdote. Man suchte sich daran zu erbauen, und sie wirkte erziehend auf jung und alt. Es ist hübsch, sich daraufhin einmal das Rathaus der alten Festung Ulm anzusehen, dessen ganze Außenwände (etwa in Luthers Zeit) mit großen, bunten Fresken bedeckt worden sind; da sehen wir z. B. den römischen Feldhauptmann Camillus, der einst die Festung Falerii vergeblich berannte. Ein kleiner Schulmeister, der ein Schalk war, wollte gegen guten Lohn diesem Camillo die Festung Falerii verraten und führte alle Schulbuben des Orts auf den Anger vor das Tor zur Kurzweil heraus, um die Kleinen dort dem Feind in die Hand zu liefern. Der edle Camillus aber verschmähte die Beute; er ließ vielmehr jedem Knäblein eine Rute reichen, mit der sonst der Lehrer die Kinder strich, und befahl ihnen, den ungetreuen Schulmann damit gründlich zu verprügeln, auf daß er seinen Lohn habe. Man sieht, wie lehrreich das Histörchen aus einer Römerbiographie gerade für eine Festung wie Ulm hat erscheinen müssen.
Schon das Altertum hat bekanntlich die Biographie, auch gerade die Römerbiographie, erfunden. Ein paar Proben davon gibt uns der dürftige Cornelius Nepos; vor allem wird der Grieche Plutarch, einer der edelsten Essayisten, nicht müde, sich mit den Staatsmännern Roms, Sulla und Marius und wie sie heißen, zu beschäftigen, und seine Darstellungen sind wirkliche Monumente. sie sind von bleibendem ethischem, ja auch von hohem historischem Wert. Schlimmer steht es mit den Kaiserbiographien des Sueton und seiner Fortsetzer, der sog.Scriptores historiae Augustae. Sueton war unter Kaiser Hadrian Bürovorsteher des kaiserlichen Sekretariats, außerdem ein fleißiger klassischer Philologe; das sind aber gefährliche Eigenschaften. Denn man wird fragen: was kann von einem klassischen Philologen Gutes kommen? Jedenfalls sind Sueton und gar seine Fortsetzer der biographischen Aufgabe, die sie sich stellten, nicht gewachsen gewesen. Es fehlt da an aller eigentlichen Vertiefung, und wir erhalten gelegentlich so wichtige Tatsachen wie, daß Kaiser Caligula keinen Schwimmunterricht hatte, oder daß der Musikkaiser Nero sich nicht nur für Gesang, sondern auch für den Dudelsack begeisterte, und dazu kommen dann die goldenen Sofakissen und die Bowlenrezepte, die Elagabal in Mode brachte, derselbe Elagabal, der bekanntlich auch Hahnenkämme und Nachtigallzungen aß, während es vom Alexander Severus heißt, daß er maßvoll und fast wie ein Abstinenzler lebte; er trank nach dem Bad gern ein Glas Milch mit einem Ei dazu: erbärmliche Nichtigkeiten und Kuriositäten. Wir müssen denn doch versuchen, es besser zu machen.
Kehren wir hiernach zum Anfang zurück. Rom ist nach der Sage im Jahre 754 v. Chr. gegründet, aber unsere Aufgabe selbst hebt erst fünfhundert Jahre später an. Denn vorher fehlt in Rom eine Literatur, und wo keine Literatur ist, können wir auch über das Menschentum nichts erfahren. Um das Jahr 323, als Alexander der Große stirbt, hat die herrliche griechische Literatur ihren Höhepunkt schon hinter sich, und da treten eine Menge griechischer Orginalmenschen wie Themistokles, Alkibiades, Kritias, Agesilaos, von denen jeder weiß, vor uns hin, während Rom noch ganz grabesstumm liegt, eine Barbarenstadt: es hat noch kein einziges Buch, noch keine Buchzeile der Erinnerung für seine eigenen verdienten Männer.
Charakterköpfe aus jenen Zeiten fehlen uns also. Aber der Altrömer selbst war ein Charakterkopf. Wie auf den ägyptischen Reliefs sich alle Figuren gleich sind, so auch die Altrömer; sie sind nichts als ein Typus; der Instinkt der Masse redet aus jedem einzelnen. allen gemeinsam der Stolz, die maßlose Habsucht, das harte Rechten um mein und dein, der unnachgiebige Trotz und der gröbste Chauvinismus. Daher aber auch der blinde Gehorsam der Subalternen und die erstaunliche Einigkeit im römischen Senat, die so seltenen Zerwürfnisse der beiden Konsuln; eine Kollektivseele wie im Bienenstock, wo alles seit Jahrtausenden glatt geht und niemand sich hervortut. Dazu half in Rom ohne Frage die altmodisch barbarische Hauserziehung, diepatria potestas. Denn der Vater hat Gewalt über Leben und Tod seiner Söhne. Jeden kühneren Schwung, jeden Hochflug der Jünglinge zerrten die Väter unerbittlich zurück, bei Strafe der Verstoßung: kein Sohn wächst daher über seinen Vater hinaus. So blieb es durch fünf Jahrhunderte.
In Fell und Kappe, struppig und ruppig und ziemlich ungewaschen, so denken wir uns jenen alten Typ, mit unsauberen Nägeln und großen Ohren; in Lehmhütten hausend; immer selbst zugreifend zum Schwert oder zur Mistgabel. Mit dem Spieß wurde das Vieh getrieben, mit dem Spieß in der Schlacht gefochten. Ungünstige Verträge mit dem Feinde wurden kassiert, indem man herzlos den Beamten preisgab, der sie geschlossen; denn es kam nie auf den Menschen an, sondern nur auf den Staatsvorteil. Hartknochige Naturen, ohne Schönheitssinn, ohne alle Phantastik, auch ganz unmusikalisch, aber energisch, rasch zufahrend und das Gegenteil des Harmlosen.
Unbekannter Römer älteren Stils
Römer älteren Stils (sog. Brutus). Rom, Konservatorenpalast. Nach Photographie.
Dabei ist der alte Römer trotz dieser Einheitlichkeit ein Rassenproblem. Denn schon die Erzählung von der Gründung Roms durch Latiner und Sabiner deutet, wenn sie recht hat, auf frühe Mischung des Blutes. Auch von den ganz fremdblütigen Etruskern haben früh angesehene Familien in Rom gesessen. Weiterhin sehen wir dann, daß ein altangesessener Ortsadel, der Stand der Patrizier, vorhanden ist, der sich gegen den Andrang der mutmaßlich zugewanderten Plebejer wehrt: ein Schutzmittel gegen sie war die Verweigerung der Ehegemeinschaft. Aber die Absonderung der Bevölkerungsschichten ließ sich auf die Dauer nicht durchführen. Dazu kam dann aber noch die Masse der Sklaven oder Knechte, der Kriegsgefangenen, Gallier, Griechen, Punier, Asiaten in Rom: denn die Söhne der freigelassenen Knechte erhielten in Rom früh und regelmäßig das Bürgerrecht, und zwar zu Tausenden und Abertausenden, unechte Römer, die sich unmittelbar mit derplebsvermischten. Daher kann schon seit dem 2., ja schon seit dem 3. Jahrhundert v. Chr. von einer reinrömischen Stadtbevölkerung kaum noch die Rede sein. Aber der ehrgeizige Stolz, Römer zu sein, ergriff gleich alle in die Bürgerlisten Eingetragenen und riß auch die fremdartigen Elemente zusammen. Indes hielt der Vornehme bei solchen Zuständen ängstlich auf seinen Stammbaum und sorgte für Familienchronik und Ahnenbilder nach Möglichkeit.
Mit dem Wachsen des Landerwerbs und der Bevölkerung änderten sich naturgemäß in Rom ständig die Satzungen und Rechte, wobei sich Plebs und Junker hartnäckig befehdeten; daraus ergab sich schon früh eine ereignisreiche Verfassungsgeschichte und Rechtsgeschichte Roms, und da treten nun in den berühmten Volkstribunen in der Tat starke und temperamentvolle Persönlichkeiten auf, deren Stimme über die Komitien scholl und die mit ihrem Einspruch unerschrocken selbst den hohen Senat lahm setzten; was sie trieben, war wie eine politische »Sabotage«: die Schienen der Gesetzgebung wurden gleichsam aufgerissen, und die Staatsmaschine mußte stoppen, oder sie zerschellte. Aber diese Volkstribunen, soweit wir sie kennen, sind schließlich wieder alle gleich; der Beruf erzeugte den besonderen Menschentypus. Sie wechselten jährlich, und das ergibt im Lauf der Zeiten eine Menge Exemplare, die alle ungefähr dieselbe Sprache führen und sich gleichsehen wie Bulldoggen.
Aber Roms Kriegsgeschichte? Allerdings, keine Kriegsgeschichte ist so schlachtenreich wie die altrömische, aber in keiner ist auch wohl so großartig gelogen, oder sagen wir: so großartig gedichtet worden, wie in ihr. Eine Fülle herrlicher Namen: die ersten sieben Könige, die meist so brav sind, dann der Mann mit den langen Locken, Cincinnatus, weiter Menenius Agrippa, Valerius Poplicola, Manlius Torquatus, Camillus: Helden, gut für das alte Ulmer Rathaus und ganz prächtig auch für die moderne Kinderstube, aber leider nicht für uns, die wir Wahrheit und Wirklichkeit wollen.
Woher stammen diese Geschichten? Niebuhr glaubte einst (und schon Vico und Perizonius vor ihm), sie stammten aus wirklicher altrömischer Poesie her, aus alten Heldengesängen, von denen sich bei dem Geschichtschreiber Livius zufällig nur Auszüge erhalten hätten; und der große englische Historiker Macaulay setzte sich dann hin und dichtete wirklich solche altrömischen Heldenlieder nachträglich in englischer Sprache, als könnte er einen verloren gegangenen römischen Homer ersetzen; z. B. eine Ballade »Horatius Cocles« in siebzig Strophen, die Macaulay in der Überschrift ruhig in das Jahr 394 v. Chr. versetzt, eine zweite Ballade vom See Regillus, wo die Götter Castor und Pollux in die Römerschlacht reiten:
Nie hätt' ein sterblich Auge Sie unterschieden je. Schneeweiß die blanke Rüstung, Die Rosse weiß wie Schnee u. s. f.
Aber Niebuhrs Vermutung, der Macaulay folgte, ist längst aufgegeben. Alle jene hübschen Legenden sind viel jünger und erst durch die Einflüsse der griechischen Literatur und in ihrer Nachahmung entstanden, wo bei die erfinderischen Griechen selbst mit halfen. Denn die Griechen interessierten sich auf das lebhafteste für Rom. Den kleinen feinen Leuten imponierten diese breitspurigen Herrenmenschen gewaltig.
Die verliebte Jungfrau Tarpeja z. B., die zur Zeit des Romulus dem schönen König Titus Tatius das Kapitol verrät, ist der griechischen Scylla nachgedichtet, die dem schönen König Minos gegenüber, der ihre Stadt belagert, das gleiche tut. Um das Volk aufzuregen, stellt Brutus sich wahnsinnig bei der Vertreibung der Tarquinier; das ist nach Solon gemacht, der sich wahnsinnig stellt bei der Eroberung von Salamis. Camillus aber ist offensichtlich zum römischen Achill ausgedichtet; des Camillus Zorn und der Zorn des Achill; eine Gesandtschaft muß den Zürnenden bittflehend aus Veji zurückholen: das ist ganz wie die Gesandtschaft in der Ilias. Und Veji selbst wird, wie Troja, just zehn Jahre belagert und dabei auch noch die römischen Belagerungswerke in Brand gesteckt, wie das Lager der Griechen bei Homer.
Nichts herrlicher als Coriolan, den man in das Jahr 491 v. Chr. setzt. Coriolan wird, weil er das Stimmvieh der Spießbürger verachtet und den rassigen Patrizierstolz übermäßig zur Schau trägt, vom römischen Volke seiner Amtswürden beraubt, begibt sich voll Wut zum Landesfeind und besiegt Rom als Heerführer des Feindes; Rom zittert und wankt. Aber seine Mutter Veturia sucht ihn in seinem Feldlager auf und ergreift sein Herz; er gibt seine sieghafte Stellung preis, der Mutter zuliebe, und wird darum vom Feind erschlagen. Dieser Stoff hat einem Shakespeare zu einer seiner schönsten Tragödien verholfen. Aber dies ist nicht Shakespeares, dies ist antike Dichtung; das durchschaute schon Mommsen.
Historisch wirklich beglaubigtes Detail erhalten wir zuerst für den Krieg mit König Pyrrhus, der im Jahre 282 beginnt, und für den ersten punischen Krieg, der im Jahre 264 anhebt. Da taucht z. B. der alte Appius Claudius, der Blinde, vor uns auf, der Erbauer der unvergänglichen Appischen Straße, ein Mann mit ganz persönlichem Gesicht, der als Demagog mächtig wirkte, vor allem aber im Senat jede Friedensverhandlung mit König Pyrrhus hintertrieb, eine berühmte Szene, die uns Cicero schildert.
Dann kam der erste punische Krieg, und da maß sich Rom zum erstenmal mit einer voll ebenbürtigen, außeritalischen Weltmacht, mit Karthago, Republik gegen Republik, Handelsstaat gegen Handelsstaat (denn Rom hatte längst die Stadt der Ackerbauer zu sein aufgehört). Es war ein fast 25jähriges Ringen und der äußere Erfolg zunächst nicht sehr erheblich. So wie das moderne Italien im Jahre 1911 seine Regimenter nach Tripolis warf, genau so ist das schon damals unter des Regulus Führung geschehen. Aber die Sache war damals hundertfach gefährlicher als heute. Das mächtige Karthago schüttelte sich wie eine verwundete Löwin; aber die Wunde heilte rasch, und das Raubtier wuchs an Kräften und schlich brüllend auf neue Beute, den Rand Nordafrikas entlang, schwamm über die Meeresenge von Gibraltar und begann in die Hürden Spaniens einzufallen.
Die Zeit des ersten punischen Kriegs ist die eigentliche Idealzeit Roms gewesen: so wie bei uns Deutschen die Zeit der Entscheidungskämpfe von 1866–1870. Tadellos ist überall die persönliche Führung, die Opferwilligkeit, das Verhalten von Volk und Senat und aller Chargen; aller gemeine Eigennutz, Bestechung, Unterschlagung fehlt; der größte Opfermut beseelt die Patrioten: eine Idealität, wie sie ein Volk ergreift, das vor einer Aufgabe steht, die sein Schicksal, seinen Weltberuf für die Zukunft entscheidet. Und die Vorteile, die Rom dabei gewann, waren denn doch erheblich: das wachsende Ansehen nach außen; die bereicherte Erfahrung im Seekrieg und in der Kampfesweise ausländischer Völker; vor allem aber der Umstand, daß Rom jetzt einen Historiker fand, der diesen Krieg wirklich darstellte, und zwar einen der größten und zuverlässigsten, den Griechen Polybius. Rom trat jetzt endlich in die Geschichte ein, d. h. es wurde endlich Gegenstand der Geschichtschreibung in der griechischen Welt.
Aber von eigentlichen Charakterköpfen erfahren wir auch da noch nichts. Da ist z. B. Duilius, der den ersten Seesieg bei Mylae gewann; wir erfahren über ihn sonst weiter nichts, als daß er später sehr stolz war. In Rom gab es nachts keine Straßenbeleuchtung; vom Duilius aber wird mitgeteilt, daß er sich erdreistete, nachts mit einem Diener, der eine Kerze trug, über die Straße zu gehen, was sonst keinem Römer zustand, in Anbetracht der Feuersgefahr. Und Regulus? Die ganze schöne Geschichte, die erzählt, daß Regulus von den Karthagern, die ihn gefangen genommen, als Friedensunterhändler nach Rom geschickt worden, daß er in Rom jedoch ehrenfest für Fortsetzung des Krieges geeifert, daß er bieder sich in die Gefangenschaft zurückbegeben und von den Karthagern endlich zu Tode gemartert sei, ist leider allem Anschein nach erfunden. Denn Polyb, der Bewunderer der Römer, weiß nichts von ihr; er hätte sich dies Heldenstück gewiß nicht entgehen lassen.
Nun aber – und zwar gleich danach – tritt das entscheidende Neue ein: das siegreiche Eindringen der griechischen Geistesbildung in Rom. Rom verwandelt sich rasch, sagen wir etwa um das Jahr 240, und man lernt jetzt dort griechisch, spricht griechisch, denkt schließlich auch griechisch, und der Sinn für Dinge der Muße, Kunst, Theater, Tugendlehre und Sport wird in den zähen Kriegsleuten rasch geweckt. Das ist aber die Stimmungslage, in der auch die Individualitäten erwachen. Nicht im strammen Drill, sie gestalten sich erst in der Muße. Und sofort, im Hannibalkrieg (218–201), tritt davon auch die Wirkung hervor: Charaktere treten vor uns, die sich von der Masse energisch abheben. Das ist nicht zufällig. Das Genie meldet sich, das Genie der Tat, dem das Volk und der Durchschnittsmensch nur Raum gibt bei großem Risiko und in ganz außerordentlichen Verhältnissen. Bisher unterjochte die Pflicht die Eigenart; die römische Geschichte war darum bisher eine unendliche farblose Fläche, verschattet, monoton und grau; von diesem grauen Hintergrund hebt sich jetzt endlich wie Goldschimmer das Scipionentum ab.
Es handelt sich um die Ichbildung, die Vertiefung des Ichs, das moralisch-ästhetische Durchbilden der eigenen Person; es ist höhere Selbstpflege, eine Verklärung des Egoismus; und sie bewirkt, daß einzelne Personen sich frei auf sich selbst stellen und als Denker oder als Herrenmenschen verfeinerten Stils weit über die Menge der braven Leute hinausragen, da sie sich ihres Eigenwertes energisch bewußt werden. Griechenland hat diese Ichbildung geschaffen und wundervoll ausgestaltet; es war von ihr durchdrungen; mochte Griechenland nunmehr politisch zugrunde gehen, kulturgeschichtlich war es damit zum Erzieher Roms und der Menschheit geworden.
So kam es, daß die Geschichte Roms jetzt geradezu zur Personengeschichte wird. Es ist, als ob wir plötzlich aus engem Waldesdunkel, in dem ein Stamm dem andern glich, auf die freie Halde unter Baumriesen treten, die in Lichtungen stehen und, aus mächtigem Wurzelwerk hochgetrieben, ins Unermeßliche ihre sturmbewegten Wipfel dehnen. Denn alle jene großen Naturen – Scipio, Sulla, Pompejus und die anderen – streben fortan nach der Verwirklichung des Satzes: »Der Staat bin ich.« Rom personifizierte sich in ihnen.
Scipio der Ältere
Ich beginne mit dem großen Zweikampf zwischen Rom und Karthago, zwischen Afrika und Italien, mit dem Hannibalkrieg, wobei es sich nicht etwa um das heutige Marokko handelt, das, damals noch unzugänglich und uneinnehmbar, ganz außerhalb blieb, sondern nur um Tunis, Tripolis und Algier. Das waren damals reiche, fruchtgesegnete, üppige Länder, und auf sie stützte sich Karthago, die Weltstadt und Großhandelsstadt, die das spanisch-afrikanische Meer beherrschte und Rom dort nicht aufkommen lassen wollte. Aber Rom hatte sich schon als stärker erwiesen. Rom war Landstadt, aber zugleich auch Handelsstadt erster Größe, und seine überseeischen Interessen griffen unaufhaltsam immer weiter aus.
Zwar gab es damals noch andere Großmächte der um das Mittelmeer gelagerten Welt: die Königreiche Syrien, Ägypten, Mazedonien, Pergamon, die Erben Alexanders des Großen. Aber das waren Länder ohne Aufstreben, ohne Ziele, ohne Zukunft: es waren Dynastien, aber keine Nationen, froh, wenn sie ihr glänzendes Dasein aufrecht erhielten, genußsüchtig und phlegmatisch, wie der ganze Orient: Antiochia, Alexandria, Pella die Residenzen.
Bewegung kam in dies Weltbild nur durch Karthago und Rom. Der erste punische Krieg (264–241) hatte keine Entscheidung gebracht. Es folgt jetzt das entscheidende Duell, das uns an das Duell zwischen Preußen und Österreich im Jahre l866 durchaus erinnern muß. Es galt, die Machtfrage endgültig zu lösen: einer nur kann in Deutschland vorherrschen! Ebenso konnte damals nur einer herrschen im Mittelmeer; und hier treten nun gleich auch zwei Charaktere auf, die ihre Zeit beherrscht haben: Hannibal und Scipio. Ich will in diesen Zeilen über Publius Cornelius Scipio handeln.
Leider steht es auch noch mit Scipio ähnlich, wie mit den Gestalten der älteren Zeiten, daß wir ihn nicht im scharfen Umriß, sondern nur im Halblicht gewahren. Das liegt an der Überlieferung und kommt daher, daß die Poesie oder der unkontrollierte Trieb zur Fabel sich früh seiner bemächtigt hat. In jedem Fall aber kann niemand diesen viel vergötterten Mann verstehen, der nicht auch Hannibal versteht. Scipio ist nur als Gegenfigur zu Hannibal das geworden, was er ist.
Karthago war kein Militärstaat und daher wohl den Griechen, aber nicht den Römern gewachsen: semitische Kaufleute ohne alle Rauflust; kein Eisen im Blut, kein Soldatengeist. Überhaupt sind, wie Cicero mit Recht bemerkt, die Landstädte vor den Seestädten immer im Vorteil; denn in den Seestädten ist die Bevölkerung nicht seßhaft genug, sie fließt ab und zu, und die Tradition fehlt, die den Nationalstolz und Opfermut erzeugt. Die preußische allgemeine Wehrpflicht hochgelobten Andenkens war etwas ganz Römisches; bei uns wollte auch der friedlichste Zivilist doch gern als Reserveleutnant herumgehen, und im Kriegsfall stand er seinen Mann. So also auch in Rom und Italien: der Städter so gut wie der Bauer rüstet sich selbst aus und füllt die Legionen. Das ergibt eine gewaltige Kopfzahl. Um das Jahr 220, dicht vor Hannibals Einrücken, hatte Rom in Italien 800 000 Waffenfähige zur Verfügung. Freilich konnten begreiflicherweise nicht alle gleichzeitig aus ihrem Handwerk oder von ihrem Acker abkommen; aber wenn Rom auch nur jeden fünften Mann einzog, hatte es 160 000 Mann beisammen. Daher hat es in dem bevorstehenden Krieg gleichzeitig nach Spanien und Sizilien, ja auch nach Griechenland und auf die Balkanhalbinsel Legionen detachieren können.
Die Seeleute und Kauffahrer Karthagos wollten dagegen, wie der Engländer und Amerikaner, von Dienstzwang nichts wissen. Sie hatten Geld und ließen Söldner für sich fechten – vom Sold hat der Soldat seinen Namen –, angeworbene Truppen aus Afrika, aber auch aus anderer Herren Ländern, die sich nie für eine Idee und selten für das Vaterland, sondern höchstens für ihren Führer begeistern und schließlich doch zumeist zu dem übergehen, der am besten zahlt.
Auch die karthagische Kriegsmarine war nicht erster Güte und hielt sich nicht auf der Höhe. Der erste punische Krieg war der Krieg der großen Seeschlachten und geradezu beispiellos dabei das Aufgebot an Schiffen und Mannschaften gewesen; angeblich fochten in solcher Schlacht 300 oder 350 Galeeren auf jeder Seite. Von jetzt an geht die Marine Roms ebenso wie die Karthagos zurück, und man bietet gar keine Seeschlachten mehr an. Die Sache schien denn doch zu kostspielig (schon damals wie heute), und man kam überein, die Flotte nur zu Transportzwecken zu verwenden.
Auch der Senat, der die Republik Karthago regierte, war keineswegs kriegerisch; er war immer gleich mit einem Gelegenheitserfolge zufrieden. Aber es gab einige Familien fürstlichen, ja königlichen Ansehens in der Stadt, die Krieger, Soldaten, Feldherren von Beruf waren, in deren Händen oft die konsularische Exekutive lag und die nach außen hin den Vorteil und die Ehre der Stadt berufsmäßig vertraten, für sie fochten und ihr Leben ließen. Es sind die so häufig wiederkehrenden Namen eines Hanno, Mago, Hamilkar, Hasdrubal. Kraft ihrer Energie und ihres Patriotismus nahmen sie das Geschick des Staates persönlich in die Hand. Eine solche fürstliche Gestalt war schon Hannibals Vater, Hamilkar Barkas, der Träger der punischen Großmachtpolitik, den Cato wie einen Epaminondas bewunderte. Hamilkar begann, um Kraft gegen Rom zu gewinnen, die Eroberung Spaniens, und als neunjähriger Knabe (im Jahre 237) tat sein Sohn Hannibal in des Vaters Hand den Schwur seines Lebens: »niemals Roms Freund zu sein«. In diesem Knabenschwur lag das Schicksal zweier Städte. Der Schwur ging aber, wenn wir den überlieferten Wortlaut genau nehmen, nicht auf die Vernichtung Roms, sondern bedeutete nur den Vorsatz, selbst so stark zu werden, daß man die Freundschaft, das Bündnis Roms nicht brauchte. Denn Hannibal wußte, was jeder wußte, daß Rom seine Bundesgenossen zu ersticken, zu erdrosseln pflegte.
Mit unerhört raschem Aufstieg wurde Hannibal, der junge zwanzigjährige Mensch, in Spanien Reitergeneral; ja, fünfundzwanzigjährig wurde er durch das Heer zum Generalissimus der Armee gemacht. Der Senat Karthagos war dabei gar nicht gefragt worden; der Senat war gefügig und gab nachträglich seine Bestätigung. Eine solche königliche Vollmacht wie Hannibal hatte kein römischer Feldherr: denn Hannibal blieb durch Jahrzehnte ständig in seiner hohen Charge, während die römischen Feldherren fast jährlich wechselten, und er machte nach Gutdünken im Namen der Stadt Politik, schloß Bündnisse, unterwarf Länderstrecken und Städte, konstituierte binnen etwa drei Jahren in Spanien ein stattliches karthagisches Reich, und so hat er, ohne zu fragen, eigenmächtig, das heißt kraft seiner Stellung, auch den Krieg mit Rom begonnen, indem er im Jahre 218 den Ebro überschritt.
Ihm ist es, trotz seines großartigen Heldentums, im Andenken der Menschen schlimm ergangen. Er hat auf einer Erzinschrift seine Großtaten selbst verewigen lassen, aber dies Monument ist verloren. Sowohl die römischen Schriftsteller wie die meisten griechischen haben ihn mit Haß und Neid verfolgt und ihm Missetaten angedichtet, die er nie getan. »Der perfide, der grause, der gräßliche Hannibal« – mit solchen einfältigen Worten reden die späteren Römer von ihm. In Wirklichkeit war die römische Politik perfider als er. Hannibals Taten reden eine ganz andere Sprache; sie zeigen uns einen Mann von einziger Größe, und zwar auch moralischer Größe, der nicht nur ein Feldherr war von blitzender Geistesschärfe und fabelhaft kaltblütiger Schlagfertigkeit (er hat immer mit geringeren Kräften gesiegt), nicht nur ein Organisator von höchster Genialität (wir brauchen nur an seinen Alpenübergang zu denken: ein ganzes Heer mit einem Train von Elefanten übersteigt den noch gänzlich straßenlosen Alpenkamm); vor allem bewundernswert ist seine unverrückbare Zielsicherheit, Ausdauer und Beharrung in Glück und Unglück, ein zwanzigjähriges Heldentum und Selbstopfer, nicht aus Ehrgeiz, sondern aus Patriotismus und bedingungsloser Liebe zu seiner Vaterstadt, deren Schicksal er auf dem Herzen trug: einer der größten Männer semitischer Rasse, aber so, daß die sonst so spezifisch semitischen Eigenschaften nicht stark an ihm hervortraten: jede religiöse Leidenschaft fehlt ihm; aber auch jeder persönliche Ehrgeiz und jedes Wichtigtun; es geht ihm nur um die Sache, Rom endlich doch zu einem annehmbaren Frieden zu zwingen. Er war ferner ein Mann der Tat und nicht des Wortes, handelte auch nie sanguinisch und von Aufwallungen hingerissen, sondern stets vorsichtig und nach Berechnung und nur da kühn, wo es sich verlohnte. Aber es verlohnte sich in der Tat, kühn zu sein. Hannibal, der Einäugige – er sah gut und hat eigentlich nie falsch gehandelt. Nur in dem einen verrechnete er sich, daß er Roms für jene Zeiten beispiellosen Hilfskräfte unterschätzte und zu gering anschlug.
Wen hatte Rom diesem Menschen, der mit seiner Armee plötzlich wie ein tausendköpfiges Gespenst über die Alpen kam, gegenüberzustellen? Männer gewöhnlichen Kalibers, ob sie Claudius oder Fabius oder Cornelius heißen, ist im Grunde einerlei. Die Siege Hannibals gingen in Italien Schlag auf Schlag, so wie der junge Tiger die anrennenden Hunde niederschlägt. Im dritten Jahre (216) war die Schlacht bei Cannä; Rom lag niedergezwungen am Boden. Es schien, als wären ihm die Hände abgehauen. Womit sollte es jetzt noch kämpfen?
Wer heute durch den St. Gotthard rollt, kommt auf die Straße Hannibals: ins Ticinotal; dann öffnet sich ihm die wundervoll fruchtbare lombardische Ebene des Po, vom Ticin bis zur Etsch, bis Cremona, Verona. Diese norditalische Ebene war damals von dem Kraftvolk der Gallier bewohnt, und diese Gallier haßten Rom und fochten mit Hannibal. Hannibal hatte auf ihre Hilfe gerechnet. Ganz nackt bis zum Gürtel, gingen diese Leute in die Schlacht und fochten mit langen Säbeln; auch zu Pferde. Die Schlacht bei Cannä wurde von Hannibal durch eine glänzende Reiterattacke eröffnet: das waren solche gallische Reiter. Nun drohten auch Süditalien, Campanien, Apulien, die Samniten zu Hannibal abzufallen, und das Aushebungsgebiet für ein neues römisches Heer war erheblich verkleinert.
Rom trauerte dreißig Tage, aber Rom blieb trotzig. Seine Hilfsquellen waren doch noch nicht erschöpft. Der Landsturm wurde aufgeboten – auch sechzehn- bis siebzehnjährige Knaben (wie bei uns im Jahre 1813), ja, auch 8000 Sklaven in die Uniform gesteckt. Man brachte angeblich 200 000 Mann auf: so konnten neue Truppen nach Sizilien und Spanien geworfen werden, und ein paar Heerhaufen (unter Fabius Cunctator und Claudius Marcellus, braven Militärs der alten Gattung) kamen so wirklich auch in Italien zusammen, die allerdings kaum ein Gefecht wagten, aber Hannibal immer doch beschäftigen konnten. Es war ein Ruin für Italien selbst; das schöne Land, die Städte und Felder verheert, verwüstet und ausgesogen, und zwar nicht nur vom Feind, auch von der römischen Truppe; Frucht, Vieh und Mensch weggeschleppt, dezimiert, vernichtet. Die Sache schien hoffnungslos. Die Verstärkungen, die Hannibal aus Spanien erwartete, brauchten nur zu kommen, und er hatte Rom am Messer. Er konnte Rom aushungern, um hernach selbst auf dem Kapitol zu speisen, wie ihm sein Reitergeneral Maharbal verhieß.
Da erhob sich in Rom ein junges Genie und ein Retter, nicht melancholisch ernst und herbe, wie Hannibal, sondern strahlend heiter, ein sorgloser Optimist: das war Scipio.
Scipio! Siebzehn- bis achtzehnjährig ritt er schon mit in die Schlacht am Ticino und lernte da den großen Sieger Hannibal kennen; er soll da seinen Vater herausgehauen haben. Ja, auch bei Cannä war er mit und floh, wo alles floh. Der Eindruck der Schlacht bei Cannä aber war für ihn unauslöschlich, denn er hatte offene Sinne und sah, wie ein großer Stratege manövriert und siegt. Damals schon wird ihn der Ehrgeiz gepackt haben, es diesem großartigen Gegner einmal gleich zu tun. Denn man kann auch das Siegen lernen. Muntere Zuversicht war der Grundzug seines Wesens; und dazu kamen die militärischen Überlieferungen in seiner Familie. Schon sein Großvater, der Sohn des Scipio Barbatus, siegte dereinst im ersten punischen Krieg; und eben jetzt standen sein Vater Scipio und sein gleichnamiger Onkel kämpfend in Spanien, um die punische Macht dort gemeinsam anzugreifen. Aber ihr Werk mißlang. Beide, Vater und Onkel, wurden dort von Hasdrubal, Hannibals Bruder, geschlagen und getötet.
So trat der fünfundzwanzigjährige junge Mann, der es bisher noch kaum zum Stabsoffizier gebracht hatte, selbstgewiß vor das geängstigte Volk in Rom und bewarb sich ohne Umschweife um den Oberbefehl in Spanien. Es war ein lächerlich tolles Ansinnen. Denn so wie ein preußischer Armeechef unter fünfzig Jahren nicht so leicht vorkommt, so stand es annähernd ähnlich auch bei den Römern. Wozu ist sonst die Rangordnung und das liebe stufenweise Avancement, das den Charakter stählt? In Rom waren die würdigen konsularischen und prätorischen Männer dazu da, die Heere zu schaffen und anzuführen.
Aber Scipio drang durch. Er war vor kurzem Marktbeamter, Ädil, gewesen und hatte als solcher für das Volk glänzende Schauspiele gegeben, acht Tage lang, vor allem Wagenrennen im Zirkus, hatte außerdem unter anderem an das Volk straßenweise Rationen Öl verteilt, was dasselbe ist, als wenn bei uns ein Vornehmer etwa jedem Bürger Butter ins Haus schicken wollte. Denn die Alten kochten mit Öl und kannten noch keine Butter. Durch den Erfolg, den er jetzt errang, wird uns sein Bild gleich mit einem Schimmer des Wunderbaren umgeben; er war längst beliebt, und es heißt, daß auch die feurige Ansprache, die er hielt, und vor allem seine edle Gestalt das Volk bezwangen.
In Wirklichkeit aber hätte dem Scipio die edle Gestalt und die Ölverteilung wohl wenig genützt. Aber das Kommando haftete nun einmal an seiner Familie. Vor allem aber hat das Vorbild des Gegners selbst hierauf eingewirkt. Das ist offensichtlich und gar nicht zu verkennen. Hannibal wurde fünfundzwanzigjährig Generalissimus, und zwar als Nachfolger seines Vaters; so erhält jetzt auch Scipio, um ihn zu bekämpfen, just fünfundzwanzigjährig, sein Kommando, und zwar auch er als Nachfolger seines Vaters. Die Römer erkannten eben, daß man, wo alles auf dem Spiel stand, von der ängstlichen Alte-Herren-Methode einmal abgehen müsse; und sie lernten dabei vom Feinde.
Und so wie Hannibal seine Siegeslaufbahn in Spanien begann, so jetzt auch Scipio. Scipio faßte den punischen Stier nicht bei den Hörnern und bewarb sich nicht darum, ein Korps gegen Hannibal selbst zu führen. War es Furcht? Gewiß nicht. Ihm widerstrebte es, mit beizutragen zu der Verwüstung des eigenen Heimatlandes. Scipio hat es in seinem ganzen Leben vermieden, auf Italiens Boden Krieg zu führen. Und wie viel schöner war es für ihn, abenteuernd ins ferne Ausland zu ziehen! Vor allem: aus Spanien erwartete Hannibal seine ihm notwendigen Verstärkungen. Gelang es, Spanien wegzunehmen, so war Hannibals Stellung in Italien auf einmal unhaltbar, so wie der Baum eingeht, dem man die Wurzel durchsägt hat.
Scipio segelte ab, und das Klügste und Überraschendste war gleich Scipios Erstlingstat, im Jahre 209. Das Herz und die Hauptstadt der großen punischen Besitzungen in Spanien war die schöne Hafenstadt Neu-Karthago, die heute Cartagena heißt: die strahlende Inselstadt im blauen Meer, in der Tat ein zweites Karthago, wo die angesehensten Behörden, auch alle Kriegsmagazine, die Kriegskassen, der Provinzialreichsschatz des Feindes sich befanden: stark befestigt und ganz unzugänglich. Scipio rückt von Tarragona rasch heran, und es gelang ihm, die Stadt mit einem wuchtig geführten Handstreich blitzschnell zu nehmen. Wundervoll! Es war alles elegant, was er tat.
Cartagena, wo die Rosen auch im Winter blühen! Cartagena, das fischreiche, wo man die schönsten Fischsaucen bereitete, die das Altertum kannte. Eine Aktiengesellschaft versandte die Sauce in Krügen von da über die ganze Welt. Cartagena, berühmt auch durch seine Getreidespeicher oder Silos, die man unterirdisch anlegte und in denen das Getreide fünfzig Jahre lang aufbewahrt werden konnte. Ob Rosen, ob Fischbrühe, ob Silos, die Hauptsache war: das Herz der feindlichen Provinz war getroffen, war ihr ausgerissen. Die punischen Armeen rückten zwar nachträglich heran, wagten aber keinen Versuch, den Römer wieder herauszuwerfen. In Cartagena fand Scipio auch vornehme Spanier, die von den Puniern als Geiseln festgehalten worden waren: er befreit sie und gewinnt sich damit die Herzen und das Zutrauen der einheimischen Stämme.
210–206, fünf Jahre, blieb Scipio so in Spanien, residierte in Tarragona, lieferte noch ein paar Schlachten, zum Teil durch seine Unterfeldherren, die älter als er, aber ihm bis zur Unterwürfigkeit ergeben waren; er gründet dort auch eine römische Kolonie, der er nach seiner Heimat den bedeutsamen Namen Italica gibt (damit wurde der Name Italiens zum ersten Male ins Ausland getragen). Endlich fällt ihm durch Verrat auch noch Cadix zu, die letzte Stadt, in der die Karthager saßen, und Spanien ist so durch ihn römisches Land geworden.
Nur mit Hasdrubal, Hannibals Bruder, dem gefährlichsten Gegner, hat er es sich zu leicht gemacht. Hasdrubal stand ihm dort gegenüber; Scipio gewann ihm zwar einen Sieg ab; aber Hasdrubal verließ trotzdem, um nach Italien gegen Rom zu ziehen, mit beträchtlichen Heermassen unbehelligt das Land. Hasdrubal brachte seinem Bruder Hannibal die erhofften Verstärkungen nach Italien; Rom selbst wurde damit aufs neue bedroht, und Scipio rührte weiter keinen Finger, das zu verhindern. Der Vorwurf bleibt auf Scipio sitzen. Es war nicht sein Verdienst, daß Hasdrubal hernach dennoch seinen Untergang fand und nicht an sein Ziel gelangte. Nicht die Eroberung Spaniens durch Scipio, sondern der Untergang Hasdrubals am Fluß Metaurus (nicht fern von Ancona) ist die eigentliche entscheidende Glückswende in diesem Hannibalkrieg gewesen.
Man muß Scipio zu verstehen versuchen. Er war eben kein Durchschnittsrömer. Laelius heißt der ihm ganz ergebene Freund, der ihn am stärksten beeinflußt hat. Laelius stammte aus der kleinen Stadt Tibur – Tivoli – bei Rom, wo damals, wie es heißt, viele griechische Traditionen herrschten, und Scipio selbst wurde so schon als junger Mensch durch diesen Laelius in die griechische Literatur, in die griechische Denkweise hineingezogen.
Daher das Mystische, womit er sich schon als sechszehnjähriger Junge umgab. Er liebte die Einsamkeit; »ich bin dann am wenigsten allein, wenn ich allein bin,« war sein Ausspruch. Das hatte er von Xenophon; das war sokratisch. Ja, er sprach von Träumen und von Götterstimmen, die er in der Einsamkeit vernahm und die ihn lenkten, und unternahm nichts, ohne zuvor lange einsam im Tempel verweilt zu haben. Die Seestadt Cartagena eroberte er, indem ihm dabei das Eintreten der Ebbe zu Hilfe kam. Der gemeine italienische Soldat wußte damals noch nichts von Ebbe und Flut, und Scipio erklärte den Leuten nicht etwa das Naturgesetz, sondern verkündete mystisch seinem Heere, der Meeresgott Neptun selbst stehe mit ihm im Bunde. Wie fremdartig diese prophetenhaft-geistliche Pose bei einem sonst so frischen, jungen Reitersmann! Insbesondere hatte Scipio, wie später noch so mancher andere, den romantischen Trieb, Alexander dem Großen zu gleichen. Auch das also ein Einfluß des Griechentums. Daher schritt er schlicht militärisch, aber majestätisch einher und trug dabei lange Alexanderlocken; das stand ihm schön, er war eine interessante neue Erscheinung. Daher übte er aber auch gegen schöne junge Frauen, die ihm als Beutestück gebracht wurden, im Stil Alexanders die edelste Großmut, und alles schwärmte für ihn. Vor allem aber erwachte in ihm der Trieb zur Autokratie und das Talent, selbst König zu sein, wie Alexander, oder doch den König zu »spielen«.
Auch Hannibal war in Spanien königlich aufgetreten. Jetzt boten die unterjochten spanischen Volksstämme dem Scipio geradezu das spanische Königtum an, und der Grieche Polybius, sein Verehrer, wundert sich, daß Scipio sich nicht irgendwo auf Erden wirklich ein Königreich begründet habe. In der Tat war Scipios Residenz in Tarragona wie eine Hofhaltung. Er betonte das. Es machte ihm Freude, für fünf Jahre lang spanischer Monarch zu sein, und um das voll auszugenießen, ließ er den gefährlichen Hasdrubal mit seinem Heer aus Spanien unbehelligt nach Italien abziehen. Mochten die alten würdigen Generäle in Rom zusehen, wie sie mit ihm fertig werden. Er war ihn los.
Nachdem er zum Abschied noch in Cartagena königliche Festspiele gegeben, kehrte Scipio endlich im Jahre 206 nach Rom zurück.
Er war da. Aber er entließ sein Heer nicht; er blieb mit seinen Legionen vor Rom stehen. Denn er wollte nur an ihrer Spitze als Triumphator in der Tracht Jupiters mit dem Schimmelwagen in die Stadt, und dazu brauchte er die Erlaubnis des Senats. Der Senat mußte also hinaus vors Tor kommen, damit ihm Scipio zunächst seine Taten anpreisen konnte. Solchen meistens recht ruhmredigen Rechenschaftsbericht gaben die heimkehrenden Feldherren regelmäßig zum besten; oft stellten sie sich mit Landkarten und gemalten Schlachtbildern auf dem Marktplatz auf und demonstrierten dem Stadtvolk, was sie geleistet. Aber der Senat war immer noch altmodisch gesonnen und zäh, denn Scipio war noch zu jung, war ja noch nicht einmal Prätor und Konsul gewesen, und der Senat gewährte ihm den Triumph nicht. Als schlichter Privatmann betritt also Scipio, nachdem er sein Heer entlassen, die Stadt, opfert aber dem Jupiter auf dem Kapitol gleich hundert Rinder – das gab eine herrliche Volksspeisung –, und die Menge huldigt ihm, wie bisher keinem gehuldigt wurde.
Was nun? Der Krieg war immer noch unentschieden. Hannibal stand noch unbesiegt in Süditalien, und die Partei der alten Herren wollte jetzt alle Kräfte gegen diesen Hannibal vereinen. Scipio, der eben jetzt Konsul wurde, blickte weiter und setzte nach schweren Kämpfen durch (er terrorisierte dabei den Senat durch das Volk), daß er das Kommando für Sizilien erhielt mit der Möglichkeit nach Afrika zu gehen. Er wollte keine Schlachten in Italien schlagen; und es galt, jetzt endlich Karthago selbst zu bedrohen. Der Senat suchte ihn zu hemmen, seine Mittel zu beschränken. Aber freiwillige Hilfe floß ihm aus vielen Städten Mittelitaliens, wie Perugia und Arezzo, zu: an Bauholz, Waffen, Proviant. Vierzig Tage, nachdem das Holz gefällt war, lag die neue Flotte schon im Wasser.
Das Wichtigste aber ist, daß Scipio – wie Hannibal – jetzt auch Truppen für Geld anwarb: Soldknechte, die ihm huldigten. Das war für einen römischen Konsul unerhört, das war der Stil der Könige und Despoten. Es beginnt im Heere jetzt der Berufskrieger, und das hat später Marius durchgeführt. Der Krieg wird dadurch allmählich zum Handwerk bezahlter Leute, und der Bauer und Schuster kann hinfort bei seinem Pflug und bei seinem Pfriemen zu Hause bleiben. Überdies umgab Scipio sich in Sizilien mit einer Leibwache von dreihundert auserlesenen Reitern.
Übrigens nutzte er dort die Zeit; mit fleißigen Exerzier- und Gefechtsübungen hielt er seine Truppen in Bewegung. Denn in der Kriegskunst setzte eben damals eine der bedeutsamsten Neuerungen ein. Die alte, schwerfällig wuchtige Kampfweise der Truppenhaufen mit ungegliederter Front (Phalangen), die jahrhundertelang gegolten hatte, wurde jetzt durch Scipio aufgehoben; die Soldaten mußten fortan lernen, in zwei Treffen aufgelöst in der Schlacht zu stehen und so getrennt zu schlagen. Diese losere Gliederung verhieß große taktische Vorteile. Vielleicht war Hannibal auch darin Scipios Lehrer; dann mochte er sich vorsehen; sein Schüler sollte ihm gefährlich werden.
Das neue Söldnerwesen aber brachte ins römische Heer sogleich Meuterei, Frechheit und Verrohung, und die Sache ließ sich sehr übel an. Schon in Spanien mußte Scipio solche Meuterer dämpfen, schon in Spanien wurden von seinen Soldaten gegen alles damals geltende Völkerrecht schöne Frauen als Beute aufgebracht, verschenkt und verhandelt. Die barbarische Praxis, daß jeder Soldat durch Anteil an der Kriegsbeute belohnt wird, war alt; aber sie artet schon jetzt in ein Raubsystem aus, und die Offiziere räuberten ebenso wie die Gemeinen. Die besiegten Städte und Länder wurden ausgeplündert, ausnahmslos: Privatgut, Tempelgut. Wozu wurden sie sonst besiegt? Nicht durch Arbeit und Industrie ist Rom so reich geworden, sondern lediglich durch seine Kriege. Ein schmachvoller Betrieb. Roms Geschichte ist die Ausplünderung der Welt; erst die Kaiser machten dem ein Ende.
Das Scheußlichste waren damals die Blutbäder in der Stadt Lokri, für die Scipio jedenfalls verantwortlich war; Pleminius hieß der Legat, der da so wütete, und Scipio suchte ihn wirklich zu decken, eine Zeitlang mit Glück. Der gestrenge Senat sandte eine Untersuchungskommission nach Sizilien; denn man glaubte, Scipios Heerwesen sei dort gänzlich im Verfall; damals, scheint es, hat auch der Dichter Naevius ihn auf der Theaterbühne öffentlich angegriffen. Aber die Kommission fand in Syrakus, dem Hauptquartier, alles wirklich musterhaft. Denn was ließ sich dagegen einwenden, daß Scipio für seine Person da gern vormittags ins Theater ging und nachmittags am griechischen Turnsport teilnahm? Und Scipio blieb vollständig Herr der Situation.
Aber es war eine herausfordernde Situation: Scipio in Syrakus, Hannibal in Kroton! beide großen Heerführer so hart nebeneinander, unglaublich nahe und nur durch die schmale Meerenge von Messina getrennt! Scipio dachte jedoch auch jetzt nicht daran, sich an Hannibal zu versuchen, ja, er wurde von seinem Plan, nach Afrika zu gehen, auch dadurch nicht abgehalten, daß die Karthager im Jahre 205 eine neue Armee unter Hannibals jüngstem Bruder Mago nach Genua warfen, so daß Rom selbst jetzt abermals von zwei Seiten her bedroht war. Es war eine geniale Folgerichtigkeit in Scipios Handeln. Mit 40 Kriegsschiffen, 400 Lastschiffen brach er, gerade jetzt, nach Afrika auf. Bei der Abfahrt alle Felsenufer voll Menschen! ein pompös theatralischer Moment: große Zeremonie und Opferhandlung am offenen Meer. Der Feldherr selbst betet laut und salbungsvoll: alle Landgötter und Meeresgötter, fordert er, sollen Rom helfen, und die Eingeweide der unzähligen Opfertiere werden ins Meer geworfen! Ein frommes Werk, in Wirklichkeit ein Leckerbissen für die Haifische.
Natürlich erfolgten dann in Afrika zunächst etliche Schlachten. Aber Festungen einzunehmen gelang durchaus nicht. Das römische Belagerungswesen war damals noch keineswegs auf der Höhe. Scipio aber bewährte sich auch als Diplomat, und das war eine Eigenschaft, die Hannibal abging. Es handelte sich um die zwei numidischen Könige oder Scheiks, die sich damals in das Land Algier teilten, Syphax und Masinissa: Scipio schloß kavaliermäßig mit Masinissa persönliche Freundschaft: der König mit dem König, und Masinissa leistete ihm sogleich gegen Karthago die wichtigsten Dienste.
Da hinein spielt auch der Roman von der schönen punischen Frau Sophoniba (Sophonisbe), die dieser König Masinissa liebt, die aber die Frau seines Widersachers Syphax wird. Unser Dichter Geibel hat daraus eine Tragödie gemacht. Masinissa jagt Sophonisbe dem Syphax wieder ab und heiratet sie; Scipio aber fürchtet, die Punierin wird den Masinissa auf Karthagos Seite hinüberziehen, und zwingt die Fürstin, Gift zu nehmen, das er ihr sendet.
Aber die Ereignisse überstürzen sich. Hannibal, der unbesiegte, kommt endlich aus Italien herbei und wird von Scipio im Jahre 202 in der berühmten Schlacht bei Zama wirklich überwunden. Zama lag in Algier. Siegte hier Scipios neue Taktik? Sie hätte es nicht getan, wären nicht numidische Reiterschwärme, die Vorläufer der heutigen Berbern in Tunis und Tripolis, dem Hannibal unversehens in den Rücken gefallen.
Was sind die Folgen dieses Sieges? Die Herrschernatur in Scipio zeigt sich von neuem. Der römische Senat will noch nichts von Frieden wissen; er wittert gerade jetzt mächtige Beute und fordert die Einnahme und Plünderung der gewaltigen Stadt Karthago selbst. Aber das Volk in Italien, das durch den Krieg kläglich verarmt ist und von der großen Beute doch nichts zu hoffen hat (denn der Hauptgewinn bleibt immer in den Klauen des senatorischen Adels), das Volk in Rom schreit nach Frieden, und Scipio gibt sich die Miene des Volksbeglückers und setzt den Frieden durch. In Wirklichkeit aber hatte er erkannt, daß sich bei Roms gegenwärtigen Mitteln an eine Einnahme Karthagos schlechterdings nicht denken ließ.
Großartig war alsdann sein Triumphzug durch ganz Italien von Süden her, bis hinauf aufs Kapitol. Tausende von Gefangenen, die er aus Karthagos Hand befreit, zogen lobpreisend vor ihm her. »Liebling des Volks zu sein, Heil Scipio dir!« ungefähr solche Töne hat man damals zu seiner Verherrlichung angeschlagen, als wäre er ein Monarch. Er war auf dem Gipfel. Der Senat beugte sich. Scipio nannte sich selbst Africanus. Offiziell wurde er vom Senat mit dem Prädikat »der Glückliche« gefeiert. Das Glück – diefelicitas– war nicht mit Hannibal; es war mit ihm. Das Glück aber galt als die Eigenschaft und das Vorrecht der Könige und Götterfreunde.
Und er wurde nun, kaum fünfunddreißig Jahre alt, für den Rest seines Lebens »Erster des Senats« (princeps senatus) und hat als solcher weiterhin die einflußreichste Stimme in der Weltpolitik Roms gehabt. Eine Schar vornehmer Jünglinge begleitete ihn beim öffentlichen Auftreten, sein ständiger »Komitat«. Man sagte: seine Winke hatten die Geltung von Senatsbeschlüssen. So war Scipio der erste wirklich weltgeschichtlich große Mann Roms. Seine Bedeutung zeigt sich beiläufig auch darin, daß er sich herausnahm, den Aufstieg zum Kapitol selbst, den er so oft erklomm, mit einem Durchgangsbogen zu schmücken, der zwei Rosse und sieben übergoldete Statuen trug. Solche Luxusbauten sind Sache der Könige, und die griechische Kunst wurde dazu in Dienst genommen.
Aber er hielt sich nicht auf der Höhe, und es folgt nun noch das enttäuschende Ende. Scipio wurde laß; er hatte sich ausgegeben. Schon seine Amtsführung als Zensor enttäuschte.
Roms Kriege hörten nicht auf. Es griff damals sogleich mächtig über die Adria auf die Balkanhalbinsel hinüber (auch heute stand hiernach mit Erfolg der Ehrgeiz der Politiker Italiens), und um Griechenland entspann sich der Streit Roms mit Antiochos, dem fernen König von Syrien, bei dem der flüchtige Hannibal Zuflucht gefunden hatte. Wahrlich, der kleine italienische Bauer und Legionssoldat lernte die Welt kennen; er wurde weithin über Länder und Meere getragen.
Gegen Antiochos zog nun Scipio im Jahre 190 mit seinem Bruder Lucius noch einmal aus. Aber sein Verhalten war diesmal auffällig; es lockte ihn sichtlich, mit einem griechischen Großkönig auf gleichem Fuß zu verkehren, und er ließ sich auf zwecklose Verhandlungen mit dem Gegner ein, die verdächtig scheinen konnten. Antiochos nahm dann Scipios etwa zwanzigjährigen Sohn gefangen; Scipio selbst wird krank; da schickt ihm der König, ohne Lösegeld zu nehmen, seinen Sohn ans Krankenlager, und Scipio dankt ihm dafür mit dem sonderbaren Ratschlag: Antiochos solle keine Schlacht wagen, bevor er, Scipio, nicht genesen und ins römische Feldlager zurückgekehrt sei. Antiochos gibt auf diesen Rat nicht acht und wird bei Magnesia in Scipios Abwesenheit vollständig geschlagen. Hatte Scipio ihm diese Niederlage ersparen wollen?