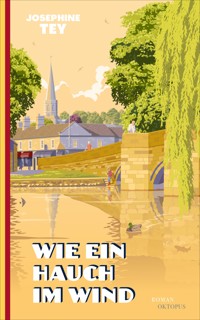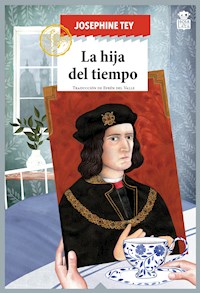Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: OKTOPUS by KampaHörbuch-Herausgeber: AUDIOBUCH
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Alan Grant
- Sprache: Deutsch
Inspector Alan Grant von Scotland Yard muss mit einem gebrochenen Bein das Bett hüten - und fühlt sich wie im Gefängnis. Erbärmlicher noch, denn im Krankenhaus ist Haftverkürzung selbst bei guter Führung ausgeschlossen. Beinahe so demütigend wie die Erinnerung an seinen lächerlichen Sturz ist der schroffe Ton der Krankenschwestern. Am schlechtesten aber erträgt Grant die Langeweile. Eine Freundin rät ihm, sich an einem der vielen ungelösten Rätsel der Kriminalgeschichte zu versuchen, und versorgt ihn mit Porträts berühmter Verbrecher. Beim Anblick von Richard III., der seine Neffen ermordet haben soll, muss Grant stutzen: Keineswegs die Visage eines Mörders, befindet der erfahrene Polizist. Mit der Unterstützung eines unterbeschäftigten Historikers geht Grant der Sache nach und stellt fest: Die Beweislage ist äußerst dürftig. Grant kann der Versuchung nicht widerstehen: Vom Krankenbett aus rollt er einen über vierhundert Jahre zurückliegenden Mordfall ganz neu auf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Josephine Tey
Alibi für einen König
Roman
Aus dem Englischen von Maria Wolff
Oktopus
Die Wahrheit ist das Kind der Zeit
Altes Sprichwort
1
Grant lag in seinem hohen weißen Bett und starrte zur Decke. Angeekelt starrte er sie an. Er kannte jeden noch so kleinen Riss auf der schönen sauberen Fläche auswendig. Er hatte die Decke zur Landkarte gemacht und Flüsse, Inseln und Kontinente darauf entdeckt. Er hatte ein Wimmelbild aus ihr gemacht und Gesichter, Vögel und Fische darin gefunden. Er hatte sie mathematisch vermessen und sich in seine Kindheit zurückversetzt gefühlt: Winkel, Rechtecke, Dreiecke. Nun konnte er sie nur noch anstarren. Ihr Anblick war ihm verhasst.
Er hatte die Zwergin gebeten, sein Bett ein wenig zu verrücken, damit er ein neues Stück der Decke erkunden konnte. Aber offenbar störte dies die Symmetrie des Raumes, und in Krankenhäusern kommt die Symmetrie kurz nach der Sauberkeit und ein gutes Stück vor der Gottgefälligkeit. Alles, was der Symmetrie zuwiderlief, war eine Profanierung des Krankenhauses. Weshalb er denn nicht lese, fragte sie ihn. Warum lese er denn nicht einen dieser teuren nagelneuen Romane weiter, die seine Freunde ihm ständig brächten?
»Es werden viel zu viele Menschen geboren und viel zu viele Wörter geschrieben. Jede Minute kommen Millionen und Abermillionen Wörter aus den Druckmaschinen. Ein grauenhafter Gedanke.«
»Ihre Verdauung ist wohl nicht in Ordnung«, sagte die Zwergin.
Die Zwergin war Schwester Ingham. Nüchtern betrachtet war sie eine sehr hübsche, etwa ein Meter fünfundfünfzig große Frau. Grant nannte sie die Zwergin, um sich dafür zu rächen, dass dieses Meissener Porzellanfigürchen ihn herumkommandierte; mit einer Hand hätte er das Ding hochheben können. Allerdings hätte er dazu auf beiden Beinen stehen müssen. Nicht nur, dass sie ihm vorschrieb, was er zu tun und zu lassen habe; sie behandelte seine ein Meter achtzig auch mit einer Gleichgültigkeit, die Grant als demütigend empfand. Größenordnungen schienen der Zwergin nichts zu bedeuten. Sie schleuderte die Matratzen mit der geistesabwesenden Grazie eines Fließbandarbeiters. Wenn sie dienstfrei hatte, wurde er von der Amazone versorgt, einer Göttin mit Armen wie Buchenstämme. Die Amazone hieß Schwester Darroll, stammte aus Gloucestershire und bekam Heimweh, wenn die Narzissen blühten. (Die Zwergin stammte aus Lytham St Anne’s und hatte mit solchem Narzissen-Blödsinn nichts am Hut.) Schwester Darroll hatte große, sanfte Hände und große, sanfte Kuhaugen mit einem stets teilnahmsvollen Blick, musste aber bei der geringsten körperlichen Anstrengung schnaufen wie eine Dampfwalze. Im Großen und Ganzen empfand Grant es als noch demütigender, wie ein totes Gewicht behandelt zu werden, als gar kein Gewicht zu haben.
Grant war bettlägerig und unter der Aufsicht der Zwergin und der Amazone, weil er durch eine Falltür gestürzt war. Das war natürlich der Gipfel der Demütigung; das Geschnaufe der Amazone und das mühelose Herumbugsieren der Zwergin waren daneben reine Lappalien. Durch eine Falltür zu stürzen war die Höhe der Lächerlichkeit: ein Stummfilmgag, ebenso trivial wie grotesk. Als er da vom Erdboden verschwand, war Grant gerade Benny Skoll auf den Fersen gewesen, und die Tatsache, dass Ben an der nächsten Ecke Sergeant Williams in die Arme gelaufen war, bildete den einzigen kleinen Trost dieses unerträglichen Vorfalls.
Benny war jetzt für drei Jahre »versorgt«, was für seine Umwelt sehr zufriedenstellend war. Aber Benny würde man bei guter Führung einen Teil seiner Strafe erlassen. In Krankenhäusern dagegen war Haftverkürzung selbst bei guter Führung ausgeschlossen.
Grant wandte den Blick von der Decke ab und ließ ihn über den Bücherstapel auf dem Nachttisch gleiten. Da lag der fröhliche teure Haufen, auf den die Zwergin seine Aufmerksamkeit gelenkt hatte. Der oberste Band mit der hübschen Ansicht von Valetta in unwahrscheinlichem Rosa war Lavinia Fitchs alljährlicher Bericht über die Leiden einer makellosen Heldin. Der Abbildung des Grand Harbour auf dem Umschlag nach zu urteilen, musste die diesmalige Valerie oder Angela oder Cecile oder Denise die Gattin eines Marineoffiziers sein. Er hatte das Buch nur aufgeschlagen, um Lavinias liebenswürdige Widmung auf dem Vorsatzpapier zu lesen.
Der Schweiß und die Scholle von Silas Weekley war eine siebenhundert Seiten lange Heimat-Schwarte. Soweit aus dem ersten Absatz ersichtlich, hatte sich seit Silas’ letztem Buch nicht viel verändert: Die Mutter liegt mit ihrem elften oben in den Wehen, der Vater nach seinem neunten unten im Parterre, der älteste Sohn im Streit mit Behörden, die älteste Tochter mit dem Liebhaber auf dem Heuboden und alles andere im Argen. Vom Strohdach trieft der Regen, vom Misthaufen dampft der Kuhdung. Es lag nicht an Silas, dass dieser Dampf das einzige aufstrebende Element im Gesamtbild war. Hätte Silas eine Dampfmarke entdeckt, die nach unten dampft, hätte er sie sicherlich verwendet.
Auf die harten Schatten und Lichter von Silas’ Schutzumschlag folgte eine elegante Fin-de-siècle-Schnörkelei mit albernen Barockeinflüssen, die Glöckchen an ihren Füßen betitelt war. Rupert Rouge ließ sich darin neckisch über das Laster aus. Auf den ersten drei Seiten brachte er einen immer zum Lachen. Ungefähr auf der dritten Seite aber merkte man, dass Rupert von jenem überaus neckischen (wenn auch natürlich nicht boshaften) Geschöpf George Bernard Shaw gelernt hatte, dass es am einfachsten ist, witzig zu klingen, wenn man sich der billigen und naheliegenden Methode des Paradoxons bedient. Von da an sah man die Witze schon drei Sätze im Voraus kommen.
Das Ding mit dem roten Mündungsfeuer auf dem nachtgrünen Umschlag war Oscar Oakleys neuestes Produkt. Schwere Jungs, die in synthetischem Amerikanisch, ohne Witz und Würze, aus dem Mundwinkel kauderwelschten. Blondinen, chromblitzende Bars, halsbrecherische Verfolgungsjagden. Sehr beachtlicher Quatsch.
Das Geheimnis des verschwundenen Dosenöffners von John James Mark wies schon auf den ersten zwei Seiten drei kriminalistische Kardinalfehler auf und verschaffte Grant zumindest fünf fröhliche Minuten, in denen er in Gedanken einen Brief an den Autor aufsetzte.
An das schmale blaue Bändchen, das zuunterst lag, konnte er sich nicht recht erinnern. Es war irgendetwas Seriöses und Statistisches. Tsetsefliegen oder Kalorien oder Sexualverhalten oder so was in der Art.
Aber selbst bei solchen Büchern wusste man immer schon, was einen auf der nächsten Seite erwartete. Fiel denn niemandem auf dieser Welt jemals auch nur hier und da eine neue Masche ein? War denn heute jeder auf eine Formel gedrillt? Die aktuellen Autoren schrieben so schematisch, dass ihr Publikum es gar nicht mehr anders erwartete. Man sprach von einem »neuen Silas Weekley« oder einer »neuen Lavinia Fitch« kein Stück anders als von einem »neuen Ziegelstein« oder einer »neuen Haarbürste«; nie war von einem »neuen Buch« die Rede, von wem auch immer. Das Interesse galt nicht dem Buch, sondern seinem Neusein. Wie das Buch sein würde, wusste ohnehin jeder.
Es wäre vielleicht gut, dachte Grant, als er seinen angewiderten Blick von diesem zusammengewürfelten Haufen abwandte, wenn alle Druckmaschinen der Welt für eine Generation angehalten würden. Eine literarische Stagnation müsste einsetzen. Irgendein Übermensch müsste einen Strahl erfinden, der alle gleichzeitig stoppen würde. Dann könnten einem die Leute nicht mehr ganze Haufen konzentrierten Blödsinns schicken, wenn man auf dem Rücken liegen musste, und die Meissener Porzellankommandeusen könnten dann nicht verlangen, dass man das Zeug läse.
Er hörte die Tür aufgehen, rührte sich aber nicht. Er lag mit dem Gesicht zur Wand, buchstäblich und in übertragenem Sinn.
Er hörte, wie jemand auf sein Bett zukam, und schloss die Augen, um jedem Gespräch aus dem Weg zu gehen. Gerade jetzt stand ihm der Sinn weder nach dem Mitgefühl Gloucestershires noch nach der Forschheit Lancashires. In der nun folgenden Stille stieg ihm ein zarter Duft in die Nase, eine wehmütige Erinnerung an die Blumenfelder von Grasse, und umschwirrte sein Hirn. Er kostete ihn aus und überlegte. Die Zwergin roch nach Lavendelpuder, die Amazone nach Seife und Jodoform. Was ihm aber hier so köstlich um die Nasenlöcher wehte, war teures L’Enclos Numéro Cinq. Nur eine Person in seinem Bekanntenkreis benutzte L’Enclos Numéro Cinq. Marta Hallard.
Er öffnete ein Auge und blinzelte sie an. Sie hatte sich über ihn gebeugt, um zu sehen, ob er schlief, und stand nun unschlüssig – wenn man überhaupt etwas, was Marta tat, so bezeichnen konnte – neben seinem Bett, den Blick nachdenklich auf den Stapel allzu jungfräulich aussehender Publikationen auf dem Nachttisch gerichtet. Im einen Arm hielt sie zwei neue Bücher, im anderen einen großen Strauß weißen Flieders. Er überlegte, ob sie wohl weißen Flieder gewählt hatte, weil sie ihn für die richtige Blumengabe im Winter hielt (er schmückte ihre Garderobe im Theater von Dezember bis März) oder weil er die Harmonie ihrer schwarz-weißen Eleganz nicht störte. Sie trug einen neuen Hut und ihre üblichen Perlen, jene Perlen, die er einst für sie hatte wiederfinden dürfen. Sie sah sehr hübsch aus, sehr pariserisch und wohltuend unkrankenhausmäßig.
»Hab ich dich geweckt, Alan?«, fragte sie.
»Nein, ich habe nicht geschlafen.«
»Ich scheine die sprichwörtlichen Eulen zu bringen«, sagte sie und legte die beiden Bücher neben die verhassten Artgenossen. »Hoffentlich interessieren sie dich mehr, als es offenbar die anderen getan haben. Hast du denn nicht mal einen kurzen Blick in unsere Lavinia geworfen?«
»Ich kann nichts lesen.«
»Hast du Schmerzen?«
»Ich leide Höllenqualen. Aber das hat nichts mit dem Bein und auch nichts mit dem Rücken zu tun.«
»Was ist es dann?«
»Meine Cousine Laura nennt es die Dornen der Langeweile.«
»Armer Alan! Und wie recht deine Laura hat!« Sie nahm einen Strauß Narzissen aus einer Vase, die viel zu groß für ihn war, ließ ihn geschickt ins Waschbecken gleiten und arrangierte in dem leeren Gefäß den Flieder. »Man könnte meinen, Langeweile wäre ein einziges gewaltiges Gähnen, aber so ist es natürlich nicht. Sie pikt einen ununterbrochen.«
»Was heißt hier piken? Es ist, als würde man mich mit Brennnesseln schlagen.«
»Beschäftige dich doch mit irgendwas!«
»Um aus dieser Sternstunde das Beste herauszuholen?«
»Um deine Laune zu bessern. Ganz zu schweigen von deinem seelischen Zustand. Du könntest zum Beispiel irgendeine Philosophie betreiben. Yoga oder so. Aber ein analytischer Verstand ist wohl nicht gerade die beste Voraussetzung für so etwas Abstraktes.«
»Ich habe schon daran gedacht, noch einmal mit Algebra anzufangen. In der Schule hatte ich wohl nicht die richtige Einstellung dazu. Aber inzwischen habe ich so viel Geometrie auf dieser verdammten Zimmerdecke betrieben, dass ich die Mathematik ein wenig leid bin.«
»Puzzle vorzuschlagen hat wenig Sinn, weil du ja liegen musst. Wie wär’s mit Kreuzworträtseln? Wenn du willst, besorge ich dir Hefte.«
»Gott bewahre!«
»Du könntest dir natürlich selbst welche ausdenken. Das soll mehr Spaß machen, als sie zu lösen.«
»Vielleicht. Aber ein Lexikon wiegt mehrere Pfund, und ich hasse es, etwas nachzuschlagen.«
»Spielst du eigentlich Schach? Wie wär’s mit Schachproblemen? Weiß ist am Zug, Schachmatt in drei Zügen oder so ähnlich …«
»Mein Interesse am Schachspiel ist rein ästhetischer Natur.«
»Ästhetisch?«
»Sind doch sehr dekorative Dinger, diese Türme und Bauern und was es sonst noch so gibt. So elegant.«
»Ja, entzückend. Ich kann dir auch ein Set bringen, wenn du lieber mit den Figuren spielst. Na schön, dann kein Schach. Du könntest auch irgendwelche rein theoretischen Untersuchungen anstellen. Das ist auch eine Art Mathematik. Ein ungeklärtes Problem lösen.«
»Ein Verbrechen, meinst du? Ach, diese klassischen Fallgeschichten kenne ich alle auswendig. Da gibt’s nichts Neues zu entdecken. Schon gar nicht von einem, der flach auf dem Rücken liegt.«
»Ich meine ja nicht etwas aus den Akten von Scotland Yard. Ich meinte eher etwas – wie sagt man? –, etwas Klassisches. Etwas, worüber sich die Welt schon seit Jahrhunderten den Kopf zerbricht.«
»Zum Beispiel?«
»Na, zum Beispiel die Kassettenbriefe.«
»Oh, bloß nicht Maria Stuart!«
»Und warum nicht?«, fragte Marta, die, wie alle Schauspielerinnen, von Maria Stuart nur eine verklärte Vorstellung besaß.
»Eine schlechte Frau könnte mich vielleicht interessieren, eine alberne unter keinen Umständen.«
»Albern?«, sagte Marta mit ihrer schönsten tragikumwitterten Elektrastimme.
»Sehr albern.«
»Oh, Alan, wie kannst du nur?«
»Hätte sie eine andere Kopfbedeckung getragen, hätte sich kein Mensch für sie interessiert. Diese Haube hat die Leute verführt.«
»Meinst du, mit einem Sonnenhütchen hätte sie weniger leidenschaftlich geliebt?«
»Sie hat nie leidenschaftlich geliebt, mit welchem Hütchen auch immer.«
Marta sah so schockiert aus, wie ein Leben auf der Bühne und eine Stunde sorgfältigen Make-ups es ihr nur möglich machten.
»Wie kommst du bloß auf so was?«
»Maria Stuart war eins achtzig groß. Fast alle Frauen dieser Größe sind frigide. Frag jeden Arzt.«
Und während er dies sagte, wurde ihm klar, dass ihm in all den Jahren, in denen er Martas Begleiter gewesen war, wenn sie einen gebraucht hatte, noch nie der Gedanke gekommen war, dass ihre notorische Nüchternheit in Bezug auf Männer mit ihrer Körpergröße zu tun haben könnte. Aber Marta hatte keine Parallelen gezogen; ihre Gedanken waren noch immer bei ihrer Lieblingskönigin.
»Zumindest war sie eine Märtyrerin. Das wirst du ja wohl zugeben.«
»Märtyrerin – wofür?«
»Für ihre Religion.«
»Ihr ganzes Märtyrertum war nichts als Rheumatismus. Sie heiratete Darnley ohne päpstlichen Dispens und Bothwell nach protestantischem Ritus.«
»Gleich behauptest du noch, sie wäre keine Gefangene gewesen!«
»Dein Problem ist, dass du sie dir in einer Kammer in einem Schlossturm vorstellst, mit vergitterten Fenstern und einem treuen alten Diener, der mit ihr betet. In Wirklichkeit hatte sie einen persönlichen Hofstaat von sechzig Personen. Als man ihn auf lumpige dreißig reduzierte, beschwerte sie sich bitterlich, und als man ihn auf zwei männliche Sekretäre, mehrere Frauen, einen Sticker und ein oder zwei Köche reduzierte, wäre sie beinahe gestorben vor Kummer. Und das alles musste Elisabeth aus ihrer eigenen Tasche bezahlen. Zwanzig Jahre lang zahlte sie, und zwanzig Jahre lang verhökerte Maria Stuart die schottische Krone in ganz Europa an jeden, der eine Revolution vom Zaun brechen und sie wieder auf den Thron setzen würde, den sie verloren hatte. Oder sonst den, auf dem Elisabeth saß.«
Er merkte, dass Marta lächelte.
»Sind sie jetzt nicht mehr so schlimm?«, fragte sie.
»Was?«
»Die Dornenstiche der Langeweile.«
Er lachte.
»Nein. Eine ganze Minute lang hatte ich sie vergessen. Wenigstens eine gute Sache, die auf Maria Stuarts Konto geht!«
»Woher weißt du denn so viel über sie?«
»Ich habe in meinem letzten Schuljahr einen Aufsatz über sie geschrieben.«
»Und mochtest sie nicht, nehme ich an.«
»Ich mochte nicht, was ich über sie herausfand.«
»Du hältst sie also nicht für eine tragische Figur?«
»O doch, sehr tragisch sogar. Aber nicht in dem Sinn, in dem man sie gemeinhin für tragisch hält. Ihre Tragödie bestand darin, dass sie als eine Königin mit dem Horizont einer Vorstadthausfrau geboren wurde. Wenn man eine Mrs Tudor aus der Nachbarschaft ausstechen will, ist das harmlos und amüsant. Es kann einen zwar in unverantwortbare Geldschwierigkeiten bringen, aber das betrifft nur einen selbst. Überträgt man das gleiche Benehmen auf ganze Königreiche, sind die Folgen katastrophal. Wer bereit ist, ein Land mit zehn Millionen Einwohnern zu verpfänden, um eine königliche Rivalin zu erledigen, der endet eben als gescheiterte Existenz und verscherzt sich alle Sympathien.« Er dachte einen kurzen Augenblick nach. »Als Direktorin einer Mädchenschule hätte sie einen Riesenerfolg gehabt.«
»Du Biest!«
»Das habe ich nett gemeint. Das Kollegium hätte sie gemocht, und alle kleinen Mädchen hätten sie vergöttert. Das meinte ich damit, dass sie tragisch ist.«
»Na schön. Dann also keine Kassettenbriefe. Was gibt’s sonst noch? Den Mann mit der eisernen Maske?«
»An den erinnere ich mich nicht. Aber ich könnte mich auch nicht für jemanden interessieren, der sich hinter Blech versteckt. Ich könnte mich überhaupt für niemanden interessieren, dessen Gesicht ich nicht sehen kann.«
»Ach ja, ich vergaß deine Leidenschaft für Gesichter. Die Borgias hatten wunderbare Köpfe. Ich könnte mir denken, dass sie dir das ein oder andere kleine Rätsel aufzugeben hätten, wenn du dich mit ihnen beschäftigen würdest. Und dann war da natürlich noch Perkin Warbeck. Hochstapelei ist immer faszinierend. War er es oder war er es nicht? Ein schönes Spiel. Das Gewicht fällt nie ganz auf die eine oder die andere Seite. Man stößt es um, und es kommt immer wieder hoch, wie eines dieser beschwerten Spielzeuge.«
Die Tür öffnete sich, und Mrs Tinkers biederes Gesicht erschien im Türspalt, von einem noch biedereren historischen Hut gekrönt. Diesen Hut trug Mrs Tinker, seit sie in Grants »Dienste« getreten war; er konnte sie sich mit gar keinem anderen vorstellen. Er wusste, dass sie noch einen besaß, denn sie erwähnte ihn ab und zu als »meinen Blauen«. Ihr Blauer war nicht nur ein Gelegenheitskauf, er wurde auch nur zu besonderen Gelegenheiten getragen und tauchte natürlich niemals in Tenby Court 19 auf. Er war der absolute Maßstab für alle gesellschaftlichen Ereignisse. (»War es nett, Tink?« – »Mein Blauer war mir dafür zu schade …«)
Sie hatte ihn zur Hochzeit von Prinzessin Elisabeth und zu verschiedenen anderen königlichen Anlässen getragen, und für zwei erhebende Sekunden war er tatsächlich in einer Wochenschau zu sehen gewesen, in der die Herzogin von Kent ein Band durchschnitt. Aber das wusste Grant nur aus Erzählungen.
»Ich hörte, dass Sie Besuch haben«, sagte Mrs Tinker, »und wollte gerade wieder gehen. Aber die Stimme ist mir bekannt vorgekommen, und da hab ich mir gesagt, das ist ja bloß Miss Hallard, da kannste ruhig reingehen.«
Mrs Tinker war mit verschiedenen Papiertüten und einem kleinen Strauß Anemonen beladen. Sie grüßte Marta unbefangen, denn sie war früher einmal Garderobiere gewesen, entsprechend hielt sich ihre Verehrung für die Göttinnen des Theaters in Grenzen. Dann warf sie einen schiefen Blick auf das herrliche Fliederarrangement, das unter Martas Händen erstanden war. Dieser Blick entging Marta, das kleine Anemonensträußchen jedoch fiel ihr auf, und sie zeigte sich der Situation gewachsen, als hätte sie sie schon mehrmals geprobt.
»Da verprasse ich meinen Gauklerlohn für weißen Flieder, und schon kommt Mrs Tinker und übertrumpft mich mit den Lilien der Felder.«
»Lilien?«, fragte Mrs Tinker misstrauisch.
»Sie sind wie Salomo in all seiner Herrlichkeit. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht.«
Mrs Tinker ging nur zu Hochzeiten und Taufen in die Kirche, gehörte aber einer Generation an, die noch die Sonntagsschule hatte besuchen müssen. Sie betrachtete daher jetzt die kleine Handvoll Herrlichkeit, die ihr Wollhandschuh umschloss, mit ganz anderen Augen.
»Ah so. Das hab ich nicht gewusst. Aber so ist’s ja viel verständlicher, nicht wahr? Ich hab dabei immer an weiße Madonnenlilien gedacht, an ganze Felder voll schrecklich teurer Lilien. Und die haben ja in Massen doch was Bedrückendes. Die waren also farbig? Warum erfährt man das denn nicht gleich richtig?«
Und dann sprachen sie über Übersetzungen und wie irreführend die Heilige Schrift doch sein konnte (»Ich habe mich immer gefragt, was das Brot auf dem Wasser bedeutet«, sagte Mrs Tinker), und die Situation war gerettet.
Während sie noch mit der Bibel beschäftigt waren, kam die Zwergin mit neuen Blumenvasen herein. Grant sah, dass die Vasen für weißen Flieder und nicht für Anemonen bestimmt waren. Sie waren ein Tribut an Marta, ein Freibrief für weitere Besuche. Aber Marta waren Frauen völlig gleichgültig, wenn sie ihr nicht unmittelbar nützlich sein konnten; ihr taktvolles Verhalten Mrs Tinker gegenüber war reines Savoir-faire gewesen, eine Reflexhandlung. Die Zwergin fühlte sich in ihre Schwesterngrenzen zurückgewiesen, holte die weggeworfenen Narzissen aus dem Waschbecken und stellte sie kleinlaut zurück in eine Vase. Die Zwergin kleinlaut zu sehen, bereitete Grant eine langersehnte, tiefe Befriedigung.
»So«, sagte Marta, als sie ihren Flieder fertig arrangiert und das Ergebnis ins rechte Licht gerückt hatte.
»Jetzt werde ich dich Mrs Tinker überlassen, damit sie dich mit den Leckerbissen aus ihren Papiertüten füttern kann. Sie haben nicht zufällig Ihre köstlichen Bachelor Buttons in einer dieser Tüten, liebste Mrs Tinker?«
Mrs Tinker strahlte.
»Möchten Sie vielleicht einen oder zwei? Frisch aus dem Ofen!«
»Und ob! Ich werde zwar schwer dafür büßen – diese kleinen Kuchen sind der Tod für die Hüfte –, aber bitte geben Sie mir ein paar. Damit ich im Theater was zum Tee habe.«
Mit schmeichelhafter Bedächtigkeit suchte sie sich zwei Stück aus (»Ich mag sie ein bisschen braun an den Rändern«), verstaute sie in ihrer Handtasche und sagte: »Also au revoir, Alan. Ich komme in den nächsten Tagen wieder vorbei und helf dir, einen Socken anzufangen. Nichts soll so beruhigen wie Stricken. Ist es nicht so, Schwester?«
»O ja, da haben Sie recht. Viele Herren unter meinen Patienten stricken ganz begeistert. Sie finden, dass es einem sehr schön die Zeit vertreibt.«
Marta warf Grant von der Tür aus eine Kusshand zu und verschwand, gefolgt von der zutiefst beeindruckten Zwergin.
»Würde mich nicht wundern, wenn das ein ganz durchtriebenes Luder ist«, sagte Mrs Tinker und machte sich daran, die Papiertüten zu öffnen. Sie bezog sich nicht auf Marta.
2
Aber als Marta zwei Tage später wiederkam, brachte sie weder Stricknadeln noch Wolle mit. Sie stürmte kurz nach dem Mittagessen herein, sehr schneidig mit einem Kosakenhut, den sie sich so gekonnt auf den Kopf gestülpt hatte, dass sein lässiger Schwung ganz zufällig aussah – sie musste mehrere Minuten vor dem Spiegel verbracht haben, um diese Wirkung zu erzielen.
»Ich kann nicht lange bleiben, mein Lieber. Bin auf dem Weg ins Theater. Heute ist Matinee, Gott steh mir bei. Tee schlürfende alte Tanten. Und wir alle sind nun an dem schrecklichen Punkt angelangt, wo wir überhaupt nicht mehr darüber nachdenken, was wir eigentlich sagen. Ich habe das dumpfe Gefühl, dieses Stück wird niemals abgesetzt. Es wird noch so wie in New York, wo ein Theaterstück nicht jahre-, sondern jahrzehntelang läuft. Geoffrey ist gestern Abend mitten im zweiten Akt stecken geblieben, die Augen sind ihm beinah aus dem Kopf gequollen. Einen Moment lang dachte ich, er hätte einen Schlaganfall. Hinterher sagte er, er könne sich an nichts erinnern, was zwischen seinem ersten Auftritt und der Stelle geschehen sei, an der er zu sich kam und merkte, dass der Akt schon zur Hälfte vorbei war.«
»Ein Blackout, meinen Sie?«
»Nein, o nein. Er ist einfach zum Automaten geworden. Da spricht man, völlig abwesend, seinen Text und bewegt sich nur noch mechanisch und denkt dabei an etwas ganz anderes.«
»Wenn es stimmt, was man so hört, ist das bei Schauspielern doch gar nicht so ungewöhnlich.«
»Na, ganz so ist es auch wieder nicht. Johnny Garson zum Beispiel kann dir genau sagen, wer mit Papier raschelt, während er gerade schluchzend seinen Kopf in irgendjemandes Schoß vergräbt. Aber das ist etwas ganz anderes, als einen halben Akt lang ›weg‹ zu sein. Stell dir nur vor! Geoffrey hat auf der Bühne seinen Sohn aus dem Haus geworfen, sich mit seiner Geliebten verstritten und seine Frau beschuldigt, sie hätte ihn mit seinem besten Freund betrogen. Und das alles, ohne dass er sich dessen bewusst gewesen ist!«
»Und woran hat er wirklich gedacht?«
»Er hat sich überlegt, ob er seine Wohnung in der Park Lane an Dolly Dacre vermieten und das Haus in Richmond kaufen soll, das die Latimers aufgeben, und ob er das kleine Zimmer mit der chinesischen Rokokotapete in ein zusätzliches Badezimmer umbauen soll. Mit der herrlichen Tapete könnte man den langweiligen kleinen Raum hinten im Erdgeschoss dekorieren. Der hat nämlich eine viktorianische Täfelung. Er hat sich auch den Abfluss angesehen, sich gefragt, ob er genug Geld hätte, um die alten Fliesen zu ersetzen, und darüber spekuliert, was für ein Herd in der Küche war. Er hatte gerade beschlossen, die Sträucher am Tor zu entfernen, als er merkte, dass er vor neunhundertsiebenundachtzig Zuhörern und mitten in einer Rede mir gegenüber auf einer Bühne stand. Kein Wunder, dass er die Augen aufgerissen hat … Wie ich sehe, hast du dich zur Lektüre wenigstens eines der Bücher aufgerafft, die ich dir mitgebracht habe – wenn der zerknitterte Umschlag diesen Rückschluss erlaubt.«
»Ja. Das mit den Bergen. Es war ein Geschenk des Himmels. Stundenlang habe ich mir die Bilder angeschaut. Nichts rückt die Dinge so schnell ins rechte Licht wie der Anblick eines Bergs.«
»Die Sterne sind besser, finde ich.«
»O nein. Die Sterne reduzieren einen lediglich auf den Status einer Amöbe. Sie rauben einem den letzten Rest Menschenwürde, den letzten Funken Selbstvertrauen. Aber ein schneebedeckter Berg ist ein erträglicher Maßstab für eine Menschengröße. Ich lag da, schaute auf den Everest und dankte Gott, dass ich ihn nicht besteigen musste. Mein Krankenbett war im Vergleich dazu ein Hort der Wärme, der Ruhe und Geborgenheit, und die Zwergin und die Amazone zwei der höchsten Errungenschaften der Zivilisation.«
»Ah … Nun, hier sind noch ein paar Bilder für dich.«
Marta kippte den großen Umschlag, den sie in der Hand hatte, über seinem Bett aus, und eine Reihe Blätter flatterte ihm auf die Brust.
»Was ist das?«
»Gesichter«, sagte Marta entzückt. »Dutzende von Gesichtern für dich. Männer, Frauen und Kinder. Alle Arten, Zustände und Größen.«
Er nahm ein Blatt und betrachtete es. Es war ein Frauenporträt aus dem 15. Jahrhundert.
»Wer ist das?«
»Lucrezia Borgia. Ist sie nicht ein Herzchen?«
»Mag sein. Aber willst du etwa behaupten, sie hätte etwas Geheimnisvolles gehabt?«
»O ja. Bis heute hat keiner herausgefunden, ob sie das Werkzeug ihres Bruders oder seine Komplizin war.«
Er legte Lucrezia beiseite und nahm ein zweites Blatt in die Hand. Es war das Porträt eines kleinen Jungen in der Tracht des späten 18. Jahrhunderts, darunter stand in verblassten Großbuchstaben: Louis XVII.
»Na, das ist doch ein schönes Rätsel für dich«, sagte Marta. »Der Dauphin. Ist er entkommen, oder starb er in Gefangenschaft?«
»Wo hast du die alle her?«
»Ich habe James aus seinem Verschlag im Viktoria and Albert Museum gelockt und ihn gezwungen, mich zu einer Kunsthandlung zu bringen. Er kennt sich doch mit solchen Dingen aus, und ich bin sicher, dass ihn in seinem Museum sowieso nichts interessiert.«
Es war so typisch für Marta, stillschweigend vorauszusetzen, dass ein Beamter, der zufällig auch Dramatiker und Experte für Porträts war, seine Arbeit freudig im Stich ließe, um ihretwegen in Kunstläden herumzustöbern.
Grant drehte die Reproduktion eines elisabethanischen Porträts um. Ein Mann in Samt und Perlen. Auf der Rückseite stand, dass es sich um den Grafen von Leicester handele.
»Das ist also Elisabeths Robin«, sagte er. »Ich glaube, ich habe noch nie ein Porträt von ihm gesehen.«
Marta betrachtete das fleischige männliche Gesicht und sagte: »Mir wird zum ersten Mal bewusst, dass es zu den großen Tragödien der Geschichte gehört, dass die besten Maler die Leute immer erst gemalt haben, wenn sie ihren Höhepunkt schon überschritten hatten. Robin muss ein bemerkenswerter Mann gewesen sein. Auch Heinrich VIII. soll als junger Mann umwerfend gewesen sein. Und wie kennen wir ihn? Als Spielkartenkönig. Wenigstens weiß man heute, wie Tennyson ausgesehen hat, bevor er sich diesen schrecklichen Bart wachsen ließ. Ich muss los. Bin sowieso schon spät dran. Ich habe im Blague zu Mittag gegessen, und es kamen so viele Leute an meinen Tisch, dass ich später wegkam, als ich wollte.«
»Ich hoffe, dein Gastgeber war entsprechend beeindruckt«, sagte Grant mit einem Blick auf den Hut.
»O ja. Sie kennt sich aus mit Hüten. Ein Blick, und sie sagte: ›Jacques Tous, wenn ich mich nicht täusche!‹«
»Sie?«, fragte Grant erstaunt.
»Ja. Madeleine March. Und ich habe gezahlt. Mach nicht so ein erstauntes Gesicht. Das ist taktlos. Wenn du es genau wissen willst, ich hoffe, dass sie das Stück über Lady Blessington für mich schreibt. Aber es war ein solches Hin und Her an unserem Tisch, dass ich gar keine Gelegenheit hatte, Eindruck zu schinden. Na, jedenfalls habe ich ihr ein gutes Essen spendiert. Dabei fällt mir ein, dass Tony Bittmaker sieben Leute an seinem Tisch hatte. Eine Magnumflasche nach der anderen. Wie der das nur schafft?«
»Mangel an Beweisen«, sagte Grant, sie lachte und ging.
In der Stille dachte er wieder über Elisabeths Robin nach. Welches Geheimnis umgab Robin?
Ach ja. Amy Robsart natürlich.
Aber Amy Robsart interessierte ihn nicht. Es war ihm egal, wie und weshalb sie die Treppe hinuntergefallen war.
Dennoch verbrachte er einen sehr vergnüglichen Nachmittag mit den übrigen Gesichtern. Schon lange, bevor er zur Polizei gegangen war, hatte er sich für Gesichter interessiert, und in seinen Jahren bei Scotland Yard hatte sich dieses private Vergnügen auch als beruflicher Vorteil erwiesen. Zu Beginn seiner Laufbahn waren er und sein Vorgesetzter einmal zufällig zu einer Gegenüberstellung dazugestoßen. Es war nicht ihr Fall, aber sie hielten sich im Hintergrund und sahen zu, wie ein Mann und eine Frau nacheinander die Reihe der zwölf nichtssagenden Männer abschritten, um nach dem einen zu suchen, den sie zu erkennen hofften.
»Wissen Sie, welcher es ist?«, hatte ihm sein Chef zugeflüstert.
»Ich weiß es nicht«, hatte Grant gesagt. »Aber ich kann es mir denken.«
»So? Und welchen meinen Sie?«
»Den Dritten von links.«
»Was hat er ausgefressen?«
»Keine Ahnung. Ich weiß überhaupt nichts von der ganzen Geschichte.«
Sein Chef hatte ihn belustigt angesehen. Als aber weder der Mann noch die Frau einen der Männer identifizieren konnten und wieder gegangen waren und die Reihe der Verdächtigen sich zu einer schwatzenden Gruppe auflöste, die Männer ihre Krawatten zurechtrückten, um wieder auf die Straße zu gehen und im Alltag unterzutauchen, aus dem man sie gerissen hatte, um dem Recht Hilfestellung zu leisten, war der Einzige, der sich nicht rührte, der Dritte von links gewesen. Der Dritte von links wartete ergeben auf seinen Wärter und wurde wieder in seine Zelle geführt.
»Donnerwetter!«, hatte sein Vorgesetzter gesagt. »Die Chancen standen eins zu zwölf – und Sie haben es erraten. Nicht übel. Er hat den richtigen Mann herausgepickt«, sagte er erklärend zum Polizeiinspektor.
»Kannten Sie ihn?«, fragte der Inspektor ein wenig überrascht. »Soweit wir wissen, hat er vorher noch nie Ärger gemacht.«
»Nein, ich habe ihn noch nie gesehen. Ich weiß nicht einmal, was er verbrochen hat.«
»Wie kommen Sie dann dazu, gerade auf ihn zu tippen?«
Grant hatte gezögert. Er musste es sich selbst erst klarmachen. Mit dem Verstand hatte es nichts zu tun. Er konnte kein bestimmtes Merkmal benennen, das auf die Täterschaft hindeutete. Es war eine reine Gefühlssache gewesen. Die Gründe lagen tiefer. Schließlich hatte er gestottert: »Er war der Einzige der zwölf, der keine Falte im Gesicht hatte.«
Darüber hatten sie gelacht. Aber als Grant die Sache noch einmal gründlich überdachte, wurde ihm klar, wie sein Instinkt gearbeitet hatte und welche Logik dem zugrunde lag. »Es klingt albern, aber das ist es nicht«, hatte er gesagt. »Der einzige Erwachsene, der keinerlei Falte im Gesicht hat, ist der Idiot.«
»Freeman ist kein Idiot, lassen Sie sich das gesagt sein«, unterbrach ihn der Inspektor. »Ein äußerst heller Bursche, glauben Sie mir.«
»So habe ich es auch nicht gemeint. Ich meine, dass der Idiot verantwortungslos ist. Der Idiot ist der Inbegriff der Verantwortungslosigkeit. Alle zwölf Männer, die da standen, waren um die dreißig. Aber nur einer hatte das Gesicht eines Verantwortungslosen. Deswegen bin ich auf ihn gekommen.«
Seit diesem Vorfall nannte man Grant bei Scotland Yard scherzhaft den »Mann, der auf den ersten Blick Bescheid weiß«. Und einmal hatte ein leitender Kommissar neckend zu ihm gesagt: »Erzählen Sie mir bloß nicht, Sie glauben, es gäbe so was wie eine Verbrechervisage, Inspektor.«
»Nein«, hatte Grant geantwortet, so einfach sei das nicht. »Wenn es nur eine Art von Verbrechen gäbe, Sir, ließe sich darüber reden. Aber die Verbrechen sind so vielfältig wie die menschliche Natur, und wenn ein Polizist anfängt, Gesichter in Kategorien einzuteilen, ist er aufgeschmissen. Wenn man zwischen fünf und sechs Uhr nachmittags durch die Bond Street geht, weiß man, wie die meisten anrüchigen Frauen aussehen – und doch hat die berüchtigtste Frau Londons das Gesicht einer Säulenheiligen.«
»In letzter Zeit ist es nicht mehr weit her mit der Heiligkeit. Sie trinkt zu viel«, hatte der Kommissar erwidert, der sofort wusste, von wem die Rede war. Dann hatten sie von anderen Dingen gesprochen.
Aber Grants Interesse an Gesichtern blieb bestehen und war allmählich zu einem ernsthaften Studium