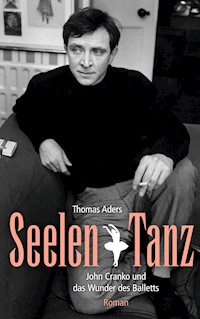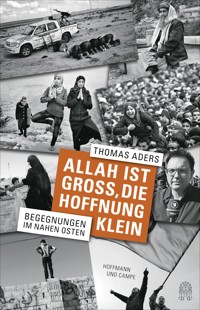
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Auf den Spuren des IS in Syrien, unterwegs in Ägypten, Saudi-Arabien oder dem Irak - als ARD-Korrespondent berichtet Thomas Aders aus dem Nahen Osten. Seine Beiträge über Menschen, ihre Schicksale und ihre Lebenswelt dauern maximal zwei Minuten und dreißig Sekunden. Erstmals erzählt er ausführlich von bewegenden und grausamen Momenten, die jenseits des Nachrichtenalltags stattfinden. Thomas Aders zeichnet sehr persönliche Porträts von Menschen und Orten, von Terroristen und Opfern. Er lässt Augenblicke der Recherche aufleben, die sich mit der Kamera kaum einfangen lassen. Die Erzählungen führen an entlegene Orte - auf einen Dorfplatz im Südsudan, in die weltgrößte Molkerei in Saudi-Arabien oder in ein Krankenhaus im Jemen. Sie lassen Unterstützer von Baschar al-Assad in Syrien oder fastende Muslimbrüder in Kairo zu Wort kommen. In Bagdad begegnet Aders Saher und ihren beiden Söhnen. Die Mutter versteckt sie 1980 im Kinderzimmer vor dem mordenden Regime Saddam Husseins, erst 2003 können sie das Haus wieder verlassen. Aders ist dabei, als sie auf die Straßen gehen, taumelnd angesichts der Eindrücke, die nichts mehr mit ihrer kindlichen Lebenswirklichkeit zu tun haben. Mit einem Vorwort von Jörg Armbruster.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Thomas Aders
Allah ist groß, die Hoffnung klein
Begegnungen im Nahen Osten
Hoffmann und Campe
Für Hannsky
Vorwort
Jörg Armbruster
Ein dieser Tage immer wieder zitiertes Bild: ein Kämpfer der Terrororganisation Islamischer Staat in Siegerpose. Angeblich eine Chiffre für den Nahen Osten. Für einige ist es sogar so etwas wie eine Ikone.
Seine schwarze Hose spannt über dem Bauch, die Hosenbeine hat er in seine Militärstiefel gestopft, sein langärmeliges Hemd ist natürlich auch schwarz, darüber eine Weste mit Taschen für Gewehrmagazine, auf dem Kopf eine Wollmütze, schwarz, versteht sich. Sein ungepflegter Vollbart erinnert mehr an zerzauste Schafswolle als an eine Gesichtsdekoration. Irgendetwas scheint er zu grölen, seinen Mund hat er auf dem Foto jedenfalls sperrangelweit aufgerissen, wahrscheinlich stößt er gerade einen dieser Flüche gegen alle Ungläubigen aus. So posiert, dschihadistisch korrekt, ein Kämpfer der Terrorbande Islamischer Staat vor dem Fotografen. Denn so sehen sie sich selbst am liebsten: drohend, herrisch, siegessicher. Um seine Macht zu demonstrieren, reckt er mit einer Hand eine Kalaschnikow hoch, mit der anderen schwenkt er die IS-Fahne, auch diese schwarz bis auf das sogenannte Prophetensiegel mit der Schrift: »Es gibt keinen Gott außer Allah.« Und schaut man genau hin, dann kann man auch noch den Koran in der Faust erkennen, die die IS-Fahne umklammert.
Schwarz – die Erkennungsfarbe dieser Terroristen, die versuchen, ein Netzwerk brutalster Gewalt über dieser Region auszuwerfen, die Andersgläubige abschlachten wie Vieh. Schwarz wird aber inzwischen auch immer mehr zum Markenzeichen der arabischen Welt. Nicht mehr das freundliche Grün des Propheten steht für den Islam, es ist zunehmend die Farbe des Todes, die Farbe der Angst und des Terrors. Genau das wollen die Dschihadisten.
Terror und Naher Osten lassen kaum noch voneinander, Islam und Gewalt wachsen immer enger zusammen, zumindest in der Phantasie vieler Nachrichtenkonsumenten im Westen – eine nur schwer aufzuhaltende Folge dieser Brutalisierung jenseits des Mittelmeers. Wenn nämlich aus dem Nahen Osten berichtet wird, dann hat es fast immer mit Tod und Terror zu tun. Kein Wunder, denn IS ist ein neues, so noch nie gekanntes Phänomen, Selbst Bin Ladens al-Qaida hat die eigene Grausamkeit nicht derartig lustvoll zur Schau gestellt, wie es die Medienabteilung von IS liebt, die sich auf Youtube und in einer eigenen Online-Zeitung mit Gekreuzigten und Geköpften brüstet wie ein Fußballverein mit seinen Pokalen. Dabei ist noch nicht einmal klar, ob diese Killer des Kalifen nur die besonders blutrünstigen Enkel Bin Ladens sind oder tatsächlich eine ganz neue Variante des internationalen Terrorismus. Jedenfalls beherrschen diese Kämpfer zurzeit unser Bild von der arabischen Welt wie kaum ein anderes Ereignis, und es droht unwiderruflich zum Zerrbild zu werden. Das schwarze Kriegerkäppi hat gewissermaßen das Palästinensertuch abgelöst. Auch das ist ganz im Sinne von IS.
»Araber müssen Terrorgene haben«, dröhnen inzwischen Stammtische. Oder: »Terrorismus wird denen schon in die Wiege gelegt.« Oder: »Der Islam ist die Religion der Gewalt.« Auf den Pegida-Demonstrationen sind solche Parolen mittlerweile regelmäßig zu hören. Außerdem haben etliche solcher Sprüche die Wirtshäuser schon verlassen und sind Thema ernst zu nehmender Fernsehsendungen geworden. Auch einige politische Parteien entziehen sich immer weniger dem Sog solcher Parolen.
Aus dem Westen starren mittlerweile viele auf die arabische Welt und ihre Muslime, als würden alle 350 Millionen Menschen in den 22 Ländern schwarze Klamotten, eine Kalaschnikow und den Koran unter dem Arm tragen wie der eingangs beschriebene IS-Krieger. Dass dem nicht so ist, braucht eigentlich gar nicht groß erklärt zu werden. Die Kleiderordnung im Orient reicht vom Anzug bis zum Kaftan, vom Abendkleid bis zur Abaya. Schließlich ist diese Welt genauso vielfältig und bunt wie unsere. Ein paar andere Farben vielleicht, etwas zurückhaltender, nicht ganz so schrill wie unsere. Gottesfürchtiger ist das Leben dort allemal als in unserer der Religion entwöhnten Welt. Der Kosmos der arabischen Menschen lässt sich aber genauso wenig über einen Kamm scheren wie der der Europäer. Als hier einst IRA, RAF oder ETA ihre Bomben zündeten, hat niemand in Kairo ganz Europa dafür verantwortlich gemacht. Auch umgekehrt sollte dies eine Selbstverständlichkeit sein – eigentlich.
Doch dank der Massaker des IS, dem Trommelfeuer der Berichterstattung über diese Terroristen und der Neigung der Menschen, Unterschiede möglichst wenig wahrzunehmen, ist mal wieder alles in einen großen Topf geflogen. Dort rührt jeder, der will, um und holt sich am Ende raus, was ihm passt. Im Augenblick sind dies das schwarz uniformierte Schreckgespenst von IS und der angeblich so gewalttätige Islam, dessen wichtigstes Ziel es sein soll, die nichtmuslimische Welt zu unterwerfen.
Tatsächlich aber töten diese Terroristen viel mehr gläubige Muslime als sogenannte Ungläubige. Ihre Vorbilder und Lehrmeister leben allerdings nicht nur in den Höhlen des Hindukusch, sondern auch in den Wüsten Saudi-Arabiens.
Saudi-Arabien? Das ist doch das Land mit dem vielen Öl und deswegen unser »best friend« da unten. Die machen so was? Richtig!
Der in viele Länder der islamischen Welt exportierte Wüstenwahhabismus der Saudis, eine extrem engherzige Auslegung des Korans, ist gewissermaßen der Nährboden und das Vorbild für den Steinzeitislamismus des IS. Das beginnt beim Zwang zur Totalverschleierung der Frauen, geht über das Verbot und die Verfolgung anderer Religionen bis hin zur Todesstrafe durch Köpfen, alles überwacht durch eine mächtige Religionspolizei, die unter anderem auch Geschäftsleute bestraft, die nicht rechtzeitig zu den Gebetszeiten ihre Läden verrammelt haben. Genauso wie die Tugendwächter des IS. Die meisten der rund 1,57 Milliarden weltweit lebenden Muslime können allerdings mit einem solchen Religionspurismus nicht viel anfangen, sind gemäßigt, friedliebend und fromm.
Man muss also schon sehr genau hinschauen, ehe man urteilt über die islamische Welt. Um zu einem ehrlichen Bild zu kommen, ist es also fast zwingend, sich schneller Pauschalurteile zu verweigern, sich stattdessen auf die Schicksale einzelner Menschen einzulassen, auf die Mühen ihres Alltags, auf ihre Hoffnungen, aber auch ihre Verzweiflung. »Allah ist groß«, daran werden die Menschen festhalten, dieser Satz ist Teil ihres Lebens, vielleicht werden sie sich sogar immer stärker an ihn klammern als letztem Rettungsanker. Denn ihre Hoffnung wird immer kleiner, ihre Hoffnung auf ein besseres Leben, auf Perspektiven und auf Würde, besonders seit die Rebellionen auf den Tahrirplätzen der arabischen Hauptstädte gescheitert sind. Die Schicksale Einzelner sollten also bei einem Gesamturteil berücksichtigt werden – nicht umgekehrt. Solche Geschichten erzählt Thomas Aders in seinem Buch. Man darf hoffen, dass sie ein wenig zum Verständnis und zur ideologischen Abrüstung beitragen, dass sie helfen, Stereotype abzubauen und den Blick zu weiten.
Wie aber reagiert die arabische Welt selbst? Sie schaut zu und schweigt, als wäre sie gelähmt, als hätte sich die Erde aufgetan und Monster wären aus der Hölle aufgestiegen. Einzig eine Frau hat dieses Schweigen durchbrochen, Klartext gesprochen und damit die arabische Männerwelt mutig aufgemischt.
Bei der Eröffnung eines Mediengipfels in Abu Dhabi im November 2014 machte die jordanische Königin Rania ihrer Wut über die Medienerfolge der Extremisten Luft: »Eine kleine Minderheit areligiöser Extremisten nutzt die sozialen Medien, um unsere Geschichte umzuschreiben, unsere Identität zu kidnappen und uns zu diskreditieren. Das ist ihre Version der arabischen Welt, ihr Plot, ihre historische Erzählung und Interpretation. Und der Rest der Welt hört und schaut zu. Die Extremisten sind abnorm und abstoßend und müssten jeden Araber kochend vor Wut machen«, hatte sie den arabischen Herrschern zugerufen und dieser hilflosen Männerriege ins Stammbuch geschrieben: »Unser Schweigen spricht Bände, es ist das größte Geschenk für den IS.«
Jörg Armbruster, Januar 2015
Das Kalifat des Schreckens Auf den Spuren des Islamischen Staats
Syrien, Oktober 2014 / Irak, November 2014
Unser Taxi schraubt sich über steile Serpentinen aus Beirut hinauf in die Hügel, es ist ein Umweg. In der libanesischen Hauptstadt behindern Straßensperren die Fahrzeuge, die auf der großen Ausfallstraße gen Osten unterwegs sind. Vor wenigen Tagen gab es mehrere Sprengstoffattentate im schiitischen Hisbollahviertel Harek Hreik, die Nerven der Sicherheitskräfte sind zum Zerreißen gespannt. Die Hisbollah, die »Partei Gottes«, kämpft an der Seite des syrischen Regimes und ist den sunnitischen Extremisten von al-Qaida, al-Nusra und dem sogenannten Islamischen Staat ein Dorn im Auge.
So kommen wir durch kleine Stadtteile, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Feigenbäume, blühende Bougainvilleabüsche und Pinien säumen unseren Weg wie ein Verabschiedungskomitee. Immer weniger Häuser sind zu sehen, die Steigung ist jetzt so groß, dass eine Bebauung kaum möglich wäre. Plötzlich öffnet sich der Blick, und unter uns liegt Beirut – pastellfarben, dazwischen grüne Flecken Zedernwald. Und dahinter: das Mittelmeer, verschleiert, verschwommen hinter seinen eigenen Ausdünstungen. Von hier oben aus: eine beinahe irreal schöne Szenerie, Bilder, die in Deutschland nur die wenigsten mit dem Nahen Osten verbinden.
Unser Ziel ist Syrien – zum achten Mal seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs. Es ist für Journalisten eines der heikelsten Länder auf der Welt, unsere schusssicheren Westen und das Atropin als Gegengift bei einem Einsatz von Chemiewaffen liegen griffbereit im Kofferraum. Ich sehe auf die Schönheit Beiruts und versuche mir die syrische Stadt Maalula vorzustellen, zu der wir reisen wollen. In dem christlichen Wallfahrtsort hielten bis Ostern 2014 Gotteskrieger der al-Nusra-Front mehrere Viertel besetzt und trieben in den Klöstern ihr Unwesen. Wie sieht der Ort nun aus, über den so viel berichtet wurde?
Wir fahren aus dem Felsmassiv des küstennahen Libanon-Gebirges hinunter in die saftig grüne Bekaa-Ebene und dann wieder hinauf zur Gebirgskette des Anti-Libanon im Osten. Etwa eine Stunde brauchen wir bis zur syrischen Grenze. Am Grenzübergang Jdeideh stehen nur ein Dutzend Männer und Frauen an den Passschaltern, bei unserem letzten Aufenthalt im Juni warteten dort noch Hunderte. Kaum jemand will jetzt mehr nach Syrien. Unser Gepäck wird wenig später äußerst gründlich untersucht, wie jedes Mal bei der Einreise. Die Grenzsoldaten suchen nach BGAN-Laptops, mit denen man per Satellitenverbindung Beiträge direkt in die Redaktionen schicken und von fast überall auf der Welt Livegespräche führen kann. Natürlich liegt das nicht im Interesse des Regimes von Baschar al-Assad, und wir verzichten sogar auf den Importversuch, denn sonst könnten wir gleich wieder umkehren. Interessanterweise werden sogar unsere zwei Bodytracker beschlagnahmt. Wenn man sie aktiviert, ermitteln sie per Satellitenortung unsere Position und senden die Daten an einen Server. Unsere Kollegen in Kairo und Stuttgart können so auf dem Monitor immer genau verfolgen, wo wir uns gerade aufhalten. Eine Sicherheitsmaßnahme in Krisengebieten, die in diesem Falle aber nicht zum Tragen kommt.
Überall Poster von Baschar al-Assad, alleine auf unserer Seite der Gepäckkontrolle zähle ich 45: Baschar grüßend, lächelnd, sprechend. Baschar in Anzug, Militäruniform, Hemd. Baschar mit Sonnenbrille, Baschar, wie er ernst ins Ungewisse schaut. Baschar der Freund, Baschar der Landesvater. Wir haben auf unserer ersten Syrienreise im Januar 2012 eine Druckerei in Damaskus besucht, die diese Art von Devotionalien seit dem Putsch von Vater Hafez al-Assad zu verantworten hat, also seit 1970. Im Hamidie-Souk an der Umayyaden-Moschee drucken Vater Shafiq und Sohn Radvouan Mousolie in ihrem Familienbetrieb, Mindestabnahme 100 Stück pro Motiv. Sie waren nicht untätig seit meiner letzten Reise im Sommer, ein braun gehaltenes Plakat im Orientstyle kannte ich noch nicht.
Dann lassen wir die Grenze hinter uns. Die Autobahn öffnet sich, unser Fahrer Majid drückt auf die Tube, doch nur sehr kurz. Bis zum ersten von gefühlten zwanzig Checkpoints. Der zuständige Soldat lässt sich auch von unseren offiziellen Papieren der syrischen Behörden nicht beeindrucken und geht erst mal telefonieren. Wir warten derweil untätig am Straßenrand, bis er zügig zurückkommt, sich entschuldigt und uns unterwürfig eine gute Fahrt wünscht. Irgendwann tauchen rechter Hand die beiden Vororte Al-Moadameyya und Dareyya auf. Hier sind wir 2013 einmal zwischen die Fronten geraten, links stand Assads Artillerie, rechts die Rebellen. Heute jedoch: keine Militärbewegungen, nur eine schwarze Rauchwolke über der Siedlung, es könnte sich auch um einen Fabrikschornstein handeln.
Damaskus kommt mir vor wie immer: geordnet, sauber, beinahe still. Kein Gehupe wie in Kairo, die Autos halten vor Ampeln sogar an. Auf den ersten Blick eine Hauptstadt, die sich vor allem durch ihre Aufgeräumtheit von anderen Metropolen des arabischen Raums unterscheidet. Die Menschen nehmen ihre Busse, schlendern mit Softeis über die Bürgersteige, sonnen sich in den Parks, trinken Macchiato und rauchen ihre Wasserpfeife. Selbst die zweistöckigen Schutzmauern vor dem Informationsministerium sind fein säuberlich in den Farben Syriens bemalt: rot, weiß und schwarz mit zwei grünen Sternen in der Mitte.
Als wir vor dem Eingang des Hotels Dama Rose parken, zeigt Producer Mumtaz nach oben auf die Fassade des Gebäudes. Neben dem Büro seines Freundes von der Nachrichtenagentur AP prangt ein riesiger schwarzer Fleck. Vor etwa einer Woche wurde das Dama Rose wieder einmal von einer Mörsergranate getroffen. Wir passieren eine besonders straffe Sicherheitskontrolle mit wünschelrutenartigem Sprengstoffdetektor, unser Gepäck wird geröntgt. Und dann betreten wir die glänzend gewienerte Marmorlobby, in der uns grausam pathetische Keyboardmusik begrüßt – auch das ist nichts Neues.
Beim Aufstehen und dem gemeinsamen Frühstück hören wir massives Artilleriefeuer ganz in unserer Nähe, Kameramann Martin Krüger, Cutter Frank Sauer und ich zucken jedes Mal zusammen. Um zehn nach zehn, als wir gerade unseren Wagen mit dem Equipment beladen, erfolgt eine Salve von Schüssen.
»In or out?«, fragt Frank besorgt.
»Outgoing«, beruhigt der Syrer Mumtaz.
Die Medienbeauftragte des Informationsministeriums, die wir im Anschluss treffen, spricht ein hervorragendes Englisch mit britischem Akzent. Wir sagen ihr, dass wir nach Maalula wollen. Sie werde ihr Möglichstes tun, sagt sie, aber nur mit Begleitung des Militärs. Freundliche Aufmerksamkeit auch angesichts unserer Bitte um ein Interview mit einem möglichst hochrangigen Vertreter der syrischen Regierung. Ansonsten könnten wir im Stadtgebiet von Damaskus drehen, was immer wir wollten. Und das tun wir dann auch.
An einem militärischen Posten, unter einem von einem großen Projektil zerstörten Wasserturm, haben die Soldaten Zeugnisse des Bürgerkriegs gesammelt: Vielleicht 50 Mörser und Granaten liegen auf einem verdorrten Blumenbeet in Haufen, 15 bis 80 Zentimeter lang sind die Geschosse, von den Gegnern mit einfachsten Mitteln zusammengeschweißt und dennoch tödlich. Allein in dem Viertel Dscharamana, in dem wir uns jetzt bewegen, sind seit Ausbruch der Kämpfe im Frühjahr 2011 insgesamt 7000 Sprengkörper niedergegangen, abgeschossen von den Rebellen und den Dschihadisten, die Assad gemeinsam stürzen wollen. Wir erreichen eine Baustofffirma – Ziegelsteine, Kalkberge und Sandhügel versperren zunächst die Sicht, bis wir auf weitgehend freies Feld kommen.
»Duckt euch lieber«, sagt der zuständige militärische Abschnittskommandant.
Nur 300 Meter von uns entfernt verläuft die innerstädtische Front. Eine ganze Häuserkette, fast 100 Meter lang, ist zerbombt und zerschossen worden, offene Wohnungen, deren Trümmer in den Himmel starren. Wie in der Rebellenhochburg Homs, denke ich.
Hier wird es sichtbar: Das Assad-Regime ist so geschwächt, dass es mehr als zwei Drittel seines Landes seinen Gegnern überlässt. Nur noch in ihrer Machtbasis kann die Regierung so viele Truppen aufbieten, dass man von militärischer Präsenz reden kann – etwa von der Stadt Daraa im Süden an der Grenze zu Jordanien über die Hauptstadt bis hin zum alawitischen Kernland rund um den Mittelmeerhafen Tartus. Der Rest ist von den Rebellen der syrischen Opposition, den Kurden und den verschiedenen Fraktionen der Gotteskrieger erobert worden. Doch selbst in der Hauptstadt muss sich die Armee gegen unentwegte Angriffe ihrer Gegner wehren, nicht einmal Damaskus kann Assad kontrollieren. Seit unserem letzten Aufenthalt zur Präsidentenwahl vor vier Monaten hat der Konflikt sich sogar zugespitzt, meine ich zu erkennen. Zum einen haben die Kampfhandlungen in der Hauptstadt wieder zugenommen, zum anderen weitet die syrische Armee ihre Angriffe auf Standorte von Opposition und Islamisten weiter aus. Die frühere Industriestadt Aleppo beispielsweise wird massiv bombardiert und steht offenbar kurz vor dem Fall. Nach der Rückeroberung von al-Qusseir im Juni 2013 und der ehemaligen Rebellenhochburg Homs im Mai 2014 wäre Aleppo für das syrische Regime ein weiterer, diesmal ungleich bedeutenderer Sieg.
Für das Regime Assads ist die Lage nun deutlich komfortabler: Seit dem Erscheinen der äußerst aggressiven und äußerst blutrünstigen Terrortruppe Islamischer Staat (IS) bekämpfen sich nun zwei von Assads Gegnern gegenseitig, die Kurden und der IS. Warum sollte sich die syrische Armee dort einmischen? Sie hätte keine Ressourcen dafür, und selbst wenn – solange ihre Feinde sich gegenseitig schwächen und die von den USA geführte Anti-IS-Allianz den Job übernimmt, den Islamischen Staat aus der Luft zu bekämpfen, kann der syrische Präsident sich zurücklehnen.
Zu Beginn der Aufstände war die Aussage des Regimes, es handele sich bei den Aufständischen um dschihadistische Terroristen, fraglos eine Lüge. Seit die Gotteskrieger der al-Nusra-Front und des IS aber in Syriens Städten wüten, hat es im Nachhinein jedoch zum Teil recht bekommen. Man fragt sich, warum das Regime nicht endlich zwischen gemäßigten Oppositionellen (auch wenn sie gegen Assad kämpfen) und den wesentlich radikaleren Gotteskriegern unterscheidet und Erstere mit einer Amnestie vielleicht sogar auf seine Seite zurückholt. Doch von einem auch nur verbalen Versöhnungsangebot kann keine Rede sein.
Unsere Reise dient einer 60-Minuten-Dokumentation in der ARD, Ende Oktober 2014. Titel: Das Kalifat des Schreckens. Bedrohung durch den IS-Terror. Wie konnte der IS so schnell so groß und mächtig werden, dass er weite Teile des Irak und Syriens kontrollieren kann? Woher kommt das Geld, das er für seine Herrschaft benötigt? Warum gehen immer mehr Freiwillige aus Deutschland und ganz Europa über die Türkei nach Syrien, um sich den Gotteskriegern anzuschließen? Zehn Korrespondenten und Reporter der ARD sind unterwegs, um die Hintergründe dieses erst einige Monate existierenden Phänomens zu analysieren, die Einsätze werden von meiner Heimatredaktion beim SWR in Stuttgart koordiniert. Etliche westliche Fernsehteams stellen jede Woche Anträge, um aus Damaskus berichten zu können, nur unser Team aus Kairo hat es bislang jedes Mal geschafft, dank unserer langjährigen Kontakte.
Termin im alten Damaszener Präsidentenpalast, unsere Gesprächspartnerin ist Buthaina Schaaban. Sie gehörte schon zum engsten Kreis um Baschars Vater Hafez al-Assad, nun ist sie mediale und politische Beraterin des amtierenden Präsidenten im Range einer Ministerin. Was sie sagt, sagt die syrische Führung. Frau Schaaban ist die hochrangigste Vertreterin des Regimes, mit der ich jemals gesprochen habe, darüber kommt nur noch Baschar al-Assad selbst. Sechs bis sieben Minuten Interview hat sie uns vorab zugestanden; ich habe kein gutes Gefühl. Jede zeitliche oder gar inhaltliche Einschränkung empfinden wir Journalisten als Drangsalierung. Da speziell im arabischen Raum unsere Gesprächspartner zudem zu minutenlangen Antworten neigen, erwarte ich von der Unterredung nicht allzu viel. Doch als sie in das Vorzimmer kommt, frisch frisiert und elegant gekleidet, als sie behände, aber nicht eilig auf mich zuläuft und ihr professionellstes Lächeln aufsetzt, als sie Smalltalk macht, während wir die Kamera einrichten und der Fotograf sie nebenbei ablichtet, als sie ganz nebenbei die wichtigsten Fragen zur Gesprächsführung abklärt und in professioneller Weise zusagt, ihre Antworten so kurz wie möglich zu halten – da bin ich tatsächlich gespannt auf das kommende Interview.
»Rolling«, sagt Martin Krüger, die Kamera läuft.
»Wie gefährlich ist der sogenannte Islamische Staat?«, frage ich zur Einleitung.
»Sehr gefährlich!«, sagt die Dame Anfang sechzig. »Denn es handelt sich weder um einen Staat noch ist er islamisch. Er ist eine terroristische Organisation, die Menschen tötet, Menschen abschlachtet, Land okkupiert. Er ist extrem gefährlich – nicht nur für Syrien, sondern für die ganze Welt!«
»Wie konnte der IS so stark werden?« Ich kenne die Antwort, bin aber erstaunt, wie präzise und plakativ sie ausfällt.
»Der IS hätte niemals so stark werden können ohne die Hilfe von Staaten und Ländern, die ihn unterstützt, finanziert und gefördert haben. Seit dem Beginn der Krise in Syrien haben wir oft gesagt, dass die Türkei, Saudi-Arabien und Qatar Terroristen innerhalb unseres Landes finanziert, bewaffnet und unterstützt haben.«
Und nun die Frage, die mir sehr am Herzen liegt: »Wer von beiden Gruppen ihrer Gegner ist gefährlicher: die Rebellen der Opposition oder die Islamisten?«
»Wir haben unter Massakern gelitten – in Idlib, in Aleppo, in Homs –, vor und nach dem Auftauchen des sogenannten Islamischen Staates«, antwortet die Medienexpertin. »Die Oppositionellen und die Dschihadisten haben die gleiche Mentalität: Sie denken alle, dass ein menschliches Leben wertlos ist. Dass sie jede Frau und jedes Kind töten können. Dass sie grauenhafte Massaker verüben können. In Homs haben sie 50 Kinder getötet. In der Schule. Jeder, der sich in einer Gruppe von Kindern selbst in die Luft sprengt, ist nichts anderes als ein Verbrecher – egal, was für einen Namen er verwendet.«
Nach wie vor also wirft die Regierung jeden ihrer Gegner in einen Topf, eine Unterscheidung zwischen Rebellen und Gotteskriegern, zwischen Syrern und ausländischen Kämpfern, zwischen Befürwortern und Gegnern der Demokratie gibt es für Damaskus nicht. Das syrische Regime ist so starr geblieben, wie ich es im Jahr 2005 bei meiner ersten Reise vorgefunden habe. Es erkennt nicht an, dass die syrischen Oppositionellen nichts anderes getan haben als ihre Mitstreiter in Tunesien, Ägypten, Libyen und anderen arabischen Staaten: für eine Befreiung von den verknöcherten Strukturen zu kämpfen, für ein Ende von Korruption, Postenschacher und fortgesetzter Verletzung der Menschenrechte. Nun könnte das Regime – aus einer Position der Stärke heraus – mühelos einen Schritt auf die Rebellen von der Freien Syrischen Armee zugehen, aber ebendas wird unterlassen. Mit fatalen Folgen: Ein Ende des überaus blutigen Bürgerkriegs in Syrien ist unter diesen Voraussetzungen praktisch ausgeschlossen.
Die Augen des Westens und der freien Welt sind meiner Ansicht nach viel zu einseitig auf die Terroristen des Islamischen Staates fokussiert; das Grundübel – die unversöhnliche Haltung der Damaszener Regierung – gerät immer mehr aus unserem Blickfeld. Und das, obwohl dadurch weiterhin Menschen umkommen, von denen wohl die meisten unbeteiligte Zivilisten sind. Fast jeden Tag schmeißt das Regime Fassbomben auf Flüchtlingslager, aber keiner interessiert sich mehr dafür angesichts eines spektakulären Gefechts zwischen dem IS und den Kurden, das die Kameras live ins Haus liefern. Die syrische Regierung kann sich die Hände reiben, weil das Publikum wegschaut und vergisst.
Nach dem Ende unseres ebenso interessanten wie auch letztlich frustrierenden Interviews brechen wir umgehend auf nach Maalula, die Drehgenehmigung kam in der vergangenen Nacht. An diesem Ort sieht die Regierung gerne Journalisten, denn die Bilder und Eindrücke, die sie dort sammeln, können der Verifikation der These, dass ihre Gegner die Bösen sind, nur dienlich sein. Im Wissen, dass man uns benutzen will, besteigen wir unseren Teamwagen und machen uns auf den Weg.
In einem der Armeestützpunkte, in dem man uns sagt, es stehe heute keine militärische Begleitung für uns zur Verfügung, ziehe ich mich in einer Toilette schnell um. Anzug und Krawatte lege ich in eine Plastiktüte und tausche sie gegen Jeans und Hemd aus. Wir haben freies Geleit und fahren in Richtung Nordwesten, die Trasse ist an vielen Stellen in Sandsteinhügel gefräst worden. Von den Parks in der Hauptstadt und den grünen Feldern im Umkreis von Damaskus bleiben nur vereinzelte Olivenplantagen übrig, die Vegetation wird immer wüstenhafter. An einer einzigen Straßenkreuzung mache ich nicht weniger als vier Armeeposten aus, mit Scharfschützen und Panzern.
Zwei-Sterne-General Baschar al-Sharany begrüßt uns in der letzten Militärbasis vor Maalula – groteskerweise unter einer Plastikplane des UNHCR, des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen. Die Armee, letztlich verantwortlich dafür, dass mehr als neun Millionen Syrer und Syrerinnen auf der Flucht sind – im Ausland wie im Inland –, macht es sich gemütlich unter Planen, die für die Notleidenden gedacht sind. Der General inszeniert sich als humoriger Kommandant, er bietet uns Kaffee, Tee und Zigaretten an. Nebenbei will er uns in eine längere Diskussion über Hitler, Rommel und die deutsche Militärgeschichte verwickeln, doch wir pochen auf möglichst zügige Weiterfahrt. Heute ist unser letzter Tag in Syrien, morgen früh schon geht es zurück; über Beirut nach Amman, von wo aus wir am Tag danach zu einer weiteren Reportage für die ARD-Dokumentation in den Süden Jordaniens aufbrechen wollen. Nach zehn Minuten entlässt er uns und stellt uns einen anderen General an die Seite, der sich von einem Fahrer im Mittelklassewagen vor unserem Transporter herfahren lässt. An einem weiteren Checkpoint vor den Toren der christlichen Stadt legen wir unsere kugelsicheren Westen an, Level IV, mit Schutz vor Langwaffenmunition mit Vollmantel und Hartkern. Gegen einen Scharfschützen jedoch, so wissen wir, würden sie keinen ausreichenden Schutz bieten.
Maalula kommt aus dem Aramäischen und bedeutet Eingang. Ein massiver Kontrast schon hier zu Beginn, die steilen, felsigen Kalamun-Berge erheben sich ockergelb und majestätisch hinter dem von Granaten und Panzern durchlöcherten Stadttor. Die Spuren der Zerstörung sind nicht zu übersehen. Wir fahren weiter, an Mehrfamilienhäusern vorbei, die nach massiven Treffern stockwerksweise in sich zusammengesunken sind. Je näher wir dem Ortskern kommen, desto deutlicher erscheint eines der Viertel, das sich über einen nahezu kugelrunden Hügel ergießt. Als wir am zentralen Platz aussteigen und die Menschen uns anstarren, fühle ich mich unwohl; meine Schutzweste hätten die Bewohner gebraucht, als die Gotteskrieger ihre Stadt in Schutt und Asche gelegt haben.
»Sehen Sie hier«, sagt ein General namens Iyad, der sich nicht filmen lassen will und der die ganze Zeit über bis zur Rückeroberung an Ostern 2014 hier gekämpft hat, »dieser Tunnel unter der Stadt hat Hunderten von Menschen das Leben gerettet. Durch ihn sind sie aus dem von den Islamisten besetzten Westen zu uns herübergekrochen. Bis die Angreifer das gemerkt haben …«
Der Tunnel ist über eine Länge von drei Häuserfassaden gesprengt worden, niemand konnte danach mehr fliehen. Auch der Bürgermeister Naji Wehbeh denkt mit Grauen an die Zeit der Okkupation durch die Kämpfer der al-Qaida-nahen »Siegesfront« Dschabhat al-Nusra.
»Gleich zu Anfang haben sie zwei Stellungen hoch oben auf den Hügeln erobert«, sagt der offiziell gekleidete, noch sehr junge Gemeindevorsteher mit rauchiger Stimme. »Von dieser idealen Position aus haben sie die Menschen im Westen von Maalula aufs Korn genommen. Gleich am ersten Tag haben sie drei junge Männer erschossen und sechs Menschen gekidnappt.«
Eine Kirche am Platz neben unserem Teamwagen ist zerschossen, der Innenraum wurde durch ein verheerendes Feuer zerstört. Von der Treppe am Eingang, die voller Glassplitter, Ruß und Steinen liegt, erblicke ich das Minarett einer Moschee auf der anderen Straßenseite, auch dieses Gotteshaus wurde von Granaten durchsiebt. Das, was im syrischen Maalula geschehen ist – wie auch in al-Raqqa und in Kobane, im irakischen Mosul und in der Provinz Anbar –, wirkt angesichts dieser Eindrücke auf mich wie ein mittelalterlicher Glaubenskrieg.
Ein Metallschild weist am erhöhten Mittelstreifen des Platzes auf eines der melkitischen griechisch-katholischen Klöster hin. Es ist symbolträchtig auf der Höhe des Ortsnamens durchschossen, von einer Panzergranate mit zehn Zentimetern Durchmesser.
Wir fahren nun über sehr steile Straßen bergan zu jenem Konvent, das mein Korrespondentenkollege Jörg Armbruster 2012 besucht hat, etwa ein Jahr nach Ausbruch des Bürgerkriegs. Damals schon war im Kloster der heiligen Thekla die Angst der Nonnen vor einem Überfall durch die Islamisten mit Händen greifbar. Ein einzigartiger Ort auch heute, nach zwei Seiten sind die Gebäude umgeben von den hoch aufragenden Felsformationen und zum Teil in die natürlichen Höhlen hineingebaut. Von hier aus hat man den wohl schönsten Blick auf die Stadt, die sich an die ockerfarbenen Steilhänge schmiegt.
Durch enge, nur zu Fuß begehbare Schluchten sind die Krieger der al-Nusra-Front genau an dieser Stelle in die Stadt eingedrungen und haben das Kloster eingenommen. Die Islamisten setzten sich hier fest und begannen ihr von maßlosem Hass auf Andersgläubige geprägtes Vernichtungswerk.
Außer dem Militär, das uns auch hierher begleitet hat, finden wir nur zwei Menschen in den Ruinen: einen Architekten, der das Ausmaß der Zerstörungen aufzeichnen und Pläne für eine Rekonstruktion erstellen soll. Er will nicht vor der Kamera sprechen, zu groß ist seine Angst vor einer Rückkehr der Islamisten und ihrer Rache. Und einen Mitarbeiter des Klosters, von Beruf Bäcker. Michael Ouba, selbst gläubiger Christ, hat bis zu den Vorfällen Ende 2013 bei Gottesdiensten assistiert, mit Handwerksarbeiten geholfen und das Brot für die Nonnen sowie die Hostien gebacken. Jetzt räumt er auf, so gut er kann. Unrasiert, seine Hosen fleckig, sein Hemd eingerissen, obwohl die Ereignisse mehr als ein halbes Jahr zurückliegen – als wäre es der sichtbare Ausdruck seines seelischen Zustands. Anders als der Architekt ist Ouba sofort bereit, uns Bericht zu erstatten und durch das Kloster zu führen.
»Als die Kämpfer der al-Nusra-Front hier eingedrungen sind«, erzählt er aufgeregt, »haben sie die 14 Nonnen gekidnappt und das ganze Kloster von unten bis oben zerstört. Sie sehen es überall: Sie haben die uralten Ikonen aus frühchristlicher Zeit zerhackt, das sind unwiederbringliche Unikate gewesen; sie haben die Kirchenglocken abgerissen und mitgenommen; sie haben alle Kreuze auf den Kirchtürmen abgebrochen; und sie haben die bronzene Jesusstatue enthauptet. Schauen Sie sich selbst um, es ist alles kaputt!«
Zunächst gehen wir in die Kapelle direkt neben dem Innenhof, in dem wir Michael Ouba getroffen haben. Schwarz ist die alles dominierende Farbe, die Wände bis hin zur 20 Meter hohen Kuppel mit ihren Fresken sind hinter einer Schicht aus Ruß und Dreck verborgen, von den großen Ölgemälden ist nur ein Haufen verschmorter Holzpartikel übrig. Auf einem Fenstersims: mehrere uralte Bibeln mit kyrillischen Schriftzeichen, bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. In der Apsis: ein Maria-und-Jesus-Fresko, das die Extremisten mit Messern bearbeitet und aus der Wand gebrochen haben. Im Hauptraum: ein Porträt, möglicherweise das der Namensgeberin des Klosters, von der aber zwei Drittel fehlen, nur die Beine und ein danebenliegender Löwe sind noch zu erkennen; eine Marienminiatur, deren Gesicht eingedrückt oder eingeschlagen wurde; eine Abendmahlszene, in mehrere Teile zerrissen; Abraham, dem nur noch ein Arm geblieben ist; eine Heilige mit einem Auge.
Natürlich, jede vom syrischen Regime abgeworfene Fassbombe tötet Menschen, der Islamische Staat bringt Geiseln um, jede Bombe in einer schiitischen Moschee kostet Menschenleben. Diese Handlungen sind weitaus schlimmer als die Zerstörung von Gegenständen. Und trotzdem: Die bewusste Vernichtung von einzigartigen Kulturschätzen, wie wir sie jetzt im Thekla-Kloster mit eigenen Augen sehen, ist ein Verbrechen, das mich erschüttert. Bis zu 1800 Jahre alt waren die Kunstschätze, die nun für alle Zeit verloren sind, Zeugnisse des frühen Christentums. Über Jahrhunderte kamen Pilger, um sie sich anzuschauen und vor ihnen zu beten. Nun ist das Thekla-Kloster nur noch ein Skelett seiner selbst. Denn – bei weitem schlimmer noch als die Zerstörung einzelner Gemälde oder Bibeln – das spirituelle Zentrum des Komplexes ist nach dem Auftauchen der al-Nusra-Front nicht mehr vorhanden.
Michael Ouba geht vor uns her die Treppen zum Allerheiligsten hinauf. Schleppend, als würde sein Körper sich dagegen wehren, den Ort aufzusuchen. Noch einmal bekreuzigt er sich, bevor er den Vorraum durchmisst: eine der großen, halboffenen Felshöhlen, die so geräumig ist, dass ein Baum dort wächst, seine Äste an der Decke entlang nach draußen zum Licht ragend. Er zieht seine Schuhe aus, wir tun es ihm nach. Drinnen ist die winzige Grabkammer fast stockdunkel, nur der Schein einiger Kerzen lässt ihre steinerne Begrenzung erahnen. Als unsere batteriebetriebene LED-Lampe das Szenarium grell erleuchtet, fällt mein Blick zunächst auf eine Reihe von Ikonen, die jemand fein säuberlich an der Wand aufgerichtet hat, fast keine ist unbeschädigt. Dann sehe ich Michael, er wirkt getroffen, verletzt. Er stöhnt und schüttelt seinen Kopf, als könnte er es noch immer nicht fassen, was die Dschihadisten aus der Stätte des Glaubens gemacht haben.
»Als wir in die Grabkammer kamen, waren die Ikonen in drei Teile zerbrochen, das Grab der heiligen Thekla geschändet, der goldene Schmuck geraubt. Wir haben alle geweint, wir sind bis heute fassungslos.«
Zu mehr Worten ist Michael jetzt nicht in der Lage. Wir verabschieden uns und fahren mitgenommen zurück nach Damaskus. Noch einmal, bevor wir in den Wagen steigen, schweift unser Blick über das kleine Maalula an der syrisch-libanesischen Grenze – früher ein Schmuckstück, heute ein Ort der Trauer. Wie oft schon bin ich mit einem ähnlichen Gefühl abgereist von Stätten der Verwüstung und der Hoffnungslosigkeit? Das Schlimme ist: Seit meinem ersten Aufenthalt in der Region vor mehr als 15 Jahren scheinen es immer mehr zu werden.
Angesichts der vielen Opfer der Unruhen in Tunesien, Ägypten, Libyen dachte man im Jahr 2011, dass der Nahe Osten nicht zur Ruhe kommt, hatte aber zumindest eine Spur von Zuversicht. Dann brach der Bürgerkrieg in Syrien aus, und alles wurde noch viel schlimmer: Mit unfassbarer Brutalität bekämpfte das Regime jeden Gegner, die Zahl der ums Leben bekommenen Menschen durchbrach irgendwann die für unmöglich gehaltene Grenze von 100000. Als die Gotteskrieger von al-Nusra und anderen Terrororganisationen aus aller Herren Länder in Syrien auftauchten, verübten sie grässliche Massaker an Armeeangehörigen und Andersgläubigen, sie zerstörten schiitische Moscheen und christliche Klöster – wie in Maalula. Massaker geschahen nun auf beiden Seiten, noch einmal hatte die Lage sich zugespitzt. Aber damit noch immer nicht genug: Das plötzliche Auftauchen der Terrororganisation, die sich damals noch ISIS nannte, Islamischer Staat im Irak und in Syrien, im Sommer 2014 hatte eine nochmalige Steigerung von Unmenschlichkeit zur Folge. Die al-Qaida-nahe Siegesfront al-Nusra – lange Zeit für das denkbar Schlimmste gehalten – entpuppte sich als vergleichsweise berechenbare Vorstufe der Mordkommandos des Islamischen Staates, wie er sich nach der Gründung des Kalifats im Irak und in Syrien nannte. Massenerschießungen von Soldaten und Zivilisten, Verstümmelungen von Frauen, Enthauptungen von Journalisten und Hilfskräften – nach menschlichem Ermessen ist damit die unterste Stufe der Zivilisation erreicht.
Geradezu bedrohlich nahe kommen wir den Terrormilizen auf einer weiteren Drehreise Ende November 2014 in den Irak. Nach einem Jahr hat das irakische Militär unseren Antrag auf Begleitung der Soldaten in ihrem Antiterrorkampf genehmigt, wir werden in einer Militärmaschine aus Bagdad in die Unruheprovinz Anbar an der Grenze zu Syrien gebracht, die die Milizen weitgehend unter ihrer Kontrolle haben. Die Piloten fliegen ihre Maschine in großer Höhe, denn jenseits des Euphrat, der sich unter uns in ausladenden Seen sammelt, beginnt die Todeszone der Islamisten.
Zum ersten Mal sehe ich die Geländewagen des Islamischen Staates in dem Dörfchen Dulab an den Gestaden des Euphrat, das die Extremisten für zwei Monate erobert hatten, bis die Armee Ende Oktober eine Gegenoffensive startete und einige Dutzend Orte zurückeroberte. Es sind aktuelle Modelle, von den Pick-ups ist jedoch nicht mehr viel übrig, Raketen der Armee haben sie zerfetzt. Die Halterungen für die schweren Maschinengewehre auf der Ladefläche sind kaum noch zu erkennen, halbverbrannte Notizen bedecken die Sitze. Wir begehen das ehemalige Hauptquartier der Extremisten in einem Wohnhaus: Farbige Gebetsketten, schlichte weiße Kopfbedeckungen, auf einem Tischchen liegt ein rot eingebundener Koran und auf der Sitzbank unter dem Fenster eine Tüte Pflaster und Medikamentenschachteln. Banale Zeugnisse eines vermeintlich Heiligen Krieges. Einer der Terroristen scheint demnach unter einem Glaukom zu leiden. Daneben: eine große, grüne Plastikküchenwaage. Damit, sagt mir der lokale Kommandant, sei TNT abgewogen worden für die Minen und Sprengfallen, mit denen der IS die Gegend unsicher macht. Scharfe, runde Metallplättchen liegen auf dem Kühlschrank, die in Ladungen gemischt werden, um die tödliche Wirkung zu potenzieren.
Nur eine Familie ist zurückgekehrt nach Dulab, die anderen scheinen der Kampfkraft der Armee nicht zu trauen – trotz ihrer gerade stolz verkündeten, unbestreitbaren Erfolge. Sollten die Islamisten wiederkommen, so befürchten die Anwohner, könnte sie der Hass der Gotteskrieger mit voller Wucht treffen. Die Familie, die trotz Bedenken dennoch gerade wieder hier lebt, tut es aus finanziellen Nöten. Überall unter den hohen Palmen stehen PVC-Säcke in Reihen nebeneinander. Es ist Erntezeit für die süßen braunen Datteln, die im ganzen Irak geschätzt werden. Würde der Bauer, der in abgetragener Kleidung zusammen mit seinen Kindern unermüdlich arbeitet, jetzt nicht den Ertrag eines Jahres einsammeln, wäre seine Familie völlig verarmt.
Bei dieser Gelegenheit kann ich endlich einige Fragen loswerden, die mir schon seit dem Sommer nicht mehr aus dem Kopf gehen: Warum schafft es die US-geführte Antiterrorallianz nicht, mit dem Problem IS fertig zu werden? Warum gelingt es den 60 angeschlossenen Staaten nicht, den Gotteskriegern Herr zu werden, mit ihren Drohnen und Kampfflugzeugen, indirekt unterstützt vom syrischen und direkt vom irakischen Militär, von Hunderttausenden der schiitischen Freiwilligenmilizen und den kampferprobten Peschmerga? Wenn man einmal von 50000 Kämpfern des IS ausgeht, dann sind es im Irak höchstens 25000 bis 30000. Warum schlägt die Armee mit ihren weit mehr als 200000 Soldaten die Extremisten nicht einfach in die Flucht? Und warum nahm sie Reißaus, als der IS im Sommer eine Offensive von Mosul bis vor die Tore von Bagdad startete?
Ich stelle sie dem Kommandeur der lokalen Armeeeinheiten in Dulab und Umgebung. Schaaban Bersan ist ein zupackender Vertreter des irakischen Militärs, er trägt einen dichten schwarzen Schnurrbart, seine Augen lodern vor innerer Energie, seine laute, tiefe Stimme zeugt von natürlicher Autorität. Von seinen Soldaten wird er – nicht zuletzt wegen seines Etappensieges gegen die Gotteskrieger vor einer Woche – als Held verehrt. Und dennoch kommen seine Antworten eher wie Ausreden daher, er schiebt die Schuld für den insgesamt schmachvollen Rückzug der irakischen Armee den dafür verantwortlichen Truppen nördlich der Hauptstadt zu.
»Die Terroristen haben viel bessere Waffen als wir«, sagt er entschuldigend, »und die Grenze zu Syrien ist offen, sodass ihr Nachschub gesichert ist und sie sich zurückziehen können.« Und dann hebt er an zu einer dieser Forderungen, die die eigene Verantwortung abschwächen sollen: »Die Amerikaner sollen mit ihren Flugzeugen die Grenze sichern, dann können wir den Irak befreien!«
In der Nacht können wir beobachten, wie gut die Versorgung der Militärbasis funktioniert. Ein Lkw-Konvoi kommt durch ein Lagertor, 340 Tonnen Lebensmittel und Treibstoff für die Armee.
Von einem solch üppigen Nachschub kann Scheich Naim al-Gaoud, das Oberhaupt des Stammes der Albu Nimr, nur träumen. Wir treffen ihn in der letzten Nacht vor unserer Abreise, als wir schon kurz davor sind, unsere Dreharbeiten für unseren Weltspiegel am 3. Dezember 2014 frustriert abzubrechen. Vier Tage hat man uns untätig in Bagdad warten lassen, auch am fünften Tag, an dem wir in die Militärbasis geflogen sind, war aus bürokratischen Gründen und fehlender interner Kommunikation jede filmische Tätigkeit unmöglich. Ein zugesagtes Interview mit dem Verteidigungsminister wurde für unmöglich erklärt, genauso wie ein Helikopterflug zur Front. Selbst der Ausflug nach Dulab – obwohl nicht uninteressant – konnte unsere Interessen als Reporter nicht zufriedenstellen.
Und dann diese Begegnung, die unsere Perspektive verändert: Scheich Naim sitzt im Empfangszimmer jenes spartanischen Wohnhauses, in dem das Militär ihn, seine Assistenten und uns als Gäste untergebracht hat. Vier Telefone klingeln ununterbrochen, seine Helfer fädeln die Anrufer in die Warteschlange ein, manchmal harren sie stundenlang am anderen Ende der Leitung aus. Völlig übermüdet ist Scheich Naim al-Gaoud, Abgeordneter im irakischen Parlament. Dunkle Ringe rahmen seine halbgeschlossenen Augen, er trinkt starken türkischen Kaffee und raucht ohne Unterlass. Monatelang hat Scheich Naim in der Hauptstadt um Unterstützung für seine Albu Nimr geworben, gebeten und gefleht, doch sie wird bis zum heutigen Tage aus fadenscheinigen Gründen verweigert. Weder einen Sack Reis noch eine einzige Patrone haben die Stammeskämpfer bislang erhalten, und doch sind sie es, die sich tägliche Gefechte mit dem Islamischen Staat liefern. Wie eine Erlösung aus der Untätigkeit ist es, als Scheich Naim uns gegen Mitternacht verspricht, dass wir ihn morgen früh begleiten können.
Von nun an sind Schutzwesten wieder Pflicht in unserem Team, begleitet von mehreren gepanzerten Militärwagen und etwa zehn Soldaten beginnen wir unsere Reise. Zunächst geht es wie schon am Vortag über die Pontonbrücke über den Euphrat, die die Armee errichtete, nachdem die Islamisten das Original gesprengt hatten. Dann kommen wir durch mehrere Ortschaften, die meisten sind Geisterstädte. Schließlich nehmen wir eine kleine Straße, die uns weg von dem üppigen Grün am Flussufer führt, hinauf in eine verlassene Bergregion. Wir müssen uns festhalten, um nicht gegen die stählernen Türen oder das Dach geschleudert zu werden. Mehrere der Schlaglöcher, erklärt uns Fahrer Abu Mohammed, sind entstanden, als die Armee vor einer Woche die Strecke von über 300 Sprengkörpern geräumt hat. Diese Minen – von denen wir in einem stark gesicherten Bunker in der Militärbasis mehrere Tonnen gesehen haben – waren von den Islamisten vergraben worden, um einen Vorstoß der Armee zu verzögern oder zu verhindern.
Neben der mittlerweile mühsam geräumten Straße steht eine Gruppe von Kühen in der Felswüste, offenbar kurz vor dem Verdursten. »Der Besitzer«, sagt der Fahrer, »ist geflüchtet. Wie die meisten hier.«
Wir erreichen Machbubie, ein kleines Dorf mit einem zentralen, von Häusern umgebenen Platz. Dort haben sich die lokalen Albu Nimr versammelt, ihre Kleidung hängt in Fetzen an ihrem Leib, fast alle sind abgemagert. Kaum noch Nahrung haben sie übrig, in ihrem Abwehrkampf gegen die Islamisten stehen sie auf verlorenem Posten. Man erzählt uns von ungezählten Familien, die vor den IS