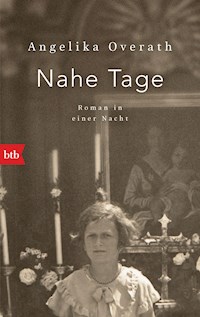6,99 €
6,99 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Wie lebt es sich an einem Sehnsuchtsort?
Ferienorte sind flüchtige Heimat. Oft verbinden sie sich mit dem Wunsch für immer bleiben zu können. Und doch reisen wir ab. In der Regel. Die Reporterin und Romanautorin Angelika Overath hat sich, zusammen mit ihrem Mann und dem jüngsten Sohn aufgemacht, aus einem Traum Realität werden zu lassen. Die Familie ist nach Sent ins Unterengadin gezogen. Ihr Buch erzählt, wie sich Wahrnehmungen und Lebensweise ändern, wenn das Feriendorf in den Bergen zum festen Wohnort wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 273
Veröffentlichungsjahr: 2011
4,9 (18 Bewertungen)
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Titel
Widmung
1. September
2. September
3. September
13. September
14. September
17. September
20. September
Copyright
für Esther Krättli
1. September
Scuol-Tarasp, Endstation der Rhätischen Bahn. Ich nehme meinen Rucksack. Vom Zug sind es wenige Schritte über den Bahnhofsplatz zur Haltestelle des Postautos nach Sent. Drüben auf der Südseite des Tals ziehen die weißen Gipfel der Unterengadiner Dolomiten über ein metallenes Schild aus Nachmittagsblau. Hinter dieser Bergkette beginnt schon Italien. Ich gehe durch Gruppen von sonnenmüden Touristen mit Teleskopstöcken, sportlich gefederten Kinderwagen, Rollkoffern. Radfahrer haben ihre Helme an die Lenker gehängt und halten die Gesichter in die Sonne. Es ist warm und riecht nach Schnee. Hier möchte ich Ferien machen, denke ich. Und dann erschrecke ich für einen Moment. Denn das ist vorbei.
Allegra, grüßt der Fahrer und knipst die Streifenkarte ab. Das Postauto fährt durch Scuol. Am Ende des Dorfs, auf der Anhöhe des Hospitals, biegt es rechts in eine Bergstraße ein und schraubt sich langsam einen Steilhang hinauf. Von weitem ist Sent zu sehen, kehrenweise: mit dem spitzen Kirchturm auf einem Terrassenvorsprung in den Wiesen, hoch oben über dem Inn. Das Postauto erreicht das Gemeindegebiet des Dorfes und die Straße wird zur schattigen Allee. Ich war auf einer Reise, denke ich, und jetzt fahre ich -
Warum zögere ich vor dem Wort »nach Hause«? Ich fahre dahin, wo mein Bett steht, mein Tisch, wo mein Mann liest und schreibt, wo unser jüngster Sohn zur Schule geht.
Seit gut zwei Jahren leben wir in diesem Bergdorf, das wir nur aus den Ferien kannten. Mittlerweile ist unser Alltag flächig geworden; es gibt nicht mehr die Spitzen des Überraschens. Und doch: vom Rheintal kommend beim Umsteigen in Landquart sofort die andere Luft, voll Heu, Schnee, die körperhafte Gewißheit, nun könne einem nichts mehr geschehen. Eine gute Stunde später, wenn die Rhätische Bahn durch die Felsenpforte ins Prättigau hineingefahren, oberhalb von Klosters im gedärmhaften Dunkel des Vereinatunnels verschwunden ist und bei Sagliains wieder ins Licht stößt: Herzklopfen. Immer noch.
2. September
Es sind zuerst die Augen. Die opaken, grünblauen, nach oben gekehrten Augen einer Gemse. Dahinter im Dunkel des offenen Kofferraums eine zweite Gemse. In den schmalen Mund hat ihnen der Jäger Edelweiß gesteckt. Die Tiere liegen in einer blumenhaften Drehung da, die ihnen nur bei leblosen Beinen gegeben werden konnte. Das feste Fell ist struppig; eckige Anmut. Am Bauch zeigen die Gemsen einen roten Schnitt. An den Kehlen auch.
Die Metzger des Dorfs haben mit Kreide auf ihren Straßentafeln frisches Wild angeschrieben.
3. September
Über Nacht ist der Wald hinter dem Dorf weiß, auch auf den Wiesen unterhalb des Waldrands liegt Schnee. Gegen Mittag werden die Hänge wieder abgetaut sein. Doch bald beginnt die weiße Zeit.
Mein Gemüsegarten über der Straße sieht aus wie ein Dschungel. Reisen rächt sich. Ich schäme mich, denn in Helens Garten nebenan stehen die Salatköpfe grün und unkrautfrei auf frisch geharkter schwarzer Erde. Ihre Akeleien blühen duftig, hoch ragt ihr Rittersporn. Noch ihr Schnittlauch hält sich gerade, während meiner überlang sich unter rosa Blütenkugeln biegt.
Auf meiner Seite: wuchernde Minze, monströser Mangold, überall und ausufernd Ringelblumen, die Wicken überwachsen den hohen Salbeistrauch, der blau blüht; die Reihen von Koriander sind ins Kraut geschossen. Nur die Reben ranken so, als gehörten sie hierher. Ich habe Americano-Trauben aus dem Tessin gesetzt, eine robuste Sorte. Jetzt bilden sich Früchte, manche noch grün, aber andere schon groß und dunkelblau wie dicke Heidelbeeren. Ich koste eine, und sie ist süß. Ich glaube, meine Rebstöcke sind die einzigen von Sent. Und bin ein bißchen stolz, daß sie in meinem Garten auf einer Höhe von 1450 Metern tatsächlich reifende Trauben tragen.
Engadin: Garten des Inn. Der Inn entspringt im Oberengadin oberhalb von Maloja nahe dem Lunghin-Paß und stürzt über Passau, wo er sich mit der Donau verbindet, ins Schwarze Meer. Er ist der Geschwisterfluß der Julia, die über den Rhein in die Nordsee fließt, und der Maira, die mit dem Po zur Adria strömt. Auf dem Dach des Engadins liegt Europas wichtigste Wasserscheide. Ich habe das Engadin immer als europäisch empfunden. Schwarzes Meer. Nordsee. Adria. Wo, wenn nicht hier, grenzte wie Böhmen die Schweiz ans Meer!
Du bist wieder da! sagt Helen. Sie bringt ein Sieb mit Grünabfällen für den Kompost, den wir uns teilen. Ihr linkes Auge ist noch verklebt. Seit ihrem Unfall entzündet es sich leicht, weil sich das Lid noch nicht selbstverständlich schließt. Sie steht da, aufrecht, und lächelt. Sie hat etwas von der Anmut eines Waldtieres, denke ich, etwas Scheues, Wildes.
Wir sind zusammen Fahrrad gefahren, letzten Sommer. Helen auf dem Mountainbike immer voraus.
Sie fährt noch da, wo ich kaum gehe. Von Sent aus ins Seitental Val Sinestra hinein, hoch auf eine Alp, dann steil hinunter und hinüber über eine Hängebrücke, eine Hand am Geländer, die andere das Velo tragend. Sie klettert mit dem Rad über Felsen und fährt schmale Wurzelwege, am Abgrund entlang. Unten ein zischender Gebirgsbach. Ich schiebe. Sie wartet. Sie zeigt mir Pilzplätze und weiß, wo wilder Spinat wächst.
Im Februar schneite es stark. Helen fuhr mit dem Auto von Sent hinunter nach Scuol. Die Strecke am Steilhang hatte keine Leitplanken. Das Auto ist gegen einen Baum der Allee geknallt und hat sich den Hang hinunter überschlagen. Ein aus Scuol kommender Busfahrer hat das auf dem Dach liegende Auto in der Schneewiese gesehen und den Notarzt angerufen. Der Notarzt hat die Bewußtlose ins Spital nach Scuol gebracht. Dort hat man sofort einen Rettungshubschrauber gerufen, der sie ins Krankenhaus nach Chur brachte. Es war viele Tage nicht sicher, ob Helen überleben würde.
Ja, endlich, sage ich. Sie lacht. Sie hat ihre Locken mit einem Band im Nacken zusammengebunden. Wann gehen wir Radfahren? frage ich. Ich fahre schon, sagt sie, zur Arbeit hinunter nach Scuol und wieder hinauf.
Helen ist Sozialarbeiterin, wie ihr Mann Werner, der in Scuol die Buttega leitet, eine geschützte Wohn- und Arbeitsstätte für Menschen mit einer Behinderung.
Schau, sage ich, alles ist verwildert. Es geht noch, sagt Helen, und ich habe so schon von deinem Mangold geerntet.
Hier wohnen heißt, hier etwas wachsen lassen können.
Hinter unserem Haus haben wir noch ein winziges Stück Wiese, da, wo früher der Heustall gegen Süden unmittelbar an das alte Hotel Rezia anschloß. Jetzt steht hier ein junger Kirschbaum. An der Bruchsteinmauer gegen Westen, die beim Abriß des Stalls stehenblieb, blüht ein Rosenstock. Johannisbeerbüsche tragen rote, gelbe, schwarze Früchte. Dazwischen Minze.
Immer wieder die Bemerkung: Das war aber mutig von euch. Das war doch eine Entscheidung! Und dann seid ihr da wirklich hingezogen? In ein Dorf in den Bergen?
Wir sind nach Sent gezogen, sage ich manchmal. (Und denke: Wir sind nicht in ein Dorf auf der Schwäbischen Alb gezogen. Und nach Zürich auch nicht. Und ist es nicht auch mutig, einfach weiterzuleben, wie man lebt?)
13. September
Mit dem Hund gehe ich die obere Dorfgasse Richtung Osten in die Wiesen hinaus. An der Weggabelung nehmen wir die mittlere Straße, die ins Val Sinestra führt. Nach wenigen Metern biegt rechts ein schmaler Feldweg ab. Hier beginnen die alten steilen Ackerterrassen, die heute fast alle Wiesen sind. Es gibt noch das eine oder andere Roggenfeld, Gerstenfeld. Nun sind sie abgemähte, helle Streifen. Unter mir liegt der kleine Friedhof. Etwa 300 Meter tiefer fließt der Inn. Je nach Windrichtung kann man sein Rauschen hören. Der Hund ist vorausgesprungen. Sein rotes Fell blitzt durch das Grün. Ich habe eine Robydog-Tüte für Hundekot an die Leine geknotet und beobachte ihn.
Ungefähr hier ist die Entscheidung gefallen.
Es war ein warmer Septemberabend im Jahr 2005. Der Hund sprang voraus. Der Umbau unserer Senter Ferienwohnung in dem alten Bauernhaus war so gut wie abgeschlossen. Manfred, mein Mann, und ich gingen nebeneinander, dem Verlauf des Tals gegen Osten nach, vor uns die gleißenden Schneegipfel des S-chalambert, von Österreich her ein milchiger Glanz, im Süden noch das blaue Licht aus Italien.
Ich sagte: Wir könnten auch hierher ziehen.
Manfred schwieg.
Nur kurz. Dann sagte er: Ja, das können wir machen. Nun schwieg ich. Er hatte das Verb im Indikativ benutzt. Im fehlenden Zungenschlag für ein »t« lag unsere Zukunft im Unterengadin.
Von nun an besprachen wir nur noch den Zeitpunkt des Umzugs. Silvia, unsere Tochter, studierte schon in Hildesheim. Unser Sohn Andreas stand vor dem Abitur. Unser kleiner Sohn Matthias würde im kommenden März sechs Jahre alt werden und sollte im Sommer in die Schule kommen. Würden wir sofort umziehen, wäre Andreas während des Abiturjahrs allein in Tübingen. Das wollten wir nicht. Wir entschieden uns, Matthias in Tübingen einzuschulen.
Ende Juli 2007 würden wir umziehen. Matthias sollte dann in die zweite Klasse der rätoromanischen Grundschule in Sent kommen.
14. September
Ich zupfe die vertrockneten Nelken in den Blumenkästen. Immer noch hängen tiefrote Blüten kopfüber vor dem Weiß der Fassade. Es ist eine alte Sorte: Engadiner Hängenelken. Sie blühen überall im Dorf. Ihre Silhouette erscheint in den Vorhängen der Bauernhäuser, auf Stickereien in den Stuben. Zwei, drei Wochen werden wir die Kästen noch draußen lassen können. Wann kommt der Schnee? Unsere Nelken stehen auf den Fensterbänken der Nordseite, zur Straße hin. Zwei der Kästen auf unserer Hausseite, drei weitere auf der breiteren Seite der Ferienwohnung.
Am Anfang sollte es nur eine Ferienwohnung sein.
Je nach Geduld unserer Zuhörer erzählen Manfred und ich die Geschichte in immer neuen Varianten. Wenn wir nicht in Sent wohnten, würden wir keine dieser Erzählungen glauben.
Es war im Herbst 1991/92. Eine ehemalige Studienkollegin hatte im Autoradio von Scuol gehört, einem Ort im Unterengadin, der noch nicht so touristisch und teuer sei. Sie schlug ein Freundestreffen in den Winterferien vor. Aus Tübingen, Heidelberg, Paris kamen wir in Scuol im Hotel Quellenhof zusammen, das mit seinem riesigen Speisesaal und den großen, nicht modernisierten Zimmern (ausladende Badewannen, Messingarmaturen, hohe Spiegel) noch etwas vom Glanz des Kurlebens der Jahrhundertwende hatte. Der Koch war Italiener, über weiße eingedeckte Tafeln zogen sich silberne Platten mit verschiedenfarbigen Nudeln. Das Scuoler Skigebiet Motta Naluns war nicht besonders groß, aber es war schön und es gab Pisten aller Schwierigkeitsgrade. Ich erinnere mich an einen Tellerlift, der um die Ecke fuhr und mehr sportliches Können und Gleichgewichtssinn erforderte als jede Abfahrt. Eine 13 Kilometer lange Piste führte von der Gipfelstation Salaniva hinunter in das Dorf Sent. Dort saßen wir dann an der Haltestelle Sent-Sala und warteten auf den Postbus nach Scuol. Und Manfred sah zu den dicken Häusern mit den Sgraffitofassaden und sagte: Wenn wir einmal Geld haben, kaufen wir hier eine Ferienwohnung.
Wenige Monate zuvor waren wir aus Griechenland zurückgekommen. Manfred hatte an der Universität Thessaloniki Deutsche Literatur unterrichtet. Ich war begleitende Ehefrau und Reporterin gewesen. Mir fehlte Griechenland und ich hätte mir auch eine Ferienwohnung auf der Peloponnes, in der Mani, vorstellen können. Aber Manfred sagte, da müßte man immer fliegen, und er kam mit der Hitze nicht besonders gut zurecht. Aber das Meer, sagte ich. Und sah über die Dächer ins Engadinblau.
Nach diesem ersten Winter kamen wir fast jede Ferien zurück. Im Sommer meist nach Guarda, das westlich von Scuol gelegene Terrassendorf auf 1650 Metern, Schauplatz des Bündner Kinderbuchs »Schellenursli«. Wir wanderten ins Tuoi-Tal hinein, sammelten Pilze, Silvia lernte Ziegen melken. Andreas schloß sich der Fußballjugend von Guarda an. Im Winter kamen wir zum Skifahren nach Scuol, Ftan oder Sent.
Die Jahrtausendwende verbrachten wir im Hotel Rezia in Sent. Ich war schwanger mit Matthias. Manfreds Mutter und meine Mutter waren schon tot; unsere alten Väter aber lernten den Kleinen noch kennen. Als sie innerhalb eines Jahres starben, erbten wir so viel, daß die Idee einer kleinen Ferienwohnung realistisch wurde. Wir nahmen Kontakt auf zu einem Immobilienhändler in Scuol. Es gab einige Bauprojekte, denen wir uns anschließen wollten, die aber nicht zustande kamen. Es schien, daß sich damals niemand außer uns für eine Ferienwohnung in Sent interessierte.
Im Sommer 2002 wurden wir in Scuol an einer der Reklamefensterscheiben des Einkaufszentrums Augustin auf ein kopiertes Din-A4-Blatt aufmerksam. Über die Photographie eines alten Bauernhauses war der Entwurf für zwei Wohnungen skizziert, eine große und eine kleinere. Hier war offensichtlich eine Überbauung geplant. Wir riefen bei der angegebenen Telephonnummer an und sagten, wir würden uns für die kleinere der beiden Wohnungen interessieren. Mengia war am Apparat, die älteste von vier Geschwistern. Ihre Stimme war dunkel und freundlich. Das Bauernhaus war ihr Elternhaus, ein altes Bäckerhaus. Es stehe leer. Die Erbengemeinschaft der Geschwister wolle es verkaufen. Mengia sagte, Mina, die jüngste Schwester, würde uns das Haus zeigen.
Wir verabredeten uns auf den nächsten Tag. Ein weißes Auto hielt vor dem Center Augustin. Mina, braungebrannt mit schwarzen, kurzen Haaren, stieg aus und gab uns die Hand. Steigt ein, sagte sie und dann fuhr sie uns, als ließe sie sich von den Kurven beschleunigen, nach Sent hinauf.
Wir hielten in der Dorfmitte hinter dem Hotel Rezia. Das Haus war häßlich. Rauher, auberginefarbener Putz, blaue, abbröckelnde Fensterläden. Wie ein Balkon hing schief ein selbstgebauter Hasenstall auf mittlerer Höhe. »Furnaria«, das romanische Wort für Bäckerei, stand blaß über einer kleinen Holztür. Wir gingen um das Haus herum. Mina öffnete das Eingangsportal. Wir betraten ein Gewirr von Treppen und Kammern auf mehreren Stockwerken. Mir war schwindelig. Wir folgten Mina hinauf und hinüber. Mina öffnete eine Tür und vor uns lag ein riesiger, leerer Heustall, durch die Ritzen flimmerte das Sonnenlicht. Die Holzböden gaben nach. Offensichtlich war darunter ein Viehstall. Wir gingen zurück, eine Treppe hinauf. Wir kamen in eine Stube, deren Wände außen aus übereinandergelegten rohen, runden Holzbalken bestanden, wie eine Skihütte. Innen war sie mit Brettern verkleidet und mit Ölfarbe in Türkis gestrichen. Unten dann eine kleine Küche mit gewölbter Decke und einer Stange, an der einmal Fleisch geräuchert worden war, daneben eine einfache Arvenstube mit einem gemauerten Ofen. Mina öffnete die Tür in der Gitterholzverschalung, und wir sahen, daß der Ofen begehbar war. Engadiner Tritt, sagte sie und zeigte auf drei kleine Stufen, die hinaufführten. Sie öffnete eine Klappe, durch die man nun nach oben in die türkisfarbene Skihütte hineinsah. Die Skihütte, verstanden wir, war die ehemalige Schlafkammer, die über den Ofen in der Arvenstube geheizt wurde. Beide Räume waren ursprünglich nur über die Holzstufen und die Klappe miteinander verbunden. Wir gingen wieder hinunter und weitere Treppen tiefer. Zwischen altem Gerümpel sah man die gußeisernen Türen einer wandgroßen, verkachelten Ofenanlage mit dem metallenen Schriftzug »Amicus«. Hier wurde einmal Brot für das Dorf gebacken.
Ich weiß nicht mehr, ob es hier war oder beim Blick in den Heustall oder in der Arvenstube, jedenfalls wußten wir, daß diese fremden Räume etwas mit uns zu tun hatten.
Es gibt außer euch keine Interessenten, sagte Mina. Schade, sagten wir. Sehr schade. Nehmt das Haus ganz, sagte Mina. So viel Geld haben wir nicht, sagten wir. Da sagte Mina: Doch.
Mina war befreundet mit einem Architekten, der auch die Überbauungszeichnung auf dem kopierten Zettel gemacht hatte. Wir trafen Jachen in seinem Büro in Scuol. Er trug eine alte Strickjacke. Seine Haare waren wirr. Er lachte uns an. Wir sagten, wie viel Geld wir hatten. Er sagte, vergeßt die zweite Haushälfte. Wir nickten.
Das Haus war ein gassenbildendes traditionelles Engadiner Bauernhaus, die unregelmäßige Fensteranordnung wies auf einen Bau aus dem 17. Jahrhundert hin, der später aufgestockt worden war. Hier hatten Menschen und Vieh unter einem Dach gelebt. Das Haus verband Schlaf- und Wohnräume (gegen Norden) mit unterirdischen Tierställen und, darüber, einem riesigen Heuspeicher (gegen Süden, damit das Heu besser trocknete). Durch eine große Bogentür fuhr der Heuwagen in den hohen Hausflur, den Piertan, direkt bis in den Stall. Traditionell öffneten sich vom Piertan aus die Arvenstube mit dem Ofen, die Küche und die Vorratskammer. Da in unserem Haus aber noch eine Backstube Platz gefunden hatte, lagen diese Wohnräume eine halbe Treppe höher. Der Plan entstand, eine Wohnung, und zwar in diesem älteren östlichen Hausteil (Arvenstube, Küche, türkisene Schlafstube, Dachstuhl) für uns als Ferienwohnung umzubauen. Der westliche, kleinere Hausteil würde unberührt bleiben. Die Grundregel sollte sein: alles lassen, was man lassen kann. Nur dort erneuern, wo es notwendig war. Von den soliden Materialien die einfachsten nehmen: Holz und Glas. Wir sind freie Autoren, sagte ich. Es darf nicht mehr kosten, als wir haben. Der Architekt nickte.
Wir waren freie Autoren. Wir hatten drei Kinder. Manfred war frisch habilitiert und hatte in Tübingen eine Professur vertreten, die aus Spargründen nicht weiter vertreten werden durfte; ich schrieb Reportagen, Rezensionen, Radiosendungen, ohne feste Anstellung.
Es gab noch ein juristisches Problem. Wir waren Ausländer und konnten in der Schweiz kein ganzes Haus kaufen. Ich kenne einen Rechtsanwalt in Zuoz, sagte Mina und strahlte uns an. Die Sache sollte zu klären sein, vielleicht über einen Pachtvertrag.
Der Winter kam, und wir fuhren in den Ferien wieder nach Scuol. Wir stellten Matthias mit knapp drei Jahren auf Skier. Genaugenommen nahmen Silvia und ich ihn abwechselnd zwischen die Beine. Er jauchzte, je schneller wir fuhren; wir massierten hinterher unser Kreuz. Wie viele Male seit dem Freundestreffen in Scuol begleitete uns unsere alte Freundin Ute. Sie ist die katholische Patentante unserer nicht getauften Söhne. In Stuttgart leitet sie das Stefan George Archiv. An einem der ersten Tage, es war sonnig, der Himmel blau, zog sich Ute, die nicht Ski fährt (»Man soll keine Leibesübungen machen, wo Gottes eisiger Odem weht«), ihre Baskenmütze auf und wanderte durch die verschneite Landschaft hinauf nach Sent. Als sie zurückkam - wir saßen gerade beim Vesper in der Küche einer Ferienwohnung, an deren Wänden dicht an dicht 37 hornige Geweihe, Jagdtrophäen hingen, die wir mit Strohsternen geschmückt hatten -, starrte sie uns an, als käme sie aus einer anderen Welt. Ihr Gesicht war aschfahl. Sie hatte das Haus gesehen.
Seid ihr sicher, fragte sie tonlos. Seid ihr sicher, daß ihr das machen wollt? Ute war Erbin ihres Elternhauses, sie wußte, was es bedeutet, ein altes Haus zu übernehmen. Außerdem kannte sie uns. Wir sind handwerklich nicht begabt, um es vorsichtig zu sagen.
Wir kauften das Haus mit einem Nicken, einem Ja. Das Wort galt. Als im Sommer 2003 mit den Umbauarbeiten begonnen wurde, gehörte das Haus rechtlich noch nicht uns. Jachen und sein junger, ernster Kollege Rico hatten die Bauleitung übernommen. Sie erteilten den einheimischen Handwerkern die Aufträge. Wir vertrauten. Ab und an fuhren wir von Tübingen für ein paar Stunden nach Sent, um zu sehen, welche Fortschritte der Umbau machte. Im Auto hörten wir Vivaldi, Vier Jahreszeiten; Matthias liebte den Winter.
Manchmal schickte Rico Photos per Mail. Alles ging unwahrscheinlich gut.
Wir haben Welpenschutz, sagte ich zu Manfred. Wir hatten jetzt auch einen Hund, und ich hatte neue Wörter gelernt.
Einmal sagte Jachen, wir bauen in Scuol ein Haus für einen Manager um. Das, was dessen Küche kostet, kostet euer ganzer Umbau. Ich wußte, er übertrieb. Aber nur knapp.
17. September
Die Schwalben stürzen. Wie lange noch? Bald kommen die Bergdohlen. Im Sommer leben sie in großen Höhen; im Winter kehren sie in die Dörfer zurück.
13.20 Uhr. Die Mittagsschulglocke läutet. Ich sehe das metallene Schwingen im offenen Glockenturm. Matthias ist schon unterwegs zum Nachmittagsunterricht.
Es gab eine Wette zwischen Manfred und mir. Manfred sagte, nach dem Abriß des Stalls sieht man den Kirchturm. Ich sagte, das ist unmöglich, das Haus liegt zu tief. Und dann standen wir einmal vor der abgebrochenen Stallwand, an der nun eine Fensterfront entstehen sollte. Die Maueröffnung war mit Planen abgehängt. Ein Windstoß löste eine Folie, sie wehte kurz auf, und für eine Sekunde zeigte sich wie ein Wink die neugotische Nadelspitze der Senter Kirche.
Mitte September 2003 fuhren wir in Minas offenem Cabriolet nach Zuoz. Da das alte Bauernhaus im Dorfzentrum drei Jahre leer gestanden und sich kein Schweizer Käufer gefunden hatte, durften wir es als Ausländer kaufen. Mina und Manfred unterschrieben den Vertrag. Als Ehefrau mußte ich meinen Beruf angeben. Ich war nicht darauf gefaßt gewesen und dachte, so ein unwahrscheinliches Haus hat einen unwahrscheinlichen Beruf verdient. Dann sagte ich zum ersten Mal: Schriftstellerin.
An Manfreds Geburtstag im Dezember, die Skisaison hatte gerade begonnen, feierten wir die Einweihung unserer Ferienwohnung.
Bereits im Januar 2004 vermieteten wir die Räume an Feriengäste. Anders war das Projekt nicht zu finanzieren.
Wir lernten, daß sich für die Wohnung sehr leicht Mieter fanden. Wir dachten an die zweite Haushälfte. Wir sprachen mit den Architekten. Wir nahmen eine Hypothek auf und ließen nun auch die andere Haushälfte umbauen. Es ging sehr schnell. Die Schreiner waren großartig. Im Herbst 2005 war nun auch der westliche Hausteil renoviert. Die Bäckerei hatte einen Holzboden und, wie auch der große Flur, einen weißen Wandanstrich bekommen. Wir standen in den hellen Räumen. Wir rochen das Arvenholz. Und dann gingen Manfred und ich mit dem Hund in die Wiesen hinaus und Manfred sagte: Ja, das können wir machen.
Wir wollten Dorfbewohner werden; aber was sagte das Dorf dazu? Wir fragten Mina und Mengia. Sollen wir nach Sent ziehen? Die beiden sahen uns skeptisch an.
Aber ihr behaltet eine Wohnung in Tübingen?
Nein, sagten wir, wenn wir kommen, kommen wir ganz. Und Matthias geht dann hier in die Schule.
Und die Kultur? fragten sie.
Unsere Bücher bringen wir mit, sagte ich. Der heuwagenhohe Hausflur würde die Bibliothek werden.
Und eure Freunde?
Unsere Freunde kamen auch nach Griechenland. Das war weiter weg als das Engadin.
Am Abend sehe ich ein großes, aufgeschlitztes Reh kopfüber vom Dach eines Schuppens hängen. Das Dorf ist jetzt leerer und aufgeladener zugleich. Ich war noch nie beim Jagen dabei, kenne das Leben auf den Jagdhütten nicht. Tierzeit, in der andere Gesetze gelten. Engadiner Jagd, das war für uns zunächst der Bildschirmschoner unseres Architekten Rico, auf dem ein 14-Ender erhaben über uns hinwegsah. Und dann begriffen wir, daß man während der Tage der Jagd, egal für welchen Auftrag, keinen Handwerker bekommt. Einmal möchte ich mitgehen; bislang habe ich im letzten Augenblick immer abgesagt. Ich will nicht sehen, wie ein Tier erschossen wird. Aber ich esse gerne Hirsch und Gemse und Reh. Sichere Widersprüche.
Bis Dezember kann man bei den zwei Senter Metzgern frisches Wild kaufen, über das Jahr gibt es Trockenfleisch. In Sent gehen auch Frauen zur Jagd. Vielleicht frage ich einmal eine Jägerin, ob sie mich mitnimmt. Aber auch Frauen schießen Tiere tot.
20. September
Matthias und ich fahren mit den Rädern ins Val Sinestra hinein. Helen hat uns eine steile Lichtung gezeigt, auf der es Pilze gibt. Von den Bäumen kommt ein warmer Geruch. Fichten, Föhren, Lärchen. Es braucht eine Weile, bis sich die Augen eingestellt haben. Das Finden des ersten Pilzes dauert am längsten. Die Augen müssen das Pilzesehen erst lernen. Die versteckten matten oder orangehellen Köpfe der Pfifferlinge im Moos, unterm Gras. Die dunklen Hüte der Steinpilze im Schatten eines tiefen Gezweigs. Ihr runder, dicker Stiel. Es gibt auch Preiselbeeren, Heidelbeeren, Himbeeren. Wir verlieren uns, rufen nach einander. Als wir müde sind, haben wir sicher zwei Kilo Pilze gefunden. Wir geben sie in die Fahrradtaschen und fahren heim.
Lesung in Sent, in der Grotta da cultura. Noch vor unserem Umzug hatte sich im Dorf eine Kulturvereinigung gebildet, die in einem kleinen Gewölbekeller des Hotels Rezia einen Veranstaltungsraum mit Bar und Internet eingerichtet hat. Die Gemeinde unterstützt das Projekt, indem sie die Miete bezahlt. In der Grotta da cultura finden regelmäßig Konzerte, Filmabende, Lesungen und Ausstellungen statt, meist mit Bezug zum Dorf. Aber der Bezug zum Dorf kann auch nur darin bestehen, daß sich jemand aus dem Dorf für irgendetwas interessiert. Dann hat er in der Grotta da cultura einen Raum dafür.
© 2010 Luchterhand Literaturverlag, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Satz: Greiner & Reichel, Köln
eISBN 978-3-641-05118-1
www.luchterhand-literaturverlag.de
Leseprobe
www.randomhouse.de