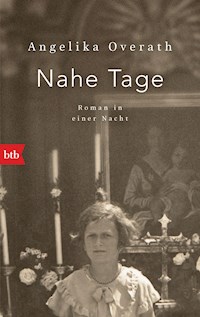Angelika Overath
Flughafenfische
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Autorin dankt dem Deutschen Literaturfonds e.V. für die Unterstützung ihrer Arbeit.
© 2009 Luchterhand Literaturverlag, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
ISBN 978-3-641-02631-8V002
www.luchterhand-literaturverlag.de
www.randomhouse.de
für Barbara Spengler-Axiopoulos
Μ΄αεροπλάνα και βαπόρια
και με τους φίλους τους παλιους
* Me aeroplana kai vaporia/kai me tous filous tous palioús (Mit Flugzeugen und mit Schiffen/und mit den alten Freunden) ist eines der bekanntesten Lieder von Dionysis Sawopoulos. In der schönsten Aufnahme singt er es zusammen mit Sotiria Bellou.
I TOBIAS
Es war einer jener langen, unbedeutenden Nachmittage, und es sollte doch der letzte seiner Art sein. Und auch als es später Nachmittag, wohl Abend geworden war in dieser Halle ohne Zeit, und als die Nacht begann mit all den gleißend weißen und bunten Lichtern draußen vor dem Glas und als der Nebel zu einer Wand gewachsen war und die Rollfelder, die Start- und Landebahnen und die Flugzeuge einfach weggenommen hatte, selbst dann noch, als manche, wider jede Notwendigkeit, schon auf das Morgenlicht warteten (warum sollte die Sonne denn nicht aufgehen über den silbernen Betonbändern und dem tintigen Gras?), da gehörte dies alles immer noch zu jenem langsamen Nachmittag, der damit begonnen hatte, daß Tobias’ Augen auf der Bauchhaut des Rochen lagen.
Er stand vor dem Aquarium.
Der Rochen klebte flach mit ausgebreiteten Seitenflossen am Glas. Seine Unterseite war milchig weiß. Und Tobias spielte gerne mit diesem Blick, bei dem er sich selbst sah (nur ein wenig, nur als Schemen mit blaßdunklen Gesichtszügen) und zugleich denken konnte, er sähe einen andern.
Einen Mann, einen Fremden, der interessanter war als er, einen Reisenden im Staubmantel vielleicht und mit Hut, einen, den er gerne kennenlernen würde.
Manchmal kam er dann einen Schritt näher und starrte in die zwei dunklen Öffnungen über dem Mund des Tieres, die so aussahen, als könne der Rochen mit ihnen sehen.
Ein Gespenst, kreischte es, schau, ein Gespenst!
Er drehte sich weg. (Immer wenn der Rochen so dahing, kreischte bald irgendein Kind.)
Ein Mädchen in rosageringelter Filzweste streckte jetzt seinen Zeigefinger gegen die dicke Scheibe und zog ihn schnell, in erschrockener Lust, wieder zurück. Nun sah es sich um, als suche es nach einem Echo seiner Begeisterung. Der Rochen klebte weiter an der Scheibe. Sein geschwungener schwarzer Mund stand offen wie ein kleines Lächeln. Seine Nasenlöcher gaben ihm ein täuschendes Angesicht. Mit den flachen Flossen bot er sich an wie ein Gekreuzigter.
Tobias sagte nichts.
Das Mädchen wippte vor dem Glas. Es trug einen kurzen, dunkelblauen Faltenrock, der sein Hüpfen optisch verstärkte.
Wie eine beschleunigte Qualle, dachte Tobias.
Ein Rochen, sagte müde ein Mann. Langsam trat er von hinten an das Kind und legte ihm die Hand auf die Schulter, das ist ein Rochen.Von unten gesehen. Schau, das da ist der Mund, und da, die zwei Öffnungen, die Kiemen.
Auch falsch, dachte Tobias, die Kiemen liegen tiefer.
Einst hatten Seefahrer Rochen mitgebracht, auf den Schiffen getrocknete Rochen, die sie an Land als Wasserfrauen verkauften. Nur ein wenig zurechtgeschnitten, da und dort etwas abgebunden, und schon hatten diese Fische weibliche Körper, etwas Engelhaftes auch. Geigenrochen, dachte Tobias, bewiesen die Existenz von Nixen. Jeder konnte sie anfassen. Und mit den Fingerspitzen über die spröden Falten ihrer nun fast gläsernen Haut fahren.
Ein Gespenst, schrie das Kind, mit Gespensteraugen! Schau doch, schau doch mal.
Tobias senkte den Blick. Er kannte diese Szene in ihren täglichen Varianten. Sie gehörte zum Rochen wie seine weiße Bauchmaske, wie seine geöffneten Seitenflossensegel.
Vater und Tochter standen an der Scheibe.
Willst du etwas trinken, fragte der Vater, als müsse er das Kind ablenken.Das Mädchen nickte.Der Vater nahm seinen Rucksack von der Schulter und dirigierte die Tochter zu der Reihe von Plastiksesseln, die in einem geringen Abstand vor dem Aquarium standen. Bald saßen beide nebeneinander und sahen auf das kleine Meer, das hier im Flight Connection Centre die fensterlosen Fluchten der Einkaufsareale abteilte vom Oval einer Ruhezone, deren Glasfront einen weiten Panoramablick auf die Flugzeuge bot.
(Unter anderem ist es ein Raumteiler, dachte Tobias, unter anderem.) Es war ein buntbewegter Glaskörper, ein Segment Lagune, wie aus einem Ozean herausgeschnitten. Eine professionell arrangierte, bemessene Portion Korallenriff.
Das Mädchen sog selbstvergessen an einem gebogenen Trinkhalm und schaukelte mit den Beinen. Tobias sah seine mageren Waden und darüber die Knie, die aus den Gummistiefeln stiegen wie feine Gliedmaßen einer Gelenkpuppe. Der Vater hatte sich zurückgelehnt und die Augen geschlossen.
Tobias war nie in Siena gewesen. Aber vieles kannte er aus Filmen. Das war leichter. Er mußte nicht reisen, er mußte nicht reagieren. Er konnte sehen, blieb aber selbst unsichtbar. Filme sahen nicht zurück. Wenn er Filme sah, gaben andere Augen den seinen Halt. Die alten Bäder von Bagno Vignoni zum Beispiel, er sah sie, wie Tarkowski sie gesehen hatte. (Er mochte seine verzögerten Blicke.) Und dort gab es am Ende so ein Mädchen, ein Mädchen, das unvermittelt dasitzt in den verlassenen Becken. Überall steht das Wasser, alles tropft, und der schweifende, der unsichere, ja, der wohl haltlose Dichter – es war doch ein Dichter? -, er weiß nicht wohin mit seinem Leben, und da sitzt das Mädchen mit seinen Gummistiefeln. Sitzt einfach da.Wie ein Beweis. Und Tobias wußte nicht mehr, ob das Mädchen nun lachte oder nur gerade so mit den Beinen wippte. Aber wie es dasaß und ihn ansah (ohne ihn zu sehen, er wußte das schon), war das Leben entschieden. Zum Guten entschieden. Auf einmal war klar, daß es weiterging. Ohne Grund. Oder nur aus diesem einen nicht stichhaltigen Grund, daß da das Mädchen saß und mit den Beinen schaukelte. Die Füße in den großen Gummistiefeln.Weiter konnte man das nicht erklären. Diese Gummistiefel waren ja auch komisch.Was sollten denn Gummistiefel noch retten, angenommen – und der Dichter sah es wohl so – die Welt würde untergehen? Jedenfalls, erinnerte Tobias sich, war der Film nach diesem Bild zu Ende.
Tobias sah den reisenden Vater an. Er hatte die Hände in seine Jacke gesteckt, eine Allwetterjacke mit vielen Taschen, wie sie Photographen oft anhaben, und den Kopf nach hinten gelegt. Fast schien es, als wolle er Kraft schöpfen während kostbarer Sekunden heimlicher Abwesenheit. (Aber er war ja da.) DieserVater würde nicht einschlafen, auf keinen Fall, aber er nahm sich diesen einen Moment, den das Kind ihm gab. Das Kind sog an seinem Trinkhalm, schaukelte mit den Beinen, sah zu den Fischen, die aus den Felsen herausschwammen und wieder verschwanden in einem Gewoge, bunt wie zuckrige Süßigkeiten aller synthetischen Geschmacksrichtungen. Es glaubt vermutlich, dachte Tobias, man kann das alles lutschen. So wie es saugend hinsieht, schmeckt es die Blumentiere schon.
Tobias fuhr langsam das Gesicht des Vaters ab. Er weiß nicht, dachte er dann, daß ich Spezialist bin. Er weiß nicht, daß ich sammle.
Tobias Winter war Aquarist. Er war verantwortlich für das 200 000-Liter Meerwasserbecken hier in einem der größten Flughäfen der Welt. Vor sieben Jahren hatte er dieses Aquarium mit aufgebaut. Kein Plastik, keine toten Kalkskelette. Der Sponsor hatte darauf bestanden, daß es ein ganz und gar natürliches Aquarium sein solle, nur lebende Steine, Korallen, Anemonen, Schwämme, Algen, Muscheln, Krebse, Fische. Es handelte sich bei dem Auftraggeber, das hatte er erst später erfahren, um eine Gesellschaft, die auf futuristische Innenräume spezialisiert war. In Dubai etwa bauten sie Hallen, in denen man Ski fahren konnte, auf künstlichem Schnee, mit Schweizer Liftanlagen in einer Alpenklangkulisse unter Sonnenlicht aus Speziallampen. Tobias vermutete, daß es sich bei seinem Riffaquarium um ein Pilotprojekt handelte. Er hatte gehört, daß man auch an vollklimatisierten Hotels unter Wasser arbeitete. In gläsernen Aufzügen fuhren die Reisenden in die Tiefe, trockene Taucher, die dann hinter den bruchsicheren Panoramafenstern ihrer Unterwasser-Appartements lebten. Draußen schwammen Haie vorbei, Riesenkraken, Schildkröten tauchten. Kelpwälder wogten. So schien Tobias der teure Riffaufwand im Flughafen zwar groß, aber doch nur Teil eines größeren Denkens zu sein. Er selbst war nur ein unscheinbares Glied ganz anderer Vorhaben.
Und doch war er,Tobias Winter, gelernter Schreiner, später Verkäufer in einem internationalen Tierfachhandel, gefunden worden, um für diesen Unterwasserkosmos im Flughafen zu arbeiten. Einer der Manager hatte ihn angesprochen, als er in seiner blauen, durchnäßten Schürze vor einem Quarantänebecken stand und dabei war, Fische umzusetzen. Man hatte sich dann eine Weile unterhalten.Tobias Winter hatte sofort zugesagt. Er glaubte nicht an Zufälle.
Für den Aufbau und die Installationen hatten sie ihm Handwerker und Techniker zur Seite gegeben, aber er hatte das Becken dann alleine eingefahren. Eine behutsame Arbeit von Monaten. Allein bis die Ionenzusammensetzung stimmte und das Wasser richtig reifte! Kein Mensch, der die Fische hier schwimmen sah, so imVorübergehen, wußte ja, was das hieß. Und nun wartete er sein Ozeanriff im Flughafen. Er fütterte die Fische (die Seepferdchen von Hand, sie waren zu langsam), kontrollierte den Algenbewuchs, putzte die Scheiben, saugte die Korallen ab. Er prüfte die Komponenten der verschiedenen Filter und reinigte sie, er sah nach den Umwälzanlagen, er wechselte die Halogenleuchten aus. Er war der Hausmeister seines Meeres. Fast alle Fische kannte er persönlich. (Bei den Schwarmfischen war er sich nicht immer ganz sicher.) Manche kannten wiederum ihn, glaubte er, oder sie erkannten zumindest die Geste, wenn er von oben kleingeschnittenes Muschelfleisch streute, winzige Krebse, Bananenstückchen, Salat. Dann näherten sie sich, kamen hoch an die Wasseroberfläche. Schnappten nach seiner Hand. Das waren die Augenblicke, in denen Tobias Winter von sich als einem glücklichen Menschen gesprochen hätte.
Mit den Jahren aber hatte er kleine, zunächst kaum irritierende Veränderungen an sich wahrgenommen. Sein prüfender Blick auf das Leben der Fische war, ohne daß er es gewollt hätte, immer öfter und länger auf die Reisenden übergegangen. Wenn sie herabkamen aus der Höhe der gläsernen Halle, Flügellahme auf elektrischen Treppen, über mobile Bänder gleitend mit ihren Rollkoffern, registrierte er sie als Schwarm. Und dann war es gerade so, als ob er seine professionelle Fisch-Aufmerksamkeit nicht schnell genug auf Unschärfe stellen oder ganz ausblenden könnte. Diese Reisenden kamen ihm unter als Umgeleitete, Verirrte aus allen Kontinenten, ein exotischer Fang. Hatten sie den Zoll passiert, strömten sie ohne Ziel in die Halle, ließen sich von den Spiegelbrechungen der Verkaufslabyrinthe anziehen, den Cafés und Bars. Nach und nach nahmen sie Orientierung auf. Ihre Blicke suchten die Startpläne, die in einem Lamellengefieder über ihren Köpfen rauschten und ihr Dasein hier bestätigten. Sie beruhigten sich mit der Buchstabensicherheit einer Ankunft. Hongkong. Frankfurt. Tel Aviv. Am Anfang war das Wort, das im Wirbel der Plättchen um sich schlagend verschwand. Und wieder auferstand, um eine Zeitposition verrückt. Rote oder grüne Lichtsignale gaben ihm Geleit. Reisende glaubten an die Metamorphosen dieser Namen mehr als an die Gestirne. Sie würden nach den flimmernden Anweisungen dieser kühlen Poesieautomaten fliegen. Tokio. Kyoto. Athen. Kamen solch kontrolliert Schweifende wie blind an sein Glas, hatte er sie schon als Fisch verbucht. Seine Blickkontrolle schloß sie einfach mit ein, wie der Beobachtungszwang eines Schäfers vermutlich nicht nur das wolkige Sprengel seiner Schafe im Blick hat, sondern auch das Leben der Hasen notiert, den Wildwechsel der Rehe, das hormonell gesteuerte Wandern der Kröten im März. Im April, im April.
April is the cruellest month, breeding
Lilacs out of the dead land, mixing
Memory and desire.
Tobias sah weg von dem müden Vater. Er kannte die Wege der Transitreisenden. Er konnte Physiognomie und Handgepäck verbinden, Eßverhalten und Ruhestellungen verorten. Nie sprach er mit ihnen. Das heißt, wenn sie ihn nicht ansprachen und, was in letzter Zeit leider zunehmend vorkam, etwas wissen wollten. Seit neuestem stand er im Faltblatt des Flughafens, mit Bild, er neben seinem Aquarium: »Fragen Sie unseren Tierpfleger Tobias Winter.« Was sollte er machen? Er antwortete. Dafür war er jetzt auch da. Und obwohl es ihm schwerfiel, bemühte er sich um ein angemessenes Gespräch. In einem Dokumentarfilm über den Seemann Joseph Conrad war von dessen »situationsbedingter Homosexualität« die Rede gewesen. Er hatte sich den Film mehrmals angesehen. Und in der Abfolge schöner Männer (die Matrosen gefielen ihm) hatte er begriffen, daß man ihn,Tobias Winter vor seinem Aquarium, wohl als situationsbedingt gesprächig bezeichnen müßte.
Natürlich war dieses Aquarium interessant. Es war ungewöhnlich. Spektakulär. Es war eine Kostbarkeit, es war vermutlich das Beste, was die Reisenden auf ihren Reisen zu sehen bekamen. Aber wer von ihnen schaute schon genau hin?
Hatten sie sich jemals Gedanken gemacht über die komplizierte, die letztlich unbegreifbare Lebensgemeinschaft eines Korallenriffs? Doch wer war denn er, Unwissende zu beschämen? Ruhig stand er Rede und Antwort. Auch wenn sie die falschen Fragen stellten. Auch wenn er lieber geschwiegen hätte. Die Fische redeten ja auch nicht.
Er sah die Passagiere in einem besonderen Licht, in einem gemäßigten Fluidum, das sie selbst natürlich nicht wahrnahmen. Das hatte er vor dem Glas, vor den Fischen gelernt, die sich nicht erklärten, nur in ferner Nähe wort- und berührungslos hinter der Scheibe schwammen, sich drehten, einzeln eine geheime Spur verfolgten, im Schwarm erschraken und leicht wie ein Wimpernschlag wendeten, ein buntes Mobile von nie verstandenem Eigensinn. Man kann nicht mit Fischen leben, dachte er oft, wenn man nicht sehen kann. Und mit Menschen lebte Tobias Winter am leichtesten, wenn er sie als ein schwimmendes Muster begriff, als eine in sich bewegte Wassertapete.
Der Rochen hatte sich von der Scheibe gelöst. Langsam war er in den Sand hinuntergeglitten. Eine leise Wellenbewegung ging durch seinen Körper. Er wirbelte den Boden auf und legte sich still in ihm ab. Eine wunderbare Mimikry. Der gesprenkelte Rochen hatte sich im grobkörnigen Sand unsichtbar gemacht.
Unter den Reisenden aus allen Kontinenten, die an ihm vorüberkamen, war Tobias Winter ein Hindernis. Ein Widerstand in den Wogen der Weltenfahrer. Er gehörte nicht zu ihnen; er reiste ja nicht.
Und doch war er ständig unterwegs. Er war verbunden mit den andern, denen es erging wie ihm. Er war sicher, sie waren eine besondere Gemeinschaft. Auch wenn sie sich nie sehen würden, gehörten sie zueinander, wußten voneinander, waren sich nah, namenlos. Sie waren einander Gedanken-Echo über den Erdball, wo der Tag des einen die Nacht des anderen war. Und die durchwachte Nacht in den müden Tag tauchte. Sie waren die, die nicht schliefen. Mitglieder einer geheimen Loge. Aber seit er sammelte, mußte er nicht mehr schlafen. Er hatte eine Aufgabe. Er war einer von ihnen, und er gab acht. Was sie von ihm wußten, darauf kam es nicht an. Was weiß der Schwarm vom Fisch? Aber er, Tobias Winter, sammelte. Er sammelte für die, die nicht schlafen konnten. Er arbeitete an einem Stoff. Er bewahrte im Gedächtnis, was die Reisenden taten, wenn sie schlafen wollten und nicht schliefen. Er sammelte ihre Müdigkeiten. Memory and desire. Ja, er sammelte und klassifizierte sie. Für sich. Und für alle. Denn es war wichtig, daß einer aufmerksam war. Was er sich merkte, was er registrierte, das würde gelten, und all dieser nicht geleistete, dieser nicht gekonnte Schlaf würde dann doch etwas wert sein, wenn er ihn behielt. Es wäre eine Art Schlaf-Futter, eine Art Schlaf-Unterfutter für einen heiligen Mantel, der all jene umschloß, die müde waren und nicht schliefen.
Natürlich konnte man Müdigkeiten sammeln und auswendig lernen. Er zumindest konnte es. Man mußte beobachten und es sich merken. Vielleicht tat er es so, wie andere (andere, die eben selbstverständlich schliefen) schöne Sätze aus besonderen Büchern auswendig lernten: Die Sibylle habe ich nämlich in Cumä mit eigenen Augen gesehen. Sie hing in einer Flasche, und als die Knaben sie fragten: ›Sibylle, was willst du?‹ antwortete sie: ›Sterben will ich.‹<
Es war ein komisches Buch. Ziemlich schmal, blauer Einband, abgegriffen.Verse und Anmerkungen. Sehr viele Anmerkungen. Er hatte keine rechte Ahnung, was das war. Aber er hatte es an sich genommen, als er es auf einem der Plastiksessel gefunden hatte. Und dieser erste Satz, damit ging es ja los, hatte ihn sofort beschäftigt. Sibylle in einer Flasche. Dann war die Prophetin eine Nixe, eine Meerjungfrau, gefangen in einem Aquarium. Kein Geigenrochen auf dem Seemannsmarkt. Sondern echt. Hier an dieser Stelle kam das Wasser ja noch nicht vor. Aber später. The sound of water only. Und Tobias sah den Zusammenhang. Immer wieder hatte er in dem Buch gelesen. (Warum eigentlich?) Er hatte das Buch nur gefunden (Strandgut, das von den Reisenden übrigblieb; sie ließen vieles liegen). Und doch hatte er manchmal geglaubt, das fremde Buch spreche gerade zu ihm.
Falling towers
Jerusalem Athens Alexandria
Vienna London
Unreal
Es gab vielerlei und ganz verschiedene Müdigkeiten. Da waren zufrieden Müde und traurig Müde, Paare waren (jedenfalls meistens, wie er beobachtete) gemeinsam müde, anders als Einzelreisende. Sie hatten auch in der Fremde schon eine heimatliche Weichheit aneinander, eine hingebungsgewohnte Müdigkeit, die sich an der Schulter des anderen beruhigte. Einzelreisenden fehlte das ganz. Sie scheuten, sie schämten sich noch ihrer Müdigkeit und versuchten hinauszuzögern, was jene sich schon längst gestatteten. Tiere wiederum waren wieder anders müde. Ein Hund schläft, kaum daß er müde ist, seinen wachen Sekundenschlaf, aus dem ihn jede Bewegung seines Herrn wecken wird. (Natürlich lebt er ohne die Aura der Schlaflosigkeit.) Das alles waren im Grunde erst grobe Raster, mit denen noch nichts anzufangen war. Aber er sammelte ja noch.
Ihn interessierte der sonderbare, ziehende Schmerz, das Flimmern, der Sog von Schlafentzug. So war er hinter dem Schlafbegehren her wie ein Jäger.
Dieser Vater dort, dachte er jetzt, entspannt sich in Lauerstellung. Er hat einen Instinkt ausgebildet, der ihn sofort alarmierte, würde sich das Kind mit einem kleinen Hopser von der Sitzfläche des Stuhls entfernen.Vermutlich riecht er das quirlige, quietschende Mädchen auf eine maximale Entfernung. Noch mit geschlossenen Augen bewacht er es. Er wird das kleine Herdentier, mit dem er loszog, wieder nach Hause bringen müssen, sonst verstößt er gegen die Rituale seines Rudels. Und da er das weiß, opfert er ihm nun sein letztes, er opfert dem Kind seinen Schlaf.
Tobias Winter lebte jenseits von Kindern und Göttern. Er war eher bescheiden in dieser Welt. Er hatte vielfarbige Fische aus verschiedenen Ozeanen aufgenommen; in seinem Aquarium beheimatete er Exemplare aus fast allen tropischen Meeren. Ihm unterstand ein globales Riff, das es in Wirklichkeit nicht gab, das allerdings existierte, weil er es gebaut hatte und unterhielt. Steinkorallen, Weichkorallen, pumpende Xenien, geweihstolze Gorgonien, Anemonen, Fische, Fische über fließende Gärten von Blumentieren, und vielleicht waren sie es, die ihn nicht schlafen ließen. Die seinen Schlaf dem eines Hundes ähnlich machten, nervös und aufmerkbereit. Ohne Tobias gäbe es diese stillen Wesen eben nicht. Nicht hier, in einem der wahnsinnigsten Flughäfen der Welt. Darauf war er stolz. Und so, wie sie unter seinem sorgenden Blick lebten, gab es sie auch nirgendwo anders. In keinem natürlichen Wasser schwammen Fische in dieser Kombination zusammen. Auch kein anderes Becken sah aus wie das seine.Aquarien sind künstliche Räume, die leben. Es ist nicht möglich, daß es zwei identische Aquarien gibt.
Er hatte die niederen Tiere, was heißt denn nieder, er hatte die Fische hier eingesetzt, er hielt sie am Leben. Er war es, der die abgemessene Welt im salzigen Fluten garantierte. Nitratgehalt, Sauerstoffgehalt, Temperatur, Strömung. Kaum einer machte sich darüber Gedanken. Leuchtende Schönheit. Ja sicher. Aber wie gefährdet! Fressen die Seesterne, die Fische die Korallen an? Fressen die Fische sich untereinander auf? Nesseln die wandernden Anemonen die Korallen, die Fische zugrunde? Setzen die festsitzenden, nesselnden Korallen mit Hilfe der Strömung den Anemonen zu? Doch alles war noch viel komplizierter. Korallenriffe waren ein Indikator. Und vielleicht schlief er auch deshalb nicht. Denn wie könnte einer, der das alles wußte, denn schlafen?
Gut, er war verantwortlich für dieses eine Aquarium im Flight Connection Centre. Aber es ging doch um mehr. Hier strömten nicht nur täglich Reisende aus allen Kontinenten zusammen und sammelten sich für kurze Zeit, um wieder in andere Himmelsrichtungen zu starten, hier berührten sich auch die Wasser der Welt.
Tobias sprach mit niemandem darüber. Aber er nahm die Ströme wahr. Er spürte, wie sie insgeheim durch diesen geographischen Punkt liefen. Und er stand in Verbindung mit allen. Er war der stille Messias der Meere. Denn es sind, das wußte er, sehr oft die nebensächlichen Dinge, die die großen bestimmen. Und Domenico, hieß dieser alte Mann in BagnoVignoni nicht Domenico, jedenfalls der alte Mann wußte das auch. Eine Kerze durch das aufgegebene Wasserbecken tragen, eine Kerze durch das Wasserbecken, das der Heiligen Katharina geweiht war. Das war seine Aufgabe. Und es war ganz egal, daß nur er diese Aufgabe verstand. Und wenn die Durchquerung des Wasserbeckens gelang, ohne daß die Kerze erlosch, dann war die Welt – (Vielleicht sind die Bescheidenen doch unbescheiden, dachte Tobias manchmal. Aber die Bescheidenen, auch das wußte er, würden nicht töten, sie würden eine Kerze tragen, eine flackernde Kerze durch ein aufgegebenes Bassin.)
Unermüdlich schaufelte der Krebs wieder Sand aus seiner Höhle. Die Grundel bewegte sich davor hin und her wie eine somnambule Tänzerin. Unter allen Paaren im Aquarium, und es gab hier die seltsamsten Lebensgemeinschaften, gefielen Tobias diese beiden am besten. Der Krebs war