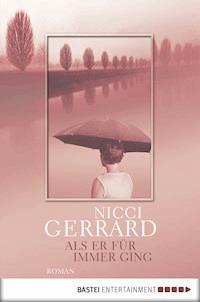7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Gaby wünschte, sie würde noch einmal am Anfang stehen, könnte alles noch einmal tun, es dann richtig, vollkommen richtig machen ... Aber gibt es ein Leben ohne den Irrtum? Ohne Fehltritte, ohne Verrat?
»Pures Leben. Einfühlsam. Ermutigend« Madame über »Als er für immer ging«
»Ein wunderbares Familienporträt - Gefühlvoll, aber ohne jeden Kitsch« Freundin über »Als wir Töchter waren«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 629
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Vierundzwanzig
Fünfundzwanzig
Sechsundzwanzig
Siebenundzwanzig
Achtundzwanzig
Neunundzwanzig
Dreißig
Einunddreißig
Zweiunddreißig
Dreiunddreißig
Vierunddreißig
Fünfunddreißig
Sechsunddreißig
Siebenunddreißig
Achtunddreißig
Neununddreißig
Vierzig
Einundvierzig
Zweiundvierzig
Über die Autorin
Nicci Gerrard ist der weibliche Teil des bekannten Autorenteams Nicci French. Unter diesem Pseudonym hat die englische Journalistin mit ihrem Ehemann Sean French bereits zahlreiche Romane im Spannungsgenre veröffentlicht. »Als wir Töchter waren«, ihr erster Soloauftritt, war eine bewegende Familiengeschichte und begeisterte weltweit eine große Leserschaft. Auch mit ihrem zweiten Roman beweist Nicci Gerrard, dass sie jenseits der Spannungsliteratur zu fesseln vermag.
Nicci Gerrard
Allein aus Freundschaft
Roman
Aus dem Englischenvon Gabriele Gockel und Rita Seuß
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2007 by Nicci Gerrard
Titel der englischen Originalausgabe:
»Since You’ve Been«
Originalverlag: PENGUIN BOOKS Ltd, London
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2007/2014 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Regina Maria Hartig
Titelillustration: © Anastasia Folman/www.af-photography.de/
Guter Punkt unter Verwendung von Bildern von
© Shutterstock/Michaela Stejskalova
Umschlaggesetaltung: Guter Punkt, München
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-7325-0431-2
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Pat and John Gerrard
Jemand rief ihren Namen, aber Gaby konnte sich nicht bewegen. Nicht nach oben, hinauf in das immer spärlicher werdende Geäst, das im Wind ächzte und knackte; nicht nach unten, zum sicheren, aber unerreichbaren Boden. Sie konnte nur genau da bleiben, wo sie war, und den Stamm der Buche umklammern, die Wange gegen die raue Rinde gedrückt. Ihre nach oben ausgestreckte linke Hand griff nach einem Stumpf, ihre unglücklich verdrehte Rechte suchte Halt in einem kleinen Spalt. Ihr Handgelenk pochte, so groß war der Druck. Sie würde fallen, wenn sie auch nur mit einer Hand losließe, ganz sicher. Sie sah sich bereits durch die Äste und Zweige brechen und auf dem harten Boden aufschlagen. Als sie ihr Gewicht ein klein wenig verlagerte, spürte sie, wie der Ast nachgab, auf dem sie stand. Er würde unter ihrem Gewicht brechen. Oder die Hand, die feucht vor Angst war, würde abrutschen.
Gaby blickte hoch. Durch die frischen, noch ganz klebrigen Blätter, die sich mit quälender Langsamkeit im Sonnenlicht wiegten, sah sie ein Stück blauen Himmel. Weiße Wolken huschten vorüber. Der Baum neigte sich ihr entgegen. Sie drückte sich fester an den Stamm. Gleich würde sie rückwärts hinunterstürzen.
Sie schaute unter sich, und ihr Herz pochte wie wild. Die Äste waren wie pulsierende Adern, die vom Wind zerzausten Blätter ein einziges grünes Gewoge. Und weiter unten der Boden, der nicht mehr fest wirkte, sondern aufgewühlt wie ein schlammiger brauner Fluss. Ein leises Wimmern entfuhr ihr. Das Herz raste, ihr keuchender Atem schmerzte, die Waden zitterten, die Handflächen brannten, das Handgelenk schmerzte. Ein Tröpfchen Blut lief ihre Wange hinunter, lästig wie eine Fliege, die sie nicht abwehren konnte. Sie streckte die Zunge heraus und kostete den Eisengeschmack auf den Lippen. Gleich ist es so weit, dachte sie, dann lasse ich einfach los. Sie hielt die Anspannung nicht mehr länger aus. Am besten, sie brachte den Sturz sofort hinter sich.
»Gaby…Du darfst nicht nach unten schauen«, sagte eine Stimme.
»Ich sitze fest.«
»Gleich unterhalb der Stelle, wo du stehst, ist ein Ast. Wenn du mit dem linken Fuß nach links unten tastest, spürst du ihn. Er ist ziemlich dick.«
»Ich kann nicht.«
»’türlich kannst du. Es ist gar nicht schwer.«
Gaby senkte vorsichtig den Fuß und tastete mit der Spitze. Angst würgte die Kehle, und ihr Mund war wie ausgetrocknet.
»Noch etwas weiter runter, nur ein ganz kleines bisschen. Gut. Und jetzt die rechte Hand. In Taillenhöhe ist ein Ast.«
»Aber ich kann nicht loslassen.«
»Irgendwann wirst du loslassen müssen, meinst du nicht? Du kannst doch nicht für immer da oben bleiben. Soll ich Hilfe holen?«
»Nein! Lass mich nicht allein!«
»Also gut. Beweg die Hand ein kleines Stück! Ja, das war doch okay, oder? So, und jetzt kannst du mit der linken Hand nach unten greifen. Genau. Und jetzt den anderen Fuß.«
Als Gaby auf den unteren Ast trat, spürte sie, wie sich eine Hand um ihren Knöchel schloss, unmittelbar über ihrem Turnschuh. Sie war trocken und warm und gab ihr ein Gefühl größerer Sicherheit.
»Siehst du? Ich stehe auf der großen Astgabel, du hast es gleich geschafft.«
»Wie weit noch?«
»Nur noch einen großen Schritt nach unten, ich glaube, das schaffst du spielend. Jetzt musst du noch mal mit der rechten Hand nach unten greifen, direkt vor dir ist ein Ast.«
Gaby streckte den rechten Fuß und ließ sich hinab. Ihr linkes Knie stieß fast an ihr Kinn, ihre Arme zitterten vor Anstrengung. Sie senkte den Kopf und blickte durch das Kaleidoskop der Blätter in ein Gesicht mit entschlossenem Kinn und türkisblauen Augen. Eine Hand streckte sich ihr entgegen.
»Nimm meine Hand und spring!«
Gaby sprang. Ihre Füße erreichten die hölzerne Plattform des Baumhauses, und sie stolperte, bevor sie neben Nancy niedersank. Ihre Beine zitterten so heftig, dass sie sie mit den Armen umschlang und ihr Kinn auf die Knie legte. Sie wartete, dass sich ihr Herzschlag beruhigte und die Welt wieder ins Gleichgewicht fand. Die Blätter im Geäst über ihr rauschten im Wind, und die Sonne strahlte von einem friedlichen blauen Himmel. Nancy sah Gaby an, deren Wangen mit Blut, Schmutz, Moos und Tränen verschmiert waren und deren Unterlippe immer noch bebte. Sie kramte ewig in ihrem Rucksack, um ein Papiertaschentuch herauszuholen.
»Dein Gesicht ist ganz schmutzig.«
»Danke«, sagte Gaby kurz angebunden. Sie war froh, dass ihre Freundin taktvoll schwieg und nicht viel Aufhebens machte, sodass sie sich nicht noch dümmer und lächerlicher vorkam als ohnehin schon.
Sie betupfte die Schramme auf ihrer Wange.
»Ist es jetzt weg?«
»Da ist noch was.« Nancy zeigte auf ihr eigenes Gesicht. »Und da. Soll ich es dir wegwischen?«
»Na gut.«
Nancy befeuchtete das Papiertaschentuch mit der Zungenspitze – eine seltsam mütterliche Geste – und wischte Gabys Gesicht behutsam sauber; dabei runzelte sie konzentriert die Stirn.
»So. Jetzt ist es weg.«
Einen Augenblick saßen sie schweigend da, Gaby mit dem Rücken an den Baum gelehnt. Wenn sie den Kopf neigte, konnte sie ihre Mutter im Küchenfenster sehen, die am Spülbecken stand, wahrscheinlich Geschirr spülte und dabei Radio hörte. Sie schloss kurz die Augen und lauschte dem Vogelgezwitscher und dem Wispern des Windes, das jetzt nicht mehr bedrohlich, sondern heiter klang.
Sie hatten das Baumhaus vor zwei Jahren gebaut, kurz nachdem sie sich kennengelernt hatten und Freunde geworden waren. Gabys Brüder hatten ihnen zwar bei der Konstruktion geholfen, aber angestrichen hatten sie es ganz allein. Inzwischen sah es etwas heruntergekommen aus. Die Bretter waren mit Vogelkot bespritzt, und einige Latten hatten sich gelockert. Die Glocke, die sie aufgehängt hatten, war verschwunden, und nur ein Stück ausgefranster Schnur erinnerte noch an sie. In jenem ersten Sommer hatten sie sich aus zwei Brettern und ein paar Backsteinen einen Tisch gebaut und sich mit einer Stellwand vor der Außenwelt abgeschirmt. Fast jeden Tag waren sie Stefans Strickleiter hochgeklettert und hatten stundenlang geredet, gelesen und als Picknick verzehrt, was sie bei Gaby in der Küche vorbereitet hatten. Jetzt kamen sie seltener hier herauf. Schließlich war Nancy dreizehn und Gaby auch schon fast so alt. Ihre Körper zeigten allmählich Rundungen; sie hatten Brustansätze, Schamhaare, einen Flaum unter den Armen und Pickel auf der Haut, und Nancy hatte sogar schon ihre Periode. Ihr Blick auf Jungs war jetzt ein anderer, und ihr eigenes Spiegelbild studierten sie nun mit nie gekanntem Ernst und einer skeptischen Sorgfalt. Sie lackierten sich die Fingernägel und probierten Make-up und neue Frisuren aus – auch wenn Nancys Haar viel zu kurz war, um etwas damit zu machen, und Gabys Locken waren so lang und voller Knoten, dass sie aufschrie und ihr Tränen in die Augen schossen, wenn Nancy sie zu kämmen versuchte. Sie ahnten beide, dass ihre Kindheit zu Ende ging, und wenn sie in ihr Baumhaus kletterten, befiel sie beinahe eine sentimentale Sehnsucht nach den flachbrüstigen, schlaksigen Mädchen, die sie gewesen waren.
»Ich hatte wahnsinnige Angst«, sagte Gaby, als sich ihr Pulsschlag beruhigt und das Zittern aufgehört hatte.
»Ich hab dir doch gesagt, dass du nicht so weit raufsteigen sollst.«
»Du hattest recht. Ich wusste es, bevor ich hochgeklettert bin. Aber ich konnte nicht anders.«
»Warum?«
»Och«, sagte Gaby vage. »Keine Ahnung. Es ist mir so eingefallen, und da wusste ich, dass ich es tun würde, obwohl ich gar nicht wollte. Es hat mich…gejuckt.«
»Eine deiner riskanten Unternehmungen?«
»Ja. Ich kann in dem Moment einfach nicht anders. Geht dir das nie so?«
»Nein.«
»Nie?«
»Nie. Ich hab keine Lust, mich zu verletzen.«
»Ich auch nicht«, sagte Gaby.
»Und ich fall auch nicht gerne auf.«
»Ach so!«, sagte Gaby und schnellte herum. »Du glaubst, ich will angeben.«
»Ich weiß, dass du angeben willst. Aber auf eine nette Art«, fügte sie hastig hinzu, als sie Gabys Miene bemerkte. »Du tust es nicht, um gut dazustehen oder dich wichtig zu machen. Eher wie eine Schauspielerin, die alle möglichen Rollen ausprobiert.«
»Aber dir brauche ich doch nichts vorzuspielen.«
»Nein.«
»Ich glaube, du hast mir heute das Leben gerettet.«
»Sei nicht albern! Hättest du wirklich nicht mehr vor und zurück gekonnt, hätte ich deine Mum rufen können.«
»Ich habe festgesessen. Ich konnte mich keinen Zentimeter mehr bewegen. Ich dachte, der Baum fällt auf mich drauf.«
»Was möchtest du für ein Sandwich? Das mit der zerdrückten Banane, die schon ganz braun ist, oder das mit Erdnussbutter. Sehen beide gleich aus.«
»Banane.«
»Hier.«
Sie saßen schweigend da und aßen ihr Brot. Die Sonne stieg höher und höher am Horizont, ihr Licht fiel gefiltert durch die Blätter, sprenkelte den Boden rings um die Mädchen und wärmte ihnen Gesicht und Nacken. Nancy zog den Wollpulli aus und stopfte sich ihn als Kissen in den Rücken. Gaby band die Schnürsenkel auf, zog die Turnschuhe aus und bewegte die Zehen. Sie sah zu ihrer Freundin hinüber, die mit überkreuzten Beinen und geradem Rücken dasaß, schlank, adrett und ordentlich. Sie hatte sich das Haar hinter die Ohren gestreift; ihre Ohrläppchen waren frisch durchbohrt und immer noch ein wenig rot und geschwollen. An Nancys dreizehntem Geburtstag hatte Gaby eine ziemlich große Nadel über eine Flamme gehalten, um sie zu sterilisieren, und die rußgeschwärzte Spitze durch Nancys Ohrläppchen und eine halbe rohe Kartoffel gestoßen, die sie von hinten gegen das Ohrläppchen gedrückt hielt. Die Ohren hatten sich furchtbar entzündet; außerdem waren die Löcher völlig asymmetrisch, was bei Nancys ebenmäßigem Gesicht ganz schön seltsam aussah. Neben ihr kam sich Gaby schmuddelig vor mit ihrer zerrissenen Jeans, den an der Ferse durchgescheuerten Socken, den Fingernägeln mit Trauerrändern und dem schmutzigen Hals. Die Haare fielen ihr über die Augen. Ihre Kleidung kratzte. Sie seufzte, blickte hinauf zu den Ästen und überließ sich der Erinnerung an das Gefühl, als sie dort oben gewesen war, überzeugt, sie würde hinabstürzen.
»Wer von uns beiden wohl als Erste sterben wird?«, fragte sie nachdenklich.
»Sterben!«
»Wahrscheinlich ich. Ich werde von einem Baum fallen oder so.«
»Nein, du hast neun Leben.«
»Ich möchte in ein brennendes Boot gelegt werden wie die Wikinger und aufs Meer hinaustreiben, lichterloh in Flammen.«
»Ich möchte in einer Pappkiste begraben werden. Das habe ich in einem Buch gelesen. Auf die Art werde ich schneller von den Würmern gefressen.«
»Ist ja eklig!«
»Wieso denn? Das ist nun mal so in der Natur. Am Ende werden alle gefressen.«
»Nicht, wenn man auf einem Boot verbrannt wird.«
»Jedenfalls wirst du als Erste heiraten.«
»Meinst du?«
»Ja. Ich werde nämlich überhaupt nicht heiraten. Ich werde ganz allein leben, nur mit einer Katze zur Gesellschaft, und machen, was ich will.«
»Kann ich nicht mit dir zusammenleben?«
»Kannst du, bis du heiratest.«
»Willst du denn keine Kinder?«
»Weiß ich nicht. Mum sagt immer, Kinder sind furchtbar anstrengend. ›Außer Spesen nichts gewesen‹, sagt sie.«
»Sie hat doch nur dich.«
»Stimmt.«
Gaby starrte Nancy einen Augenblick an, dann wandte sie sich ab. »Ich will schon Kinder«, sagte sie fest entschlossen. »Vier, und wenn ich es mir aussuchen könnte, was natürlich nicht geht… Schau mich nicht so an, als wäre ich ein Baby, das von Tuten und Blasen keine Ahnung hat: zwei Jungs, Oliver und Jack, und zwei Mädchen, Rosie und Poppy. Und eine Katze und einen Hund und Hühner und einen Hamster.«
»Erwachsene wollen keinen Hamster haben!«
»Wieso nicht?«
»Sie wollen es eben nicht!«
»Ach so«, sagte Gaby ratlos und blinzelte in die Sonne. »Manchmal möchte ich gar nicht erwachsen werden. Es ist zu kompliziert, zu chaotisch. Am liebsten möchte ich für immer hier bleiben, wo wir jetzt sind. In diesem Baumhaus. Und Bananenbrote essen und Pläne schmieden, die man nicht verwirklichen muss.«
»Mmmm«, murmelte Nancy. Sie gähnte, und Gaby konnte sehen, wie die Mandeln in ihrem sauberen rosigen Mund leicht bebten.
»Man weiß einfach nicht, was passiert, wenn man erwachsen ist. Ein komisches Gefühl. Alles, was vor einem liegt, ist irgendwie verschwommen.«
»Hier, nimm einen Schokokeks.«
»Aber eins weiß ich genau: Wir werden immer Freundinnen bleiben, oder?«
»Ja, natürlich.«
»Bis wir neunzig sind.«
»Wenn wir so lange leben.«
»Sollen wir schwören?«
»Was? Dass wir am Leben bleiben?«
»Dass wir Freundinnen bleiben, bis wir sterben.«
»Okay.« Widerstrebend gab Nancy sich der feierlichen Stimmung hin, die zu der ihrer Freundin passte, auch wenn es ihr ein wenig peinlich war. »Ich schwöre, dass wir Freundinnen bleiben, bis wir sterben.« Sie zögerte. »So wahr mir Gott helfe«, fügte sie dann hinzu, um der Sache mehr Gewicht zu verleihen.
»Du hast doch gesagt, du glaubst nicht an Gott!«
»Tu ich auch nicht. Es hört sich einfach besser an.«
»Finde ich nicht. Jedenfalls nicht, wenn man weiß, dass es nicht dein Ernst ist.«
»Es ist mein voller Ernst – jedenfalls, dass wir Freundinnen bleiben. So, und jetzt bist du dran.«
»Okay.« Gaby ergriff Nancys Hand und sah, dass Nancys Fingernägel abgekaut waren und sie an beiden Handgelenken einen Ausschlag hatte, und aus irgendeinem Grund machte dieser Anblick Gaby traurig und gab ihr das Gefühl, erwachsen zu sein. Sie blickte in Nancys blasse türkisblaue Augen. »Ich verspreche hoch und heilig, deine Freundin zu bleiben«, sagte sie scheu. Plötzlich hatte sie wieder Tränen in den Augen, und ihr Herz pochte heftig. »Und dass nichts und niemand uns auseinanderbringen kann. Niemals. So, und jetzt gib mir den Schokokeks, bevor die Füllung schmilzt.«
Eins
»Wie wir uns kennengelernt haben?«, fragte Gaby und lächelte in das junge Gesicht ihr gegenüber. »Na ja, es war ganz schön dramatisch. Wir haben uns durch einen Unfall kennengelernt.«
»Durch einen Zufall?«
»Einen Unfall. Ich weiß es noch, als wäre es erst gestern gewesen.«
Jedes Paar hat eine Geschichte, die von seiner ersten Begegnung handelt. Diese Geschichte erzählt zuerst einer dem anderen, und schließlich erzählen beide sie mit spontanen Hinzufügungen und Auslassungen Angehörigen und Freunden. Ihre Geschichte war wild und fesselnd, durchzogen von der Tragödie anderer Menschen, und wenn sie sie erzählten, sahen sie einander an und erinnerten sich wieder an die bergab führende Straße und die samtschwarze Nacht, und dann fühlten sie sich wie Figuren in einem Gruselbild. Denn sie hatten sich weder in der Schule noch im College, weder bei der Arbeit noch auf einer Party kennengelernt; weder durch einen gemeinsamen Bekannten, in einem Abendkurs oder Eheanbahnungsinstitut; weder im Zug, im Flugzeug noch am Strand; nicht einmal ihre Blicke hatten sich getroffen, noch hatte ihnen der Atem gestockt und die Welt ringsum sich langsamer gedreht. Sie hatten sich bei einem Verkehrsunfall kennengelernt. Sie hatten in völlig getrennten Welten gelebt und wären einander wohl nie begegnet, wenn drei betrunkene Studenten in einem alten, nicht versicherten Rover nicht zu schnell um eine scharfe Kurve gebogen und gegen einen alten Kastanienbaum geprallt wären, dessen dicker Stamm kaum eine Spur davontrug. Beim Aufprall wurde die Karosserie wie eine Pappschachtel zusammengedrückt. Das Auto schob sich mit dem kreischenden Geräusch von berstendem Metall und splitterndem Glas zusammen, und der kurze Aufschrei, der zu hören war, klang aus der Entfernung wie der Schrei einer Eule. Die Geschichte dreier Menschen endete in jener Nacht – die beiden Beifahrer starben noch am Unfallort, unter dem Astwerk des Baums, der Fahrer, der nach seinen Freunden rief, auf dem Weg ins Krankenhaus –, während Gaby und Connors Geschichte begann.
Mit den Jahren konnte Gaby die beiden Versionen ihrer Geschichte nicht mehr auseinanderhalten. Connors Erinnerungen an ihre erste Begegnung schienen mit ihren eigenen zu verschmelzen, und umgekehrt machte auch er sich ihre Erinnerungen zu eigen. Es war ein unheimliches Gefühl wie in einem hellwachen Fiebertraum, in dem sie sich mit Connors Augen sah und Connors Gefühle in sich spürte. Ob das Liebe ist?, fragte sie sich dann. Wenn man das eigene Ich nicht mehr von dem des anderen unterscheiden kann? Der Gedanke ängstigte sie, denn sie wollte nicht einfach so verschwinden, sich durch eine solch intime Nähe zum anderen auflösen. Manchmal wünschte sie sich ihre eigene Geschichte zurück, eine Geschichte mit klaren Konturen und einem festen Standpunkt. Sie brauchte eine deutliche Abgrenzung, um sich nicht zu verlieren. In der Nacht, als sie sich kennenlernten, hatte Connor sie gefunden, und sie selbst hatte sich verloren – euphorisch und ohne jeglichen Zweifel. Wenn sie ihn ihre gemeinsame Geschichte erzählen hörte, spürte sie, wie sie in die Vergangenheit hinabgesogen und von einer Art Schwindelgefühl überwältigt wurde. War es wirklich so gewesen?
Connor war nach einem Besuch bei seinen Eltern in der Nähe von Birmingham auf dem Heimweg nach Oxford. Sein Vater, von Beruf Maschinist und zeitlebens schwerer Raucher, hatte soeben erfahren, dass er an Lungenkrebs litt. Seine Mutter, vom Leben bitter enttäuscht, hatte auch tagsüber angefangen zu trinken – mit derselben Entschlossenheit, mit der sie die Wohnung zu putzen und im Hinterhof den Staub aus den Teppichen zu klopfen pflegte. Am Steuer seines Wagens dachte Connor über seine Eltern nach. Sein Vater hatte die Diagnose überraschend gefasst, ja beinahe vergnügt aufgenommen; in seinen Augen hatte ein maliziöses Blitzen gelegen, als er wie gewohnt über Connors politische Ansichten und seinen Sträflingshaarschnitt gelästert hatte. Die Mutter war Connor erbärmlich abgemagert vorgekommen, noch magerer als sonst, und ihre Augen hatten ein gesprenkeltes Gelb angenommen. Er spürte noch immer den Druck ihrer Finger auf seinen Oberarmen, als sie sich von ihm verabschiedet hatte. Sie war zwar erst fünfzig, aber plötzlich hatte sie ihn an eine böse Märchenhexe erinnert, die ihn in das erstickende düstere Loch seiner Kindheit zurückzerren wollte. »Besuch uns bald wieder!«, hatte sie gelallt, und ihr Atem hatte nach billigem Rotwein und Brandy gerochen. Er hatte sich furchtbar zusammennehmen müssen, um nicht angewidert zurückzuweichen.
Während der Fahrt versuchte er, diese Erinnerungen auf Abstand zu halten, sodass nur Gedankenfetzen und einzelne Bilder an seinem erschöpften Geist vorbeizogen: das Buch über Tropenmedizin, das er gerade gelesen hatte, der Text eines Liedes, wie ging der noch? »Lying in a burnt-out basement« und so weiter und so fort, »hoping for…« – hoffend worauf? Er wusste es nicht mehr. Die Worte irrlichterten durch seinen Kopf, und wenn er sie fassen wollte, waren sie verschwunden. Er dachte an die Mahlzeit, die er mit seinen Eltern eingenommen hatte: Hackfleischauflauf mit lauwarmem Kartoffelbrei, in den mit der Gabel Wellenmuster eingeritzt waren, und als Beilage Karotten aus der Dose. Sein ganzer Körper juckte, und er fühlte sich schmutzig; seine Glieder waren schwer von der langen Fahrt. Morgen früh würde er joggen, bevor er ins Krankenhaus fuhr. Er würde um halb sieben aufstehen, noch bevor es richtig hell war, und den Kanal entlanglaufen, während die Sonne aufging. Er warf einen Blick auf die Uhr des Armaturenbretts und sah, dass es schon nach Mitternacht war. Bis Oxford waren es noch einige Kilometer, doch bereits jetzt war am Himmel der schwache orangerote Widerschein der Stadt zu sehen. Völlige Dunkelheit kannte er gar nicht; vielleicht würde sie ihm Angst machen, aber nein, sie würde ihm wohl gefallen. Die Dunkelheit empfand er als recht angenehm. Er hasste grelles Licht. Nackte Glühbirnen; Wüsten; weite Flächen gleißenden Schnees.
Sally war inzwischen sicher schon im Bett. Er stellte sich ihr friedliches Gesicht und ihr dunkles Haar vor, das über das Kopfkissen gebreitet war. Außerhalb seines Zimmers herrschte Unordnung, Krach, das Chaos eines Studentenwohnheims, in seinen vier Wänden aber herrschte Ordnung. Alles war an seinem Platz. Die Schranktüren waren geschlossen, seine Lehrbücher stapelten sich auf dem Arbeitstisch. Sally blieb zwar oft über Nacht, doch sie achtete sorgsam darauf, nichts durcheinanderzubringen. Auf dem Nachttisch neben ihrem Bett befanden sich ein Glas Wasser, eine runde Pillenpackung und wahrscheinlich ein Roman oder ein medizinisches Lehrbuch mit einem Lesezeichen darin. Ihre Kleider lagen ordentlich zusammengefaltet auf dem Stuhl neben der Tür. Im Schlaf zeigte sie ein unscheinbares, rätselhaftes Lächeln, doch ab und zu öffnete sie die Augen so, dass nur das Weiße zu sehen war; dann legte Connor ganz sanft die Daumen auf ihre Lider, um sie wieder zu schließen, und fühlte sich dabei wie ein Leichenbestatter.
Nun kämpfte er mit dem Schlaf, obwohl er fast am Ziel war. Die Fahrt würde höchstens noch zwanzig Minuten dauern. Er wusste, er sollte besser ein paar Minuten Halt machen und aussteigen, aber er blieb träge sitzen und fuhr weiter. Die Heizung funktionierte nicht richtig, aus dem rechten Gebläse kam eiskalte, aus dem linken viel zu warme Luft. Seine Lider waren schwer, und im Licht der Scheinwerfer schien die Straße vor ihm zu wanken. Er riss die Augen auf und verzog das Gesicht zu einer Grimasse, um Konzentration bemüht. Er richtete sich in seinem Sitz auf, steckte sich das letzte Stück Milchschokolade aus der Folie auf dem Beifahrersitz in den Mund und lutschte es langsam, um länger etwas davon zu haben. Süß rann es ihm die Kehle hinunter; für einen kurzen Moment fühlte er sich hellwach, und er erkannte die Straße klar und deutlich vor sich. Aber merkwürdig: Gegen den Schlaf kommt man nicht an, auch wenn man weiß, dass der Schlaf den Tod bedeutet. Connor kaute auf der Unterlippe und zwickte sich in die Wange, so fest, dass es wehtat. Er umklammerte das Steuer noch entschlossener. Wenn das Radio funktionierte, fände er vielleicht einen Musiksender und könnte laut mitsingen, aber aus dem Lautsprecher drang nur ein unangenehmes Knistern, ein statisches Rauschen, ab und an unterbrochen von einem einzelnen Wort. Er öffnete das Fenster und ließ die kalte Herbstluft herein, und obwohl er sich fest vorgenommen hatte, mit dem Rauchen aufzuhören, drückte er den Zigarettenanzünder und zündete sich eine Zigarette an. Die Spitze glühte rot auf, und seine Lungen schmerzten beim Inhalieren. Er dachte an die versengten Lungen seines Vaters, er dachte ans Sterben, und immer noch drohte ihn der Schlaf zu überwältigen. Irgendwoher glaubte er ein Geräusch zu hören, einen Donnerschlag oder gar einen Schuss und dann den Schrei einer Eule. Er rieb sich fieberhaft die Augen, weil die Straße vor ihm plötzlich zu schlingern schien und Bäume schwindelerregend auf ihn zustürzten.
Eine Gestalt tauchte aus dem Gebüsch auf und hechtete auf sein Auto zu. Im ersten Moment – und auch später noch, während er schon auf der Bremse stand, der Wagen mit quietschenden Reifen ins Schleudern geriet und Adrenalinstöße durch seinen Körper jagten – glaubte er, es sei ein Schatten – ein Streich, den ihm die Dunkelheit und seine Müdigkeit gespielt hatten. Er hätte nicht einmal sagen können, aus welcher Richtung die Gestalt gekommen war; vielleicht war es auch ein großer Vogel, der dicht über ihn hinweggestrichen war. Doch dann löste sich die Gestalt vom Hintergrund, sie schrie und fuchtelte mit den Armen und trat immer wieder ins Scheinwerferlicht. Sein Blick erhaschte den hellen Fleck eines Gesichts, einen dunklen geöffneten Mund und Schattenhöhlen, wo Augen sein mussten, wehendes Haar, einen langen, hochgebundenen Rock.
»Was zum Teufel…?«
Fäuste trommelten an sein Wagenfenster. Er zog die Handbremse und stieß die Tür auf. Ihr Schwall unverständlicher Worte hätte ihn fast erdrückt. Da waren der Geruch von Zigaretten und Parfüm und eine Kette aus bunten Perlen um ihren Hals.
»O mein Gott, Hilfe! Sie rühren sich nicht mehr, ich glaube, sie sind tot, so jung, einen Krankenwagen, o Gott…«
»Ganz langsam!«, sagte er laut, plötzlich hellwach. »Erzählen Sie, was Sie wissen!«
»Ein Autounfall«, sagte sie und rang um Fassung. »Gleich hinter der Kurve. Sie sind gegen einen Baum gefahren. Ich weiß nicht, ob einer von ihnen noch lebt. Der Wagen ist…er ist vollkommen zerstört, ich habe reingeschaut, o Gott…« Sie konnte nicht weitersprechen.
Gaby selbst wusste später nicht mehr, was sie zu ihm gesagt hatte. Sie erinnerte sich nicht einmal mehr, dass sie überhaupt etwas gesagt hatte oder zu wem: zu einem Mann oder einer Frau, einem alten oder jungen Menschen. Sie erinnerte sich nur noch, dass sie sich in ein Auto gebeugt hatte, das nach Leder, Rauch und Schokolade gerochen hatte, im Rücken Blut und Zerstörung.
»Führen Sie mich hin!« Connor war ausgestiegen, mit beiden Beinen fest auf dem Boden; sein Herz schlug gleichmäßig. Er war seltsam ruhig und sprach mit gebieterischer Stimme, wahrte dabei jedoch eine gewisse Distanz. Während er sprach und agierte, war er sich dessen bewusst, dass er eine Rolle spielte: die des Arztes, der in einer Krisensituation das Kommando übernimmt. Er kam sich zugleich edelmütig und lächerlich vor – wie ein Schwindler. Aber die Frau schien ihm zu vertrauen. Seine Worte wirkten sichtlich beruhigend auf sie.
Tatsächlich? Auch daran erinnerte sie sich nicht mehr. Aber es stimmte, dass der Mann vor ihr Autorität ausgestrahlt und sie ihm sofort zugetraut hatte, dass er wusste, was zu tun sei. Sie war nicht mehr allein in dieser stürmischen Nacht, allein mit den Toten.
»Wo ist es?«, fragte er entschlossen.
»Nein! Hören Sie! Sie müssen zum nächsten Haus fahren und einen Krankenwagen rufen. Ich habe nur ein Fahrrad, und ich glaube, die Kette ist gerissen, als ich angehalten habe.«
»Ich bin Arzt«, sagte er – eines Tages würde er ein Arzt sein. Die Worte verliehen ihm Autorität und gaben ihm das Recht, das Kommando zu übernehmen. »Sie sollten losfahren und einen Krankenwagen holen, ich bleibe hier und sehe zu, was ich machen kann. Können Sie Auto fahren?«
»Mehr oder weniger«, sagte sie. »Ich meine…ja. Ja!«
»Dann nehmen Sie meinen Wagen. Wenden Sie auf der Stelle! Nach fünf, sechs Kilometern kommen ein paar Häuser.«
»Retten Sie sie!« Sie ließ sich auf den Fahrersitz fallen, schlug die Tür zu, dass ihr gestreifter Rock, ein bunter Fetzen, bis zum Armaturenbrett hochwirbelte, und stieß zur Böschung zurück, dass der Splitt durch die Luft spritzte. Der Motor heulte auf. Sie verfehlte ganz knapp den Straßengraben, warf das Steuer erneut herum, die Räder drehten durch, bevor sie endlich griffen und der Wagen sich in Bewegung setzte. Sie beugte sich vornüber, das Gesicht fast auf dem Lenkrad. Connor sah dieses Gesicht, die glänzenden Augen, das medusenhafte Haar, und für einen Moment durchzuckte ihn etwas wie Angst. Sie fuhr, als wolle sie einen wilden Hengst zureiten: Einer würde seinen Willen durchsetzen, der andere unterliegen. Connor drehte sich um und lief die Straße entlang. Jetzt, da er allein war, verließ ihn die Selbstsicherheit schlagartig. Er fürchtete sich vor dem, was er sehen würde, wenn er um die Kurve bog, und hatte keine Ahnung, was er als Nächstes tun würde.
»Dann hattest du also auch Angst?«, hatte Gaby gefragt, als sie sich die Geschichte zum ersten Mal vergegenwärtigten, Einzelheiten hervorkehrten und Dinge in ihr Bewusstsein hoben, die, ob wahr oder unwahr, mit der Zeit in ihren Köpfen Wirklichkeit wurden. »Ja, ich hatte Angst«, erwiderte er. »Furchtbare Angst.«
Wie sich herausstellte, konnte er nur sehr wenig tun. Es war stockdunkel, der Unfallort wurde nur von einem tief am Himmel stehenden Halbmond und einigen winzigen Sternen erleuchtet. Er blieb kurz stehen, und während er tief Luft holte, spürte er den nassen Schweiß auf seiner Stirn. Das Auto hatte sich regelrecht um den Baum gewickelt. Der gesamte vordere Teil der Karosserie hatte sich nach innen geschoben, kaum vorstellbar, dass da drin noch jemand lebte. Trotzdem, er musste nachschauen. Er konnte nicht einfach nutzlos dastehen und gaffen. Er zwang sich, ein paar Schritte näher zu treten und sich das Wrack genauer anzusehen. Eine Hand hing schlaff aus dem hinteren Fenster – eine erstarrte Geste der Hilfsbedürftigkeit –, ansonsten fiel ihm nichts auf. Das Auto hatte sich um die Insassen gefaltet wie eine Blechdose, die unter einem Schuh mit Spikes zerquetscht worden war.
»Hallo«, sagte er, als er dicht am Auto war. Er war erleichtert, dass seine Stimme ruhig und fest klang. »Kann mich hier drin jemand hören? Der Krankenwagen ist schon unterwegs, er wird bald, sehr bald eintreffen.«
Ringsum herrschte eine unheimliche Stille, und er hielt die Luft an, um sie nicht zu stören. Nichts. Nur das Rascheln und Kratzen eines Blatts, das zu Boden fiel.
»Ich bin hier, um zu helfen«, sagte er und versuchte die verbeulte Hintertür aufzureißen. Sie bewegte sich nicht. Er fasste nach der schlaffen Hand und suchte den Puls, während er den Körper inmitten all der Zerstörung im Wageninneren auszumachen suchte. Es roch nach Blut, metallisch und süß, und nach Kot; der Geruch haftete in seiner Nase. War das der Geruch des Todes? In seinem ersten Studienjahr hatte er Leichen aufgeschnitten, aber die hatten nur nach Formaldehyd gerochen. Konserviert und farblos, fast ohne Ähnlichkeit mit Menschen aus Fleisch und Blut.
»Halten Sie durch!«, flüsterte er. Ein sinnloser Satz. Er fühlte keinen Pulsschlag. Er ließ die Hand behutsam wieder los und steckte den Kopf ins Auto, vorsichtig, um nicht an die scharf gezackten Glassplitter im Fensterrahmen zu stoßen. Er streckte den Arm ins Innere, um nach einem Körper zu tasten. Er berührte eine Schulter, den Stoff einer Jeansjacke, ein Ohr, einen weichen Schopf Haar, das er sich braun vorstellte. Unwillkürlich zuckte er zurück, als seine Hände ein blutnasses Gesicht berührten. In der Dunkelheit horchte er nach einem Atem, einem Stöhnen. Nichts. Er versuchte Umrisse zu erkennen und sah fahle Haut. Er zwang sich, die Hand noch weiter vorzustrecken, und ertastete einen Arm, kalt und leblos. Wie schnell ein Körper auskühlt!, dachte er. Er hörte den eigenen keuchenden Atem, nur seinen Atem, sonst nichts.
Dann ein Geräusch, leise wie das Knacken eines Astes. Es kam nicht aus dem Wageninnern. Er richtete sich auf und horchte. Da war es wieder, direkt vor ihm, dort, wo einmal die Kühlerhaube gewesen war. Wenn er nur eine Taschenlampe hätte! Er durchwühlte die Manteltasche nach seinem Feuerzeug und hielt das Flämmchen vor sich hin. Es zitterte, und für einen kurzen Moment sah er im Wagen ein Gesicht. Es war gegen die zersplitterte Windschutzscheibe gepresst. Weit aufgerissene, glasige Augen starrten ihn an. Er wandte sich ab.
»Ist da jemand?«, rief er leise und bewegte sich einen Schritt vorwärts.
Der junge Mann lag an der Straßenböschung, wenige Meter vom Baum entfernt. Sein Bein war grotesk verdreht, der ganze Oberkörper dunkel von Blut. Aber er lebte. Connor hörte flache, unregelmäßige Atemzüge. Er machte sein Feuerzeug aus, ging im feuchten, mit Brennnesseln durchsetzten Gras neben dem Verletzten in die Hocke und legte ihm vorsichtig eine Hand auf die Stirn.
»Der Krankenwagen wird bald hier sein«, sagte er. »Halten Sie durch!«
Er wusste nicht, was er als Nächstes tun sollte. Der junge Mann – fast noch ein Kind – atmete. Er brauchte keine Mund-zu-Mund-Beatmung oder Herzmassage. Connor zog den Mantel aus, rollte ihn zu einem Kissen zusammen und legte ihn unter den Kopf des Jungen. Dabei fiel ihm auf, wie dicht und dunkel dessen Haar war und dass er ein Pflaster am Kinn trug; vermutlich hatte er sich beim Rasieren geschnitten. Das Pflaster hatte für Connor etwas furchtbar Trauriges. Das Hemd des Jungen war blutgetränkt.
»Meine Kumpel…?«
»Machen Sie sich um die jetzt keine Sorgen!«
»Gary? Dan?«
»Halten Sie durch!«
»Lassen Sie mich nicht allein hier im Dunkeln.«
»Nein, keine Angst! Ich bleibe bei Ihnen, bis der Krankenwagen kommt.«
Jetzt hörte er, wie sich ein Auto näherte, hochtourig, in einem viel zu niedrigen Gang, dann Bremsenquietschen und Türknallen. Die ganze Zeit über beugte er sich weiter über den Verletzten.
»Wo sind Sie?«, hörte er sie rufen, aber er antwortete nicht. Er wollte sich nicht laut bemerkbar machen.
Dann kauerte sie sich neben ihn, und in dem Augenblick wanderte der Mond über die Bäume und tauchte die Szenerie in ein gespenstisches Licht.
»Er wird gleich hier sein«, flüsterte sie. Und als sei es das Natürlichste auf der Welt, beugte sie sich hinunter und küsste den Jungen auf die Stirn. Dann zog sie die Jacke aus, einen unter der Achsel eingerissenen Gehrock im Stil des neunzehnten Jahrhunderts, und deckte ihn damit zu. Sie nahm seine Hand in ihre Hände und hielt sie fest. Ihre Halskette schwang über seinem Kopf hin und her wie ein Metronom, ihre Haare umrahmten sein Gesicht.
O ja, daran erinnerte sie sich. An das im Mondschein bleiche Gesicht, das zu ihr aufsah, die riesigen, erschrockenen Augen, die sie anstarrten, als könne sie allein ihn retten. Sie erinnerte sich an seinen Geruch, den Geruch von Einsamkeit und Angst; und an seine feuchte, eiskalte, klebrige Haut. Sie empfand eine schmerzliche Zärtlichkeit für ihn, als wäre sie zugleich seine Mutter, seine Schwester, seine Geliebte, seine Freundin – und hätte in diesem Augenblick alles getan, um ihn zu retten.
»Ich bin Gaby«, sagte sie, nicht zu Connor, sondern zu dem Jungen, der an der Böschung lag und dessen Augen langsam zufielen. »Jetzt wird alles gut. Sie sind schon unterwegs.«
»Halten Sie die Augen offen!«, sagte Connor eindringlich, weniger, weil er an das dachte, was er als angehender Arzt gelernt hatte, sondern weil er Filme gesehen hatte, wo sich der Polizist über seinen tödlich verwundeten Kollegen beugt und ihn zwingt, wach zu bleiben. Das Wort »ausbluten« kam ihm in den Sinn.
»Es ist meine Schuld«, flüsterte der Junge.
»Nein«, sagte Gaby. »Nein, es ist nicht deine Schuld. Denk so etwas nicht!« Sie wischte ihm mit einem Zipfel ihres Rocks über die Stirn, einem Rock aus einem dünnen, glänzenden Stoff, wie Connor auffiel, der nun stark von Öl und Blut verschmiert war. Blut sickerte dem Jungen aus dem Mund, und Connor nahm ein Papiertaschentuch aus der Hosentasche und tupfte es auf. Der Junge zuckte leicht zusammen, und Connor legte ihm eine Hand auf die Schulter.
»Bleiben Sie ruhig liegen!«, mahnte er.
»Halt durch!«, sagte Gaby. »Bitte, halt durch, mein Schatz! Bitte.«
Gemeinsam beugten sie sich über den Sterbenden, redeten ihm gut zu, sagten ihm, alles werde gut, und versicherten ihm, dass sie bei ihm bleiben würden. Unsinnige Worte im Dunkeln. Connor war tief bewegt von der Intimität dieser Szene und gleichzeitig merkwürdig ruhig, obwohl er wusste, dass der Junge vor ihnen sein Leben aushauchte und hinter ihnen zwei Tote lagen. Dann durchschnitt das Heulen einer Sirene die Stille, und blaue Lichter bogen um die Kurve. Plötzlich herrschte Hektik, ein zielgerichtetes Treiben. Mehrere Wagen reihten sich am Straßenrand auf. Anweisungen wurden gerufen. Helle Scheinwerfer warfen Licht auf die Szenerie, leuchteten sie aus wie den Set eines Films. Männer mit Tragen rannten los.
»Treten Sie zurück«, sagte ein Mann, und Gaby und Connor standen auf und beobachteten, wie der Verletzte auf eine Trage gelegt und weggebracht wurde. Einen Augenblick blieben sie stumm.
»Wird er es schaffen?«, fragte Gaby schließlich.
»Ich weiß es nicht. Vielleicht.« Connor musterte sie in der Dunkelheit. Ihr bleiches Gesicht leuchtete, und ihre Augen wirkten riesengroß. »Ist alles okay mit Ihnen?«
»Mit mir?«
»Sie waren großartig.«
Connor bückte sich und hob seinen Mantel vom Boden auf. Es erschien ihm unpassend, ihn wieder anzuziehen, obwohl die Nacht kalt war. Er sah Gaby an. Sie trug ausgetretene Stiefel und einen langen Rock, aber nur ein schwarzes Westchen als Oberteil.
»Sie frieren doch bestimmt«, sagte er.
»Ich glaube, ja.« Sie klang ganz benommen.
»Möchten Sie meinen Mantel?«
»Nein!« Fröstelnd schlang sie die Arme um den Körper. »Diese Menschen…in dem Auto«, sagte sie und unterbrach sich sogleich. »Ich habe noch nie einen Toten gesehen.«
»Ich auch nicht – jedenfalls nicht so. Nur Leichen.« Er wollte noch hinzufügen, dass sie vakuumverpackter Hühnerbrust aus dem Supermarkt geähnelt hatten oder besser noch geschlachtetem Geflügel, an den Beinen aufgehängt in einem Metzgerladen, aber er sagte nichts dergleichen. Es hätte herzlos geklungen.
»Ich dachte, Sie sind Arzt?«
»Nicht wirklich. Ich studiere Medizin.«
»Sie haben sich wie ein Arzt verhalten«, sagte sie.
»Ich habe doch gar nichts gemacht.«
Zwei Männer in gelben Jacken und Helmen näherten sich mit großen Metallschneidern dem Unfallwagen.
»Das möchte ich nicht sehen«, sagte sie.
»Nein«, sagte Connor, obwohl er den Blick nicht abwenden konnte. »Wir sollten besser gehen. Hier gibt es für uns nichts mehr zu tun.«
»Braucht die Polizei nicht unsere Personalien?«
»Vermutlich schon«, sagte er. »Ich habe damit keine Erfahrung, aber Sie haben wohl recht. Am besten, wir warten noch kurz. Eine Zigarette?«
»Ja«, sagte sie. »Aber zuerst möchte ich, glaube ich, in den Arm genommen werden.«
Also legte er seinen Arm um sie, und sie lehnte den Kopf an seine Schulter. Ihr Haar kitzelte ihm die Wangen, und er spürte ihre vollen, weichen Brüste. Sein T-Shirt war etwas feucht, und da wurde ihm klar, dass sie weinte, und dann stellte er fest, dass er ebenfalls weinte. Tränen liefen ihm über die Wangen, aber er machte keinen Versuch, sie wegzuwischen. Er erinnerte sich nicht, wann er zum letzten Mal geweint hatte, und er wusste nicht, warum er es nun tat.
Gaby spürte, wie er seinen hageren Körper an sie presste, spürte seine starken Arme, die kratzenden Bartstoppeln auf ihren Wangen. Sie spürte seine Tränen, ein Fremder schluchzte in ihren Armen, während sie in seinen Armen schluchzte. Vielleicht war es in diesem Augenblick, dass sich etwas in ihr löste. Sie fiel und wusste, dass es kein Halten mehr gab. Sie ließ sich fallen, sie wollte seine Umarmung nicht lösen, wollte nicht zurück in diese kalte Nacht, wo soeben das Leben von drei jungen Männern ausgelöscht worden war. Sie wollte, dass sie so verharrten und einander in den Armen hielten, um nie wieder loszulassen.
»Ich komme gerade von einer Party«, sagte sie dicht an Connors Schulter, und ihre Stimme klang gedämpft. »Eigentlich wollte ich gar nicht hingehen – ich war müde und hatte noch zu tun, und außerdem wusste ich, dass dieser Junge da sein würde, dem ich auf keinen Fall begegnen wollte. Aber eigentlich war das gar nicht so wichtig, wie ich gedacht hatte. Ich habe plötzlich gemerkt, dass er mir gar nichts bedeutet, und das war wirklich eine Erleichterung. Am Ende habe ich mich sogar prima amüsiert. Es waren ein paar nette Leute da. Ein komischer Typ hat in der Küche Zaubertricks vorgeführt und ständig Asse von einem Kartenstapel abgehoben. Ich habe nicht verstanden, wie er das macht. Manchmal denke ich, ich sollte auch solche Tricks lernen, aber das tue ich nie. Und ich habe getanzt. Ich tanze gern. Und Sie?«
Ihre Finger berührten die Tränen auf seinen Wangen und wischten sie fort, während sie weiterredete. »Wie auch immer, als ich nach Hause radelte, fühlte ich mich glücklich. Es war dunkel, der Mond stand am Himmel, und ich war ganz allein mit mir. Unterwegs von einem Ort zum anderen, fuhr ich im Leerlauf den Hügel hinunter, nur der Wind war da und die Bäume, sonst nichts, und ich hatte das Gefühl, alles ist gut. Und dann sah ich dieses Auto. So schnell kann alles zu Ende sein. Das klingt echt blöd, wie ein Klischee. Aber für sie hat hier alles aufgehört, einfach so. Sie fuhren im Auto und redeten wahrscheinlich und lachten und passten nicht auf, und plötzlich war für sie alles aus und vorbei. All ihre Pläne – ausgelöscht. Unvorstellbar. Und jetzt werden sie es nach und nach erfahren, ihre Eltern, ihre Freunde und Freundinnen, für die sich ebenfalls alles schlagartig ändern wird. In irgendeinem Schlafzimmer klingelt vielleicht gerade das Telefon. Die Eltern schrecken hoch, und wenn sie merken, dass es noch mitten in der Nacht ist – ob sie dann wohl sofort wissen, dass ihrem Sohn etwas zugestoßen ist? Meine Mutter sagt immer, wenn man ein Kind hat, trägt man es in Gedanken immer mit sich herum und macht sich Sorgen, wenn man nicht genau weiß, wo es ist, selbst wenn es längst erwachsen ist. Und wir machen einfach weiter; wir wissen nichts über sie. Obwohl ich das hier, glaube ich, nie vergessen werde, das hoffe ich wenigstens. Sich daran zu erinnern ist beinahe eine Pflicht, wenn man der letzte Zeuge ist.«
»Reden Sie immer so viel?« Er atmete in ihr weiches Haar und wollte nicht, dass sie aufhörte. Ihre Worte kamen ihm vor wie Stofffetzen und Bänder aus Seide, mit denen sie ihn einwickelte und vor dem beschützte, was da draußen geschah.
»Ist vielleicht der Schock. Haben sie sie schon aus dem Auto rausgeholt?«
»Ja. Und weggebracht.«
Sie seufzte und entwand sich seinen Armen. »Dann rauchen wir jetzt eine Zigarette.«
Er schüttelte zwei Zigaretten aus der Packung und drehte das Rädchen seines Feuerzeugs. Im Schein der aufzuckenden Flamme sah er ein anderes Gesicht – viele Sommersprossen, einen vollen Mund, dicke Brauen, verschmierte Wimperntusche unter den fast schwarzen Augen, ein Muttermal am Hals, scharf hervortretende Schlüsselbeinknochen und die Wölbung ihres Busens. Und sie sah ihn: eckig und kantig, mit schmalen Lippen und müden Augen.
»Ich weiß nicht einmal, wie Sie heißen.«
»Connor.«
»Connor«, sagte sie und nahm einen tiefen Zug. Der Rauch kräuselte sich vor ihrem Gesicht. »Was für eine merkwürdige Art, sich kennenzulernen!«
»Da kommt er.«
Ein Polizeibeamter trat zu ihnen. Während Gaby ihre Zeugenaussage machte, beobachtete Connor sie aufmerksam. Sie hieß Gabriella Graham, war zwanzig Jahre alt und studierte an der Universität. Sie wohnte zusammen mit vier anderen Studentinnen in der Jerome Street 22. Sie gestikulierte beim Reden, beugte sich zu dem Polizeibeamten vor, zeigte mit dem Finger auf etwas und strich sich ungeduldig die Haare hinter die Ohren. Das Auto habe sie mit hoher Geschwindigkeit überholt und sei kurz darauf gegen den Baum geprallt. In den Unfall sei sonst niemand verwickelt gewesen. Sie wisse, dass zwei der Insassen – die beiden im Wagen – Gary und Dan hießen, weil der Dritte nach ihnen gerufen habe, als er an der Straßenböschung lag, aber den Namen des Dritten kenne sie nicht. Sie glaube, dass er der Fahrer gewesen sei – dabei wandte sie sich Connor zu, um dessen Bestätigung einzuholen –, weil er gesagt hatte, es sei seine Schuld, aber sie sei nicht sicher.
»Sollen wir Sie in die Stadt mitnehmen?«, fragte der Beamte, als sie ausgeredet hatte. Die Krankenwagen waren verschwunden; zwei Männer in gelben Leuchtjacken stellten im Umkreis des Autowracks Kegel auf.
»Nicht nötig. Ich hab mein Auto hier«, sagte Connor. »Sie kann mit mir fahren.«
»Wenn Sie fit genug sind?«
»Ich bin mit dem Fahrrad hier«, sagte Gaby. »Und Ihr Auto –«
»Sie können nicht mit dem Rad fahren. Vielleicht kriegen wir es irgendwie in den Fond«, sagte Connor. »Wenn nicht, kommt es in den Kofferraum und wir lassen die Klappe offen. Es sind ja nur ein paar Kilometer.«
»Wie Sie wollen«, sagte der Polizeibeamte.
»Ich habe etwas überstürzt geparkt«, sagte Gaby. Sie hüstelte nervös. »Ähm, es könnte schwierig werden zurückzusetzen.«
»Wo ist der Schlüssel?«
»Ich glaube, ich habe ihn stecken lassen. Ich weiß nicht mehr, ich erinnere mich nicht mehr so richtig, aber ich habe ihn nicht bei mir, also –«
»Sehen wir mal nach!«
»Allerdings könnte es sein… Es könnte sein, dass ich ihn in meine Jackentasche getan habe, aber mit der habe ich ihn zugedeckt, wissen Sie noch? Und er war immer noch damit zugedeckt, als sie ihn weggebracht haben, oder nicht? Also könnte Ihr Autoschlüssel ebenso gut auf dem Weg ins Krankenhaus sein.«
»Stimmt«, sagte Connor und sah dem Polizeiwagen nach.
Doch er stellte fest, dass ihm das überhaupt nichts ausmachte. Zum ersten Mal in seinem Leben dachte er nicht über die Folgen nach, über Terminvorgaben, über die geregelte Ausführung sorgfältig erarbeiteter Pläne. Es kümmerte ihn nicht, was morgen geschehen würde, denn die Nacht war wie ein Traum, losgelöst vom Vorher und Nachher, mit einer eigenen inneren Logik. Ja, er wäre fast enttäuscht gewesen, wenn der Schlüssel am Ende doch im Zündschloss gesteckt hätte, wenngleich es ihm doch etwas ausmachte, dass das Auto fast senkrecht in dem von Brennnesseln überwucherten Graben hing.
»Tut mir leid«, sagte Gaby. »Ich war ein bisschen nervös, als ich geparkt habe.«
»Geparkt?« Er hob spöttisch die Augenbrauen und war plötzlich von einer unerklärlichen Fröhlichkeit erfüllt. »Wie haben Sie bloß die Prüfung bestanden?«
»Ähm… Als ich gesagt habe, ich kann fahren, war das nicht ganz ehrlich. Ich meine, ich kann zwar fahren, aber die Prüfung als solche habe ich nicht gemacht.«
»Als solche?«
»Ich bin schon vier Mal durchgefallen.«
»Vielleicht hätten Sie doch mit dem Polizeibeamten fahren sollen.«
»Dafür ist es jetzt zu spät.«
»Dann fahren Sie besser mit dem Rad.«
»Ich möchte Ihnen helfen.«
»Helfen?«
»Sie wiederholen ständig, was ich sage. Das macht mich ganz nervös.«
»Nervös?«
Sekundenlang blickte sie in sein ausdrucksloses Gesicht, dann musste sie lachen. »Wir müssen zu Fuß gehen«, sagte sie. »Ich werde mein Fahrrad schieben. Es sind ja nur ein paar Kilometer.«
»Mindestens zehn.«
»Zwei Stunden«, sagte sie. »Ich gehe zügig, und Sie bestimmt auch. Sie sind der Typ dafür.«
»Was für ein Typ?«
»Getrieben. Angespannt. Sie schlafen wahrscheinlich nur fünf Stunden täglich, stehen im Morgengrauen auf und rudern, laufen oder schwimmen, bevor Sie zehn Stunden arbeiten, mit nur einer Tasse schwarzen Kaffees. Hab ich recht?«
»Kann sein.«
»Ich dagegen bin eher von der behäbigen Sorte. Ich brauche mindestens zehn Stunden Schlaf. Ich kann immer und überall schlafen. Und das mache ich auch. Einmal bin ich sogar im Bus auf dem Weg zum Flughafen eingeschlafen, im Stehen.«
»Wie ein Pferd.«
»Wussten Sie, dass die Kniegelenke schlafender Pferde in einer bestimmten Position einrasten?«
»Ehrlich gesagt, nein.«
»Ein Freund von mir hat ein großes Auto – eigentlich war es mal ein Leichenwagen. Ich weiß nicht, warum er es so gut findet, in einem Leichenwagen herumzukutschieren; er denkt wohl, das ist witzig, obwohl mir der Witz nicht einleuchtet. Jedenfalls kann er bestimmt morgen kommen und Sie aus dem Graben ziehen.«
»Das schaffe ich allein«, sagte Connor.
Er fühlte sich unbeholfen, unsicher, unfähig, sich auszudrücken, älter als sie. Er glaubte zu wissen, aus welchem Milieu sie stammte – Mittelschicht, vielleicht ein Schuss Boheme. Liebevolle Eltern, die mit Lob nicht geizten, mehrere Geschwister, jede Menge Verwandte – Großeltern, Patenonkel und -tanten, Cousins und Cousinen; ein großes altes, unordentliches und ein wenig baufälliges Haus, in dem es laut zuging und viel gelacht wurde. Sie war leichtfüßig, unbekümmert und mitteilsam und nahm kein Blatt vor den Mund; sie fürchtete sich nicht davor, Unsinn zu reden oder sich lächerlich zu machen. Sie war immer sie selbst gewesen und hatte nie eine Frau vorspiegeln müssen, die sie erst noch werden wollte. Sie gehörte einer anderen Welt an, zu der er nie Zugang gehabt hatte, und für einen Moment verspürte er einen vertrauten, bitteren Groll. Doch dann wurde ihm bewusst, dass sie sich auf ihre verrückte Art seiner annahm. Sie versuchte ihn aus der Reserve zu locken, ihre Worte waren wie eine Spur, die sie legte, in der Hoffnung, dass er ihr folgen würde. Und dazu war er tatsächlich bereit.
Am liebsten wäre er die ganze Nacht mit ihr so gegangen; er verlangsamte sogar absichtlich seinen Schritt. Er schob ihr Rad, und als sie fröstelte, bestand er darauf, ihr seinen Mantel über die Schultern zu legen und ihn bis oben zuzuknöpfen wie ein Cape und dabei ihr Haar sorgfältig zur Seite zu streichen. Sie sollte sich bei ihm geborgen fühlen, und er wünschte inständig, sie möge stolpern und wieder weinen, damit er sie auffangen und in die Arme nehmen und trösten könnte. Der Halbmond stand am Himmel. Hinter dem Gebüsch, das die Straße säumte, lagen Stoppelfelder mit riesigen Strohballen, deren Umrisse sich vor dem Horizont abzeichneten. Es war wie die Landschaft seiner Seele, und er wusste, dass er sich später daran erinnern würde. Er passte seine Schritte den ihren an, hörte deren rhythmischen Gleichklang, der ihr Gespräch untermalte, und bewahrte Gabys Worte in seinem Gedächtnis. Er wusste, dass er wieder an sie denken würde, wenn er allein war, und dass er sich dieses vor Begeisterung glühende Gesicht vergegenwärtigen würde, das sie ihm jetzt zuwandte. Sie erzählte, sie habe drei Brüder und sei die Jüngste der Familie. Sie erwähnte einen Stefan, aber das überhörte er geflissentlich. Stefan und Sally hatten in dieser Nacht nichts verloren. Er wusste sehr wohl, dass die Intensität seiner Empfindungen den besonderen Umständen geschuldet war: Sein Vater würde sterben, seine Mutter trank, er war müde und überarbeitet – und dann dieser Autounfall. Gaby war ihm wie in einem Traum erschienen. Und wie ein Traum würde ihre Erscheinung bei Tagesanbruch verblassen, und er würde sein altes Leben wiederaufnehmen.
»Wollen wir uns nicht duzen?«, fragte sie.
»Gern«, antwortete er. »Was studierst du?«, wollte er wissen, während sie ihren Weg fortsetzten.
»Physik und Philosophie.« Seine Miene hatte sich offenbar verändert, denn sie sah ihn prüfend an. »Du dachtest wohl, ich studiere – mal sehen – Psychologie. Oder vielleicht Englisch und Kunst?«
»Nein!«
»O doch. Ein verrücktes Mädel.«
»Ich wollte nicht –«
»Macht nichts! Zupfst du immer so an deinem Ohrläppchen?«
»Ja.«
»Und du bist kein großer Redner.«
»Weiß nicht. Wohl eher nicht.«
»Warum? Weil du keine Lust hast zu reden?«
»Ich –«, sagte er und unterbrach sich.
»Ich meine, gibt es Dinge, die du gern sagen möchtest, aber nicht weißt, wie, oder behältst du deine Gedanken lieber für dich? Oder gibt es ein paar Auserwählte, denen du dich anvertraust?«
»Was ich hasse«, erwiderte er, »ist, wenn man etwas wirklich Wichtiges sagt und das Gefühl hat, der andere hört gar nicht richtig zu. Jedenfalls nicht so, wie man es gern möchte, verstehst du? Das macht mich… Na ja, das hasse ich. Und sage dann lieber gar nichts.«
»Ich verstehe«, sagte Gabi. Und dann, nach einer Pause: »Hör zu, Connor, ich habe dich angelogen. Ich studiere gar nicht Physik und Philosophie. Das habe ich nur gesagt, um Eindruck bei dir zu schinden. Ich studiere englische Literatur.«
»Du hast es gar nicht nötig, Eindruck bei mir zu schinden«, sagte Connor. Auf einmal überkam ihn ein berauschendes Glücksgefühl.
»Und das Auto ist ausgeschert, um mir auszuweichen«, fuhr Gaby fort.
»Du meinst –«
»Es ist mir ausgewichen. Ich fuhr mitten auf der Straße, bergab. Es hat einen Schlenker gemacht, ist ins Schleudern gekommen und in der Kurve außer Kontrolle geraten. Das habe ich dem Polizisten verschwiegen.«
»Bist du sicher?«
»Es ist meine Schuld.«
»Es ist nicht deine Schuld«, sagte Connor. »Er war wahrscheinlich betrunken und –«
»Versuche nicht, mich zu trösten. Ich weiß es. Wenn ich nicht auf meinem bescheuerten Fahrrad gesessen hätte, wären sie noch am Leben.«
Connor erwiderte nichts. Er nahm eine Hand vom Fahrrad, griff nach Gabys Hand und legte sie unter seine Hand auf die Lenkstange. Er wusste, dass sie wieder weinte, obwohl er nicht zu ihr hinübersah, sondern geradeaus auf die Straße, die sich wie ein Band durch die abgeernteten Getreidefelder wand. Sie gingen zügig und schweigend. Er hörte das leise Geräusch ihrer Schritte. Als sie etwa die Hälfte des Weges hinter sich gebracht hatten, machten sie eine Pause und rauchten noch eine Zigarette. Sie setzten sich an den Straßenrand, mit dem Rücken gegen einen Baum gelehnt. Gaby zog die Beine an und schlang in der kalten Luft den Mantel noch fester um sich. Die Spitzen ihrer Zigaretten glühten.
»Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, nicht mehr zu rauchen«, sagte Connor. »Mein Vater hat Lungenkrebs.« Er hatte das Gefühl, blau zu sein, obwohl er keinen Tropfen Alkohol getrunken hatte, und hellwach, obwohl er seit mehr als zwanzig Stunden ohne Schlaf war. Seine Haut kribbelte, und sein Hals schmerzte.
Gaby drehte sich zu ihm, das Gesicht von den Haaren halb verborgen – verschwommene Umrisse, in fahles Mondlicht getaucht. Connor zwang sich, an Sally zu denken, die vertrauensvoll in seinem Bett lag und auf ihn wartete. Er würde sich neben sie legen, und sie würde die Arme ausbreiten, seinen eiskalten, müden Körper umschlingen und ihm etwas ins Ohr murmeln. Er wusste, was für ein Glück Sally für ihn bedeutete. Er hatte sie nicht verdient. Er war ein verdrehter, kratzbürstiger Typ und voller Verrat; er hatte niemanden verdient.
»Von ihm kam ich gerade«, sagte er, »als ich dir begegnet bin.«
Gaby ließ ihre Zigarette fallen und trat mit dem Stiefelabsatz auf die glühende Kippe. Sag jetzt nichts mehr!, nahm er sich vor. Steh auf und geh weiter! Jetzt gleich, bevor es zu spät ist. Aber er rührte sich nicht von der Stelle.
»Ich dachte, es ist ein Traum, in dem du mir erscheinst«, sagte er. »Vielleicht träume ich ja immer noch.«
Auch er ließ seine Zigarette fallen und beobachtete, wie sie allmählich erlosch. Er hörte seinen keuchenden Atem, während Gaby reglos und eingemummelt neben ihm saß, und er stellte sich vor, was als Nächstes geschehen würde. Er würde in ihr wuscheliges Haar greifen, ihr Gesicht in die Hände nehmen und in der Dunkelheit ihrer Augen versinken. Einen Moment würden sie einander wie benommen anstarren, dann würde er sie heftig an sich ziehen, und sie würden sich hinter dem schützenden Vorhang ihres Haares küssen. Sie würde unter dem dünnen T-Shirt die Arme um ihn schlingen, und er würde ihre Brüste berühren. Und dann – er schloss halb die Augen…Er streckte eine Hand aus und zeichnete mit einem Finger die Umrisse ihres Mundes nach. Ihre Lippen waren leicht geöffnet, und auch ihr Atem ging schneller. Er berührte ihre immer noch tränennassen Wangen.
»Mein Gott«, flüsterte er. »Wie schön du bist!«
Plötzlich fiel ein Lichtkegel auf sie, der sie fast blendete. Für einen kurzen Moment sah Connor Gabys Gesicht ganz deutlich im Licht der Autoscheinwerfer, wie eine Halluzination. Dann brauste der Wagen an ihnen vorüber, wirbelte Splitt auf und hupte zweimal, und schon verschwanden die Rücklichter in der Kurve.
Connor setzte sich kerzengerade auf und blinzelte.
»Ein Weckruf«, sagte Gaby und streifte ihm Moos und Erde vom Rücken. Er erschauderte bei ihrer Berührung, wich aber zurück.
»Ja, entschuldige! Wir sollten gehen.«
»Niemand zwingt uns.«
»Es ist schon spät.«
»Das ist es immer.«
»Ich wollte sagen, ich habe eine feste Freundin«, gab er sehr steif zurück.
»Oh.«
»Gaby –«
»Du hast recht. Wir sollten gehen.« Sie stand mit einer leichten, fließenden Bewegung auf, streckte ihm die Hand hin und zog ihn hoch.
»Danke.«
»Es sind immer noch ein paar Kilometer, bevor wir ins Bett kommen«, sagte sie. »Wir werden erst im Morgengrauen da sein. Also los!«
Er kam nicht. Tag um Tag wartete Gaby auf ihn. Wenn sie morgens aufwachte, dachte sie: Vielleicht heute. Sie zog sich sorgfältig an und betrachtete sich ängstlich im Spiegel, um sich zu vergewissern, in welches Gesicht er blicken würde. Sie würde Gleichgültigkeit heucheln und sich nicht anmerken lassen, dass sie jedes Mal zusammenzuckte, wenn es an der Tür klopfte oder das Telefon klingelte. Wenn sie das Haus verließ, würde sie sich beherrschen und nicht in jedes Gesicht schauen, um ihn zu suchen. Ihre Zuversicht hatte sich allmählich in eine vage Hoffnung verwandelt und war beinahe erstorben. Sie versuchte sich einzureden, dass er ihr gleichgültig sei – wer war er schon? Nichts weiter als ein ernsthafter junger Mann, der einmal Arzt sein würde. Aber er hatte in ihren Armen geweint, und sie spürte noch immer seine Tränen auf ihrer Haut. Und er hatte sie so eindringlich angesehen, als habe er sie erkannt; unter seinem verzückten Blick hatte sie sich schön gefühlt. Er hatte mit dem Daumen über ihre Unterlippe gestrichen, die Augen halb geschlossen, und ihr gesagt, dass sie schön sei. Und beinahe hätte er sie geküsst. Nur eine einzige quälende Sekunde hatte gefehlt. Wie sehr sie sich wünschte, sie könne die Uhr zurückdrehen und diesen Augenblick wiederholen, ohne ihn davon abzuhalten. Sie stellte sich vor, wie sein ernstes Gesicht sich ihrem mit leicht geöffnetem Mund näherte, wie sie einander in die Augen sahen und sie spürte, dass sie dahinschmolz, bereit, sich ihm hinzugeben; sie schmolz auch jetzt dahin, bei dem bloßen Gedanken an ihn. In ihren Träumen drückte sie ihn an sich, um ihn nie wieder loszulassen.
Mehrmals fasste sie den Entschluss, ihn zu suchen. Mehrmals verwarf sie den Gedanken wieder, weil sie seine Stimme hörte, die ihr seelenruhig mitteilte, dass er eine andere Frau hatte. Nichts, was er sagen konnte, würde daran etwas ändern.
Schließlich rief Gaby in den frühen Morgenstunden ihre Freundin Nancy an, um ihr Herz auszuschütten. Als sie laut darüber sprach, klang es so belanglos; fast war es ihr peinlich, sich so reden zu hören. Es war ja gar nichts zwischen ihnen gewesen; beide waren sie Zeugen eines Verkehrsunfalls geworden und in der Nacht gemeinsam nach Hause gewandert. Sie hatten einander kaum berührt und nicht einmal richtig geküsst. Er hatte ihr gesagt, dass er nicht frei sei, und sich im Morgengrauen mit einem knappen »Auf Wiedersehen« verabschiedet. Warum also war sie so aufgewühlt, so krank vor Sehnsucht, wenn sie an ihn dachte, so leer und traurig, weil er nicht anrief? Nancy hörte zu, ohne sie zu unterbrechen. Gaby stellte sich vor, wie ihre Freundin am anderen Ende der Leitung in ihrem gestreiften Pyjama aufrecht im Bett saß, adrett und die Ruhe selbst, obwohl es lange nach Mitternacht war und sie aus dem Schlaf gerissen worden war.
Gaby hörte auf zu reden. Ein paar Sekunden blieb es still in der Leitung.
»Du bist verliebt«, sagte Nancy.
»Stimmt«, sagte Gaby kichernd, aber sie war den Tränen nahe. »Ist das nicht lächerlich? Aber es tut so weh, dass ich gar nicht weiß, was ich machen soll.«
»Wahrscheinlich gar nichts«, sagte Nancy. »Da musst du einfach durch.«
»Wenn du nur nicht so weit weg wärst! Du bist die Einzige, der ich das alles erzählen kann, ohne mich wie ein Vollidiot zu fühlen. Du versuchst nicht, mich aufzumuntern mit Floskeln wie: ›Die Zeit heilt alle Wunden.‹«
»Da ist schon was dran.«
»Und dass es jede Menge andere –«
»Ganz genau.«
»Jetzt verdirb nicht alles!«
»Ist es wirklich so schlimm?«
»Ich glaube, ja. Es hat mich total erwischt. Ich weiß, es klingt albern.«
»Weißt du was? Ich komm dich besuchen. Wie wär’s mit morgen?«
»Nein, kommt gar nicht infrage.«
»Ich hab es schon länger vor.«
»Ich weiß, dass es schon wieder vorbeigehen wird.«
»Aber ich würde wirklich gern kommen. Ich vermisse dich. Ich könnte am frühen Abend da sein, passt dir das?«
»Was würde ich ohne dich machen?«
»Du würdest für mich dasselbe tun.«
»Jederzeit.«
Zehn Tage nach dem Autounfall stand Connor vor dem Haus Jerome Street 22. Er war bereits seit acht Uhr am Morgen da, und inzwischen war es fast elf, der Himmel grau und wolkenverhangen. Es nieselte unablässig, er war nass bis auf die Haut, und die Haare klebten ihm am Kopf. Er hatte Hunger, und dieses Herumstehen war ihm ungeheuer peinlich. Unablässig dachte er, dass er jetzt besser gehen solle. Er gab sich noch zehn, dann weitere zehn Minuten. Um halb zehn hatte ein junger Mann das Haus im Schlenderschritt verlassen, das lange blonde Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden. Kurz nach zehn war ein Mädchen in Gabys Alter aufgetaucht, allerdings war es groß und schlank, hatte kurzes Haar, trug eine zerrissene schwarze Jeans und eine Lederjacke. Von Gaby keine Spur. Die Vorhänge im ersten Stock blieben geschlossen. Connor wanderte die Straße auf und ab. Wenn ihn jemand beobachtete, würde er glauben, dass er das Haus ausspioniere oder jemanden verfolge – und er war ja tatsächlich eine Art Stalker, eine lächerliche Figur, die in dieser engen Straße herumschlich und auf ein Mädchen wartete, das wahrscheinlich keinen Gedanken an ihn verschwendet hatte, seit sie sich am Stadtrand voneinander verabschiedet hatten, als das erste Licht des anbrechenden Tages am Horizont auftauchte. Wütend trat Connor von einem Fuß auf den anderen. Ein dünnes Rinnsal lief ihm den Nacken hinunter. Natürlich sollte er einfach an die Tür klopfen und nach ihr fragen. Aber der Gedanke war ihm unerträglich, wie ein Gast hereingebeten und womöglich mitleidig behandelt oder höflich abgewiesen zu werden mit der Auskunft, sie sei nicht da oder, weit schlimmer, sie liege noch im Bett – mit jemandem, mit dem sie die Nacht verbracht hatte.
Er setzte sich eine Frist bis Viertel nach. Dann würde er sie vergessen. Ende der Geschichte.
Er gab sich noch bis halb. Keine Minute länger.
Um zwanzig vor zwölf öffnete sich die Tür von Haus Nummer 22 in der Jerome Street, und Gaby trat auf die Straße. Tag und Nacht hatte ihr Bild ihn verfolgt, und da stand sie nun – ein wenig kleiner, das Gesicht etwas schmaler, als er es in