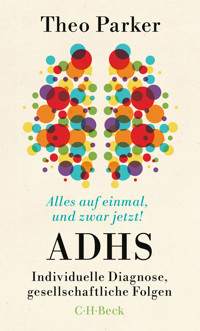
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Sind plötzlich alle hyperaktiv geworden? Immer mehr Menschen entdecken aktuell ihre ADHS und tauschen sich darüber auf Social Media aus. Doch während die Diagnosezahlen ein Rekordhoch erreichen, toben hitzige Debatten um das Störungsbild, das mal als Defizit bewertet, mal als Superkraft gefeiert wird. Theo Parker ist Psychologe und selbst seit über zehn Jahren mit ADHS diagnostiziert. Er geht dem Phänomen mit wissenschaftlicher Neugier und radikaler Ehrlichkeit auf die Spur – wobei er ganz nebenbei unser Verständnis von psychischen Störung auf den Kopf stellt.
Die Zahl der ADHS-Diagnosen hat sich in den letzten 15 Jahren verdoppelt. Termine bei Spezialambulanzen sind oftmals mit jahrelangen Wartezeiten verbunden, während in den sozialen Netzwerken Selbstdiagnosen geteilt und angeregt werden. Ist ADHS also eine lange nicht ernst genommene neuronale Entwicklungsstörung oder doch Hype-Diagnose und Symptom unserer Zeit? Als Psychologe und Betroffener diskutiert Theo Parker die Frage vor dem Hintergrund seines Wissens und seiner eigenen Erfahrungen. Er gibt erstaunliche Einblicke in die Diagnosepraxis und Wirkungsweise von Medikamenten, nimmt aber auch den gesellschaftlichen Zusammenhang in den Blick. Wie viel hat ADHS mit biologischen Eigenheiten zu tun – und wie viel mit den Lebensumständen und Mechanismen der Leistungsgesellschaft? Stimmt es, dass ADHS-Gehirne "anders verdrahtet" sind? Und warum identifizieren sich so viele Menschen derart stark mit ihrer Diagnose? Dieses Buch hinterfragt, was wir über ADHS zu wissen glauben – und verschafft Durchblick, wenn im Kopf mal wieder alles auf einmal passiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Titel
Theo Parker
Alles auf einmal, und zwar jetzt!
ADHS: Individuelle Diagnose, gesellschaftliche Folgen
C.H.Beck
Übersicht
Cover
Inhalt
Textbeginn
Inhalt
Titel
Inhalt
Bevor es losgeht
1. Eine sprunghafte Diagnose
1.1 Wer hat Angst vorm dreibeinigen Tiger? – Die Geburt einer neuen Diagnose
1.2 Das Periodensystem seelischen Leids – Die DSM-Revolution und ihre Folgen
1.3 Sag mir, wer du bist, und ich sag dir, wer du bist – Diagnostische Unschärfen
1.4 Ein ganz reales Hirngespinst – Störungsbilder zwischen Vernunft und Mythos
1.5 Schublade, Spektrum oder Kaleidoskop? – Ordnungsversuche für das Diagnosechaos
1.6 Darum bekommt John eine
ADHS
, Jennifer aber nicht – Diagnosen zwischen Ressource und Stigma
1.7 Wahnsinn als Motorschaden – Der mechanische Blick auf seelische Probleme
1.8 Tapetenwechsel im Irrenhaus – Psychiatrie im Umbruch
Milan – Beipackzettel für Menschen
2. Alles Kopfsache?
2.1 Ist mein Gehirn ein Ferrari? – Hirnstruktur und -funktion
2.2 Ein vergiftetes Geschenk – Genetik
2.3 Superstar wider Willen – Dopamin
2.4 Untote leben länger – Leerstellen der Biopsychiatrie
2.5 Das Bio-Bio-Bio-Modell – Neuronarrative erobern die Öffentlichkeit
2.6 Anders gelötet? – Der biologische Blick aufs eigene Ich
Nadja – Bauchkribbeln in der Buchhaltung
3. Der große Aufputsch
3.1 Vom Aufputschmittel zur Lernhilfe – Der Siegeszug der Stimulanzien
3.2 Fühlt es sich so an, normal zu sein? – Wie Psychopharmaka wirken
3.3 Treffen sich ein Psychiater und ’ne Dealerin an der Bar – Legale und illegale Medizin
3.4 Kein Ritalin ist auch keine Lösung – Pharmakritik und ihre Grenzen
Lucía – Das Halbe-Stunde-Kind
4. Die Lizenz zum Anecken
4.1 Jetzt ergibt alles Sinn! – Diagnosen als Kristallkugel fürs eigene Ich
4.2 Psychiatrische Fan-Fiction – Soziale Medien im Psychofieber
4.3 Vom Makel zur Superkraft – Die Glamour-
ADHS
4.4 Mein Gehirn ist ein Einzelstück – Neurodiversität
4.5 Postfordistische Belastungsstörung? – Das Straucheln mit der Arbeitswelt
4.6 Mein Arschlochgehirn und ich – Feldzug gegen die Faulheit
4.7 Mehr Prokrastination wagen – Selbstoptimierung und Selbstsabotage
Georg – Das Milchglasgefühl
5. ADHS für alle
5.1 Schick deinen Geist auf Reisen – Tagtraum
5.2 Warte nicht auf das zweite Marshmallow – Schnellschuss
5.3 Lebe wie ein wucherndes Geflecht – Abschweifung
5.4 Hyperaktive Utopien – Ausblick
Danksagung
Anmerkungen
Bevor es losgeht
1. Eine sprunghafte Diagnose
2. Alles Kopfsache?
3. Der große Aufputsch
4. Die Lizenz zum Anecken
5.
ADHS
für alle
Zum Buch
Vita
Impressum
Bevor es losgeht
Als Kind träumte ich davon, Geheimagent zu werden, so wie James Bond. Immer auf wichtiger Mission, heiße Affären, ständig explodiert etwas. Irgendwann dämmerte mir, dass daraus wohl nichts werden würde. Niemand heuert einen Spion an, der ständig vergisst, wo seine Waffe liegt oder sein Aston Martin parkt. Auch dass ich Dinge schlecht für mich behalten kann und sorglos Geheimnisse ausplaudere, ist wohl eher ein Minuspunkt. Vermutlich würde ich am Bösewicht gedankenverloren vorbeitrotten – oder versehentlich meinen Quartiermeister erschießen, weil ich bei der langweiligen Belehrung über den tödlichen Kugelschreiber lieber über den nächsten Martini nachdenke. Einen Namen für meine Marotten hatte ich als Kind noch nicht. Das änderte sich, als ich mit neunzehn meine Agententräume endgültig beerdigte und mein Psychologiestudium begann.
«Du bist auch so wie ich!», raunte mir meine neue Kommilitonin Nina zu. In mir hatte sie ihren ersten Fall gefunden. Sie bemerkte, wie ich keine Sekunde stillsitzen konnte, in Gesprächen abschweifte, fünfmal täglich meine Mütze liegenließ. Einmal erzählte der Professor in der Vorlesung, dass Aufmerksamkeit so funktioniere wie ein Spotlicht im Theater, das unseren Blick auf einen bestimmten Ausschnitt lenkt. «Bei mir ist es eher Discokugel als Scheinwerfer», flüsterte ich ihr grinsend zu. Für Nina war die Sache klar: Der Junge hat ADHS!
Sie sah in mir einen Seelenverwandten. Heimlich steckte sie mir ein paar ihrer Tabletten zu. «Es ist, als wäre dein bisheriges Leben ein Schwarzweißfilm gewesen, und plötzlich würdest du Farbe sehen», schwärmte sie von ihrem Ritalin. Sie ermunterte mich, endlich zum Profi zu gehen, für eine richtige Diagnose. Dagegen sträubte ich mich sechs Jahre lang. Nicht, dass ihre Analyse falsch war. Doch ich empfand mich damals auf so viele Weisen bizarr, dass es mir grundfalsch vorkam, dem einen Namen zu geben, gar eine Diagnose. Und doch war es, als hätte Nina mich mit einem magischen Bann belegt. Die vier Buchstaben gingen mir nicht mehr aus dem Kopf.
Irgendwann hielt ich es nicht mehr aus. Es war 2015, ich hatte mein Diplom in der Tasche, fing als freier Journalist an und bekam mein Leben nur schlecht auf die Reihe. Missmutig schlurfte ich zur Psychiaterin, wo ich nach allerlei Tests meine Diagnose bekam – und meine Pillen. Zu beidem habe ich ein zwiespältiges Verhältnis: An manchen Tagen lehne ich sie entrüstet ab, an anderen empfinde ich sie als Geschenk. Immer häufiger treffe ich auf Gleichgesinnte mit ähnlichen Eigenheiten. Wir zwinkern uns zu, als würden wir einer kollektiven Verschwörung angehören: dem Club der Chaoskids. Aber halt, wollte ich auf solche Schubladen nicht verzichten?
Ohnehin ist der Club längst kein Geheimbund mehr. Die Zahl der klinisch festgestellten ADHS-Fälle klettert in Deutschland immer weiter nach oben. Das zeigt sich beispielsweise in den Daten der AOK-Krankenkassen: Die Quote der Versicherten mit offizieller Diagnose hat sich von 2006 bis 2023 mehr als verdoppelt – auf ein Prozent. In diesem Zeitraum stieg das mittlere Alter der Patienten von 14 auf 20 Jahre.[1] Dieser Generationenwechsel macht sich auch bei den Rezepten bemerkbar: Erwachsene bekommen immer mehr ADHS-Medikamente verschrieben.[2] Besonders stark schnellen die Zahlen bei jungen Erwachsenen zwischen 20 und 35 in die Höhe, bei Frauen übrigens stärker als bei Männern. Der vormals starke Geschlechterunterschied schrumpft zusammen.
Die klinisch gestellten Diagnosen sagen noch nichts darüber aus, wie verbreitet das Phänomen in der breiten Bevölkerung ist. Dort blieben die Zahlen über die letzten Jahrzehnte auf eher gleichbleibendem Niveau.[3] Rund 2,5 Prozent aller Erwachsenen erfüllen die Kriterien für die Diagnose.[4] Doch nur ein Teil davon stellt sich in einer Ambulanz vor. Sprich: Die Gesamtlast bleibt ungefähr gleich, doch immer mehr Menschen suchen sich ärztliche Hilfe. Auch in den Medien häufen sich die Berichte: Das Thema geistert durch Podcasts, Zeitschriften und Videos auf Social Media. Prominente wie Sarah Kuttner oder Paris Hilton berichten öffentlichkeitswirksam von ihrer Diagnose. Begriffe wie Dopamin, Hyperfokus oder Neurodivergenz machen die Runde. Die ADHS scheint dieser Tage allgegenwärtig. Dieser Zwiespalt hat eine etwas kuriose Folge: Ein Teil beklagt, dass ADHS als «Modestörung» überdiagnostiziert werde – und verweist auf die steigenden Zahlen. Andere Stimmen halten die ADHS ganz im Gegenteil für unterdiagnostiziert. Sie betonen, dass ein großer Teil der Menschen mit diesen Symptomen noch nie einen klinischen Test durchlaufen hat. Beide Ansichten lassen sich mit Zahlen belegen. Wer hat nun recht?
Fest steht jedenfalls: Das Bild der ADHS hat sich gewaltig geändert. In den 1990er Jahren dachte man da vor allem an überdrehte Schuljungen. Inzwischen ist die Durchschnittsperson mit offizieller Diagnose aber volljährig – und immer häufiger weiblich. Mit der gewandelten Zielgruppe ändert sich auch ihr Image. Die Turnbeutelvergesser und Unruhegeister von damals werden erwachsen, so scheint es – und fordern nun mehr Akzeptanz für ihre Besonderheiten ein. Vor zwanzig Jahren hörte man Eltern seufzen: «Oje, mein Kind hat ADHS.» Die erwachsenen Patienten sagen heute oft in selbstbewusster Tonlage: «Ich habe übrigens ADHS!». Das heißt nicht, dass das Leidvolle daran plötzlich verschwunden wäre.
Ausgeschrieben ist die Diagnose ein richtiges Wortungetüm: Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung. Das kann man kaum aussprechen, ohne sich zu verhaspeln. Schon der holprige Begriff lässt erahnen, wie mühsam es war, das Symptomwirrwarr zu einem festen Störungsbild zu bündeln. Doch worum geht es eigentlich bei der ADHS? Also: Was meint eine Betroffene, eine Therapeutin, eine Forscherin damit, wenn sie davon spricht? Und warum sorgt die Diagnose mitunter für Skepsis? Die Antwort ist völlig simpel und zugleich merkwürdig verworren. Eine Definition lässt sich aus jedem klinischen Wörterbuch ablesen. Das erklärt aber nicht, wieso sich aktuell hitzige Debatten an dieser Diagnose entzünden. Warum die Zahlen so sehr ansteigen. Weshalb die ADHS als universelle Projektionsfläche herhalten muss – für Fragen rund um Normierung und Abweichung, Leistungsdruck und Freiheitsdrang, Gesundheit und Identität.
Hyperaktivität, Aufmerksamkeitsprobleme und Impulsivität sind die drei «Zutaten» der ADHS. Dass diese Merkmale weit verbreitet sind, steht nicht im Widerspruch dazu, dass sie einigen Menschen mehr zu schaffen machen als anderen. Ich beleuchte die Phänomene deshalb als Teil der konkreten Diagnose, aber auch losgelöst von dieser – also als Tendenzen, wie sie allen Menschen innewohnen. Mein Fokus liegt dabei auf den Lebenswelten von Erwachsenen. Die Situation bei Kindern beleuchte ich gelegentlich ergänzend, sie ist jedoch nicht mein Hauptaugenmerk.
Gemeinhin gilt die ADHS als ein fixes Etwas, das im Kopf sitzt. An dieser Gewissheit will ich in diesem Buch kratzen. Natürlich gibt es persönliche Eigenheiten wie Ablenkbarkeit, Unruhe, Impulsivität. Dabei spielen Vorgänge im Gehirn eine wichtige Rolle. Mit gleichem Recht ließe sich jedoch behaupten: Die ADHS sitzt in den Füßen. Wo man im Leben steht, welche Freiheiten und Zwänge einen prägen, wie man lebt, liebt und arbeitet: All das entscheidet mit, wie diese Eigenheiten zutage treten – und ob sie sich als Ärgernis oder Bereicherung erweisen. Die Psyche lässt sich nicht auf Vorgänge im Gehirn reduzieren. Menschliches Erleben und Verhalten entsteht stets in Wechselwirkung mit dem materiellen Umfeld. Deshalb schreibe ich im Folgenden nicht nur über Synapsen und Botenstoffe, sondern ebenso über Armut und Wohlstand, Lern- und Arbeitswelten, Medienbetrieb und Konsumkultur. Zuletzt geht es um neue Freiräume, die eine größere Bandbreite an menschlichen Regungen ermöglichen. Kurzum: Es wird Zeit, die ADHS vom Kopf auf die Füße zu stellen.
Manchmal hilft es, ein Phänomen sorgfältig in seine Bestandteile zu zerlegen, um zu zeigen, dass es sich auch ganz anders zusammenfügen ließe. Genau das versuche ich in diesem Buch. Ein Problem bei der öffentlichen Auseinandersetzung um ADHS ist, dass sie sich oft in einem festgefahrenen Entweder-oder erschöpft. Ich werfe einen frischen Blick auf alte Fragen und durchkreuze in jedem Kapitel eine Binarität – um so neue Antworten auf altbekannte Fragen anzubieten: Ist die ADHS ein echtes Ding oder eine künstliche Erfindung? Im ersten Kapitel zeige ich, dass die Diagnose eine streitbare «Verpackung» für ein völlig reales Phänomen ist. Stammt die ADHS von abnormalen Nervenbahnen oder von sozialen Einflüssen? Hinter der Frage steckt ein verkürztes Verständnis von Gehirn und Geist – einen Gegenvorschlag skizziere ich im zweiten Kapitel. Werden Patientinnen mit Ritalin und Co. unter Drogen gesetzt – oder sind die Pillen unverzichtbare Hilfen? Bereits die strikte Trennung zwischen diesen beiden Optionen ist ideologisch, das zeige ich in Kapitel drei. Besondere Identität oder Zeichen unserer Zeit? Das muss kein Widerspruch sein, argumentiere ich im vierten Kapitel. Hätte man die ADHS in einer idealen Zukunft überwunden? Als Störungsbild vielleicht schon, dennoch versteckt sich in der Diagnose ein Hauch Utopie, wie ich im fünften und letzten Kapitel bespreche: eine verträumte Ungeduld, alles zugleich zu durchleben – und das am besten sofort.
Eine Prise Hyperaktivität findet sich auch im Schreibstil. Ich bleibe beim Erzählen nicht immer streng auf einem Pfad und lege kleine Schleifen und Umwege ein, wenn ich es für passend halte. Statt alles auf eine glatte Erzählung hin zu trimmen, zeige ich auch das, was nicht ins Bild passt. Auch beim Lesen ist ein nichtlinearer Stil willkommen. Wer will, kann gern in der Mitte anfangen und sich dann zu den Rändern vorarbeiten. Bei den geschlechtlichen Wortendungen nutze ich mal die männliche, mal die weibliche, mal eine neutrale Form – ich nenne es chaotisches Gendern. Gemeint sind stets alle Menschen.
Penibel bin ich bei den wissenschaftlichen Aussagen. Hier richte ich mich, wo möglich, nach aktuellen Ergebnissen aus hochwertigen Fachjournalen. Doch möchte ich nicht beim Wiederkäuen von Forschungsergebnissen stehenbleiben: Mir geht es darum, eine neue Perspektive auf Hyperaktivität und sprunghaftes Denken zu skizzieren, die sich von einem rein medizinischen Verständnis freimacht. In einigen Punkten liege ich mit dem derzeitigen ADHS-Diskurs über Kreuz und beziehe dann deutlich Stellung. Auch wer mir dabei nicht zustimmt und die Dinge völlig anders sieht, wird hoffentlich ein paar neue Perspektiven aus dem Buch mitnehmen können. Außerdem lasse ich gelegentlich meine persönlichen Erfahrungen mit ADHS einfließen. Bei der Recherche für dieses Buch habe ich weitere Betroffene interviewt. Ihre Erfahrungsberichte finden sich zwischen den Kapiteln. Die Vornamen und einige wenige persönliche Details habe ich abgeändert, um die Privatsphäre meiner Gesprächspartnerinnen zu wahren.
1. Eine sprunghafte Diagnose
Seit ihrer Einführung toben immer wieder hitzige Diskussionen um die «Echtheit» der ADHS. Es sei eine Erfindung, die völlig normales menschliches Verhalten zur Krankheit erkläre, um Medikamente zu verkaufen, sagen manche Kritikerinnen. Auch den kürzlichen Anstieg an Fällen halten sie oft für künstlich fabriziert. Andere halten dagegen: Die ADHS sei eine natürliche Tatsache, eine eindeutig feststellbare Störung mit festem Platz im Gehirn. Zwischen diesen Extrempositionen gibt es natürlich viele Schattierungen, dennoch polarisiert das Thema.
Um diesem Entweder-oder zu entkommen, versuche ich hier einen anderen Ansatz. Dafür nehme ich die Diagnose selbst unter die Lupe. Was wir heute ADHS nennen, hat sich immer wieder verändert. Das Störungsbild wirkt sprunghaft, flüchtig und schwer greifbar – genau wie die Menschen, die es beschreibt. Um diese Sprünge soll es im Folgenden genauer gehen: vom moralischen zum ärztlichen Problem, von der Kinderkrankheit zu einer für alle Altersstufen, vom Nischen- zum Massenphänomen. Doch nicht nur die Störung, sondern die gesamte psychiatrische Landschaft hat sich über die letzten 50 Jahre stark gewandelt – und mit ihr der Blick auf Abweichung und Normalität. Was als krankhaft gilt und wem welche Hilfen zustehen, ist keine rein medizinische Frage, sondern auch eine politische. Ich beleuchte, wie das Störungsbild auf die Welt kam, welche ideologischen Annahmen in ihm stecken und welche Tücken die Diagnostik mit sich bringt.
Durch die Geschichte der ADHS zieht sich der fortwährende Versuch, diese unscharfe Diagnose endlich zu bändigen, sprich: das Reale an ihr dingfest zu machen, eine eindeutige Ursache zu finden und objektive Kriterien festzulegen. Bis jetzt ist dies noch immer gescheitert. Zu einem echten Umdenken hat das allerdings nicht geführt. Zugleich lässt sich nicht leugnen, dass viele Menschen tagtäglich eine starke Ablenkbarkeit, Rastlosigkeit und Impulsivität erleben – und irgendwie mit ihren Schwierigkeiten zurande kommen müssen. Um diesen Widerspruch zu fassen, helfen die oben genannten Extrempositionen nicht weiter. Deshalb stelle ich in diesem Kapitel einen dritten Weg vor: Die ADHS ist ein lückenhaftes und streitbares Etikett für völlig reale menschliche Erlebensweisen. Dass diese sich so schwer greifen lassen, muss man nicht als Problem sehen, ganz im Gegenteil: Menschen sind so vielseitig und einzigartig, dass sie jedem Bestreben nach einer klaren Zuordnung trotzen.
1.1 Wer hat Angst vorm dreibeinigen Tiger?
Die Geburt einer neuen Diagnose
Angenommen, ich würde beim gemütlichen Stadtbummel mitten in der Fußgängerzone plötzlich einem Tiger gegenüberstehen. Ich würde nicht lang nachdenken, wie das sein kann, ob er vielleicht dem Zoo oder einem verrückten Privathalter entflohen ist. Stattdessen würde ich die Beine in die Hand nehmen und rennen. Doch was, wenn der Tiger nur drei Beine hat? Oder wenn sein Fell keine goldgelben Streifen hat, sondern weiße? Auch dann würde ich lieber weglaufen, denn Tiger ist Tiger. Sein Äußeres ist mir erst einmal egal. Ich weiß: Es gibt eine bestimmte Kombination an genetischen Merkmalen, die alle Tiger teilen und die für mich richtig ungemütlich werden kann. Egal wie die Raubkatze aussieht: Sie hat einen biologischen Kern, der für scharfe Fangzähne und mächtige Pranken sorgt. Also lieber schnell weg! In der Schule lernen wir viele dieser natürlichen Arten kennen: Eis ist Wasser in festem Zustand. AIDS ist ein Syndrom, das durch das HI-Virus ausgelöst wird. Kohlenstoff hat Atome mit sechs Protonen und sechs Elektronen. Und so weiter. All diese Dinge haben eine innere Essenz, auch wenn sie unterschiedliche Formen annehmen können: Ein Diamant besteht aus den gleichen Atomen wie eine verkohlte Scheibe Toastbrot.
Auch die ADHS wird gern als natürliche Art gehandelt: Eine Reportage auf Zeit Online erklärt, dass hinter der ADHS eine «genetisch bedingte Störung steckt, die viele Menschen bis zu ihrem Tod begleitet».[1] Als «Diabetes des Gehirns» bezeichnet der Psychologe Russell Barkley die Störung. Es bräuchte eine tägliche Behandlung, um den Schäden vorzubeugen, welche sie verursacht.[2] Ein Fachartikel aus dem World Journal of Psychiatry spekuliert, bereits der Apostel Petrus habe eine ADHS gehabt.[3] Auch klinische Fachleute und Betroffene sprechen über die Diagnose gelegentlich so, als wäre sie ein objektiv feststellbares Ding mit dauerhaften Merkmalen.
Man nennt diese Haltung Essenzialismus. Es ist die Vorstellung, dass den Dingen ein Wesenskern innewohnt, der sie eindeutig bestimmt. Was essenziell ist, steht fest, hat klare Grenzen und lässt sich nicht durch äußere Einflüsse verändern. Dieses Denken geht auf Platons Ideenlehre zurück und taucht in verschiedenen Varianten auf. Einen Essenzialismus gibt es auch bezüglich psychischer Störungen. Die ADHS hat demnach eindeutige Merkmale, welche die Jahrhunderte überdauern. Ein Blick in die Geschichte zeigt jedoch, dass das blanke Gegenteil zutrifft. Zwar gibt es viele Zeugnisse, die an die heutige Störung erinnern. Schon aus dem 18. Jahrhundert sind medizinische Berichte über Aufmerksamkeitsprobleme überliefert (wie über so ziemlich jede vorstellbare Variante menschlichen Verhaltens). Manche sehen darin den Beleg für eine innere Wahrheit der Diagnose, der man sich mit fortschreitender Erkenntnis weiter annähert. Doch wird man der Vergangenheit nicht gerecht, wenn man sie nur bereist, um Belege dafür zu sammeln, dass es im Grunde schon immer so war wie heute. Man übersieht dabei, dass zurückliegende Phänomene einem anderen Zeitgeist entsprangen und folglich eine andere Bedeutung hatten.
Auch unser heutiges Verständnis der ADHS ist nicht in Stein gemeißelt. Man hat sich lediglich darauf geeinigt, eine Kombination bestimmter Merkmale so zu bezeichnen. Wie andere psychiatrische Diagnosen auch ist die ADHS eine «praktische Art» – also ein menschengemachtes Konzept ohne eindeutigen Wesenskern.[4] Praktische Arten kennen wir von Ländergrenzen, Währungen oder Musikgenres. Es sind Vereinbarungen, die Menschen untereinander treffen und bei Bedarf weiter anpassen. Sie sind selbst keine Wirklichkeit, sondern beschreiben diese lediglich. Deshalb können sie nicht real oder irreal sein, sehr wohl aber mehr oder weniger sinnvoll. Diagnosen werden also nicht «entdeckt» wie eine bislang unbekannte Insel, sondern aktiv entwickelt – und den Betroffenen anschließend zugewiesen. Einige Philosophen argumentieren übrigens, dass auch naturwissenschaftliche Kategorien wie Tiger oder Kohlenstoff keine rein natürlichen Arten seien, aber darum soll es hier nicht gehen.
Menschen neigen dazu, praktische Arten zu naturalisieren, das heißt: Sie behandeln sie so, als ob es natürliche Arten wären, die es in dieser Form schon immer gegeben hat. Auch Störungen wie die ADHS erscheinen mitunter so, als wären sie naturgegebene Tatsachen. Dass wir sie zuweilen «psychische Erkrankungen» nennen, kann zum Fehlschluss verleiten, sie hätten einen klar bestimmbaren Kern – so wie eine Grippe etwa von einem bestimmten Virus stammt. Das ist jedoch nicht der Fall. Psychische Störungen haben meist keine eindeutige Ursache, sondern werden von vielen Faktoren zugleich geprägt. Warum einige Menschen davon betroffen sind und andere nicht, kann niemand mit Sicherheit sagen. Ihr Name, ihre Definition und ihr gesellschaftlicher Stellenwert stehen nicht fest, sondern sind im stetigen Wandel. Das zeigt sich gut an der Geschichte der ADHS.
Als Beweis für die Zeitlosigkeit der Diagnose wird gern der «Zappelphilipp» angeführt. Dabei lässt sich der Fall auch genau umgekehrt verstehen: Er zeigt, wie unterschiedlich dasselbe Verhalten je nach geltendem Wertekanon gedeutet wird. Die Geschichte stammt aus Heinrich Hoffmanns Struwwelpeter aus dem Jahr 1845: Philipp kippelt am Esstisch derart, dass er mitsamt Stuhl umfällt und sich dabei unter Speisen und Tischdecke selbst begräbt. Hoffmann, selbst Psychiater, wollte mit seiner Geschichte aber nicht über eine Pathologie aufklären. Vielmehr beschreibt er die Unruhe bei Tisch als Fehlverhalten. Er hielt dieses offenbar für nichts Abnormes, sondern für ein weitverbreitetes Laster, sodass er es in sein Buch aufnahm. Auch die übrigen Kapitel des Struwwelpeters sollen Kinder von allerlei Unsitten abschrecken.
Mag sein, dass ein heutiger Vater seinem lebhaften Philipp etwas Ritalin ins Müsli bröseln würde. Auch Pippi Langstrumpf würde man heute vielleicht zur Diagnostik schicken – mit Verdacht auf ADHS und Störung des Sozialverhaltens. Ähnliches gilt für Huckleberry Finn oder Calvin aus den Calvin-und-Hobbes-Comics. Doch in Hoffmanns Struwwelpeter ist die Hibbeligkeit noch eine Unart, die Strafe nach sich zieht. Den Vater kümmert es nicht, warum sein Sohn so einen Wirbel veranstaltet. Auch die Mutter blickt nur «stumm um den ganzen Tisch herum», wie es dort so schön heißt. Manche sehen darin schwarze Pädagogik, andere eine derbe Satire auf die bürgerlichen Sitten. Als eines war das Buch jedoch sicherlich nicht gedacht: als Sammelalbum psychischer Krankheitsbilder.[5]
Erst später wurde aus dem Laster allmählich ein etabliertes medizinisches Störungsbild. Der Kinderarzt George Still schrieb 1902 über undisziplinierte Kinder, die sich nicht konzentrieren konnten und schlecht gehorchten. Er attestierte den Kindern einen «Mangel an sittlicher Kontrolle» – im Einklang mit der damals beliebten Lehre der Eugenik, laut der Tugendhaftigkeit ein erbliches Merkmal war.[6] Das herankeimende Störungsbild führte die moralischen Untertöne also teilweise fort. In den folgenden Jahrzehnten kursierten verschiedene Begriffe für das, was wir heute ADHS nennen, etwa «minimale cerebrale Dysfunktion» oder «hyperkinetische Reaktion im Kindesalter».
Dass aus diesen eher randständigen Diagnosen ein Massenphänomen wurde, lag auch am politischen Klima während des Kalten Kriegs. Als die Sowjetunion 1957 mit der «Sputnik 1» überraschend den ersten Satelliten ins Weltall schoss, ging ein Schock durch die westliche Welt. Gerade in den USA fürchteten viele, bei den technologischen Entwicklungen zurückzufallen und das Wettrennen um die klügsten Köpfe zu verlieren. Daraus entspann sich eine Panik um das Leistungsniveau der Kinder: Waren sie durch Fernsehen und Süßigkeiten zu verweichlicht, um dem Nachwuchs im Ostblock die Stirn zu bieten? Das Bildungssystem stand unter Beschuss. Kinder, die mit den gängigen Leistungsanforderungen nicht mithalten konnten, wurden nun problematischer gesehen als zuvor. So entstand ein neuer Druck, Abweichler als pathologische Fälle zu betrachten und entsprechend zu behandeln. Der britische Historiker Matthew Smith sieht in diesem strengeren Schulklima die Geburtsstunde der Hyperaktivität als gängiges medizinisches Problem.[7] Wer im Unterricht zu sehr aus der Reihe tanzte, ging früher oft vorzeitig von der Schule ab und arbeitete. Nun sollten Kinder länger die Schulbank drücken. Zudem wurde die Berufswelt immer komplexer und erforderte von den Arbeitenden mehr technisches Know-how, Konzentration und Durchhaltevermögen. In diesem neuen Umfeld sahen Lehrkräfte Hyperaktivität und Unaufmerksamkeit zunehmend als inakzeptabel an.
Die «Aufmerksamkeitsdefizit-Störung» (ADS) gibt es offiziell erst seit 1980: mit der dritten Auflage des Diagnostischen und Statistischen Manuals Psychischer Störungen (DSM), herausgegeben vom US-Psychiatrieverband APA.[8] Es war nicht irgendein Buch. Das DSM-III steht für einen radikalen Umbruch in der Medizingeschichte. Es war der erste umfassende psychiatrische Störungskatalog mit genauen Kriterien. Auch für Nicht-Fachleute gibt es gute Gründe, sich mit dem Manual näher zu beschäftigen: Mit seinen Neuauflagen prägt es bis heute, welches Verhalten als gesund gilt und welches als abnormal. Deswegen lohnt es sich, hier kurz abzuschweifen.
1.2 Das Periodensystem seelischen Leids
Die DSM-Revolution und ihre Folgen
Diagnosen gab es natürlich schon vor 1980. Sie waren aber uneinheitlich und oft schwammig definiert. Was in der einen Klinik als manisch-depressive Verstimmung galt, nannte man in der anderen Schizophrenie. Der Ruf der Psychiatrie war angeschlagen. Die Disziplin stand doppelt unter Beschuss: Die antipsychiatrische Bewegung der 1970er Jahre prangerte Diagnosen als Unterdrückungsinstrument an – und als unhaltbaren Schwindel. Auf der anderen Seite ärgerten sich Krankenversicherungen über die hohen und schwer nachvollziehbaren Rechnungen für langwierige Therapien. Das DSM-III sollte diese Missstände aus der Welt schaffen. Deren Autoren reagierten auf das bisherige Diagnosechaos also mit einer rabiaten Schrumpfkur: Weg mit dem Wischiwaschi! Die individuellen Gefühlswelten sollten eindeutig messbar werden. Ein Periodensystem seelischen Leids sollte her. Erstmals gab es strenge Checklisten mit ausführlich beschriebenen Kriterien für jede Störung.[9] Etwas polemisch ausgedrückt: Das neue DSM wollte den psychischen Kummer sortieren, als wäre es ein Pilzbestimmungsbuch.
Zwar konnten die Fachleute keine klaren Ursachen für psychische Störungen benennen. Doch versuchten sie ihre Diagnosen zumindest sauber zu definieren. Vielleicht würde das ja helfen bei der Suche nach einem realen Kern? Für die neuen Definitionen waren nur konkret feststellbare Symptome erlaubt. Spekulationen über mögliche Ursachen der Leiden wurden hingegen gestrichen. Schwer fassbare Begriffe wie «Neurose» verschwanden. Die Verantwortlichen beseitigten die (als nebulös verschrienen) psychoanalytischen Deutungen. Sie hofften, diese schon bald durch präzise biologische Modelle ersetzen zu können. So wollte man aufholen zu den körperlichen Sparten der Medizin. Dieser Siegeszug der Biopsychiatrie hatte auch mit den neuen Psychopharmaka zu tun, welche die Arzneimittelfirmen als Alternative zur teuren Gesprächstherapie anpriesen. Das DSM-III verkaufte sich (mitsamt Textrevision) rund eine Million Mal, ein Bestseller.[10] Es folgten weitere Updates. Bis heute gilt das Buch als «Bibel» für Klinikpersonal und Forscherinnen weltweit. Die aktuelle Version namens DSM-5-TR umfasst im Deutschen über 1500 Seiten und kostet rund 190 Euro. Auch das in Deutschland gebräuchliche Diagnoseverzeichnis ICD-10 sowie das kommende ICD-11, beide herausgegeben von der Weltgesundheitsorganisation, orientieren sich über weite Strecken am DSM. Ob sich die Hoffnung auf saubere und schlüssige Diagnosekriterien wirklich erfüllt hat, ist jedoch eine andere Frage. Hinzu kommt: Nur weil es für ein Konzept eine exakte Definition gibt, ist es deshalb noch lang kein greifbares Etwas. Ich kann beispielsweise sehr genau beschreiben, wie ein Einhorn aussieht. Gesehen habe ich trotzdem noch keines.
Leitfigur der DSM-Revolution war Robert Spitzer. Der Psychiater war federführend an der dritten und vierten Auflage beteiligt – und wusste um deren Schwächen. Spitzer bemängelte, dass die neu eingefügten Störungen des Kindesalters bislang nur «dem Augenschein nach» valide seien, sprich: wissenschaftlich kaum belegt. Die Aufmerksamkeitsstörung und andere Diagnosen waren gewissermaßen auf Pump im DSM-III gelandet. Spitzer forderte seine Forscherkollegen auf, die Gültigkeit dieser Neuzugänge besser zu belegen. Ansonsten sei es nicht mehr gerechtfertigt, die Kategorien zu nutzen.[11] Inwiefern sie diesem Anspruch gerecht geworden sind, werden wir im weiteren Verlauf des Buchs noch sehen.
Klar ist jedenfalls: Was eine Aufmerksamkeitsstörung genau ist, hat sich seit 1980 mehrmals geändert. Die Korrekturen stammen aus einem kleinen Kreis von Experten, die bei jeder DSM-Neufassung untereinander einen Kompromiss finden. Ihre Arbeit ähnelt ein wenig der von parlamentarischen Ausschüssen, die an einem neuen Gesetz feilen. Sie berücksichtigen zahlreiche Größen, etwa neue wissenschaftliche Erkenntnisse oder bürokratische Erfordernisse. Auch Lobbyismus spielt eine Rolle: 60 Prozent der US-Ärzte, die am aktuellen DSM beteiligt waren, erhielten Gelder von Pharmafirmen, insgesamt über 14 Millionen US-Dollar.[12] Dazu kommt politischer Druck von außen. Ein Beispiel ist der Stonewall-Aufstand von 1969, bei dem sich LGBT-Personen gegen staatliche Gewalt und Kontrolle wehrten. 1974 strich die DSM-Redaktion Homosexualität aus dem Katalog, zumindest teilweise. Mit wissenschaftlicher Erkenntnis hatte das nichts zu tun, sehr wohl aber mit einem veränderten gesellschaftlichen Klima: «Du musst eine Lobby haben, so geht das. Du musst Truppen haben», kommentierte Robert Spitzer diesen Wandel.[13] Die letzten Überbleibsel des Eintrags entfernte man allerdings erst 2013.
Andere Diagnosen verbreiteten sich hingegen zunehmend – darunter auch die ADS, 1987 in ADHS umbenannt. Sie findet sich heute im Kapitel der neuronalen Entwicklungsstörungen, gemeinsam mit Autismus und Intelligenzminderung. Die Kriterien lockerten sich mit den Jahrzehnten immer weiter, sodass sie auf mehr und mehr Menschen zutrafen.[14] Ein paar Beispiele:
Ursprünglich war die Diagnose nur für Kinder vorgesehen. Seit 1994 lässt sie sich auch an Erwachsene vergeben, auch wenn dies zunächst nur selten geschah.
Eine Diagnose war früher nur möglich, wenn die Symptome schon vor dem Alter von sieben Jahren auftraten. Das änderte sich mit dem DSM-5 von 2013: Seitdem reicht es, wenn die Symptome vor dem zwölften Geburtstag bestanden.
Auch benötigen Erwachsene nur noch fünf statt bislang sechs Symptome für die Störung.
Früher schlossen sich ADHS und Autismus gegenseitig aus. In der aktuellen Ausgabe ist beides zugleich möglich.
Alles Haarspalterei? Die vielen kleinen Korrekturen haben in der Summe deutliche Folgen. Je offener die Kriterien, desto mehr Diagnosen sind möglich. Viele Menschen, die heute eine ADHS-Diagnose bekommen, hätten die Kriterien vor einigen Jahrzehnten noch nicht erfüllt. Wie hoch die Fallzahlen in der Bevölkerung sind, hängt davon ab, welches Regelwerk man anlegt. Ein Beispiel: Das DSM «entdeckt» etwa drei- bis viermal so viele Fälle wie das hierzulande gebräuchliche ICD-10 (wo noch von Hyperkinetischen Störungen die Rede ist).[15] Das wird nicht so bleiben. Die kommende elfte Auflage des ICD wird sich an die lockerere Definition aus dem DSM annähern. Damit könnte die Zahl theoretisch möglicher ADHS-Fälle deutlich ansteigen.
1.3 Sag mir, wer du bist, und ich sag dir, wer du bist
Diagnostische Unschärfen
Die DSM-Kriterien sollen Klarheit schaffen, sind aber trotz der vielen Updates noch immer recht vage. Die ADHS beschreibt keine klar abgrenzbare Gruppe. Es ist ein Sammelbegriff für Menschen mit verschiedensten Besonderheiten, die (bis auf ihre Diagnose) nichts gemeinsam haben müssen. Die Realität ist verworrener, als die Störungsdefinitionen es vielleicht nahelegen. Auf diese Krux weist das DSM selbst hin.[16] Dennoch hält das Handbuch weiter an einem starren Kategorienmodell fest: Entweder man hat eine ADHS oder nicht. Die Symptome müssen in mehr als einem Setting auftreten, mehr als ein halbes Jahr andauern und das alltägliche «Funktionieren» beeinträchtigen. Die Probleme dürfen sich zudem nicht besser durch eine andere Störung erklären lassen. Das DSM führt zwei Listen mit jeweils neun Symptomen auf – für eine Diagnose brauchen Erwachsene mindestens fünf von neun Merkmalen aus einer der beiden Listen.
Die erste Liste steht für die unaufmerksame Erscheinungsform der ADHS. Dort finden sich Merkmale wie «folgt Anweisungen oft nicht vollständig» oder «scheint oft nicht zuzuhören, wenn direkt angesprochen».
Die zweite Symptomgruppe steht für die hyperaktiv-impulsive Form. Darin heißt es beispielsweise: «verlässt oft den Sitzplatz in Situationen, in denen Sitzenbleiben erwartet wird» oder «kann nur schwer warten, bis er/sie an der Reihe ist».
Daneben gibt es eine kombinierte Form. Sie erfordert je fünf Symptome aus beiden Listen.
Schon rechnerisch ergeben sich einige Merkwürdigkeiten. So können komplett unterschiedliche Menschen dieselbe Diagnose erhalten. Dank der drei Varianten ist es möglich, dass die zappelige Anna und der unaufmerksame Arthur beide eine ADHS attestiert bekommen, obwohl sie kein einziges Merkmal teilen. Selbst um zur gleichen Erscheinungsform zu gehören, genügt ein einziges gemeinsames Symptom. Umgekehrt führt schon ein kleiner Unterschied dazu, dass Bob (mit fünf Symptomen) eine ADHS attestiert bekommt, aber Alice (mit vier Symptomen) die Praxis mit leeren Händen verlässt. Insgesamt gibt es über 100.000 Symptomkombinationen, die eine ADHS-Diagnose zulassen.[17] Das erschwert die Forschung: Über ein so heterogenes Merkmalsknäuel lassen sich nur schwer verbindliche Aussagen treffen. Viele Studien zur ADHS liefern deshalb nur dünne und wenig verlässliche Ergebnisse.
Aufschlussreich ist auch, wie eine Diagnostik in der Praxis abläuft. Bei Erwachsenen baut sie in weiten Teilen darauf, wie diese sich selbst einschätzen.[18] Die gängigen Interviews und Fragebögen sind recht simpel aufgebaut. Sie fassen verschiedene Antworten zu einem Testscore zusammen, gleichen ihn mit einem Normwert ab und kommen so zu einem Ergebnis: Eine ADHS liegt vor oder nicht. Natürlich berücksichtigen die Diagnostiker noch weitere Quellen: die medizinische Vorgeschichte, den Verlauf über die Lebensspanne und andere mögliche Erklärungen für die Symptome. Konzentrationstests und andere kognitive Leistungstests kommen manchmal ergänzend hinzu, haben aber eine begrenzte Aussagekraft. Sie können eine ADHS für sich genommen weder erkennen noch ausschließen: Manche, aber längst nicht alle Betroffenen haben objektiv messbare kognitive Schwierigkeiten. Labortests für die ADHS existieren nicht. Die gängige Diagnostik stützt sich bei Erwachsenen überwiegend darauf, was diese über sich selbst erzählen – und meldet es in zusammengefasster Form zurück. Überspitzt gesagt, funktioniert sie nach dem Motto: «Sage mir, wer du bist, und ich sage dir, wer du bist.»
Damit will ich nicht sagen, dass der diagnostische Prozess überflüssig wäre, ganz im Gegenteil: Er dient dazu, sich ein umfassendes Bild von einem Patienten und seinen Lebensumständen zu machen. Er ist die Basis für alle folgenden Behandlungsentscheidungen. Die Erkenntnisse dabei sind vielschichtig, manchmal widersprüchlich – und gehen über die Feststellung eines konkreten Störungsbilds weit hinaus. Eine Diagnose kann auch ohne einen umfassenden Wahrheitsanspruch sehr hilfreich sein: als pragmatisches Arbeitsinstrument für den klinischen Alltag.
In meinem Fall lief die Diagnostik so ab: Meine Psychiaterin ließ mich einen Stapel Fragebögen aus dem HASE ausfüllen, einem gängigen Test für Erwachsene. Ich sollte ankreuzen, wie sehr verschiedene Aussagen auf mich zutreffen, etwa: «Ich höre nicht richtig zu, wenn mir jemand etwas sagt.» Oje, dachte ich, das kenne ich. Vor vier Jahren ging deshalb meine damalige Beziehung in die Brüche. Aber wie häufig ist häufig? Schulterzuckend kreuzte ich an: «Kommt oft vor». Ich wollte den Test so ehrlich wie möglich bearbeiten. Trotzdem kamen mir meine Antworten etwas beliebig vor. Ich fühlte mich wie ein Schwindler. Schließlich wusste ich ja, dass der Test nach typischen Anzeichen fragt und was meine Kreuzchen bewirken. Der HASE fordert außerdem eine Rückschau auf die kindlichen Symptome. Ich erzählte meiner Psychiaterin einige Episoden aus meiner Grundschulzeit. Manche Diagnostiker lassen sich Schulzeugnisse mitgeben. Auch die klingen bei mir übrigens ganz typisch nach ADHS: «In seiner Arbeitsweise fehlen ihm oftmals Kontinuität und Zuverlässigkeit», heißt es da. Mein Ton gegenüber den Lehrern und der Umgang mit Arbeitsmitteln wären «verbesserungswürdig». Andererseits: Ist das nicht ein wenig Kaffeesatzleserei? Findet man nicht ohnehin häufig, wonach man sucht?
«Sie erfüllen die Kriterien für eine ADHS», teilte die Ärztin mir mit. Ich war eher nachdenklich als erstaunt. Ich hatte ihr ja gewissenhaft berichtet, was ich an mir beobachte: meine ständige Unruhe, meine Ablenkbarkeit, die überstürzten Entscheidungen. Immerhin hatte ich jetzt einen Namen dafür. «Ich habe ADHS», murmelte ich auf dem Nachhauseweg skeptisch vor mich hin. Ganz so, als würde ich es mir selbst einreden wollen. Aber was hieß das für mich?
Theoretisch ist in den klinischen Leitlinien recht genau festgelegt, wie eine ADHS zu bestimmen ist. Trotzdem braucht der Prozess ein wenig Augenmaß: Was, wenn einige, aber nicht alle Quellen für eine ADHS sprechen? Falls mehrere Diagnosen gleichzeitig zutreffen – welche erklärt die Symptome besser? Auch persönliche Werturteile spielen eine Rolle: Einige Spezialistinnen misstrauen der Welle an Neuzugängen, andere sehen darin kein Problem. Sie unterscheiden sich in ihren Vorstellungen davon, was als gesundes Verhalten gilt – und was als klinisch auffällig. Dazu kommen praktische Hindernisse: Viele niedergelassene Psychiater bieten keine ADHS-Diagnostik an – etwa, weil sie mit dem Prozedere nicht vertraut sind oder die Kosten von den Krankenkassen nicht ausreichend erstattet werden. Manche Praxen nehmen überhaupt keine neuen Patientinnen auf oder haben lange Wartelisten. All diese Tücken dürften dafür sorgen, dass die Fallzahlen nicht noch stärker ansteigen als ohnehin schon.





























